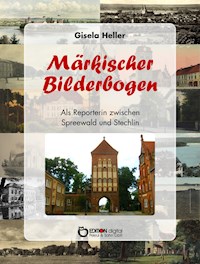9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie in ihren erfolgreichen Büchern „Märkischer Bilderbogen“ und „Potsdamer Geschichten“ erzählt Gisela Heller auch hier über Land und Leute ihrer unmittelbaren Heimat. Sie war abseits der Touristenstraßen zwischen Havelland und Oderbruch, Fläming, Barnim und Prignitz unterwegs und fand allenthalben den Satz des märkischen Wanderers Fontane bestätigt: „Das Beste aber, dem Du begegnen wirst, das werden die Menschen sein ...“ In 22 Reportagen erfahren wir Interessantes über Zeitgenossen und über Menschen vergangener Jahrhunderte: alten Adelsgeschlechtern, Militärs, Hofbeamten, Künstlern und namenlosen kleinen Leuten. Spuren ihres Daseins und Wirkens, die dem Auge des Durchreisenden allzu leicht entgehen, hat Gisela Heller für uns entdeckt und aufgeschrieben. Wir begegnen den unrühmlichen Herren von Bredow, die der Teufel einst über Friesack verloren haben soll, den schießwütigen Kähnes, die die Gegend um Petzow unsicher machten, dem alten Zieten, der tatkräftigen Frau von Friedland und an vielen Orten den Namen des Baumeisters Schinkel und des Gartenkünstlers Lenné. Fontane, der diese Gegend vor über hundert Jahren durchstreift hat, ist fast immer gegenwärtig. Gisela Heller erzählt über sie ernst oder anekdotisch, manchmal spottend über alte Zöpfe, die wir selbst noch tragen, und immer mit der versteckten Aufforderung, doch einmal selbst nachzuschauen. Neben den alten Namen stehen die von Genossenschaftsbauern, Arbeitern, Wissenschaftlern, die in den letzten vierzig Jahren das Gesicht dieser Landschaft prägen halfen. Ihre Schicksale sind beredtes Zeugnis, wie sich das Leben in diesem einst rückständigen Landstrich gewandelt hat. Die Probleme der Vorväter sind längst gelöst, neue dafür entstanden. Sie werden die Menschen dieser Gegend weiter herausfordern, aber nicht mehr ihre Existenz bedrohen wie noch zu Zeiten der Bredows und Kähnes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Teupitz unter der dünnen Haut der Idylle
Dichtung und Wahrheit um den Scharmützelsee
Kelten, Karpfen und Kasematten in Peitz
Erkner und Hauptmann – Geschichte einer Wirkung
Bad Freienwalde – Fontane auf Schritt und Tritt
Hinter den Klostermauern von Chorin
Gransee und das Storchenbein
Schöne Gegend Fürstenberg
Die Eroberung der Ruppiner Schweiz vom Wasserwege aus
Kutschfahrt durchs Rhinluch und zwei Jahrhunderte
Dat geiht bunt to inne Prignitz, awerst am büntsten in Wittstock
Sehr Irdisches aus Heiligengrabe
Der Kern im Kern, das Ländchen Friesack
Rathenow durch die Brille betrachtet
Brandenburg mit den vielen Gesichtern
Altweibersommer in den Dörfern des Hohen Fläming
Luckenwalde und die sieben Schönheiten
Glindow und der gute Ton
Die Werderschen sind gar nicht so …
Sichtbares und Unsichtbares aus Petzow am Schwielowsee
„So Ihr die Baumgartenbrücke passiret …“
Bornstedt-Bornim, Garten der Erinnerung
Gisela Heller
E-Books von Gisela Heller
Impressum
Gisela Heller
Neuer Märkischer Bilderbogen
Reporterin zwischen Havel und Oder
ISBN 978-3-95655-826-9 (E–Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals1986 im Verlag der Nation, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2019 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: verlag@edition–digital.de
Internet: http://www.edition–digital.de
Die einzelnen Reportagen sind zwischen Januar 1983 und Juni 1985 entstanden.
Teupitz unter der dünnen Haut der Idylle
„Überschläge ich meine eigene Reiserei, so komme ich zu dem Resultat, dass ich von solchen Spritzfahrten in die Nähe viel, viel mehr Anregung, Vergnügen und Gesundheit gehabt habe als von den großen Reisen, die sehr anstrengend und sehr kostspielig sind … In Teupitz und Wusterhausen aber bin ich immer glücklich gewesen.“
Das schrieb der alte Fontane an seinen Sohn; und er muss wirklich nicht übertrieben haben, denn für Teupitz nahm er bereitwillig allerlei Mühseligkeiten in Kauf, die ihn woanders sicher verdrossen hätten.
Allein der Weg dorthin war ein Kapitel für sich. Man kam damals nur mit einer einzigen Postchaise nach Teupitz, und diese startete um Mitternacht in Zossen, zockelte stundenlang über Chausseen und Heidewege, um endlich bei Sonnenaufgang ins stille Teupitz hineinzurumpeln. Der Wagen hielt gewöhnlich vor dem „Goldenen Stern“, an dessen Laubenvordach der Wirt lehnte, um eventuelle Gäste willkommen zu heißen. Der Reisende bekam unverzüglich ein freundliches Lager, damit er sich von den Strapazen der Fahrt erholen konnte.
Doch nicht lange, und der Nagelschmied von der Ecke gegenüber begann sein Tagewerk und weckte mit seinem Picken und Klopfen den unausgeschlafenen Dichter. An jedem anderen Ort hätte ihm dies allein die Laune verdorben. Nicht so in Teupitz. Hier schien es ihm die angenehmste Art, geweckt zu werden. Erwartungsvoll setzte er sich an den Frühstückstisch und ließ sich von der Stern-Wirtin über Teupitz und den Teupitzer See erzählen. So ist das eben. In einem Ort ärgert uns die Fliege an der Wand, und in dem andern kann uns gar nichts aus der Ruhe bringen.
Teupitz scheint wirklich so ein beruhigender Ort gewesen zu sein. Und ist es heute noch. Aber nicht die landschaftliche Schönheit führte Fontane damals nach Teupitz, sondern die fast unglaubhaft klingenden Geschichten von unsäglicher Armut, die so gar nicht zu der Idylle passen wollten. So hörte er von Geistlichen, die nur deshalb unverheiratet blieben, weil die Pfarrstelle keinen Haushalt trug; und Brot sollte in dieser Gegend so kostbar sein, dass Bettelkinder von dem geschenkten Brot nur die Hälfte aßen und den Rest mit nach Hause nahmen.
Auch die Wirtshäuser der Umgebung trugen bezeichnende Namen: „Zum toten Mann“ oder „Zum hungrigen Wolf“. Der „Goldene Stern“ in Teupitz selbst bildete eine verheißungsvolle Ausnahme, und die Stern-Wirtin erschien Fontane geradezu unverwüstlich in ihrer Hoffnung auf bessere Zeiten. Woher sie ihre Hoffnung schöpfe, fragte er sie, nachdem er Kaffee und Konfitüren genossen hatte.
Die Antwort war ein einziges Loblied auf den See: „Was wäre Teupitz ohne den See … Freilich, wir dürfen nicht mehr drin fischen, die Fischereigerechtigkeit ist verpachtet, aber das Wasser ist uns mehr als alles, was drin schwimmt. Mit gutem Winde fahren wir in sechs Stunden nach Berlin, und alles, was wir kaufen und verkaufen, es kommt und geht auf dem See. Wir bringen keine Fische mehr zu Markte, denn wir haben keine mehr, aber Garten- und Feldfrüchte, Weintrauben und Obst und Holz und Torf.
Das gibt so was wie Handel und Wandel … Große Spreekähne kommen und gehen jetzt täglich, das machen die neuen Ziegeleien. Überall hier herum liegt fetter Ton unterm Sand, und wenn Sie nachts über Groß Köris hinaus bis an den Motzner See fahren, da glüht es und qualmt es rechts und links, als brennten die Dörfer. Öfen und Schornsteine, wohin Sie sehen. Meiner Mutter Bruder ist auch dabei … Ich weiß ganz bestimmt, dass er reich wird, und andere werden’s auch. Aber dass sie’s werden können, das macht der See …“
In so lebhaften Farben malte sie die Teupitzer Zukunft, dass Fontane nicht wagte, ihren Optimismus zu dämpfen. Überdies hieß es, das Boot läge bereit, um ihn zum Egsdorfer und Schweriner Werder zu rudern …
Diese Bootsfahrten auf dem buchten- und inselreichen See mit der märchenhaften Aussicht auf waldige Hügel, Schloss- und Kirchtürme bezauberten den in Berlin damals noch recht glück- und erfolglosen Balladendichter immer wieder aufs Neue. Er liebte den See zu allen Tageszeiten und bei jedem Wetter; das hellgrüne, durchsichtige Wasser bei Sonnenschein und das bleigraue Wasser im Regen. Ja, vor allem im Regen schien er ihm geheimnisvoll und seltsam beseelt, als wohne auf seinem Grunde noch immer die heidnische Göttin Nemissa, die wahre Liebe belohnte und Untreue rächte.
Im hohen Alter, als der Dichter schon ein gut Stück von der Welt gesehen hatte, gestand er: „Ich habe Sehnsucht nach dem Teupitzer See. Ist es seine Schönheit allein, oder zieht mich der Zauber, den das Schweigen hat? Jenes Schweigen, das etwas verschweigt …“ Der See hat dem guten alten Fontane einiges verschwiegen, und auch die Stern-Wirtin schien ihn nicht aufgeklärt zu haben über den Mann, dem der See – ach, was sag ich –, dem zweiunddreißig Seen und knapp tausend Morgen Land rundum gehörten. Er hieß Baron von Parpart–Parcobron und war von 1860 bis 1910 Herr auf Teupitz.
Sein Bildnis findet man in der hervorragenden Teupitzer Chronik von Hans Sussmann, doch der wilhelminisch aufgezwirbelte Geheimratsbart des Herrn Baron lässt nicht vermuten, was für ein Halsabschneider sich dahinter verbarg. Er brachte die verfallene Ritterburg Teupitz in den fünfzig Jahren seiner Herrschaft zwar wieder auf Hochglanz, das ist unbestritten, „aber fragt mich nur nicht, wie“.
Seine Tagelöhner, die den ganzen Tag für fünfundzwanzig Pfennig in den Weinbergen gearbeitet hatten, mussten bei sinkender Sonne mit den traubenschweren Karren nach Berlin, um die köstlichen Früchte so frisch wie möglich abzuliefern. Sie bekamen dafür fünfundsiebzig Pfennig Botenlohn. Auf dem Heimweg nahmen sie irgendwo im Straßengraben eine Mütze voll Schlaf, und am andern Morgen ging die Arbeit weiter.
Weintrauben, Garten- und Feldfrüchte sowie die verpachteten Seen brachten aber noch nicht genug ein. Um als Rittergut zu gelten und steuerlich begünstigt zu werden, musste der Baron jährlich tausend Taler erwirtschaften. Da aus den Tagelöhnern nicht mehr herauszupressen war, verfiel er auf einen grandiosen Piratenstreich: Er ließ an der Kanaleinfahrt zum Mochheidegraben eine Eisenkette spannen, und jedes Mal, wenn sich ein Wirtschaftskahn, ein Dampfer oder Segelboot auf offener Wasserstraße von Berlin her näherte, ließ Ketten-Schulze im Auftrage des Herrn Baron die Kette runter und kassierte an einer langen Stange, an deren Ende ein Beutel hing, den Durchfahrtzoll. Die Höhe hatte der Herr Baron persönlich festgesetzt, als Besitzer des Sees, so meinte er, stände ihm dies zu. Das ging, solang es ging, bis nämlich der Berliner Ruderverein zusammen mit ansässigen Gutsbesitzern den adligen Piraten verklagte. Der Prozess zog sich über Jahre hin. Und er verschlang mehr Geld, als Parparts Tagelöhner jemals im Leben verdienen konnten. Am Ende aber war alles für die Katz, denn als das Kammergericht 1910 endlich entschied, dass der Wasserweg zum Teupitzer See ein öffentlicher und die Erhebung von Durchfahrtgebühren daher unzulässig sei, da war Baron Parpart–Parcobron mit vierundneunzig Jahren gerade verstorben.
Die Sportler aber hatten von da an auf dem Teupitzer See freie Fahrt.
Wenn sich damals die Stern-Wirtin von den glühenden Öfen und den qualmenden Schornsteinen rund um Teupitz Arbeit für alle und sogar Reichtum versprach, so sollte sie sich bitter getäuscht haben. Manches Unternehmen fing zwar recht verheißungsvoll an, endete aber meist mit einer Bauchlandung. Da beobachtete zum Beispiel – noch zu Fontanes Lebzeiten – ein Berliner Geschäftsmann, dass die Leute aus Teupitz, Tornow, Neuendorf, Egsdorf und Töpchin nicht nur nach Karpfen und Zander, sondern auch nach Kohle fischten. Auf dem Grunde des kleinen, flachen Lebersees lagerten Braunkohlestücke in Massen. Sie trockneten schnell und heizten besser als der allgemein übliche Torf.
Unverzüglich ließ der Unternehmungslustige in der stillen Gegend nach Kohle bohren. Und als der erste Versuch vage Hoffnungen weckte, da gründete er – ohne die näheren Umstände erforscht zu haben – eine Aktiengesellschaft. In allen Berliner Tageszeitungen und vor allem im Börsenblatt rührte er die Werbetrommel und brachte eine erkleckliche Summe zusammen, zum überwiegenden Teil aus Kleinaktien.
Den Herren des Direktoriums wurde sehr schnell klar, dass der Teupitzer Schacht ein Fiasko war, doch sie trommelten umso lauter, trommelten sogar noch, als der Teupitzer See in den Schacht drückte und das Grundwasser bereits erschreckend hoch stand. Die Grubenleitung sah sich außerstande, die fälligen Wochenlöhne zu zahlen. Die Frauen der Betrogenen rückten mit Handwagen an, um die Braunkohle von den Halden zu fahren und so wenigstens als Entschädigung eine warme Stube zu haben. Als sich das Dilemma gerüchtweise bis Berlin herumgesprochen hatte, reisten viele verunsicherte Aktionäre an, um sich von der Lage der Dinge selbst zu überzeugen. In den Schacht fuhren sie natürlich nicht, sie begnügten sich damit, die stattliche Halde aus Braunkohle zu besichtigen, die am Rande des Schachtes lagerte, und fuhren beruhigt nach Hause. Sie ahnten nicht, dass die Kohle heimlich aus Senftenberg angefahren worden war, um den Geldgebern dicke Pfründe vorzugaukeln.
Im Jahre 1893 soff der Tagebau endgültig ab und mit ihm die kümmerliche technische Einrichtung. Was übrig blieb, waren nach vorsichtiger Schätzung Betriebsschulden in Höhe von einer Million siebenhundertfünfzigtausend Goldmark. Das Geld der kleinen Aktionäre. Sie konnten sich’s in den Schornstein schreiben.
Die Herren des Direktoriums aber lehnten sich behaglich in die Sessel ihrer neu erbauten Villen – einen Nutzen mussten die aufregenden Jahre doch schließlich gehabt haben – und stießen mit Champagner auf die Unbestechlichkeit der preußischen Justiz an.
Immer waren die kleinen Leute die Angemeierten. Und in Teupitz waren die kleinen Leute besonders klein. Deshalb verfuhren die Großen auch mit ihnen nach Belieben. Als Albrecht der Bär sich im zwölften Jahrhundert die Altmark, den Teltow und Barnim einverleibte und zum Markgrafen von Brandenburg aufrückte, lebten die Teupitzer bereits im Schutze ihrer wendischen Wasserburg, to dem Tupcz geheißen. Slawisten übersetzten das auf verschiedene Weise. Sie leiteten den Namen von tupiza, dem stumpfen Beil, von dubica, dem Eichenwäldchen, oder auch von tupuca ab, was so viel bedeutet wie Schwachkopf oder Hinterwäldler. Zweihundert Jahre lang gehörten die Teupitzer dem märkischen Vasallengeschlecht derer von Plozeke, dann verpfändete der Markgraf von Brandenburg, um aus Geldverlegenheiten zu kommen, einen Teil der Lausitz an den Herzog von Sachsen; auch die Herrschaft Teupitz fiel darunter. Und die Teupitzer Fischer, Bauern, Schäfer und Kossäten waren nun Untertanen der Schenken von Landsberg. Das waren hohe Herren am kaiserlichen Hofe, die unumstritten über vier Jahrhunderte herrschten.
Das heißt, bei dem Wort unumstritten zögere ich, denn mir fällt die Geschichte von Michael Kohlhaas, der eigentlich Hans Kohlhase hieß, ein. Das war ein unscheinbarer Kaufmann, der in den Dörfern Getreide, Speck und Honig aufkaufte, um es in der Stadt anzubieten. Nun riss aber zu der Zeit der verwilderte Landadel immer rigoroser das Aufkaufmonopol an sich, um zum Beispiel Getreide zu horten und damit zu wuchern. Manch kleiner Mann geriet dadurch an den Bettelstab. Auch Kohlhaas steckte in Schulden. Er setzte alle Hoffnung auf die Herbstmesse 1532 in Leipzig. Die Kramwaren hatte er vorausgeschickt, er selbst ritt mit zwei Wechselpferden hinterher. An der Mulde überfielen ihn die Spießgesellen des Junkers von Zaschwitz und nahmen ihm die Pferde ab, da diese angeblich gestohlen seien. Zu Fuß musste Kohlhaas weiter und kam in Leipzig an, als die Messe vorbei war. Seine Waren konnte er nur noch mit Verlust losschlagen. Doch die wohllöbliche Kaufmannschaft bescheinigte ihm, „dass er ein lauterer und frommer Mann von gutem Wandel sey, der seine Pferde ehrlich erworben“. Der Junker von Zaschwitz warf das Papier hohnlachend ins Feuer. Dann bot er ihm zynisch an, die Pferde zurückzukaufen, wenn ihm so viel daran läge, und nannte einen unverschämten Preis, den Kohlhaas weder annehmen konnte noch wollte.
In Berlin hatte sich sein Unglück schon herumgesprochen, die Gläubiger forderten ihr Geld. Kohlhaas war ruiniert. Er klagte beim Kurfürsten von Brandenburg, der wollte sich nicht mit dem sächsischen anlegen, denn beide steckten zusammen mit den Fuggern und dem Heiligen Stuhl in Rom in Ablassgeschäften. Da hackt eine Krähe der andern doch kein Auge aus …
Kohlhaasens Klage wurde von einer Instanz zur andern abgeschoben. Die Pferde waren inzwischen reif für den Abdecker. Nach achtzehn Monaten vergeblichen Bittens schlug es bei ihm dreizehn: „Da mir außer Leib und Leben nichts geblieben, poche ich auf meine Menschenwürde, die mit keinem Gold noch Silber zu bezahlen ist. Ich will sein Gottes und aller Freund, allein des Junkers von Zaschwitz und des ganzen sächsischen Adels Feind. Möge er sich beizeiten mit Wasser und festen Scheunen einrichten, auf dass ich ihn samt seinem Schlosse verbrenne!“
Er sprach in den Vorstädten, auf den Märkten, aber wenn man zugreifen wollte, war er verschwunden. Überall fand er Unterschlupf. Am Teupitzer See fühlte er sich besonders sicher. Allzu oft war die Gegend von sächsischen Raubrittern heimgesucht worden, nun kam endlich einer, der es ihnen heimzahlte! Sogar der Amtmann war auf seiner Seite. Die Müller vom Tornowsee und der Krüger von Kleinköris gaben Kohlhaasens Leuten Proviant und Quartier, Handwerksburschen, Knechte und Tagelöhner führten ihn zu den Häusern der reichen Leuteschinder und beteiligten sich an den Strafgerichten. Auch die verwitwete Schenkin von Landsberg-Biberstein drückte beide Augen zu. Es ging ja nur gegen die sächsische Konkurrenz!
Nach zwei Jahren – den Junker Zaschwitz hatte inzwischen der Schlag getroffen – kam es endlich zur Gerichtsverhandlung. Im Dezember 1534 saß pelzvermummt der sächsische Adel zu Jüterbog einem halben Hundert verwegener Männer gegenüber, die „so geringen Standes waren, dass sich der kurfürstliche Schreiber weigerte, sie namentlich im Protokoll festzuhalten“. Und doch trugen sie den Sieg davon. Die Adelspartei bot Kohlhaas sechshundert Gulden Abfindung, woraufhin dieser die Fehde einstellte. Aufatmend unterschrieben beide Parteien den Vertrag. Der Kurfürst jedoch, empört, dass Adel und Landvogt vor „so einem Gesindel“ klein beigegeben hatten, erklärte Tage später den Vertrag für null und nichtig.
Hilfe suchend wandte sich Kohlhaas nun an Luther. Der antwortete ihm, was er 1525 schon den aufrührerischen Bauern gesagt hatte: „dass die Oberkeyt böse und unrecht ist, entschuldigt keyne Rotterey noch Aufruhr …“
Kohlhaas bemühte sich immer wieder um gütliche Einigung. Den anmaßenden Junker von Birkholz warnte er: „Legt Euch nit mit Hasen an, diese sind Wildbret und schwer zu fangen, auch vorzüglich dazu geeignet, die herrschaftlichen Kohlfelder abzufressen, sodass den Edlen am Ende nur die Strünke bleiben!“ Der sächsische Adel schlug Warnung und Mahnung in den Wind. Hätte er sich an den Rechtsvertrag von Jüterbog gehalten, so wäre aus dem gefürchteten Empörer sicher wieder ein friedlicher Kaufmann geworden; aber so, in seiner Menschenwürde immer und immer wieder zutiefst verletzt, von allen Oberen, auch von Luther verlassen und von den gleich ihm getretenen und gedemütigten kleinen Leuten als Rächer auf den Schild gehoben, blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Weg zu Ende zu gehen.
Im März 1540 wurde Michael Kohlhaas in Berlin aufs Rad geflochten. Vierzig seiner treuesten Anhänger endeten auf dem Schafott, einhundertundfünfzehn wurden zu schwerer Kerkerhaft verurteilt. Und achtzig Ortschaften mussten es bitter büßen, dass sie gewagt hatten, ihm Hilfe zu leisten. Eine dieser gebeutelten Ortschaften war Teupitz.
Die verschuldeten Schenken von Landsberg waren froh, dass sie die Herrschaft Teupitz 1717 an den König von Preußen verkaufen konnten. Friedrich Wilhelm I., bekannt als gewaltiger Jäger, reizten die weiten, wildreichen Wälder weit mehr als die Burg, an der sowieso nicht mehr viel dran war.
Teupitz wurde nun königliches Amt und bekam einen Pfarrer, der das Wort Gottes in reinstem Kanzleideutsch in die verstockten Köpfe hineinhämmerte. Vielleicht waren sie auch gar nicht so verstockt, wie es ihm schien, denn sie verstanden ihn nicht oder nur zur Hälfte, da Teupitz ja noch immer wendisches Sprachgebiet war. Wendisch jedoch galt so viel wie aufmüpfig, und deshalb setzte der König ihnen auch gleich einen preußischen Oberamtmann namens Westphal vor die Nase.
Wer heutzutage nach Teupitz kommt und den von Eichen und Linden bestandenen kleinen Marktplatz verlässt, wird in dem romantischen Winkel zwischen Pfarrhaus und Backsteinkirche auf den Namen Westphal stoßen. Die Inschrift deutet allerdings nicht im entferntesten auf die zwiespältige Funktion des königlichen Beamten hin.
Das Seitenportal der ursprünglich gotischen, aber durch die Jahrhunderte immer wieder umgebauten Backsteinkirche steht offen. Man kann es sich leisten. Schnöde Diebeshände sind nicht zu befürchten, denn es gab und gibt nichts, was sich wegzutragen lohnt. Die Teupitzer waren arme Leute und wahrscheinlich auch nicht übermäßig fromm. Nur wenige legten Wert darauf, sich in Stein zu verewigen, und das waren keine Einheimischen, sondern zugereiste Obrigkeit.
Aus dem akkurat gepflegten Rasen des Kirchhofs ragt eine einsame Sandsteinsäule zum Gedenken an Carl Ludwig Bein, dem letzten königlichen Oberamtmann von Teupitz. Er starb im zweiundvierzigsten Lebensjahr am 19. Juni 1803. „Er ist nicht mehr, der biedere, rechtschaffene, treue Gatte und Vater seiner lieben, unversorgten Kinder“, steht auf dem bemoosten Stein. Fast möchten einem die Tränen der Rührung kommen, wenn man nicht vorher in der Chronik Hans Sussmanns gelesen hätte: „Die Witwe des Oberamtmanns Bein kaufte Burg Teupitz mit allen Vorwerken, Seen, Teichen und Forsten für neunundsechzigtausend Taler.“ Demnach scheint er zu Lebzeiten schon ganz gut „vorgesorgt“ zu haben. Auf wessen Kosten? Das verschweigt die Säule natürlich.
Mit der Burg ging es im raschen Wechsel auf und ab. Sie war Rittergut, Gaststätte, Werkstatt für kunstvolle Stickereien und 1945 Lazarett. Zu allen Zeiten hatte sie den Mächtigsten im Lande gehört: zuerst den Rittern, dann dem König, dann den Neureichen der Gründerzeit – und heute dem Volk. Das heißt – von der Burg sind eigentlich nur noch ein Stückchen Wall und ein gestutzter Turm vorhanden. Auf den alten Fundamenten erheben sich jetzt moderne Gästehäuser, in denen vor allem verdienstvolle Kampfgefährten der Bruderparteien Genesung und Erholung finden.
Und was sich heute „Schenk von Landsberg“ nennt, hat mit der traurigen Vergangenheit des Schenkenländchens überhaupt nichts zu tun, es ist ein sehr zu empfehlendes öffentliches Etablissement, in dem man zwar kein historisches Flair, aber dafür alles findet, was Gaumen und Magen begehren: Hirschkeule mit Champignons, Hirschsteak mit Preiselbeeren und Apfelringen, Schildkröten-, Haifischflossen- und Känguruschwanzsuppe, scharfe ukrainische Soljanka und gutbürgerliche Gulaschsuppe, Omeletts con variazione und die dazu passenden Weine: Cabernet, Rieslinge, Traminer, Muskateller … Für die Verehrer des schwarzen Türkentranks alle Arten von Kaffee mit Gedichten aus Sahnequark, Eiern, Kirschen und Zitrone …
Hätte Fontane, der ja auch kein Kostverächter war, damals schon dieses Lokal gekannt, so wäre sein schwärmerischer Teupitz-Vers sicher um eine Strophe länger geworden.
Habe Dich ins Herz geschlossen,
Städtchen Teupitz klein und sauber,
werde nimmermehr vergessen
Deiner Reize milden Zauber.
Dieser Stammbuchvers von Theodor Fontane ist heute noch den vielen Ausflüglern aus dem Herzen gesprochen, die in der schönen Jahreszeit mit zwei oder vier Rädern, mit der Bahn oder mit dem Boot nach Teupitz kommen.
In Teupitz wirkt alles klein und anheimelnd. Der Marktplatz ist nur ein Plätzchen, aber mit prächtigen uralten Eichen, Linden und Kastanien besäumt, die sich auch die ganze Baruther Straße entlangziehen. Zur Freude der Spaziergänger und wahrscheinlich zum Leidwesen der dort Wohnenden, denn die Wurzeln sind längst durchs Mauerwerk in die Keller gedrungen, und die dichten Kronen lassen keinen Sonnenstrahl in die niedrigen Stuben.
Da ist noch das Torhaus, an dem früher bei Einbruch der Dunkelheit ein Balken quer über die einzige Straße gelegt wurde, um unliebsame Besucher fernzuhalten; da ist das klitzekleine Haus im bescheidensten Barock, vor dem man sich Postkutsche und Postillon vorstellen kann. Aber wer die Chronik gelesen hat, der weiß, dass sich auf dem Hof dieses freundlich anmutenden Gemäuers früher das Armenhaus und das Polizeigefängnis befanden und dass noch zu Fontanes Zeiten ein einziger Lehrer einhundertundzweiunddreißig Kinder unterrichtete. Das Städtlein Teupitz konnte einen zweiten Lehrer nicht bezahlen, und der preußische Staat hielt den Zuschuss für eine zweite Schulstube für rausgeschmissenes Geld. Was ein zukünftiger Tagelöhner wissen musste, das erfuhr er von Vater und Großvater, mehr Bildung konnte nur schaden. „Ein Ochs vor dem Pflug und einer dahinter“ war die landläufige Losung der Gutsherren, und in den herkömmlichen Wendendörfern hielt sie sich länger als anderswo.
Die Teupitzer Chronik ist wirklich eine nützliche Lektüre: Einerseits öffnet sie uns die Augen für den Zauber der Landschaft, andererseits bewahrt sie uns davor, sie allzu verklärt zu sehen.
Unter der dünnen Haut der Idylle brodelte oft ein Vulkan. Manchen Familienvätern, die mit Frau und Kindern oder auch schon mit den Enkeln nach Teupitz kommen, gelingt es nicht, die Landschaft unbeschwert zu erleben. Sie waren schon einmal in dieser Gegend, unfreiwillig, im April 1945. Und sie werden die Erinnerung daran nicht los.
In seinem Buch „Familienfoto“ schildert Wolfgang Eckert so einen Fall: Die Ferienfamilie geht in die Pilze. Man freut sich an Heidelerchen und Tagpfauenaugen. An der Stelle, wo sich die Straßen nach Egsdorf und Tornow gabeln, wundert sich die Tochter über die zahlreichen Löcher in den alten Bäumen. Gibt es denn so viele Spechte hier? fragt sie unschuldig. Das war ein Vierlingsgeschütz, sagt der Vater. Ihm wird plötzlich bewusst, dass dies die Stelle war, an der sie die Panzersperre errichtet hatten. Auf Befehl des Generals Busse. Um die Russen aufzuhalten. Bis der General Wenck käme mit seiner Armee von Tigerpanzern. Der würde sie retten. Sie und den Führer und das Großdeutsche Reich. Hatte man ihnen gesagt. Aber die Tigerpanzer kamen nicht. Stattdessen wurden müde, alte Volkssturmmänner und Halbwüchsige zu einem Haufen zusammengefegt, um die Reste der 9. Armee des Generals Busse aufzufüllen. Er war dabei. Siebzehnjährig.
Sie kamen gerade an, als die Erste Belorussische und die Erste Ukrainische Front völlig unerwartet mit dem Angriff begannen: „Mehr als hundert Flakscheinwerfer und Tausende von Leuchtkugeln tauchten die Landschaft in gleißendes Licht. Während sie fasziniert in den Stellungen hockten, richteten sich die Mündungsrohre der schweren Artillerie auf sie. Die Abschüsse waren zu hören, der Boden erzitterte, der Wald schwankte, die Erde brach auf. Nebelgeschosse nahmen ihnen die Sicht, und hinter dieser Nebelwand rückte das Gebrumme der T34 näher … Die 9. Armee hörte auf, eine Armee zu sein. Tagelang irrten sie durch die brennenden Wälder, überall Tote und Verwundete, stecken gebliebene Flüchtlingstrecks, elternlose Kinder. Sie aßen das Fleisch toter Pferde. Sie liefen und stolperten und fielen und glaubten sich schon tot und wunderten sich, dass sich die Beine noch bewegten … Am 26. April stießen sie auf einen sowjetischen Erkundungstrupp. So müde waren sie, dass sie schon keine Angst mehr hatten. Es war ihnen egal, ob sie schießen würden. Einen weißen Fetzen über dem Kopf haltend, liefen sie draufzu. Sie sahen, die andern waren genauso müde und verdreckt wie sie, aber sie hielten Maschinenpistolen in den Händen, äußerst wachsam. Was bei ihnen wie Müdigkeit aussah, war Enttäuschung über so viel Verirrte. Und das gab ihnen einen Zug von Menschlichkeit, den sie bei Barbaren nie erwartet hätten.“
In endloser Kolonne zogen die Gefangenen aus dem Kessel von Halbe auf Teupitz zu. An der Gabelung hier hatten sie zuletzt gehalten. Man erkannte die Panzersperre kaum wieder. Sie war samt ihren gläubigen Hitlerjungen zermalmt worden, zermalmt von den Panzerketten des Generals Busse, der sich im letzten Augenblick hatte den Weg freischießen lassen in Richtung Nordwesten, in seine persönliche Freiheit.
Er war wie ein Wunder davongekommen, als die Panzer dieses Generals über sie hinweggerollt waren.
Nachdem die Waffen endgültig schwiegen, brannte die Sonne auf das verwüstete Land, und der Pesthauch des Todes breitete sich aus. Wer noch am Leben war, musste mit hinaus, die Toten zu begraben. Klaftertiefe Trichter füllten sich mit Mensch und Tier, mit Munition und anderem Kriegsgerät. Monatelang wühlten sie wie die Maulwürfe, immer in Gefahr, auf eine Mine zu treten, auf Granaten zu stoßen.
Wer das alles erlebt hat mit siebzehn, wie soll der jemals wieder die Wälder um Teupitz mit unbefangenen Augen sehen?
Wenn zwei Menschen zur selben Zeit am selben Ort leben, noch dazu in so einem kleinen wie Teupitz, können sie doch durch Welten getrennt sein. Da war zum Beispiel Margaret Boveri, aus gutbürgerlichem Hause, Mitarbeiterin des „Berliner Tageblattes“ bis 1937, eine elegante Erscheinung, ständiger Gast im Hause des amerikanischen Botschafters, später Auslandskorrespondentin, teils schriftstellernd, teils in undurchsichtigen diplomatischen Diensten auf der Iberischen Halbinsel, einem Tummelplatz deutscher, spanischer und portugiesischer Faschisten. Zwischendurch – um sich von dem turbulenten Treiben in der Welt da draußen auszuruhen – immer mal wieder in ihrem Sommerhaus in Teupitz. Und da war Hans Sussmann. Ebenfalls aus gutbürgerlichem Hause. Er erlebte nach dem Berliner Gymnasium seine eigentliche Erziehung vor Verdun, als Freiwilliger mit Meldehund. Lernte dabei Arnold Zweig kennen. Und wer dessen Roman „Erziehung vor Verdun“ gelesen hat und sich an die Gestalt des Unteroffiziers Süßmann erinnert, der weiß, welcherart diese Erziehung gewesen ist. Vom ganzen Bataillon blieben sieben Mann am Leben. Grund genug für Hans Sussmann, sich November 1918 im Arbeiter- und Soldatenrat zu engagieren. Über die Roten Revuen kam er später mit Toller, Weinert und Heartfield zusammen und – folgerichtig – zur KPD.
Eigentlich führte er in Berlin zwei Leben: Tagsüber verkaufte er in seinem Seifenladen duftende Wässerchen an vornehme Damen und solche, die es gern sein wollten; abends hielt er in der MASCH spezielle Vorträge für kommunistische Abgeordnete über Mechanismen, Praktiken und Hintertüren des kapitalistischen Systems. Nachts klapperte im Hinterstübchen der gutbürgerlichen Drogerie der Abziehapparat; und in den frühen Morgenstunden verließ ein Bote mit dem Geschäftsrad ganz unauffällig das Haus. Zwischen den Persilkartons aber lagen – auf hauchdünnem Seidenpapier gedruckt – die Flugblätter.
Obwohl allerlei Großkopfeten in brauner Uniform tagsüber zu den Duftwasserkunden zählten, blieb Hans Sussmann wie durch ein Wunder all die Jahre ungeschoren. Niemand wusste, dass er über Albert Voigts durch ein vorsichtig und fein gesponnenes Netz mit der Schulze-Boysen-Harnack-Gruppe verbunden war. Das heißt, die alte Portiersfrau in Kreuzberg muss es geahnt haben, jedenfalls warnte sie ihn und seine Frau in letzter Minute, und so konnten sie mit dem Köfferchen voll Habseligkeiten untertauchen. Zuerst in Bad Elster, dann in Teupitz, wo sie den Schlüssel zu Doktor Gollwitzers Laube besaßen. Da es zu dieser Zeit in Teupitz von ausgebombten Berlinern wimmelte, fielen sie weiter nicht auf, und so konnte Hans Sussmann – fast als einziger der Gruppe – überleben.
Im Mai fünfundvierzig begegneten sich Frau Boveri und Hans Sussmann in Teupitz. Sie kam, um sich „nach dem Umsturz“ – wie sie es nannte – ihr Sommerhäuschen als zweiten Wohnsitz zu sichern. Er war „nach der Befreiung“ – wie er es nannte – von der sowjetischen Kommandantur als Bezirksbürgermeister für Teupitz, Mittenwalde und sechzehn Dörfer des ehemaligen Schenkenländchens eingesetzt und gerade dabei, eine Familie mit eigenen und aufgelesenen Kindern in Madame Boveris Sommerhaus unterzubringen.
„Wer gibt Ihnen das Recht, über mein Haus zu verfügen?“, fragte sie sehr von oben herab.
„Dreitausend Flüchtlinge, die allein in Teupitz ein Dach überm Kopf haben müssen“, antwortete Sussmann, „im Übrigen steht Ihnen frei, sich beim Kommandanten des Kreises Teltow zu beschweren.“
Die Lady machte auf dem Absatz kehrt. Dreiundzwanzig Jahre später erschien in München ein Buch von ihr mit dem Titel „Tage des Überlebens 1945“. Sie hatte kaum etwas gesehen, geschweige denn gelesen, hat Zahlen verwechselt oder verfälscht und das Ganze als Tatsachenbericht ausgegeben.
Hans Sussmann weiß, was es heißt, Historie aufzuarbeiten. Er selbst hat jahrzehntelang an den einhundertundfünfzig Seiten der Teupitzer Chronik geschrieben, in Archiven geforscht, Quellen verglichen, endlose Korrespondenzen geführt.
„Es ist kaum zu glauben“, sagt er, „wie wenig dazu gehört, in München so ein Buch zusammenzuklittern, wenn es nur gegen uns geht.“
Hans Sussmann ist ein Stück Geschichte von Teupitz und für manchen Jungen schon eine Art Legende. Als erster Bürgermeister in Teupitz hat er mitgeholfen, die Toten der Kesselschlacht von Halbe zu begraben, hat in den verwüsteten Wäldern Brennholz geschlagen für die Alten und mit eigenen Händen Kühe gemolken, um wenigstens an die Kleinstkinder Milch verteilen zu können, hat zerschossene Militärfahrzeuge umbauen lassen und massenweise Kriegsschrott gesammelt für Max, war lange Jahre verantwortlich für das schwierige Terrain der Bezirksnervenklinik, hat die schöne neue Willi-Bredel-Schule eingeweiht, Kindergärten und -krippen, das Volkshaus … hat unzählige Male vor jungen Soldaten und Offizieren gesprochen; manche nennen ihn Freund und Vater. Er hat für sich nie mehr in Anspruch genommen als ein winziges Haus mit einem Raum zum Wohnen und Arbeiten und einem zum Schlafen.
Nun ist er siebenundachtzig. Körperlich ein alter kranker Mann, aber es ist unglaublich, welche Kraft noch immer von ihm ausströmt. Die Energie und Leidenschaft, mit der er seine Aufgaben erfüllt, können manchen Jüngeren und Gesünderen beschämen.
Ich weiß nicht, ob Hans Sussmann Teupitz je als idyllisches Fleckchen Erde empfunden hat. Ich glaub eher, er hat immer nur die nächstanstehenden Aufgaben gesehen.
Jenseits des Teupitzer Sees habe ich einen Mann kennengelernt, der beides auf seinen breiten Schultern trägt: klare, nüchtern gestellte Aufgaben und Sinn für Schabernack. Zu finden ist Walter Stroff nicht so leicht. Irgendwo im Wald steht eine Mülltonne mit seiner Hausnummer. Ich stolziere drauflos, hundert Meter, zweihundert … Hähähä, lacht ein Eichelhäher. Lacht er mich aus? Endlich stoß ich auf einen Bootsschuppen, einen Stapel knorziger Äste, einen Korb mit Pilzen, und in den Ästen sitzen lauter verrückte Vögel in Frack und Zylinder, manche in Abendroben und mit Kalabreser. Der Vogelwalter ist überhaupt nicht überrascht, dass ihn jemand beim frugalen Mittagsmahle stört. „Is noch was im Topf, wolln Se mitessen? Sonst schmeckt’s nicht.“ Dann zeigt er mir seine tiefsinnig-heitere Vogelschar.
Wann fällt einem so was ein? Er lacht. „Wenn man genügend lange als Messearchitekt mit genormten Bauteilen gearbeitet hat, dann juckt es einen, mal ganz was anderes zu machen. Mein erster Professor an der Dresdener Kunsthochschule, Brockhage, das war ein Zauberer, der nahm een Stück Holz in die Hand – und ’s wurde Kunst draus …“
So ein Zauberer ist Walter Stroff inzwischen auch geworden. In seinem Berliner oder Leipziger Atelier wäre ihm sicher nichts dergleichen eingefallen, aber hier, mitten im Wald, wo man immer auf etwas wartet, dass der Karpfen beißt, dass die Meisen nisten, dass der Sprosser singt, dass jemand auf einen Snack vorbeikommt – da sprudeln die Ideen nur so. Spielplätze möchte er bevölkern mit seinen Vogelbäumen oder einen kleinen Platz in der Großstadt, wo die Alten gern sitzen. Am Morgen nach einer Sturmnacht, wenn er die abgebrochenen Äste aufsammelt, fliegen ihm die Ideen nur so zu. Meistens werden Liebespaare daraus, manche hingerissen und melodramatisch, manche reputierlich, da eine reine Vernunftehe, dort eine züchtige Hausfrau, die ihren Allotri von Ehegespons auf dem Kopfe trägt. Erträgt! Und dann ein geplagter Familienvater, dem die ganze Großfamilie auf dem Kopfe herumtanzt. Armer Theobald! Für fast jeden Vogel fallen einem entsprechende Namen ein. Mathilde Piepenbrock, geborene Meier, hat sich für den Gang zum Standesamt in ein taubenblaues Kostüm gezwängt mit weißem Kragen und Perlenkette. Sie strahlt vor Selbstgefälligkeit: Seht her, ich hab’s erreicht! Stundenlang könnte man Vogelwalters hintergründige Fabelwesen anschauen, doch im Hintergrund mahnt das Reißbrett: Erst die Pflicht und dann ’s Vergnügen! Da geh ich lieber.
Noch ganz eingesponnen in Poesie, gehe ich den Waldweg zum Auto zurück. Patsch! macht es, und etwas weißlich graues klatscht mitten auf die Motorhaube. Auf dem Buchenast sitzt – Mathilde Piepenbrock, geborene Meier, in taubenblauem Kostüm mit weißem Kragen, sie wippt mit ihrem breiten Stert und lacht. „Mathilde“, rufe ich, „das ist aber nicht die vornehme englische Art!“ – „Papperlapapp!“, gurrt sie und fliegt davon.
Wenn Sie zum Teupitzer See fahren, lieber Leser, grüßen Sie Mathilde von mir!
Dichtung und Wahrheit um den Scharmützelsee
Mühelos kommt man heutzutage nach Bad Saarow. Bei Fürstenwalde biegen wir von der Autobahn Berlin–Frankfurt (Oder) ab und sind im Handumdrehen am Scharmützelsee. „Dieser See, von sanften Hügeln umwaldet, hat von jeher die Künstler angezogen“, so steht es im Werbeprospekt der Stadt. Was heißt „von jeher“? Der erste Dichter, der nachweislich in diese Gegend reiste, war Theodor Fontane, und das war im Jahre 1881. Er kam auch nicht wegen der Schönheit des Sees – die hatte sich damals noch gar nicht bis Berlin herumgesprochen –, verwechselte sogar seinen Namen und sprach stets vom Schermützelsee. Fontane wollte sich auf seiner Osterfahrt ins Land Beeskow–Storkow lediglich davon überzeugen, ob noch Spuren der Löschebrands zu finden waren.
Den Löschebrands, einem alten märkischen Junkergeschlecht, gehörte über sieben Generationen alles Land ringsum, zuletzt auch der See. Um es vorwegzunehmen: dieses „Geschlecht von Schwertmagen und Kriegsgurgeln“ enttäuschte ihn. Dafür lernte er jedoch auf dieser Fahrt einen Mann kennen, der ihn für alles entschädigte. Es war dies der Kutscher Moll, „der in Potsdam bei den Ulanen gedient und dessen gesunder Menschenverstand weder dadurch noch durch die Lektüre von Büchern und Zeitungen gelitten hatte“. Durch ihn offenbarte sich dem Dichter die Denkweise der einfachen Leute, die hier auf dem blanken märkischen Sande mühsam ihr Leben fristeten. Moll hatte es immerhin zu zwei Pferden gebracht. Mit ihnen kutschierte er den neugierigen Herrn aus Berlin von Fürstenwalde an den Scharmützelsee. Als sie, von den Rauenschen Bergen kommend, das Nordufer erreichten, läuteten gerade die Mittagsglocken des Pieskower Kirchturms. Die Pferde schnaubten und dampften vor Anstrengung. Um sie zu schonen, entschloss sich Fontane, das Gefährt allein nach Pieskow fahren zu lassen, während er auf Schusters Rappen Dorf Saarow erreichen wollte. Mit dem Fährboot konnte er dann nach Pieskow übersetzen. „Es war ein wundervoller Weg; über dem blauen Wasser wölbte sich der blauere Himmel, Borkenstücke tanzten auf dem flimmernden See, der im Übrigen, all diesem Flimmern und Schimmern zum Trotz, einen tiefen Ernst und nur Einsamkeit und Stille zeigte. Nirgends ein Fischerboot, ja, kaum ein Vogel, der über die Fläche hinflog. Oft hielt ich an, um zu horchen, aber die Stille blieb, und ich hörte nichts als den Windzug in den Binsen und das leise Klatschen der Wellen.“
Am Rande des Dorfes Saarow traf Fontane eine alte Frau, die Strauch- und Reisigbündel aus der Heide geholt hatte. „Na, Mütterchen“, sagte er, „is wohl ’n bisschen schwer? Und die Sonne sticht heute so. Sie müssen die Kinder in den Wald schicken. Oder haben Sie keine?“
„Woll, woll, Kinder hebb ick, un Enkelkinner ook. Awers se wulln joa nich. Un se künn’ ook nich. Se möten joa all in de School.“
„Haben Sie denn auch eine Kirche in Saarow?“
„Nei. Wi möten nach Reichenwald.“
„Das ist da, wo sie den alten Rittmeister begraben haben. Haben Sie den noch gekannt?“
„O wat wihr ick nich?“
„Und – wie war er denn?“
„Na, he wihr so wit janz goot. Bloot man en beeten schnaaksch un wunnerlich, un ook woll en beeten to sihr för de Fruenslüd. Awers nu is he ja dod.“
„Und hat wohl ein Denkmal? Ich meine, so was aus Stein oder Eisen. Eine Figur oder einen Engel mit ’nem Spruch oder Gesangbuchvers?“
„Ne, för so wat wihr he nich.“
„Und ist sonst noch was in Saarow zu sehen?“
„Ick glöw nich. Veel is hier nich in Saarow. En nijen Kohstall …“
Das war’s wohl nicht gerade, weswegen sich Fontane die Schlupfstiefel mit Sand gefüllt hatte … Also in Saarow war nichts, und in Pieskow war auch nichts. Die Löschebrands hatten sich als unergiebig erwiesen. Und dennoch sollte gerade dieses Kapitel seiner späten „Wanderungen“ zu den wertvollsten gehören, weil er darin den einfachen Leuten „aufs Maul geschaut“ hatte: dem Kutscher, dem Fährjungen, dem Holzweiblein, der Frau in der ärmlichen Krugstube, und weil er sie ernst nahm mit ihren Ansichten vom Leben, ihrem klaglosen, ausdauernden Kampf ums Dasein, ihren bescheidenen Freuden und ihrer großen Sehnsucht nach dem Glück. Hier klingt bereits an, was er Jahre später in einem Brief an den englischen Arzt James Morris unmissverständlich aussprach: „Alles Interesse ruht beim vierten Stand. Der Bourgeois ist furchtbar, Adel und Klerus altbacken, immer dasselbe. Die neue, bessere Welt fängt erst beim vierten Stande an.“
Am Nordufer des Scharmützelsees stieß Fontane nur auf ein einsames Försterhaus, das wiederum aus einer sehr viel älteren Pechhütte hervorgegangen war, die natürlich auch den Löschebrands gehörte. Das heißt zu Fontanes Zeiten schon nicht mehr, da war ihr Glücksstern bereits erloschen. Land und See wechselten mehrfach den Besitzer, bis die Landbank AG im Jahre 1905 die Güter Saarow und Pieskow erwarb, um auf den Ländereien eine Villenkolonie zu errichten für Berliner, die es sich leisten konnten, in den Sommermonaten der staubigen Großstadt fernzubleiben. Für die neuen Gäste musste Saarow rasch „an die Zivilisation angeschlossen werden“.
Die Kutschen wurden von Pferdeomnibussen abgelöst, denen die Eisenbahn folgte; und als der Wasserturm stand, ließen Elektrizitätswerk und Postamt nicht lange auf sich warten.
Bei den ersten größeren Bauarbeiten war man 1912 auf den Wierichwiesen auf Raseneisenmoor gestoßen, das clevere Unternehmer sofort ausnutzten. Unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs öffnete das Moorbad seine Pforten, und alle kapitalkräftigen Zeitungen Berlins warben und sparten nicht mit Superlativen. Tatsächlich muss das Moor im Verein mit der guten, sauerstoffreichen Luft und der windgeschützten Lage verblüffende Heilerfolge erzielt haben.
Im Juli 1921 schrieb Lenin an Maxim Gorki in einem Brief unter anderem: „… Sie husten Blut und fahren nicht? Das ist doch aber wirklich gewissenlos und unvernünftig … In Europa werden Sie sich in einem guten Sanatorium kurieren lassen und dreimal so viel schaffen. Ganz bestimmt.“
Gorki zögerte. Wie konnte er wegfahren zu einem Zeitpunkt, da das Schicksal der jungen Sowjetmacht auf des Messers Schneide stand. Das würde ja wie Fahnenflucht aussehen.
Länger als ein Jahr bestand Lenin hartnäckig darauf, dass er fahren müsse, weil er die Pflicht habe, gesund zu werden. „Fahren Sie, lassen Sie sich auskurieren. Seien Sie nicht so dickköpfig. Ich bitte Sie. Ihr Lenin.“
Gorki war gerührt, dass der mit Arbeit überhäufte Mann daran dachte, dass er, ein durchaus nicht immer bequemer Dichter, krank war und Erholung brauchte. Und er fuhr. An Berlin banden ihn die angenehmsten Erinnerungen. Hier war im Januar 1903 am Kleinen Theater, drei Wochen nach der Uraufführung im Moskauer Künstlertheater, sein „Nachtasyl“ inszeniert und innerhalb von drei Jahren über fünfhundertmal gespielt worden. Und als Gorki wegen seiner Teilnahme an der Revolution 1905 in die Peter-Paul-Festung geworfen wurde, war es das „Berliner Tageblatt“, das den Aufruf zu seiner Rettung veröffentlichte. Die Theaterleute an der Spitze: Max Reinhardt, Eduard von Winterstein und Richard Vallentin, der in „Nachtasyl“ Regie geführt und den Satin gespielt hatte; ihnen zur Seite Gerhart Hauptmann, Anatole France, Hermann Hesse, Christian Morgenstern, Richard Dehmel, Peter Rosegger, Max Liebermann, Max Klinger und andere. Gorki wusste also, dass er in Berlin Freunde hatte. Möglicherweise kam er durch sie am 27. September 1922 nach Saarow.
Wenige Wochen später besuchte ihn dort Egon Erwin Kisch im Auftrag der „Roten Fahne“. Er schrieb: „Draußen in Saarow-Pieskow war Winter. Die Villen schliefen hinter herabgelassenen Fensterläden, und den Scharmützelsee durchfuhr kein Segelboot und keine Jacht. Im Sanatorium hatte … Maxim Gorki seine Wohnung. Zwei Zimmerchen, in denen er so fremd wirkte und die so vorläufig wirkten, als wäre der Bewohner auf dem Sprung weiterzuziehen wie vor dreißig Jahren, da er über die Ebene wanderte und in Heuschobern schlief und da er Menschen kannte, die einander wegen zehn Kopeken ermordeten …“ Aus jeder Zeile spürt man Kischs tiefe Freude, mit Maxim Gorki sprechen zu dürfen, zum einen, weil er ihn von Jugend an, eigentlich seit dem „Sturmvogel“, liebte und verehrte, und zum andern, weil er nun in der Lage war, allen Gehässigkeiten entgegnen zu können, die reaktionäre Zeitungen über Gorki verbreitet hatten. Er sei gar nicht krank, geiferten sie, er habe sich von den Bolschewiki losgesagt und Sowjetrußland ein für alle Mal den Rücken gekehrt.
Die Abteilung I A im Berliner Polizeipräsidium wusste es besser und forderte vom Amtsvorsteher Kopp aus Saarow regelmäßigen Bericht über einen gewissen Alexej Peschkoff, genannt Maxim Gorki, und seinen Anhang. Kopp belauerte den Fremden wochenlang, befragte die Kaufmannsfrau, den Wirt, bei dem Gorki zuweilen den Abendschoppen trank, sogar die Kinder, denen er Bonbons geschenkt.
Alle schilderten ihn als freundlich und bescheiden, sodass Kopp nur berichten konnte: „… Es hat sich hier in dem Verkehr des Herrn Gorki, der nur wenig Deutsch versteht, nichts zugetragen … er arbeitet ununterbrochen an seinem Schreibtisch und verlässt kaum das Haus. Die geschäftlichen Angelegenheiten besorgen die Sekretärin und der Sohn … Neuerdings ist ein russisches Paar hinzugekommen, sie wohnen im Bahnhofshotel, stehen aber mit den Gorkis in steter Verbindung. Es macht keinesfalls den Eindruck, dass die Russen aus Gesundheitsrücksichten hier wohnen. Es ist eine ausgesprochen politische Zentrale, ob bolschewistischer Art lässt sich nicht feststellen. Gorkis Sohn soll entschiedener Bolschewist sein … Es herrscht, besonders sonntags, ein reger geschäftlicher Verkehr von außerhalb mittels Autos, Wagen und Radfahrern …“ Kisch gehörte demnach auch zum „geschäftlichen Verkehr von außerhalb“.
Armer Kopp. Sein Beamtenhirn registrierte lediglich, dass sich „hierselbst nichts von Bedeutung zugetragen“ habe … Nichts von Bedeutung! Dabei beendete Gorki hier „Meine Universitäten“ und nahm „Das Werk der Artamonows“ in Angriff, Literatur, von denen Dichter kommender Generationen wie Jurij Brezan sagen würden: „Wenn ich nicht in einer entscheidenden Phase meines Lebens Maxim Gorkis Bücher kennengelernt hätte, wäre ich vermutlich nie Schriftsteller geworden.“
Was beweist der kleine Kopp? Dass es noch gar nichts bedeutet, Augenzeuge eines Ereignisses zu sein; auf welche Weise man daran beteiligt ist, darauf kommt es an.
In einem Punkte aber muss man den preußischen Beamtenseelen dankbar sein: Ihre ausführlichen Berichte bereichern heute die Gedenkstätte für Maxim Gorki in Bad Saarow und vermitteln uns aufschlussreiche Einzelheiten über Gorkis Aufenthalt. Wenn man die Fotos jener Zeit betrachtet oder die einfühlsame Stele Arnd Wittigs, die heute vor dem Hause steht, erkennt man deutlich, wie ausgezehrt und von der Krankheit geschwächt Gorkis Körper war, und wie unerbittlich hat er dagegen angeschrieben … Der Bahnhofsvorsteher von Saarow behauptete, Gorki habe im Gewimmel auf dem Bahnsteig alle anderen überragt. Er fiel auf, aber nicht allein wegen seiner leiblichen Größe oder seines Schlapphutes und des weiten, pelerinenartigen Mantels, sondern vor allem wegen seiner Haltung. Selbst wer noch nie von ihm gehört oder gelesen hatte, blieb stehen und fragte: Wer ist das?
Es gibt Saarower, die sich gut an ihn erinnern, obwohl sie damals noch Kinder waren. Heute ist Gorki in Bad Saarow ein Haus gewidmet, das er zwar nie bewohnte, das ihm aber angemessen ist. Den Blockhäusern der Potsdamer Russischen Kolonie nachempfunden, gehört es zu den anheimelndsten des Ortes. Ich habe eine Weile davor auf einer Bank gesessen, in die Herbstsonne geblinzelt und die Menschen beobachtet, die dort ein und aus gingen. Die meisten kamen nicht in Gruppen, eine Pflichtübung zu absolvieren, sondern einzeln, aus eigenem Antrieb. Die Sowjetbürger erkannte man daran, dass sie das Haus auf besondere Art betraten, fast andächtig, wie eine Pilgerstätte, und dass sie alle, ausnahmslos, mit einem leisen, nachdenklichen Lächeln herauskamen. Ich hätte viel dafür gegeben, ihre Gedanken lesen zu können.
In einem Raum warten auf niedrigem Tisch zwei Samoware auf durstige Gäste. Niedrige Sitzpolster an den Wänden entlang. Hierher kommen die Kinder zu Lesestunden, hier macht Frau Kraatz, die Rezitatorin, allein mit der Kraft ihrer Stimme die wunderlichen Tiere des Doktor Aiboli lebendig, hier las Helmut Preißler – auch ein Wahlsaarower – seine hellsichtigen, eindrucksstarken Liebesgedichte an Land und Leute, hier sitzen die Größeren zu Jugendstunden mit Götz R. Richter zusammen, auf Anhieb mit ihm vertraut, denn mit seinen Helden sind sie ja aufgewachsen, mit Najok, dem Perlentaucher, mit Sawy, dem Reis-Shopper; mit ihm waren sie „In der Höhle der fliegenden Teufel“ und hörten die „Trommeln der Freiheit“ …
In dem dunkelbraunen Holzhaus mit dem roten Schnitzwerk am Giebel ist nicht nur Maxim Gorki zu Hause, sondern auch die Gemeindebibliothek mit zehntausend Büchern und Schallplatten. Von Saarow-Strand bis Pieskow, also um den halben Scharmützelsee herum, wird Ruth Spiegel „die Mutter der Bücher“ genannt. „Großmutter“, korrigiert sie lächelnd, „ich geh bald in Rente, dann hör ich auf.“ – Wer’s glaubt, zahlt einen Taler, heißt es im Märchen.
Wie kann sie sich von den Büchern losreißen, sie sind doch in dreißig Jahren ein Teil von ihr geworden. Übrigens fühlt sie sich noch immer als Berlinerin, in Lichtenberg geboren. Ihr Vater fuhr einen Doppelstockomnibus, und sie durfte manchmal gratis mitfahren und ganz oben sitzen, ganz vorn! Schönstes Kindheitserlebnis. Im Kriege wurde die Familie siebenmal ausgebombt. Das heißt: siebenmal bei Null anfangen und nicht den Mut verlieren! Nach Bad Saarow retteten sie nur noch, was sie auf dem Leibe trugen. Dann war endlich der Albtraum vorbei, die Rote Armee war da, und Saarow-Pieskow hatte statt der dreihundert auf einmal dreitausend Einwohner, wenn nicht mehr, und keine Arbeitsmöglichkeit. Ein Dutzend Frauen sollte sich beim Kommandanten melden und Wäsche waschen für Brot, Speck und Tabak. Das war damals die stabilste Währung. Ruth, jung und unerfahren in praktischen Dingen, wollte es besonders gut machen und kippte einen Eimer Chlor in den Kessel. Statt der Soldatenhemden zog sie Puppenlappen raus. „Du Faschist!“, schrie der Sergeant. Er hatte allen Grund, misstrauisch zu sein, denn bis zuletzt hatte es in und um Saarow von Nazis gewimmelt. Die meisten waren wohl über alle Berge, aber nicht alle …
Mit der Machorkaquelle war’s vorbei. Weil sie gut gebaut und attraktiv war, bekam Ruth verlockende Angebote von Geschäftsleuten, die mit wer weiß was handelten. Bedingung: Stenogrammverpflichtung zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da arbeitete sie lieber beim Rat der Gemeinde. Dort stand ein Schrank mit zweihundert Büchern, der sie sofort anzog: die Gemeindebibliothek. Bald wurde der Schrank gebraucht, und die Bücher mussten im Hinterstübchen einer Drogerie gestapelt werden. Fünfundzwanzig Leser im Jahr fanden dorthin. Durch eine Blinddarmentzündung änderte sich alles. Ruth sprang für die erkrankte Kollegin ein, bemächtigte sich der Bücher, und in Jahresfrist stieg die Zahl der Leser auf vierhundert.
„Na ja“, wirft sie an dieser Stelle ein, „das war keine Hexerei. Saarow wurde damals zum Bad der Werktätigen erklärt, Urlauber kamen scharenweise, und ich bin ihnen mit meinen Büchern nachgerannt …“
Der Bürgermeister bemerkte nichts von ihrer Initiative, die Bücher blieben nicht nur fünftes, sondern zehntes Rad am Wagen. Von 1953 bis 1956 ist sie mit ihrer Bibliothek sechsmal umgezogen, das bedeutet bekanntlich so viel wie zweimal abgebrannt. Schließlich landete sie mit inzwischen eintausendfünfhundert Büchern auf dem Hinterhof der HO Industriewaren. Wer zu den Schätzen der Literatur wollte, musste zuerst über einen holprigen Hof und dabei meist unter aufgehängten Windeln hindurchkriechen.
Eines Tages traf sie im Schreibwarenladen Johannes R. Becher. Sie wusste, dass der Minister für Kultur in Saarow-Strand ein Häuschen hatte. Jetzt oder nie, dachte Ruth und klagte ihm im Telegrammstil ihr Leid. Becher hatte wenig Zeit, aber sie ließ nicht locker. „Also gut, Samstag um achtzehn Uhr erzählen Sie mir alles in Ruhe. Aber pünktlich sein!“ Ruth Spiegel hatte schlaflose Nächte. Wie redet man einen Minister an? Einfach mit Herr Becher? Vor Aufregung stieg sie in den falschen Bus, stürzte wieder raus, lieh sich ein klappriges Fahrrad und kam aufgelöst und keuchend, aber pünktlich bei Becher an, hängte aus Verwirrung ihren Mantel in den Besenschrank. Becher schien ihre Verlegenheit gar nicht zu bemerken. Das köstliche Brathähnchen – seltener Genuss damals – blieb ihr im Halse stecken. Schließlich hatte sie sich gefangen und redete, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Sie zitierte die Forderung ihres Gastgebers nach einer Literaturgesellschaft, und dann, gewissermaßen vor seiner Haustür, dieses Dilemma …
Drei Tage später kreuzten Reporter auf, und kurz darauf erschien im „Sonntag“ eine Glosse, die sich wohl keiner der Verantwortlichen hinter den Spiegel gesteckt haben dürfte.
Lange konnte Ruth nicht im allerhöchsten Rückenwind schweben, Becher starb 1958, und die Räume der Bibliothek waren immer noch zu klein, denn die Anzahl der Bücher stieg ständig – und noch schneller die der Leser.
Anfang der Sechzigerjahre wollte Ruth die frischgebackenen Genossenschaftsbauern in Silberberg mit ihrer fahrbaren Bücherkiste beglücken. Gleichgültig wurde sie auf den sogenannten Kulturraum verwiesen. Bevor sie ihre Bücher auspacken konnte, musste sie erst einen Besen suchen und die Überreste einer offensichtlich stürmisch verlaufenen Versammlung beseitigen. Sie spürte, dass man sie heimlich beobachtete. Endlich wagten sich ein paar Frauen hinein. Wenn sich jemand solche Mühe gibt, kann man ihn ja nicht ganz hängen lassen, nicht wahr? Sie merkten erst viel später, wenn überhaupt, dass sie mit ihrer Entscheidung nicht so sehr der „Bücherfee“, sondern sich selbst einen Gefallen getan hatten.
Man sagt, Ruth fange ihre Leser mit Charme und Lasso ein. Nur einmal ging’s scheinbar schief. Vor Jahren wollte ein Mann von asketischem Aussehen etwas Spannendes, einen Krimi oder in der Art. Vielleicht so ein Nur-Wissenschaftler, der von Politik nichts wissen will, dachte sie und empfahl ihm „Die Abenteuer des Werner Holt“, die damals gerade erschienen waren. Er winkte ab. „Aber Sie sollten es lesen“, ereiferte sie sich, „es betrifft Ihren Jahrgang, es könnte Ihr Leben sein!“ Er wollte trotzdem nicht. Schließlich fand er etwas anderes. Enttäuscht füllte sie die Lesekarte aus. „Ihren Namen bitte?“
„Noll, Dieter“, sagte der Asket.
Nun mussten beide lachen. Noll hatte sich einen Sommer lang an den Scharmützelsee zurückgezogen, um den zweiten Teil des „Werner Holt“ zu schreiben.
Inzwischen ist Bad Saarow-Pieskow nicht nur zu einem beliebten, sondern zu einem ungeheuer beliebten Ort der Erholung geworden. Ich las im Prospekt die beängstigende Zahl von einhundertzwanzigtausend Tagesgästen im Sommer! Ferienheime entstanden, Zeltplätze, Bungalowsiedlungen, nur für die Gemeindebibliothek fand sich noch immer kein zentraler Platz, der geräumig genug gewesen wäre.
Anfang der Siebzigerjahre schien es endlich so, als das Blockhaus rekonstruiert und die Gedenkstätte vorbereitet wurde. Gorki und die Gemeindebücher – wie gut würden sie zusammenpassen! Ruth Spiegel begeisterte den Jugendklub für diese Idee, sie schippten und harkten und brachten das Gelände drum herum in Ordnung. Doch als die Gedenkstätte eingeweiht worden war, blieb für die Bücher nur ein einziger Raum übrig. Da sitzt sie nun wieder vor gestapeltem Wissen und weiß nicht wohin. Aus der Not machte sie eine Tugend und richtete in dem zwölf Kilometer langgestreckten Ort acht Außenstellen ein in Heimen, Bungalowdörfern, auf Zeltplätzen, ja sogar in der Pieskower Poststelle. Und wenn sie kein Auto zur Verfügung hat, klemmt sie sich ihre Bücherkiste aufs Fahrrad. „Bisschen Bewegung schadet gar nichts.“
Sicher nicht. Und doch werde ich den Gedanken nicht los: Gorki oder Becher hätten das Problem mit den Büchern anders gelöst …
Man kann heutzutage nicht von Bad Saarow reden, ohne von Becher zu sprechen. Er ist dort allgegenwärtig: Es gibt einen Johannes-R.-Becher-Platz, der Kulturbund hat einen Johannes-R.-Becher-Klub, in dem mit Unterstützung des Johannes-R.-Becher-Archivs zwei Gedenkzimmer eingerichtet wurden. Sogar die Schulkinder beteiligten sich auf ihre Weise, sie befragten Familie Pahl, die Bechers Segelboot wartete und ihm das Segeln beibrachte.
In kindlicher Handschrift ist festgehalten, wie er anfangs oft im Schilf landete oder moddertriefend bei Frau Altner um Hilfe klingelte … und wie sein Hund Frau Dittmanns Torte gefressen … und wie Becher, obwohl ihm sein Herz zu schaffen machte, früh um fünf aufstand, um zu schwimmen oder zu laufen … und wie ihm auf Waldwegen oder im Boot die besten Gedichte einfielen … Man lächelt, wenn man liest, wie sich die Kinder ihm näherten ohne Scheu; durch seine Schwächen wurde er ihnen erst recht sympathisch. Später irgendwann wird ihnen Bechers wahre Größe aufgehen.
Kaum jemand wagte, ihn anzusprechen, wenn er durch Saarow schritt. Nicht aus Ehrfurcht vor dem Minister, sondern aus Ehrfurcht vor dem Dichter. Vielleicht war ihm gerade eine Verszeile eingefallen, und sie störten ihn dabei …
So, im Schreiten, die Hände in den Taschen vergraben, den Kopf erhoben, einem Gedanken, einer Formulierung nachsinnend, steht er heute in Bronze gegossen an der Schwanenwiese, wo die Dampfer anlegen und sich im Sommer Tausende vergnügt im Wasser tummeln. Nun tummeln sich nur noch die Schwäne. Der See liegt verlassen, „die Segel entglitten, die Sonne verglüht …“ Ich fahre hinaus nach Saarow-Strand, zu Bechers „Traumhaus“. Nüchtern betrachtet ist es ein Flachbau mit drei kleinen Zimmern und einem größeren, das sich zum See hin öffnet. Man kann es besichtigen. Lilli Becher hat es so herrichten lassen, als wäre der Hausherr nur für kurze Zeit verreist; das Geschirr steht noch in der winzigen Küche, die Brille liegt noch auf dem Tisch, nur das Gästebett ist nicht mehr da …
Nirgends ist mir Becher in seinem Anspruch auf Harmonie so nahe gekommen wie hier.
Der Nachbar, ein ehemaliger Förster, gibt geduldig und kenntnisreich Antwort. Man ist gut beraten, vorher „Auf andere Art so große Hoffnung“ zu lesen, denn diese Tagebücher sind hier entstanden. Im Trubel der Ereignisse in Berlin wäre er kaum dazu gekommen: Gründung der DDR, der Akademie der Wissenschaften und der Künste, Pfingsttreffen der deutschen Jugend – alles das spielt dort hinein; auch seine Arbeit mit Hanns Eisler an den „Neuen Deutschen Volksliedern“, von denen nur wenige wirklich wie Volkslieder gesungen werden.
Oft wurde Becher gefragt, warum er seine Kraft nicht voll und ganz der Poesie widme, warum er sich in politischer Tätigkeit verzettele. Er antwortete bekenntnishaft: „Meine politische Tätigkeit ist im Grunde nichts anderes als eine Verteidigung der Poesie. Freilich beinhaltet die Poesie nicht nur die Dichtung als solche, die Poesie ist für mich der Inbegriff … einer sinnvollen, menschenwürdigen Gestaltung des Lebens … Poesie ist das Unendliche-sich-Übersteigern-des-Menschen, und dieses Lebensrecht der menschlichen Kreatur, diese unser aller Lebensnotwendigkeit verteidige ich, indem ich politisch tätig bin.“
Becher versuchte, sich ein Bild zu machen von dem Ort, an dem er nach Jahrzehnten der Ruhelosigkeit, des Kampfes und der Emigration endlich Wurzeln schlagen wollte. So lesen wir zum Beispiel unter dem 21. März 1950: „Kurorte zeigen oft am deutlichsten, was in der Tiefe der Gesellschaft sich verändert hat. Eine neue Schicht von Kurgästen. So sah ich voriges Jahr in einem Luxushotel an der Ostsee Bergarbeiter, und sie benahmen sich schon selbstsicher, selbstverständlich. Schon dafür lohnt sich, gelebt zu haben. – Saarow ist etwas anderes. Hier muffelt es noch bedenklich nach Veraltetem, in Verwesung übergehend. Saarow gibt ein ziemlich umfassendes Bild der deutschen Katastrophe. Sein Aufstieg mit Unterstützung des ausländischen Kapitals, Versuch, ein Berliner Florida zu begründen, Luxushotels, Golfklubs, Segelklubs und alles was dazugehört; Starschauspieler und Boxchampions, Filmregisseure und Tänzerinnen; in der Nazizeit bevorzugt von Partei- und SS-Bonzen …“ Zu diesem „Florida“ der Nazis rund um den Scharmützelsee gehörte das Schlösschen „Klein-Sanssouci“, das einst Leo Slezak gehörte, aber schon 1932 von der SA okkupiert worden war. Robert Ley veranstaltete seine berüchtigten Saufgelage auf einem superprächtigen Hausboot; und in den hinter üppigem Grün versteckten Villen wohnten die Hätschelkinder der Nazis, wie der Bildhauer Thorak, der Monumentalhelden für Stadien und NS-Prunkstraßen lieferte.
Im Kriege wurden dann die Hotels und Pensionen beschlagnahmt, Offiziere von SS und Wehrmacht breiteten sich aus, Stäbe aller Art … Und das alles wälzte sich nun im April fünfundvierzig in panikartiger Flucht westwärts. Viele Landhäuser und Villen standen leer. Was danach passierte, hat mir Herr Peters in seiner Saarower Weinstube erzählt; denn was Becher in seinem Tagebuch nur anklingen lässt, das hat Peters hautnah miterlebt.
Es begann damit, dass Walter Ulbricht angesichts der reizvollen Landschaft, der heilkräftigen Chlorkalziumsolquelle und der leer stehenden Villen verkündete, Bad Saarow-Pieskow müsse auf schnellstem Wege ein Bad der Werktätigen werden. Bald darauf rückten die ersten FDGB-Urlauber an, Leute, die vielleicht noch nie in ihrem Leben in die Ferien gefahren waren. Peters war dafür verantwortlich, dass sie sich wohlfühlten. Alte Saarower und Neusiedler taten, was in ihren Kräften stand, froh über jede Verdienstmöglichkeit, die sich bot. Mit einem Ackerwagen holten sie die Gäste von Fürstenwalde ab, dann wurden sie mit Sack und Pack auf die zwölf Kilometer auseinanderliegenden Quartiere verteilt. Der Förster unternahm mit ihnen Wanderungen, wer wollte, konnte in den zwei Wochen Tango und Foxtrott lernen oder – wieder mit dem Ackerwagen – nach Fürstenwalde ins „Café Wien“ juckeln, um Haferflockentorte und Muckefuck zu genießen. Eines Tages zog Peters einige Säcke ungebrannten Bohnenkaffee an Land, er befand sich auf dem Gipfel der Seligkeit – nur: Wer sollte ihn rösten und ausschenken? „Na, du“, sagten die Funktionäre, „du hast doch Platz genug!“
Er hatte in dem Haus Unterschlupf gefunden, in dem die Töchter des verstorbenen Komponisten Xaver Scharwenka wohnten. Man drückte ihm ein amtliches Papier in die Hand – und so entwickelte sich dann „Peters’ Weinstube“, in der sich inzwischen allerlei Kunst und Kunstgewerbe angesammelt hat: eine Nofretete, Menzels „Flötenkonzert“, sogar eine echte Locke von Franz Liszt. Und wenn Peters gut aufgelegt ist, erzählt er zu jedem Stück eine Geschichte, und der Abend wird nicht lang.
Da ist von der Zirkusreiterin Therese Renz die Rede, für die Kaiser Friedrich III. eine alte Wassermühle zum Schloss ausbauen ließ. Nanu, ausgerechnet der sparsame und moralische Neunundneunzigtagekaiser soll das gewesen sein? Max Schmeling und der Filmstar Anny Ondra lebten hier ohne Aufsehen und Skandale. Ihr zeitweiliger Privatchauffeur war Anton Saefkow. Wussten sie, dass er ein aus dem KZ entlassener Kommunist war, oder wollten sie es nicht wissen? Gustav Fröhlich, Käthe Dorsch und Harry Liedtke wohnten am Ostufer des Sees. Harry Liedtke wurde mit einer Sektflasche erschlagen. Von wem? Und warum? Es gibt viele offene Fragen in dieser Gegend.
Am Dudel, gleich neben Schmeling und Thorak, wohnte Wilhelm Kohlhoff, ein bedeutender Maler der Berliner Sezession, deren Mitglieder von Kaiser Wilhelm dem Letzten verfemt und von den Nazis verfolgt wurden. Kohlhoffs künstlerische Handschrift ist mit der Hans Baluscheks verwandt. Kohlhoffs Frau lebte noch bis 1982 in dem verwunschenen Haus, auch sie war Malerin, aber von außerordentlich exzentrischem Wesen, weshalb ihr Mann sie auch beizeiten verlassen hat. Sie kleidete sich wie eine Zigeunerin, trug bis zuletzt ihre langen Haare offen, malte nicht übel, verkaufte aber kaum etwas, ließ auch keinen ins Atelier, aus Angst, man könnte sie bestehlen. In einem kostbaren Empireschrank hortete sie das Fleisch für ihre zwanzig Katzen. Es stank entsetzlich. Sie lebte vom Wahrsagen, ein Geschäft, das besonders in den Nachkriegsjahren blühte, und sie las aus der Hand. Man erzählt Geschichten von düsteren Prophezeiungen, die auf den Tag genau wirklich eingetroffen sind. Ihren bürgerlichen Namen kennen die wenigsten, aber alle kennen „die Moorhexe“. Merkwürdigerweise schenkte sie einem jungen Studenten namens John Erpenbeck bis zu einem gewissen Grade ihr Vertrauen. – Es stellte sich heraus, dass die „Moorhexe“ nur ein einziges einschlägiges Buch gelesen hatte, alles andere war Menschenkenntnis, genaueste Beobachtungsgabe und – wie sie selber zugab – Brimborium.
Das älteste Gemäuer weit und breit ist zweifellos der Eibenhof. Achthundert Jahre alte Eiben mit rauen, geborstenen Stämmen überragen ihn, sie sind wohl genauso alt wie die Grundmauern der Löschebrandschen Wasserburg, die 1723 zum barocken Herrenhaus umgebaut wurde. Doch mit dem Glück der Besitzer verfiel auch der Eibenhof und bröckelte und bröckelte, bis der Badearzt Doktor Paul Grabley 1922 den kühnen Plan fasste, das heruntergekommene Rittergut als herrschaftliches Sanatorium auszubauen. Er gewann die Großen von Bühne und Film – Olga Tschechowa, Elisabeth Flickenschildt, Will Quadflieg –, und ihnen folgte ein Kometenschweif von Verehrern und Neugierigen. Den Reichen zog Doktor Grabley ungeniert das Geld aus der Tasche, um die Armen unentgeltlich behandeln zu können. Im Krieg wurde der Eibenhof Notkrankenhaus, es war wirklich eine Notlösung. Und Doktor Grabley willigte freudig ein, als Oberst Tulpanow ihm vorschlug, ein Erholungsheim für Kulturschaffende und eine Stätte der Begegnung daraus zu machen. Er bemühte sich, die „neue Prominenz“, die harte Jahre in Gefängnissen und an den Fronten hinter sich hatte, mit kuhwarmer Milch, Kartoffeln und Kohl aus seiner Landwirtschaft aufzupäppeln.
Becher kam öfter vorbei, um mit jungen Autoren, Dramaturgen und Kulturfunktionären zu diskutieren; Alexander Dymschitz arbeitete hier an seinem Buch „unvergesslicher Frühling“, Willy Bredel quälte sich mit dem Szenarium zum Thälmannfilm, und vom Diensdorfer Ufer kamen manchmal Bruno Henschel und Fritz Erpenbeck nach einer gemeinsamen Angeltour angerudert, um bei Grabley Fische zu schnorren, wenn sie mit ihren erregten Disputen die Fische im See verscheucht hatten, aber nicht mit leeren Händen nach Hause kommen wollten.
Erpenbecks waren mit Bechers schon während der Emigration in Moskau freundschaftlich verbunden. Nun richteten sie über den Scharmützelsee eine „direkte Fahrtroute“ ein, von Haus zu Haus. Leider blieb ihnen wenig Zeit, Becher war, wie gesagt, Minister, und Erpenbeck leitete bei Henschel mehrere Zeitschriften; eine davon hätte schon genügt, um den nicht mehr jungen und auch nicht mehr gesunden Mann aufzureiben. Er schrieb Essays, Rezensionen, die heute bereits Theatergeschichte sind, und sozialkritische Kriminalromane, die meist im Künstlermilieu spielen. Er hat dies alles nur bewältigen können, weil es dieses strohgedeckte Refugium hier draußen am See gab und weil ihm in all den Jahren kampferfüllter Mühseligkeit eine treue Gefährtin zur Seite stand: Hedda Zinner.
Ihre „königliche“ Haltung hat manchen zuerst verwirrt, selbst Erich Mühsam war seinerzeit irritiert und redete sie mit Wiener Charme als „Meine gnädige Frau Genossin“ an. Sie amüsiert sich heute noch darüber. Wer den „Teufelskreis“ und die „Ravensbrücker Ballade“ gesehen, „Café Payer“ und die autobiografisch gefärbte Romantrilogie „Ahnen und Erben“ gelesen hat, dem verblasst die „gnädige Frau“, und die Genossin tritt umso deutlicher hervor.
1942, in der härtesten Emigrationszeit, wurde John Erpenbeck geboren. Als Schüler durchstreifte er später in den Ferien die Wälder rund um den Scharmützelsee. Mit vierzehn wusste er schon genau, was er werden wollte: Physiker und Schriftsteller. Die Lehrer lächelten nachsichtig. Aber er machte es wahr. Mit achtzehn schrieb er – in der hintersten Schulbank – ein Libretto zu einer kleinen Spieloper für junge Leute, die tatsächlich im Fernsehen gesendet wurde. Mit fünfunddreißig veröffentlichte er philosophische Abhandlungen über das Phänomen Kunst und ihre Wirkung. Mit vierzig kann er drei Romane vorweisen, und schließlich überraschte er seine Kollegen von der naturwissenschaftlichen Fakultät mit zwei Gedichtbänden, in denen Eichenriesen ihre erfrorenen Wurzelzehen reiben, Rechenautomaten rebellieren, Götter hinken und Chagallsche Liebespaare durch den frühtaubesternten Himmel in den Hörsaal fliegen.
Der Scharmützelsee scheint die Gedanken wahrhaftig zu beflügeln …
Kelten, Karpfen und Kasematten in Peitz
Mit Peitz, das ich nur vom Hörensagen kannte, verband sich für mich dreierlei: Karpfen, Hammerwerk und Festung.
Jeder dritte Karpfen, der bei uns sein Dasein in Weißwein-, Dill- oder Buttersoße beschließt, stammt aus der Gegend um Peitz. In keinem einheimischen Kochbuch fehlt das Rezept „Peitzer Karpfenragout“. Man schneide die Karpfenfilets in drei Zentimeter breite Stücke, würze sie mit Salz, Pfeffer und Lorbeerblatt, streue reichlich frisch gehackte Petersilie oder Dill darüber und lasse das Ganze zugedeckt zwei Stunden marinieren. Danach grob gewürfelte Zwiebeln in Öl goldgelb anschwitzen, ebenfalls grobwürflig geschnittene Senf oder saure Gurken hinzugeben, alles gut durchschwenken, zusammen mit den marinierten Karpfenstücken etwa fünf Minuten dünsten, mit Mehl bestäuben, mit einer Mischung aus Sahne und Sauermilch auffüllen, kurz aufkochen und zugedeckt noch eine Viertelstunde ziehen lassen. Mit frischen Meerrettichspänen garniert anrichten, Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree und grünen Salat dazu reichen.
Die Mischung von scharf und lieblich sowie der obligate Meerrettich verraten schon die Spreewaldnähe.
Ich habe die Peitzer Karpfen besucht, die noch nichts von Dill und Weißwein ahnen und sich in ihrem eigentlichen Element tummeln. Zu Hunderttausenden. Quicklebendig geht’s in den Karpfenkinderstuben zu, den sogenannten Streckteichen. Die andern Teiche, von wildwüchsigen Hecken umsäumt und einzelnen Weiden bewacht, liegen ruhiger da. Nur ab und zu bilden sich auf der Wasseroberfläche rasch größer werdende Kreise, zeigt sich kurz eine dunkle Rückenflosse. Dann ist wieder alles unglaublich still und friedlich. Der ahnungslose Wanderer genießt die sommerliche Idylle und hält nicht für möglich, dass er sich in einer siebenhundert Hektar umfassenden intensiven Produktionsstätte befindet. Er müsste im Dezember wiederkommen, wenn „die reifen Karpfen geerntet“ werden und die Peitzer Fischer – von Kopf bis Fuß in Gummi eingehüllt – Schwerstarbeit verrichten. Doch den verwöhnten Städter würde vermutlich schon beim Zuschauen ein ungemütliches Frösteln befallen.
Am Ortseingang von Peitz lockte ein Wirtshausschild: „Zur Teichschenke“. Nichts wie hinein! Endlich würde ich einen original Peitzer Karpfen frisch aus dem Teich serviert bekommen! Aber denkste! Alles, was ich bekam, war ein abschätziger Blick der Kellnerin. „Es ist Juni, meine Dame“, belehrte sie mich, „und in den Monaten ohne R gibt es keinen Fisch mit R!“ Da hatte ich mein Fett weg und bestellte kleinlaut Wiener Schnitzel.
Am Abend entdeckte ich auf der Speisekarte des Cottbuser Hotels „Lausitz“ gebackene Regenbogenforelle mit gemischtem Salat und Nusskartöffelchen. Wie das? Schließlich war immer noch Juni, und die Regenbogenforelle hat sogar zwei R in ihrem Namen! Die junge Serviererin erklärte mit liebenswürdigem Lächeln, dass die Forellen aus den Kühlwasserreservoirs der großen Kraftwerke kämen. Sie würden – was bei den empfindlichen Fischen niemand für möglich gehalten hätte – in dem klaren, fließenden, aber zwei bis drei Grad wärmeren Wasser schneller wachsen als üblich und bekämen festes, fettarmes, mildaromatisches Fleisch. „Überzeugen Sie sich selbst. Ich wünsche Ihnen guten Appetit!“
Die Forelle wurde früher „Fisch der Könige“ genannt, was Rückschlüsse auf den Preis zulässt. In dieser sprichwörtlich armen Gegend dürfte er damals kaum auf den Tisch gekommen sein. Inzwischen ist er dank rationeller, aber immer noch aufwendiger Intensivhaltung ein durchaus „bürgerlicher“ Fisch geworden, ein Essen für jedermann, wenn auch ein Sonntagsessen.
Karpfen dagegen galten in und um Peitz von jeher als etwas Gewöhnliches, denn es gab sie in Hülle und Fülle. Das hängt – so wunderlich es zunächst klingen mag – mit dem Hammerwerk zusammen. Unmittelbar unter der Grasnarbe der morastigen Wiesen lagerte nämlich Raseneisenerz, das seit dem frühen 16. Jahrhundert abgebaut und im Peitzer Hammer geschmolzen und verarbeitet wurde. Die Franziskanermönche kamen als erste auf die Idee, in den verlassenen, relativ flachen Tagebauen eine Karpfenzucht anzulegen.
So friedlich, wie es sich anhört, war die Gegend aber keineswegs. Der Schein trügt, denn Nieder- und Oberlausitz waren jahrhundertelang Spielball der Mächtigen. Der Kurfürst von Brandenburg erwarb zwar 1448 die Niederlausitz, musste das Gebiet jedoch 1462 an den böhmischen König abtreten. Nur die Herrschaften Cottbus und Peitz blieben als Enklaven in seinem Besitz. Die Brandenburger mussten also in der Niederlausitz immer auf dem Quivive sein, und darum bauten sie 1559 den Peitzer Hammer als Waffenschmiede auf vorgeschobenem Posten aus. Bei der Gelegenheit rissen sie auch gleich das alte Schloss ab und verwendeten die Steine zum Bau einer Festung, die an Umfang und Wehrhaftigkeit mit der in Spandau oder Küstrin vergleichbar war. Das neue Hammerwerk lieferte für die Festung allerlei Werkzeuge und Geräte, vor allem aber Waffen, Mörser und Kanonenkugeln.