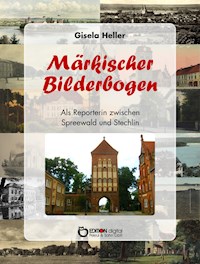10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf eine Reise durch ihr langes und bewegtes Leben lädt die Journalistin, Schriftstellerin und Fontane-Expertin Gisela Heller die Leser mit ihren Erinnerungen ein. Ausführlich, detailreich und lebendig beschreibt die Autorin ihren nicht immer leichten Weg von der Flucht aus ihrer schlesischen Heimat und ihren beruflichen Anfängen in der frühen DDR über ihre journalistische Arbeit für Hörfunk und Fernsehen bis zur näheren Beschäftigung mit einem berühmten Kollegen, der ihr zum hauptsächlichen Arbeitsinhalt und Stützpfeiler für ihr Leben werden sollte – Theodor Fontane. „Kein Schriftsteller ist mir so nah wie Theodor Fontane“, bekennt die Autorin und entdeckt, je mehr und je intensiver sie sich mit ihm beschäftigt, viele Parallelen in ihrer beiden Lebensbögen. „Ich habe ihn mir nicht ausgesucht; er ist mir zugewachsen mit der Zeit.“ Das Buch bietet zudem spannende Inneneinsichten aus der Welt der Medien und Kultur der DDR, der Wende und Nachwendezeit bis zur Gegenwart und präsentiert eine Reihe von Porträts von Politikern, Journalisten- und Künstlerkollegen. Zugleich spart der umfangreiche Text familiäre Freuden und Schwierigkeiten nicht aus und zeigt, wie es der Autorin immer wieder gelang und gelingt, teils schwere Krankheiten, Krisen und Konflikte zu überstehen und sich eine positive Lebenseinstellung zurückzuerobern. Die berührende Autobiografie schließt mit den Worten: „Die Zeit der großen, unerfüllbaren Wünsche ist vorbei; nur einer blieb: Möge ein versonnenes Lächeln das Gesicht derer verklären, die an mich denken … C’est ça …“ Die knapp 700 Seiten umfassenden Memoiren der Journalistin, Schriftstellerin und Fontane-Expertin Gisela Heller erscheinen zum 91. Geburtstag der Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1214
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Gisela Heller
Meine Irrungen, Wirrungen
ISBN 978-3-96521-024-0 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-023-3 (Buch)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta unter Verwendung einer Porträtzeichnung von Harald Kretzschmar
Fotos: Ilona Heidrich
2020 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E-Mail: verlag@edition-digital.de
Internet: http://www.edition-digital.de
„Die Welt ist nun einmal wie sie ist, und die Dinge verlaufen nicht so wie wir wollen, sondern wie die andern wollen.“ Theodor Fontane: „Effi Briest“
Zugegeben, die Szene hätte grotesker nicht sein können: Auf freiem Feld ein dünnwandiges Sommerhaus, um das nasskalter Dezemberwind heult. Drinnen, in der sparsamst möblierten Wohnstube, Hansjochen in der Rolle des jugendlichen Liebhabers, der mit goetheschem Pathos meine verdutzten Eltern um die Hand ihrer Tochter bittet; eine ebenso überraschte „Braut“ und deren kleine, etwas schulschnabberige Schwester Henny. Niemand wusste, was da eigentlich gespielt wurde: Komödie, Tragödie oder Farce. Immerhin, vor Tagen sah es eher nach Tragödie aus. Ich lag apathisch mit Nervenfieber und unerklärbaren Blutungen auf dem ausgebeulten Seegrassofa meiner Eltern und wusste nicht ein noch aus. Die so sicher erschienenen Kulissen meiner Welt waren zusammengefallen. Die vergangenen Wochen und Monate lasteten wie ein Albtraum auf meiner Seele und der Mund versiegelt. Papa und Mama wagten nicht, Fragen zu stellen, doch sie ahnten Schlimmes.
Da war nun, wie der Deus ex machina in der Griechischen Tragödie, Hansjochen, mein fideler Reporterkollege vom Landessender Weimar, hereingeschneit und hatte alles durcheinandergewirbelt, mit Turbogeschwindigkeit, denn er musste, um wieder heimzukommen, einen der wenigen Züge erreichen, die auf dem kleinen Bahnhof hielten. Schließlich konnte man ihn ja nicht auf dem Küchenstuhl übernachten lassen. Papa hatte ihn bis zum Gartentor begleitet, wir schauten ihm hinter der Gardine nach. Er machte noch einen bühnenreifen Kratzfuß in unsere Richtung und hüpfte dann vergnügt auf einem Bein durch Himmel und Hölle, die Henny als Hopsekästel in den Sandweg gezeichnet hatte. Mama schüttelte ungläubig den Kopf, wusste nicht, was sie von alledem halten sollte. „Vater, nun sag du doch mal was!“, drängte sie ihren Mann, der immer und in allen Lebenslagen Rat wusste. Papa verzog die Mundwinkel: „Komödiant!“, sagte er in gewohnt lakonischer Kürze. Hansjochen war wirklich Schauspieler, leider nur für anderthalb Spielzeiten, dann hatte er, contre cœur, in den Krieg ziehen müssen, wo er nach vier Jahren an der Westfront 1945 – Ironie des Schicksals – in sowjetische Gefangenschaft geriet, aus der er erst im Juni 1949 heimkehrte; mit ungeheurer Daseinsfreude und dem Vorsatz, acht vorenthaltene Jahre vehement nachzuholen. Daher vielleicht die Eile, der überstürzte Heiratsantrag …
„Sag bloß, du willst den hässlichen, alten Vogel wirklich heiraten!“, trompetete meine kleine Schwester. „Lustig isser ja, aber Brille, Sommersprossen und rote Haare! Den kannste als Vogelscheuche in den Kirschbaum stellen, aber doch nicht heiraten!“ „Henriette!“, warnte Mama. So wurde sie nur genannt, wenn „Achtung!“ geboten war. „Na ja, is doch wahr! – Warum heiratest du nicht Siegi, der is viiiel hübscher, und immer so schnieke angezogen!“
Es war bei uns nicht üblich, dass sich Kinder in Familienangelegenheiten einmischten, noch dazu in so despektierlichem Ton. Darum wurde sie zur Strafe und Belehrung ins Bett geschickt. Kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, konnte Mama nicht mehr an sich halten: „Hast du dir das wirklich überlegt? Du kennst Hansjochen doch kaum. Ehrlich gesagt, wenn du schon heiraten willst, was ja eigentlich nie zur Debatte stand, warum nicht Eberhard?“ Ebi war der schlaksige Sohn meiner „möblierten Wirtin“, Alleinerbe der väterlichen Firma „Lebensmittel en gros“. Was Besseres hätte mir nicht passieren können in den Hungerjahren, in denen ein halbes Butterbrötchen schon als Delikatesse galt. Von seinen „Dienstreisen“ brachte er mir manchmal Cadbury-Schokolade mit, ein Hauch der großen, weiten Welt. Ebi war zweifellos das, was man landläufig „eine gute Partie“ nannte, auch liebenswert, aber leider totsterbenslangweilig.
„Und Siegi?“ Darüber wollte ich nicht sprechen. Vor allem: Darüber durfte ich nicht sprechen. Dann lieber über Hansjochen. Seit dem Sommer war ich mehrere Tage mit ihm im Übertragungswagen durch halb Thüringen gefahren. Es war die lustigste Zeit meines Lebens. Als jüngste Reporterin des MDR-Schulfunks hatte man mich ausgeschickt, um von den Kindern zu berichten, die aus den Zwergschulen entlegener Gebirgsdörfer in Zentralschulen gefahren wurden, um dort eine ordentliche Ausbildung zu bekommen. Dies geschah, – Symbol einer neuen Zeit! – meist in requirierten Schlössern oder Herrenhäusern, in denen sie oft auch die ganze Woche über wohnen konnten. Als besonders leuchtendes Beispiel nannte man mir einen kleinen Ort im südlichsten Zipfel Thüringens. Dafür jedoch zwei Tage lang einen der wenigen Ü-Wagen abzustellen, fanden sie uneffektiv, ich sollte mich bei den Kollegen vom Landessender Weimar einklinken. Es passte mir überhaupt nicht; aber man schlug mir den schönen und oft missbrauchten Satz von der „Einsicht in die Notwendigkeit“ um die Ohren und so saß ich eines Morgens in der Veranda des Bahnhofshotels in Weimar und löffelte mein Vier-Minuten-Frühstücksei, als eine sehr ausgeschlafene Stimme hinter mir einen wunderschönen guten Morgen wünschte. „Landessender Weimar. Hansjochen Heller. Wir werden also zwei Tage miteinander das Vergnügen haben!“ Das klang verdammt nach „kam, sah und siegte“. Ich dachte hoppla!, schaute demonstrativ auf meine Uhr und meinte: „9 Uhr 15! Waren wir nicht um 9 Uhr verabredet? Pünktlichkeit ist eine Zier!“ „Ich weiß, meine Gnädigste, und die Höflichkeit der Könige, aber ich bleibe lieber bürgerlich. Und wie ich sehe“ – er schielte betont auf mein halb ausgelöffeltes Frühstücksei, – „haben wir schon einen gemeinsamen Grundsatz!“ „Frechdachs!“ Aber ich zahlte mit gleicher Münze heim: „Sie sind wohl der Tölpel-Hans aus dem Märchen, der auf jede Frage eine Antwort wusste?!“ „Genau der bin ich und der am Ende die Prinzessin bekam!“… Ich gab mich lachend geschlagen: „1:0 für Weimar!“ Tölpel-Hans schwang sich, wie gewohnt, vorn auf den Beifahrersitz und ich musste im abgeschlossenen hinteren Teil des Ü-Wagens das unbequeme harte Bänkchen mit dem Ton-Ingenieur teilen. „Sie müssen es nicht tragisch nehmen“, versuchte er, seinen Kollegen in Schutz zu nehmen, „aber er ist erst vor Kurzem aus sowjetischer Gefangenschaft gekommen und noch nicht so ganz im zivilen Leben eingerastet. Vielleicht ist er auch nur zu schüchtern einer jungen und hübschen Dame gegenüber, immerhin gab es für ihn vier, streng genommen acht Jahre lang keine Gelegenheit …“ Möglicherweise hatten die beiden vorn in der Fahrerkabine mitgehört, jedenfalls hielt der Wagen plötzlich an, Hans Heller riss die Tür auf und sagte leichthin: „Ich glaube, wir sollten jetzt mal die Plätze tauschen!“ Ich zwinkerte dem netten Ton-Ingenieur zu: „Hat seine gute Kinderstube doch nicht ganz vergessen!“ Irgendwann setzten wir ihn in einem der großen Volkseigenen Betriebe ab und fuhren weiter zu der vorbildlichen Zentralschule, an die ich mich nicht mehr erinnere.
Zeitlich fühlte ich mich gehetzt, denn der Ü-Wagen durfte nicht zu spät zum Werk zurückkommen. Hansjochen hatte dort schon alles vorbereitet und ich konnte im Wagen mithören, wie er seine Interviews anging: sehr unkonventionell! Wenn ihm jemand im gestelzten Parteijargon antwortete, unterbrach er ihn mit einem Scherz und meinte, ob er das Ganze nicht mal „für einen Dummen zum Mitschreiben“ wiederholen könne. Und siehe da, der Herr räusperte sich zwar etwas konsterniert, redete dann aber plötzlich wie ein normaler Mensch. Ich war fasziniert und dachte, als Reporter-Greenhorn könne ich sicher eine Menge von ihm lernen, fragte ihn, wie er sich auf seine Gespräche vorbereite. Er lachte: „Überhaupt nicht. Ich bluffe. Der Sender schickt mich in einen bestimmten Betrieb und will, dass mir die Leute dort das und das sagen. Ich merke aber, die haben ganz andere Probleme. Was mache ich? Ich gehe nicht, wie üblich, zum Direktor oder Parteisekretär, sondern in die Pinkelbude. Und wenn ich dann mit vier oder fünf anderen so stehe und ,diesen’ mache, dann höre ich, welche Läuse denen über die Leber laufen. Auf dem Klo sind nämlich alle Menschen gleich und da kennen sie auch keine Hemmungen. Also weiß ich, wenn ich in der Direktion ankomme, wo es im Betrieb Ärger gibt. Die Großkopfeten in der Chefetage denken dann aufgeschreckt: ‚Oh, woher hat er diese internen Informationen? Dem können wir schlecht erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt’, und so kommen sie ziemlich schnell zur Sache. Leider bringe ich dann oft Geschichten aus dem wahren Leben mit, die im Sender keiner hören will und die dann jemand ‚bearbeiten’ muss, damit sie ins Schema passen. Aber das juckt mich nicht.“ Langsam begann ich, ihn ernst zu nehmen „Bei wem haben Sie das gelernt?“ „Überhaupt nicht. Ich bin ein Narr aus eigner Hand, wie es bei Goethe heißt und eigentlich Schauspieler, aber seit acht Jahren raus aus dem Metier und als ich im Juni aus Gorki an der Wolga hier ankam, hatten die Theater für die Spielzeit schon abgeschlossen und die Partei schickte mich zum Landessender. Dort sagte man mir: ‚He, du kennst dich doch aus mit Arbeitsbrigaden und solchen Sachen, das ist für uns Neuland, da könntest du doch aus deinem reichen Wissen schöpfen und Wirtschaftsreporter werden!’ (So reden sie immer mit einem, wenn sie einen Dummen suchen!) Und so sehen Sie nun nicht den Komiker, sondern den ‚Wirtschaftsexperten’ Heller vor sich!“ Ich lachte: „Aber der Komiker grient trotzdem aus allen Knopflöchern!“ Und ernster: „Sie waren wirklich in Gorki an der Wolga?“ Ich erzählte ihm, dass ich Gorkis ,Kindheit’ für den Schulfunk bearbeitet hatte. „Existiert denn Krassno Sormowo noch?“ „Als wir 1946 dort ankamen, existierte es noch. Dann wurde es ratzekahl abgerissen und planiert. Mit uns haben sie dann was Neues hin gebaut: vier Stockwerke, Bad und Müllschlucker. Nullachtfuffzehn, aber für Krassno Sormowo schon bonfazionös! Leider wurden wohl dabei ein paar Bauzeichnungen verbummfiedelt, jedenfalls merkten sie an dem Tag, als die Gerüste fielen, dass man die Treppen vergessen hatte.“ „Wie ist denn so was möglich?!“ „Och, in der Großen Sozialistischen Sowjetunion ist alles möglich!“ „Aber haben Sie das nicht vorher bemerkt?“ „Natürlich, aber es war für uns so eine schöne, bequeme Baustelle, gleich neben dem Lager und es gab Bauarbeiterverpflegung. Da konnte es uns doch nur recht sein, ein paar Monate länger dort zu werkeln.“ Ich schüttelte ungläubig den Kopf: „Und wie sind die Leute schließlich in ihre Wohnungen gekommen, ohne Treppen?!“ „Man hat sie außen angebaut. Russen wissen sich immer zu helfen. Nur so haben sie schließlich auch den Krieg gewonnen.“
Jeder Mann wird gesprächig, wenn es um Krieg und Gefangenschaft geht. Da bildete Hansjochen keine Ausnahme. Das heißt vom Krieg, den er als Jahrgang 21 fast von Anfang an mitgemacht hatte, erzählte er kaum, umso ausgiebiger von den vier Jahren an der Wolga. „Mein Herz habe ich nicht gerade da gelassen, nur meine Vorderzähne.“ „Wie das?“ „Ja, die liegen noch in Moskau, in der Lubljanka. Sie wollten mir unbedingt anhängen, dass ich in der und der Fallschirmjägerdivision war, die sich an der Ostfront gegenüber der Zivilbevölkerung ziemlich schäbig benommen hatte. Ich war Fallschirmjäger, aber nie an der Ostfront, immer nur im Westen. Ich hatte zwar nach einer Verwundung im März 45 (!) Marschbefehl zu besagter Division, kam aber nie dort an. Bis ich ihnen das allerdings beweisen konnte, sind mir leider“, er griff sich blitzschnell in den Mund und brabbelte zahnlos weiter, „die Vorderzähne abhanden gekommen.“ Schwupp, saß der „Ersatz“ wieder da, wo er hingehörte. Er schien sich über alles lustig zu machen, vor allem über sich selbst. Ich schaute ihn an wie ein fremdes Tier: Vier Jahre hinter Stacheldraht! dachte ich. Was hatte ich alles in diesen vier Jahren erlebt: Mädchenschule, Ernteeinsatz, Flucht, Hungerjahre, irgendeinen Schulabschluss, Studium an der Buchhändler-Lehranstalt, Schwarzhörer an der Uni, Volontariat beim Rundfunk, Hals über Kopf ins Leben, während er … Er schien meine Gedanken zu lesen: „Sie brauchen mich nicht zu bedauern, wir haben in dieser Zeit auch gelebt, malocht, ja, aber auch musiziert, Witze gerissen, Theater gespielt: ‚Kabale und Liebe’, ,Land des Lächelns’, ‚Bohème’ – wie eiskalt ist dies Händchen … Die Mimi natürlich ein Mann in Frauenkleidern; wir waren ja nur Männer und hatten das Glück, dass kurz vor Toresschluss, im März 45 noch ein halbes Radio-Unterhaltungsorchester in Gefangenschaft geraten war, die schrieben wie die Weltmeister Noten aus dem Gedächtnis auf und wir Schauspieler stoppelten die Texte zusammen. Die erste Fiedel baute jemand aus einer Zigarrenkiste! Das beeindruckte den sowjetischen Kulturoffizier derart, dass er mit einigen von uns in die Stadt marschierte, um Instrumente und Notenpapier aufzutreiben. Er hatte ein detektivisches Gespür für solche Sachen. In einem verstaubten Buchladen fanden wir sogar ‚Die Räuber’ in deutscher Sprache! Das war 1947. Da glaubten wir noch, Weihnachten zu Hause zu sein. Als klar wurde, dass es wohl länger dauern würde, rief mich der Lagerkommandant und sagte: ‚Also, Towarischtsch Gälläär’ (die Russen können alles, nur kein ,h’ aussprechen!), ich mache Sie dafür verantwortlich, dass mir keiner von den 6 000 Männern die Nerven verliert und gegen den Stacheldraht rennt. Lassen Sie sich etwas einfallen!’ Das waren die ,Bunten Abende’. Ja. Der hatte mich so lieb, dass er mich gar nicht fortlassen wollte. Alle anderen fuhren nach und nach in die Heimat, ich durfte das Licht ausmachen. Meine Eltern hatten gar nicht mehr mit mir gerechnet. Und manchmal denk ich, ich bin immer noch nicht wirklich angekommen.“
Das war der erste ernsthafte Satz, den ich von ihm hörte. Und er machte mich nachdenklich. Konnte man mir’s verdenken, dass ich fortan „Musterbeispiele der Volksbildung“ suchte, bei denen ich mit dem Landessender Weimar kooperieren musste? Die „Goethe-Festtage der Deutschen Nation“ boten glanzvolle Gelegenheit. Man feierte den 200. Geburtstag des Dichterfürsten – auf sehr unterschiedliche Weise. Frankfurt am Main reklamierte Goethe als Galionsfigur der druckfrischen Bundesrepublik Deutschland, Weimar hielt dagegen, dass Goethe seine geniale Komplexität ja eigentlich erst in Weimar hatte entfalten können. Es gab hier wie dort ein ebenso erbittertes wie lächerliches Tauziehen, wem er nun „gehören“ sollte. Jedenfalls strömte alles herbei, was Rang und Namen hatte oder auch nur an der Seite der erwarteten Zelebritäten in der Wochenschau erscheinen wollte. Alle Hotels der Stadt und die wenigen kleinen Pensionen bis unter die Dachsparren ausgebucht. Man munkelte, kein Geringerer als Thomas Mann würde die Rede halten. Als kleiner Treppenterrier des Journalismus wäre ich natürlich offiziell nie zugelassen worden, es gab aber in dem ganzen Trubel einen „Tag für die Schuljugend“. Darauf setzte ich meine Hoffnung. Und ich durfte fahren. Um Unterbringung musste ich mich selber kümmern. „Kein Problem!“, frohlockte Hansjochen, „Meine Eltern haben eine 7-Zimmer-Wohnung an der Allee nach Tiefurt, zwei Zimmer sind zwar zwangsvermietet, aber die Mädchenkammer, großspurig ‚Gästezimmer’ genannt, steht leer und die alten Herrschaften werden sich über etwas Abwechslung in ihrem langweiligen Rentnerleben gewiss freuen.“
Ich kam in eine mir unbekannte Welt. Nicht die Weiträumigkeit der Wohnung mit der wundervolle Aussicht auf die Ilm beeindruckte mich, sondern eher das geistige Klima: Der Hausherr, ein mürrischer alter Mann, der mit dem Leben haderte, Dr. phil. und Dr. rer. nat., klärte mich zunächst auf über den elementaren Unterschied zwischen einem Weimarer und einem Weimeraner. „Weimarer kann jeder zugereiste Krethi und Plethi werden, Weimeraner jedoch wird man nur durch Geburt. Wer aber im Dunstkreis von Goethe, Herder und Wieland aufgewachsen ist, der stellt a priori etwas Besonderes dar.“ Die Dame des Hauses, deren einstige Schönheit sich noch ahnen ließ, fügte stolz hinzu, sie habe sogar noch den Hofknicks gelernt. Sprang mit einer Geschwindigkeit auf, die ich der Wohlbeleibten gar nicht zugetraut hätte, und verrenkte die Beine recht seltsam, wobei sie sich vorsichtshalber an der Tischkante festhielt. Hansjochen stand im Nebenzimmer, hinter ihrem Rücken, und ahmte sie pantomimisch nach. Ich bemühte mich, ernst zu bleiben. „Sie haben noch den Großherzog gesehen?“, fragte ich neugierig. „Aber ja, mein Vater verwaltete als Rendant die großherzoglichen Finanzen.“ Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Großherzöge existierten für mich, wie Könige, nur noch im Märchen. Das letzte Mal war sie 1918 „bei Hofe“ gewesen, als junge Frau, mit achtunddreißig … Moment mal, rechnete ich nach: junge Frau, mit 38? Demnach muss sie 40 oder 41 gewesen sein, als Hansjochen geboren wurde. Sie hätte meine Oma sein können. Aber Damen werden wohl keine Oma. Noch ehe sie weiter von alten Glanzzeiten schwärmen konnte, nahm der Hausherr den Faden wieder auf: „Unsere Großherzöge waren für ihre Knauserigkeit bekannt. Ihnen zu dienen galt als Ehre, und mit dieser Ehre musste man sich zufriedengeben. Selbst Schiller hat das schmerzlich zu spüren bekommen, darum ist er ja auch nach Jena gegangen, wo ich, nebenbei bemerkt, auch studiert habe.“
„Aber Goethe wurde doch hofiert?“ „Ja, Goethe! Goethe war das Aushängeschild und vielseitig verwendbar. Alle andern wurden kurz gehalten. Auch mein Vater musste sparsam wirtschaften, denn er hatte vier Söhne und alle haben studiert. Damals hatten die Menschen noch Grundsätze, die ich bis heute akzeptiere. Einer davon heißt: ‚Wohne über deinem Stande, auch wenn du unter deinem Stande essen musst!’“ Ich schaute ihn wohl etwas zweifelnd an, jedenfalls fuhr er fort: „In der heutigen Zeit, da alles aus den Fugen geraten ist, kann man allerdings nicht leicht eine geeignete Wohnung finden. Schon die Lage ist entscheidend. Und die Treppen dürfen nicht zu schmal, die Stufen nicht zu hoch sein …“
Ich dachte an unsere Flüchtlingsbehausungen, an Fräulein Lehmanns Hühnerstiege oder an den Taubenschlag, in dem wir zeitweise mit fünf Personen kampierten. Vergebliche Liebesmüh’, diesem Bilderbuch-Bourgeois davon zu erzählen. Stattdessen bemühte ich mich, etwas Nettes zu sagen: „Ihre Wohnung ist doch wunderschön …!“ „Ja, da haben Sie wohl Recht“, bekräftigte er, „und ich bin willens, sie gegen alle Repressalien der Behörden zu verteidigen!“ Sein Nussknacker-Gesicht verzerrte sich zu einer martialischen Grimasse, was mich zum Lachen reizte; und als ich dann noch Hansjochen sah, der hinter Vaters Rücken genauso martialisch, Schmachtlocke in die Stirn, Hand aufs Herz, Napoleon markierte, war’s mit meiner Beherrschung vorbei. Welche Laune des Schicksals hatte wohl diesem Ehepaar einen so heiteren Sohn geschenkt!
Im „Gästezimmer“ entschuldigte sich Hansjochens Mutter, dass sie mir nur Wolldecken überziehen könne, die seidenen Daunendecken, die sie vor den Bomben ausgelagert hatten, seien in den Nachkriegswirren geplündert worden. „Wohl dem, der noch Wolldecken hat!“, erwiderte ich ehrlichen Herzens, „meine Seidensteppdecke ist mir noch in Breslau beim Sturm auf den letzten Zug zertrampelt worden.“ – „Ach, Sie sind Flüchtling?“, fragte sie – überflüssigerweise. „Ja.“ „Ach …“ – Das konnte alles oder nichts bedeuten. Ich glaube, eher letzteres. Jedenfalls kamen wir nicht wieder darauf zu sprechen.
Als die alten Herrschaften untrüglich zur Ruhe gegangen waren, hörte ich die Dielen im Esszimmer knarren und Hansjochen legte sich zu mir. Ganz selbstverständlich. Wir erzählten noch lange Dönekens aus unserm Leben, als wäre es nur eine einzige Kette lustiger Begebenheiten gewesen. Mit der Zeit gewöhnten sich unsere Körper aneinander. Als ich wieder alleine lag, musste ich lächeln: Er war halt ein Komiker, der seine Unbeholfenheit in Liebesdingen wunderbar überspielen konnte; die Rolle des Liebhabers war ihm allerdings nicht auf den Leib geschrieben …Gelobt sei der alte Goethe!
Thomas Mann bekam ich zwar nicht zu Gesicht, doch die jungen Menschen, die man aus den entlegensten Dörfern zu „Faust“ ins hehre Nationaltheater gekarrt hatte, waren ehrlich begeistert. Und so brachte ich eine gelungene Schulfunk-Sendung nach Leipzig.
* * * *
Mitternacht rückte näher und ich erzählte noch immer; wie Scheherazade getrieben von der Angst: Wenn ich aufhöre, bin ich verloren. Ich wollte die Frage hinausschieben, die meinen Eltern auf den Nägeln brannte: Was ist passiert in all den Wochen, was hat dich so aus der Balance gebracht? Eine allzu berechtigte Frage, die ich nicht beantworten durfte. Ich hatte es unterschrieben. Ich fühlte, wie die Spannung sich immer stärker aufbaute, wie das Grummeln eines Vulkans kurz vor dem Ausbruch, und ergriff plötzlich Mamas Hand, presste sie an meine heiße Stirn und begann zu weinen. Solche Gefühlsausbrüche waren in unserer Familie tabu, jedenfalls hatte ich dergleichen nie erlebt. Wir waren hilflos. Alle drei. Papa begriff als Erster die Lage: „Ich habe auch einmal unterschrieben zu schweigen“, sagte er, „am 30. März 1933. Man hat uns, die wir nicht laut genug Heil! schrien, für ein paar Wochen eingesperrt, verprügelt und gedroht, das nächste Mal würden wir nicht mehr so billig davonkommen.“ Das Geständnis verblüffte mich. Er hatte wirklich geschwiegen, selbst als Hitler längst tot und nichts mehr zu befürchten war. – Ich würde das nicht schaffen. Ich musste reden, wenigstens zu den allernächsten Lieben. „Die Katholiken haben nicht umsonst den Beichtstuhl erfunden“, meinte er, „als Schuljunge in Glatz hab ich beobachtet, wie bedrückt da mancher hineinging – und wie aufrecht und erleichtert wieder heraus …“ Ich kannte keine Katholiken, aber das mit dem Beichten leuchtete mir ein. Vater hatte mir eine Goldene Brücke gebaut. Es brachen alle angstvoll aufgetürmten Dämme und der Redefluss spülte Angst und Bedrängnis von meinem Herzen.
Sie ahnten, dass alles mit Siegi zusammenhing, dem Schönen, dem Romantiker, dem die Damen aller Jahrgänge und auch gewisse Männer begehrlich nachschauten, der Heinrich Heines „Buch der Lieder“ auswendig kannte, selber Gedichte schrieb und in einem Kraftakt die Ostersendung des „Filmspiegels“ rettete, als dessen Leiter drei Tage zuvor nach dem Westen abgehauen war. Das hatte Siegis Stellenwert beim MDR ungemein gehoben. Er war ein Schwärmer, – und wiederum auch nicht. Ich wollte es nicht wahrhaben, als Vater damals meinen verliebten Höhenflug mit einem einzigen Satz dämpfte: „Der ist zu schön, um wahr zu sein.“ „Unverbesserliche Unke!“, dachte ich damals. Mein Adonis ging in einer Zeit, da „Aus-zwei-Alten-mach-ein-Neues“ Mode war, stets comme il faut gekleidet mit Anzug, Hemd, Krawatte und blanken Schuhen. Ich erfreute mich daran und fragte nicht nach dem Woher. Als wir uns näher kannten und unter einem Dache wohnten, nahm er mich manchmal mit in Gesellschaften, die mir wie fremde Welten erschienen. So wurden wir bei einer uralten adligen Russin eingeladen, wo man die Geister der Toten beschwor. Ein andermal bei einem Globetrotter, der im Kriege in Tokio lebte und von dem man nicht wusste, für welche Seite er spionierte.
(Spätestens bei dieser Geschichte bemerkte ich das unruhige Flackern in Mamas Augen. Ihr war das Ganze höchst unheimlich und ich verzichtete darauf, von der selbst mir abenteuerlich und bizarr erschienenen Reise nach Westberlin zu erzählen.)
Von Ost nach West zu kommen, war damals noch kein Problem, obwohl der Kalte Krieg wieder mal auf einem Höhepunkt stand. Die Russen hatten auf Provokationen der westlichen Alliierten reagiert und im Sommer 1948 kurzerhand Westberlin als Faustpfand abgeriegelt. Das traf 1,2 Millionen Westberliner hart, weil alles Lebensnotwendige eingeflogen werden musste. Eine kolossale logistische Leistung, die uns in Leipzig allerdings kaum beeindruckte. Bei uns hieß es: Erst haben sie Phosphor- und Brandbomben auf die Stadt regnen lassen, warum nicht mal zur Abwechslung Rosinen. Wir sahen darin durchaus keinen Akt reiner Menschenliebe. Westberlin war für uns lediglich „das Dorado der Geheimdienste aller Länder“, der „Pfahl im Fleische des kommunistischen Lagers“. Mir wollte nicht einleuchten, warum Siegi ausgerechnet dorthin fahren wollte, doch er behauptete, es wäre für ihn lebenswichtig. Er sei vor einiger Zeit mit einer Dame in Thüringen einen Vertrag eingegangen, den er für seinen Teil erfüllt habe und den er jetzt auflösen wolle. Mein erster Gedanke war: Eifersucht: Was für eine ominöse Dame? Was für ein Vertrag? Er wich aus. Es wäre rein geschäftlich und die Tatsache, dass er mich mitnähme, beweise doch, dass es keinen Grund zu Eifersucht gebe.
Es dunkelte schon, als wir die spärlich beleuchtete einstige Prachtstraße erreichten. Die ehemals glanzvolle Bummelmeile glich einem Gebiss mit vielen fehlenden und faulenden Zähnen. Allerdings wurde unser Blick abgelenkt von den Auslagen zahlreicher Läden und Lädchen, die sich nach der Währungsreform innerhalb weniger Wochen etabliert hatten. Dazwischen, in den brandigen Lücken, behaupteten sich kühn-optimistische Budenbesitzer mit allerlei Krimskrams. Ich hatte mir Westberlin so gut wie ausgestorben vorgestellt, doch es wuselte wie in einem Ameisenhaufen. Jeder war auf der Suche nach etwas Essbarem, das er, sobald Strom da war, in den Kochtopf werfen konnte. Viele hatten sich auf ihre Kanonenöfen aus Kriegszeiten besonnen, die fraßen unglaublich viel Holz. Tiergarten und Grunewald waren demzufolge wie leer gefegt.
Siegis Adresse in einer der ehemals vornehmen Seitenstraßen des Kurfürstendamms schien von Bomben verschont geblieben. Äußerlich wenigstens. Doch ein Blindgänger hatte die gläserne Kuppel des feudalen Treppenhauses durchschlagen und war im Keller steckengeblieben. Im Funzellicht einer Karbidlampe tasteten wir uns nach oben. Das Geländer rechter Hand fehlte, nur der Rest einer dicken, roten Kordel baumelte, dahinter gähnte, zwei Stockwerke tief, der Abgrund. Die Dame bewohnte die Beletage. Mit dem Schritt über die Türschwelle waren wir plötzlich in einem ganz anderen Film: UFA-Film mit exotischen Touch. Überall Kerzen, die flackerndes Licht und betörenden Duft verbreiteten; überall Sitzpolster aus Samt oder Leder. Auf eine Récamiere hingestreckt, ruhte die Dame des Hauses. Sie schien pikiert, weil Siegi nicht allein gekommen war, überspielte das aber, bot uns allerlei Knabbereien und Ceylon-Tee aus einer Thermoskanne an, entschuldigte sich für die ‚Stilwidrigkeit’, aber „was soll man machen in diesen Zeiten …“ Die Konversation schlich mühsam dahin, ich spürte, dass ich störte, schützte Müdigkeit vor und wurde erleichtert in die Dienstbotenkoje abgeschoben. In der Nacht erfasste mich ein menschliches Rühren. Wo in dieser riesigen Wohnung mochte die Toilette sein? Im Dunkeln tastete ich mich durch den Flur. Hinter einer Tür vernahm ich Musik und gedämpfte Stimmen, öffnete einen winzigen Spalt. Betäubende Düfte schlugen mir entgegen und ich blickte – in eine Märchenszene aus Tausendundeiner Nacht! Die Herrin rekelte sich auf einem ausladend-einladenden Lotterbett (so stellte ich mir die Königin von Saba vor!), kitzelte mit ihrem Fächer gnädig den Nacken eines Sklaven, der sich über ihr zierliches Füßchen beugte. Daneben zwei weitere bemühte Herren in buntseidenen Morgenröcken; und Siegi, mein Siegi!, bot ihr gerade aus goldenem Etui eine lange, schmale Zigarette an. – Ich hätte das lächerlich gefunden, wäre nur Siegi nicht dabei gewesen …
Unbemerkt zog ich mich in meine Koje zurück und konnte nicht wieder einschlafen. Nach „Aufhebung eines Vertrages“ sah das nicht aus! Wer war diese Messalina und wozu hatte sich Siegi verpflichtet? Je eindringlicher ich ihn danach fragte, desto abweisender reagierte er. Wenige Wochen später erklärte er, wir müssten uns für eine Zeit trennen, um dann für immer zusammenzuleben. Ich traute dem Frieden nicht, zog aus und fand in dem einzigen Haus, das auf dem weiten Areal zwischen Güterbahnhof und Funkhaus von Bomben verschont geblieben war, eine liebevolle „Schlummermutter“, die in mir eine angehende Partie für ihren extrem schüchternen Kronsohn sah.
Es begann die Zeit, von der Mama annahm, ich hätte das Glück gepachtet. Im Schulfunk dramatisierte ich russische Märchen, in der Jugendgruppe brachte ich mich wieder voll ein, nahm Schauspielunterricht, lernte Russisch, hörte schwarz an der Uni, probierte mich im Schülerfunk als Reporter aus – wobei ich den verrückt-kauzigen Kollegen aus Weimar kennenlernte, – kurz, ich war in meinem Element. Und – großes Aufatmen! – kurz vor meinem Ostsee-Urlaub verkündete mir Siegi, seine „Sache“ habe sich nun geklärt und er würde bald nachkommen.
Ich wartete vergebens. Siegi kam nicht, und als ich, schwankend zwischen Sehnsucht und Enttäuschung, nach Leipzig zurückkehrte, war er auch dort nicht. Niemand wusste etwas über seinen Verbleib. Da zu diesem Zeitpunkt etliche von Schmidt-Wieland gut ausgebildete Sprecher zum neugegründeten Sender Freies Berlin gewechselt waren, lag nahe, dass auch er diesen Weg genommen hatte. Den „Weg ins neue Leben“, – ohne mich.
Ich stürzte mich in die Arbeit, versuchte, Schülern der 6. und 7. Klasse Gorki nahezubringen. Aus seiner „Kindheit“ suchte ich die Kapitel heraus, in denen sie sich mit ihm identifizieren konnten, Passagen, wo der arme, getretene und zudem noch hässliche Maxim jede Möglichkeit nutzt, um zu lernen; nicht, um andere aufs Kreuz zu legen, sondern um ihnen klarzumachen, dass er ein Mensch ist und nur wie ein Mensch existieren kann, wenn er anderen hilft, anderen und damit sich selbst. Ähnliches las ich bei Andersen Nexö. Beide waren für mich wie große Brüder. Um jeden Preis wollte ich ihnen nacheifern. Wie auf den Leib geschrieben schien mir der Satz: „Wenn man gezwungen ist, sein Wissen aus tausend Erinnerungen des Lebens zusammenzuklauben, so heißt das, so aktiv wie möglich zu ein.“
Mein Redaktionsleiter Dr. Sachse, Humanist reinsten Wassers, belächelte wohl manchmal meinen missionarischen Eifer: „Es ist die schönste aller Täuschungen, dass der Mensch in seiner Jugend sein Ziel so nahe glaubt. Hölderlin. Hyperion….“ „Bei aller Wertschätzung für Hölderlin“, konterte ich, „aber schließlich ist er am Leben gescheitert!“ „Eher an den Verhältnissen“, fügte er hinzu. „Für das Scheitern gibt es immer mehrere Gründe. Aber fahren Sie ruhig fort. Der Glaube an Wahrheit und Gerechtigkeit ist unentbehrlich fürs Leben.“ Jeder seiner Sätze hatte doppelten Boden. Ich war nur zu dumm und unerfahren, um das herauszuhören.
Gorki und Nexö halfen mir zwar tagsüber, aber in schlaflosen Nächten fiel ich immer wieder in ein schwarzes Loch von Trauer und Verunsicherung. Wo war Siegi? Warum kam kein Zeichen von ihm? „Der ist längst über alle Berge und küsst eine andere! So einem Sunnyboy stehen doch alle Türen offen!“, spotteten einige. Irgendwann hielt ich es auch für wahrscheinlich.
Und dann fuhr ich mit dem Reporter-Mikrofon über Land und lernte Hansjochen kennen. Anfang November erhielt ich die Aufforderung, mich in einem bestimmten Zimmer des Leipziger Polizeipräsidiums zu melden. Natürlich dachte ich angestrengt nach, was ich ausgefressen haben könnte, – mir fiel aber nichts ein. An Siegi dachte ich nicht. Zu meiner schrecklichen Überraschung traf ich dort auf die zwei unangenehmen Stoppelköppe, die mich zwei Jahre zuvor zur „Mitarbeit am Weltfrieden“ überreden wollten. Ich hatte mich jedoch, bewusst oder unbewusst, so dusselig angestellt, dass sie es aufgaben und mich in Ruhe ließen. Nun waren sie stinksauer auf mich, behaupteten, ich hätte ihnen gegenüber die Naive gespielt und mich währenddessen mit dem Klassenfeind eingelassen, womöglich sogar für die Gegenseite Spionage betrieben. Aber nun würden sie sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen und alles rauskriegen. Ich fiel aus allen Wolken. Was wollten sie „rauskriegen“, WAS? Stundenlang stellten sie mir immer wieder dieselben stereotypen Fragen, mal lauter, mal leiser, mal scheinbar verständnisvoll, mal brutal und zynisch. Ich konnte nur immer wieder versichern: „Ich weiß von nichts!“ Schließlich ließen sie mich abführen in eine der Kellerzellen. Nie werde ich das Geräusch vergessen, mit dem die Tür hinter mir zuschlug und der Schlüssel sich im Schloss drehte. Zunächst war ich erleichtert, den grässlichen Visagen entronnen zu sein, dann schaute ich mich um: nackte, altersgraue Wände, darin eingeritzte Schriftzeichen: „Auf Wiedersehen, Mama!“ – „25 Jahre Sibirien“ – „Tod den Verrätern!“ (wer auch immer damit gemeint sein mochte.) Keine aufmunternde Lektüre.
Erschöpft ließ ich mich auf die Pritsche fallen; außer einem schäbigen Tisch, Schemel und Kübel das einzige „Mobiliar“. Ich weinte, fassungslos. Nach einer Weile wurde die kleine Klappe vor dem Guckloch zurückgeschoben und eine junge Stimme flüsterte: „ Krassiwaja! Krassiwaja! Potschemu ti platschesch?“ – Ja, warum weinte ich wohl … Ich war hungrig, müde und verzweifelt; kratzte die Vokabeln aus 21 Lektionen Steinitz zusammen – das Wort „unschuldig“ kam darin nicht vor – aber der junge Soldat verstand mich auch so. Ich solle ein bisschen warten, flüsterte er, dann würde er mir aus der Offiziersmesse etwas zu essen holen, da blieben immer Portionen übrig. Er hielt Wort, brachte mir eine fast kalte, aber wohlschmeckende Mahlzeit. Zum ersten Mal sah ich seine dunklen Mandelaugen in sonnengegerbtem Gesicht. Ein Tatarengesicht! „Skolko wam ljet?“ Er war achtzehn. Der Vater gefallen, die Mutter allein mit vier Kindern. Er, Aljoscha, der Älteste. Er sollte eigentlich den Vater ersetzen, nun säße er hier herum und könne nichts für sie tun. „Dafür tust du für mich etwas!“ – Er küsste zwei Finger seiner braunen, schrundigen Hand und streckte sie durch den „Spion“, ich streichelte sie, dankbar. Er zog sie zurück und hielt die Stelle, die ich gestreichelt hatte, an seine Wange. Wie viel Zärtlichkeit steckte in dem großen Jungen! Sie wog den Zynismus seiner vorgesetzten Stoppelköppe auf.
Selbstverständlich war es streng verboten, sich mit Gefangenen zu unterhalten, doch da ich zu diesem Zeitpunkt der einzige Gefangene in diesen Gewölben war, wurde kaum kontrolliert. Ich weiß gar nicht, wann er schlief, mir schien, als stünde er immer auf Wache. Wir unterhielten uns und trösteten uns – bruchstückweise – durch den Spion. In der Nacht rissen mich die Verhörer aus dem Schlaf, ließen mich, in grelles Scheinwerferlicht getaucht, auf einem Schemel sitzen, sie selber blieben im Dunkeln und schossen von dort ihre Fragen ab. Immer dieselben.
Eigentlich durfte man sich tagsüber nicht auf der Pritsche ausruhen – angezogen blieb man sowieso Tag und Nacht –, aber „mein Tatar“ pochte, sobald jemand im Kellergang auftauchte und so ertappten sie mich nicht. Um nicht verrückt zu werden, kramte ich alle Gedichte aus meinem Gedächtnis, sang alle Lieder, die ich kannte, von ‚Müde bin ich, geh zur Ruh’ bis ‚Weiß mir ein Blümlein blaue’. Und wenn ich keine mehr wusste, flüsterte er durch den Spion: „Jeschtscho ras, pashaluista!“ Und dann sang er die eintönig-getragenen Weisen, mit denen seine Mutter ihn getröstet, als sie, von Stalin aus ihrer Heimat, der sonnigen Krim verjagt, in Kirgisien mit nichts neu anfangen musste. Also auch er ein Vertriebener … Aljoscha. Ich hätte gern gewusst, was aus ihm geworden ist ….
Bald verlor ich das Gefühl für Zeit, bis mir siedend heiß einfiel, dass es der 13. November sein musste, Vaters Geburtstag. Spätestens an dem Tage würde man merken, dass mit mir etwas nicht stimmte. Und so war es auch. Die ewig besorgte Mama hatte sich bemüht, ihre düsteren Ahnungen zu verbergen und Vater sie beruhigt, ich wäre sicher nur für ein paar Tage mit dem Ü-Wagen unterwegs. Was sollte mir Sonntagskind schon Schlimmes widerfahren …
Wenn ich zurückrechnete, so war das genau der Tag, an dem man mich morgens aus der Zelle holte, in ein Auto verfrachtete, das innen keine Klinke hatte, und durch sonntäglich stille Straßen Richtung Süden fuhr. Nach Süden! Also nicht nach Sibirien! – Am frühen Vormittag überquerten wir die Elbe bei Dresden und hielten in der Bautzener Landstraße, wo ein ganzer Straßenzug vom Militär beschlagnahmt war. Hier endete die Fahrt. Wieder ging’s in den Keller, diesmal nicht ganz so tief, es gab ein schmales, vergittertes Fenster. In der geräumigen Zelle saßen bereits drei Frauen. Mama würde sie „Weibsbilder“ genannt haben. Sie erzählten pausenlos dreckige Witze, quietschten vor Lachen und amüsierten sich auf meine Kosten. Für sie war ich das „Greenhorn“, womit sie auch Recht hatten. Ich war geradezu sträflich naiv, während die drei wohl wussten, warum sie einsaßen. Die eine hatte irgendwelche Konterbande zwischen Warschau und München befördert, die andere mit Opiaten gedealt, die dritte kam, was ich damals nicht begriff, aus dem Rotlicht-Milieu. Sie vermuteten, ich sei eingeschleust worden, um sie auszuhorchen, hielten mich jedoch wegen meiner schnell erkannten Unbedarftheit für ungefährlich. So beschränkten sie sich auf Hänseleien, wurden aber nie handgreiflich. In wenigen Tagen lernte ich von ihnen allerlei praktische Dinge, zum Beispiel das Morsealphabet und wie man damit über das Heizungsrohrsystem Kontakt mit den Nachbarzellen aufnehmen kann. Oder wie man aus dem obligatorischen Mittagsfraß (Nudeln und Kartoffeln zusammen gekocht!) zwei halbwegs genießbare Mahlzeiten machen kann, indem man mittags die Kartoffeln herausfischte und die restlichen Nudeln bis zum Abend auf die Heizung stellte, so dass sie abends lauwarm und fast überbacken waren. Morgens gab es für jeden drei Scheiben Brot mit undefinierbarer Marmelade, von denen jede eine Scheibe abgab für die hungrigen Männer, die nach uns den Waschraum benutzten. Dass zwischen den einzelnen Scheiben Kassiber lagen, die über den Spülkästen der Toiletten deponiert wurden, erfuhr ich erst später.
Es war, alles in allem, eine lehrreiche Zeit. Und die Verhöre waren eigentlich keine, jedenfalls nicht vergleichbar mit denen in Leipzig. Es gab keinen Zynismus, keine Drohungen, sondern intensive Gespräche über Gott und die Welt und natürlich auch über meine mögliche Verstrickung in dem besonderen Fall. Der Kommissar sprach ausgezeichnet Deutsch und war in erster Linie Psychologe – und Mensch. Er fragte mich nach Siegi und ich gestand, er sei meine erste, große Liebe. Er seufzte und meinte, ich würde wohl eine Weile auf ihn verzichten müssen, denn der Krieg sei noch nicht zu Ende, habe nur andere Formen angenommen und trenne nicht nur Staaten, sondern zuweilen auch Mann und Frau. Ich fasste mir ein Herz und fragte ihn, was denn überhaupt mit Siegi sei, was man ihm vorwerfe. „Er war in englischer Gefangenschaft.“ – Das wusste ich. „Und er hatte dort ein gutes Leben.“ – „Ja, er hatte im Offizierscasino bedient.“ „Richtig. Und als ‚Belohnung’ hat man dann von ihm verlangt, nach Leipzig zu gehen und in dem Flugzeugwerk, in dem er ausgebildet worden war, Spionage zu betreiben.“ Das wusste ich nicht. „Aber er wollte doch mit mir zusammen ein neues Leben anfangen“… „Ja“, nickte der Kommissar, „das wollte er, aber sie haben ihn nicht losgelassen …“ „Wer ist sie?“ – Darauf bekam ich keine Antwort. Obwohl ich ihm vertraute, erzählte ich ihm nichts von der dubiosen Gesellschaft bei der Russin oder der Exotin in Westberlin, so dusselig war ich denn doch nicht mehr.
Nach ein paar Tagen ließ er mich zu sich rufen: „Halten Sie Ihr Herz fest, heute werden Sie Ihre Liebe wiedersehen.“ Er fuhr mit mir kilometerweit durch Ruinenfelder, die einst das blühende Elbflorenz gewesen. Das Herz klopfte mir vor Aufregung bis zum Hals. Um mich ein wenig abzulenken, wies ich auf die menschenleere Trümmerwüste: „Hier waren wir mit meiner Mutter und meinen kleinen Geschwistern als Flüchtlinge, zwei Wochen, bevor alles verbrannte …“ Seine Antwort überraschte mich: „Dresden war so schön wie unser Leningrad und sie“ – er zeigte gen Himmel – „haben uns diese schöne Stadt nicht gegönnt.“ „Aber es waren doch Ihre Verbündeten“, wagte ich einzuwenden. Er schüttelte den Kopf: „Manchmal muss man sich mit dem Teufel verbinden, wenn es die Große Sache verlangt.“ In seiner Gegenwart fühlte ich mich nicht als Gefangene, nicht „ausgeliefert“.
Der Wagen hielt im Hof des Sächsischen Landgerichts, das merkwürdigerweise fast unbeschädigt geblieben war. Ich wurde in einen kleinen Gerichtssaal geführt und harrte mutterseelenallein der Dinge, die da kommen sollten. Ich wusste nicht, dass der Kommissar, für mich unsichtbar, in einer Art Regie-Raum saß, in dem man alles beobachten und mithören konnte. Dann ging die schwere Eichentür auf und Siegi kam herein, bemüht, aufrecht zu gehen, aber die Schuhe schlappten, weil man ihm die Schnürsenkel weggenommen hatte, wie auch den Gürtel, so dass er sich mit einer Hand die Hose festhalten musste, die, einst maßgeschneidert, nun um die Taille schlotterte. Unter den krampfhaft hochgezogenen Hosenbeinen sah der gräuliche Rand einer langen Unterhose hervor. Oh, Siegi, Sunnyboy! Wie musste er unter diesem Aufzug leiden! Und die schrecklichen Bartstoppeln! Wahrscheinlich durften sie sich nur einmal in der Wochen und unter Aufsicht rasieren, um zu verhindern, dass sich jemand mit dem Rasiermesser die Pulsadern aufschnitt. Aber seine azurblauen Augen unter den langen Wimpern strahlten wie eh und je. Er sah mich, hob die Hände, um mich zu umarmen, allein die Handschellen hinderten ihn daran. Wir saßen uns gegenüber, jeder auf seinem Schemel, reichten uns die Hände – und wussten nicht, was wir sagen sollten. Ich kam mir vor wie aus der Welt geschossen, ringsum finstere Unendlichkeit und darin, in einem einsamen Lichtkegel, er und ich … Schließlich räusperte er sich, um seiner Stimme Halt zu geben, und sagte: „Es tut mir leid, dass du durch mich in eine solche Lage gekommen bist. Wie soll ich das je wiedergutmachen? Ich weiß es nicht.“ „Mach dir um mich keine Sorgen, ich komme schon zurecht.“ Und dann kam die gefürchtete Gewissensfrage: „Wirst du auf mich warten?“
Aus eigener Erfahrung wusste ich nun, wie sehr man sich an den Gedanken klammert: Wie wird es sein, wenn ich hier rauskomme? Wer wird auf mich warten? Sollte ich ihm die Illusion schenken und versprechen zu warten? Dann wäre ich gebunden, vielleicht für 25 Jahre, sagte ich „Nein!“, nahm ich ihm das Letzte, was ihn aufrecht halten konnte: den Traum vom Augenblick der Freiheit … „Oh, Siegi, mein Lieber …“, dann brach mir die Stimme.
Ein Wachmann erlöste mich, indem er ihn sanft, aber bestimmt, am Ärmel zupfte und hinausführte. Benommen, wie nach einem schweren Traum, saß ich, bis der Kommissar neben mir sagte: „Es ist gut. Wir können gehen!“ Er schien irgendwie erleichtert. Es ging wieder zurück in die Zelle zu den grässlichen Weibsbildern.
Nach zwei oder drei Tagen ließ er mich rufen, saß in einem Halbsessel, die Beine leger übereinandergeschlagen und begann eine Konversation: „Nun, wie gefällt es Ihnen bei uns?“ – „Ich kann mich nicht beklagen“, antwortete ich mit gebotener Vorsicht, „obwohl ich mir angenehmere ‚Pensionen’ vorstellen kann.“ Er lächelte. „Und die Verpflegung?“ Ich verzog den Mund: „ Nun ja, wenig abwechslungsreich, jeden Tag Nudeln und Kartoffeln, zusammengekocht, aber immerhin – essbar.“ Er lächelte noch immer. „Nun gut, ich korrigiere mich: Manchmal gab’s auch Kohlsuppe.“ Er wippte vergnügt mit dem Fuß: „Ja, Bockwurst mit Salat können wir Ihnen hier nicht servieren, da müssten Sie schon ins Restaurant am Hauptbahnhof gehen …“ „Soll das heißen, dass …“ Noch wagte ich nicht, laut zu jubeln. „… dass Sie nach Hause fahren können. Wir wissen nun, woran wir sind. Man wird Ihnen sogleich Ihre Sachen aushändigen plus einer Fahrkarte zurück nach Leipzig – und etwas Geld für Bockwurst mit Salat …“ Am liebsten wäre ich ihm spontan um den Hals gefallen. An der Tür rief er mich noch einmal zurück: „Melden Sie sich als Erstes bei Ihrer Arbeitsstelle. Und wenn Sie dort Schwierigkeiten haben sollten – lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen, es ist alles geregelt.“ (Fantastisch, er kennt sich sogar in deutschen Idiomen aus, dachte ich, überflüssigerweise.) „Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen sage ich lieber nicht …“ Ich war frei! Frei!! Frei!!! Wollte mich bei ihm bedanken für seine Menschlichkeit, doch diesmal schnürte mir Freude die Kehle zu.
Ein einfacher Soldat von der Wachmannschaft begleitete mich, (weiß der Himmel, warum) zur nahen Straßenbahnhaltestelle. Er war so jung und treuherzig wie Aljoscha. „Isch sähr gljuklisch – ti domoi …“, sagte er. Man habe gemunkelt, ich sei die Geliebte des Stadtkommandanten in Leipzig gewesen und hätte ihn für den CIA ausspionieren sollen. Wenn die Sache nicht so ernst gewesen wäre, hätte ich laut losgelacht: Wer denkt sich so was Verrücktes aus?! Die Straßenbahn zum Hauptbahnhof kam, der kleine Muschik legte emphatisch die Hand auf sein Herz und sagte noch einmal: „Isch sähr gljuklisch, – fsjo charascho!“ – Alles wird gut.
Aber nichts wurde gut. Der Personalchef, der inzwischen Kaderleiter hieß, gab mir deutlich zu verstehen, dass er mich sehr ungern und nur „auf höhere Weisung“ behielte. Im Schulfunk könne ich nicht mehr arbeiten, (warum nicht?), aber man würde eine andere Lösung finden. Zuvor müsse ich mich jedoch, und zwar auf der Stelle, bei der mir bekannten Adresse melden.
Novemberkälte kroch durch alle Glieder. Nein! Nicht wieder zu diesen Ekelpaketen! Doch was blieb mir anderes übrig. Nicht einen Augenblick lang kam mir der Gedanke, zu flüchten, den nächsten Zug nach Westen zu nehmen. Erstens wusste ich nicht wohin, zweitens hätten mich dann alle als Verräterin betrachtet, und drittens hatte mir der Kommissar in Dresden die Gewissheit gegeben, dass es selbst dort wahre Menschen und ehrliche Streiter für „die große Sache“ gab.
Beherzt betrat ich die Höhle des Löwen. Die Bestien knurrten und schlugen mit den Tatzen – ins Leere, denn offensichtlich hatte ihnen eine höhere Dienststelle befohlen, mich aus ihren Klauen zu entlassen. Ich musste nur noch unterschreiben, über die Ereignisse der letzten Wochen absolutes Stillschweigen zu bewahren, andernfalls – letzte Drohung! – würden wir uns wiedersehen und dann wäre mir Sibirien sicher!
* * * *
Mama streichelte meine Hand und weinte sich die Last der schlaflosen Nächte von der Seele. Selbst Vater, der sonst so beherrschte, war bewegt. Er erinnerte sich wohl an seine eigenen Erlebnisse von 1933. „Es ist wie immer und überall“, schloss er meine lange Erzählung, „ es gibt So’ne und Solche, Gute und Üble. Daran hat sich offenbar nichts geändert.“
* * * *
Hansjochen war, als er von meinem „Verschwinden“ erfuhr, sofort nach Leipzig gefahren in der Hoffnung, bei meiner mütterlichen Wirtin einen Anhaltspunkt zu finden. Sie wusste nur, dass ich mich im Polizeipräsidium melden sollte. Von dort sei ich nicht zurückgekehrt … Wie er dort hineingekommen war, wen er überredet hatte, wusste er später selbst nicht mehr zu sagen, jedenfalls schnoberte er durch alle Gänge nach meinem Lieblingsparfüm ‚Mysticum special’, – natürlich vergeblich. Es roch überall nur nach Aktenstaub, Fußbodenöl und Gleichgültigkeit.
Der Zufall wollte es, dass er den Präsidenten der eben gegründeten DDR mit dem Mikrofon ins Kunstfaserwerk nach Schwarza begleiten durfte, das seinen Namen tragen sollte. „Papa Pieck“ hieß er im Volksmund; er genoss Ansehen und Vertrauen wie sonst kein anderer. Hansjochen bat ihn um Hilfe, doch er schüttelte nur mitfühlend sein weißes Haupt: „Wenn sie tatsächlich dort ist, wo du meinst, mein Junge, kann ich dir nicht helfen. Das liegt nicht in unserer Hand. – Noch nicht.“ Kollegen berichteten mir später, Hansjochen sei derart durcheinander gewesen, dass er bei der anschließenden Liveübertragung alles verdreht und sich vom „Kunst-Pieck-Werk-Wilhelm-Faser“ gemeldet habe. Zum Glück sei es keinem der Großkopfeten aufgefallen, nur der Ton-Ingenieur im Ü-Wagen wollte sich kringeln vor Lachen. Er hatte sich also wirklich um mich bemüht, meinte es ehrlich – und wurde mir mit seinem unverwüstlichen Humor immer wichtiger. Denn was war geschehen?
Das Leipziger Funkhaus, das drei Jahre lang und bis vor wenigen Wochen noch meine geistige Heimat gewesen, war nicht mehr dasselbe. Die Kaderabteilung hatte gründliche Arbeit geleistet und überall ihre Giftkapseln mit dunklen Andeutungen ausgelegt. Wie ein Paria schlich ich durch vertraute Gänge, wie eine Aussätzige kam ich mir vor. Selbst im Kreis der Jugendgruppe spürte ich, wie sie den Atem anhielten und auf freundliche Distanz gingen. (Vielleicht bildete ich es mir auch nur ein.) Ich hätte ihnen gern die Wahrheit berichtet, die, so meinte ich, keinen politischen Schaden anrichten konnte, denn ich war ja (überwiegend) gut behandelt worden; aber keiner stellte Fragen und das Schweigen-Müssen gab dem Ganzen erst die unheimliche Faszination. Am meisten schmerzte mich, dass ich Dr. Sachse nicht reinen Wein einschenken konnte. So war das: Ein Raunen „von oben“ genügte und alle rückten in vorauseilendem Gehorsam von einem ab. Selbst wenn jemand in ehrlicher Anteilnahme gefragt hätte, was denn eigentlich passiert sei, ich hätte es ihm nicht sagen dürfen.
Nachdem ich tagelang in der Luft gehangen, ließ mich die Kaderabteilung wissen, dass ich in der eben gegründeten „Redaktion für Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ mitarbeiten solle. Ausgerechnet! Wollten sie mir eine Falle stellen? Zum ersten Mal in meinem Leben lernte ich, um die Ecke zu denken. Mein Kinderglaube: „Der Mensch ist gut!“ war erschüttert.
Die neue Redaktion stand nur auf dem Papier. Nyota K., eine sehr gebildete, junge Frau, die fließend Russisch sprach, sollte sie leiten. Doch war sie gerade im Begriff, den Grafen Thun zu heiraten, der in die neue Regierung berufen worden war als ‚Chef des Protokolls’ oder, wie man hinter vorgehaltener Hand munkelte, um als ‚Zeremonienmeister’ die gelernten Dachdecker und Tischler mit den Gepflogenheiten des diplomatischen Parketts vertraut zu machen. Während Nyota mit Hochzeitskleid, Brautstrauß und Protokollfragen beschäftigt war, stand ich rum und hatte noch nicht mal einen Schreibtischplatz. Ich fühlte mich überflüssig wie ein Kropf und so unglücklich, dass es mir auf den Magen schlug. Und die Monatsblutungen hörten gar nicht mehr auf.
Nicht die drei oder vier Wochen Haft hatten mich aus der Bahn geworfen, meine Unbefangenheit genommen, sondern der feige Buschkrieg danach. Ich erkannte mich nicht wieder, bestand nur noch aus Angst und Unsicherheit. Fuhr draußen ein Auto vorbei oder hielt gar aus irgendeinem Grund, fing ich an zu zittern: Jetzt holen sie dich wieder! Jetzt geht’s nach Sibirien! Dem alten Sanitätsrat, der die Rundfunkleute betreute, musste ich nicht viel erzählen, er schrieb mich krank und nahm mich so aus der Schusslinie. Der Kaderleiter verzog nur die Mundwinkel, als habe er nichts anderes erwartet. Ich kochte vor Wut und hätte ihn am liebsten geohrfeigt, doch ich kroch nur in mich zusammen, gab kampflos auf und kündigte zum 1. Januar 1950, verzichtete damit auf Krankengeld und jede Form sozialer Sicherheit. Ich flüchtete auf Mamas altes Seegrassofa und erstickte fast am Schweigen-Müssen. Es war das elendeste Weihnachten meines Lebens. Nicht nur für mich.
Und dann war Hansjochen erschienen und hatte mit seinen harmlosen Späßen alle zum Lachen gebracht. Und mit seinem Heiratsantrag – oder wie man es auch nennen wollte – eine überraschende Tür aufgestoßen.
* * * *
Nach meiner „Beichte“ sahen ihn meine Eltern wohl doch etwas milder. Ja, er war keine Schönheit, auch für meine Vorstellung etwas zu klein geraten, aber es war eine Art von „intelligenter Hässlichkeit“, die in gewisser Weise „apart“ und „anziehend“ genannt werden konnte. Und er war mehr als „lustig“. Jemand, der ihn aus dem Kriege kannte, bestätigte mir, Hansjochen habe auch in den vertracktesten Situationen nie den Humor verloren und selbst in der nervenzerfetzenden Atempause zwischen Trommelfeuer und Angriff die Kameraden davon abgehalten durchzudrehen oder sich in die Hosen zu machen. „So einer könnte mich retten“, dachte ich. Weiter dachte ich nicht.
„… Wes Fuß wär niemals fehlgesprungen? Wer lief nicht irr in seinem Lauf? Blick hin auf das, was dir gelungen, Und richte so dich wieder auf. Vorüber ziehn die trüben Wetter Es lacht aufs neu der Sonne Glanz, Und ob verwehn die welken Blätter, Die frischen schlingen sich zum Kranz.“ Theodor Fontane 1849
Es war, als hätte ein imaginärer Stellwerksmeister den Hebel umgelegt und den Zug in eine andere Richtung geleitet. Der Zug fuhr nach Weimar.
Meine liebenswürdige Leipziger Wirtin schenkte mir zum Abschied eine entzückende kleine Vase aus Meißner Porzellan, die nur ein ganz klein wenig angeschlagen war, und verdrückte zwei ehrliche Tränchen: Mit ihrem Ebi wäre ich sicher glücklicher geworden, gestand sie mir. Ebi selbst blieb unsichtbar. Sie entschuldigte ihn, er wollte nicht, dass wir ihn schwach sähen … Ach Gottchen, Ebi! Er würde sicher eine Frau finden wie Mutti, die alles entschuldigt und ergeben seine Langeweile erträgt.
Mit Hansjochen würde es nie langweilig werden! Dessen war ich gewiss. Mein Ur-Vertrauen kehrte zurück. Und es ergab sich alles wie im Spiel: Die Alten Herrschaften, über deren Häuptern seit Monaten das Damoklesschwert der Zwangsvermietung schwebte, atmeten auf: Das Wohnungsamt sah ein, dass Sohn und künftige Schwiegertochter Vorrang hatten. Und Arbeit gab es zuhauf. Zwar sendete Landessender Weimar zu der Zeit nur auf der Welle der Entrüstung, weil die junge DDR bei der Kopenhagener „Wellenkonferenz“ arg beschnitten worden war, aber es gab ja noch Zeitungen und es konnte nicht schaden, auch mal Satz und Umbruch kennenzulernen. Theater- und Filmkritiken schwebten mir vor und Porträts kreativer Zeitgenossen, die mit ihrem guten Beispiel zur Nachahmung anregen sollten.
Die Chefredaktion des „Thüringer Volks“ saß in Erfurt und avisierte mich in der Weimarer Kreisredaktion, wo gerade eine Stelle freigeworden war. Guten Mutes betrat ich das murkelig-schmuddelige Büro, durch das blaugrauer Nebel von „Turf“ waberte, der ordinärsten aller Zigarettensorten. Am Schreibtisch saß, mit dem Rücken zur Tür, ein extrem kurz geratenes Männchen, stand nicht mal auf, drehte sich nur halb zur Seite und musterte mich flüchtig, um theatralisch stöhnend den Kopf in seine Hände zu stützen: „Noch so’ne bürgerliche Zimtzicke!! Womit hab ich das verdient?!“
Zugegeben, ich war „overdressed“ für seine Kamurke, trug ein Pepita-Kostüm, das eine unbekannte, aber geniale Leipziger Schneiderin einem englischen Reitkostüm nachempfunden hatte, und dazu hochhackige Schuhe, die ihn vollends als Liliputaner erscheinen ließen. Vielleicht stand er auch deshalb nicht auf, um mich zu begrüßen. Es stellte sich heraus, dass meine Vorgängerin Knall und Fall nach dem Westen abgehauen war. Von mir erwartete er offenbar dasselbe. Mir lag eine leicht überzuckerte Gemeinheit auf der Zunge, doch ich zügelte mich und nahm mir vor, ein Jahr durchzuhalten, selbst wenn er sich auf den Kopf stellte und mit den Ohren wackelte. Letzteres konnte er tatsächlich und fand das sogar witzig! Was er sonst noch konnte, war nicht leicht herauszufinden. Schreiben konnte er jedenfalls nicht.
Thomas Mann hatte von Weimar als einer „vom Genie geadelten Stadt“ gesprochen und ich versuchte, mich ihr von dieser Seite zu nähern. Las alles, was ich in den Bücherregalen meiner neuen Familie fand, über Goethe, Schiller, Herder, Wieland, und wie lange Goethe gebraucht hatte, um Schiller in seiner Größe zu erkennen und anzunehmen. Über ihre menschlichen Schwächen fand ich am ehesten Zugang und Verständnis. Vor allem aber faszinierte mich Anna Amalia: Ungeliebtes fünftes Kind des Herzogs von Braunschweig wird sie mit 16 an den unbedeutenden und noch dazu kränklichen Herzog von Sachsen-Weimar verkuppelt. Der stirbt mit 20. Ihr gemeinsamer Sohn, Carl August, ist zwei, Anna Amalie 19 Jahre alt. Sie muss in die Bresche springen, um das Erbe für ihren Sohn zu retten. Es ist eine verfluchte Zeit, noch tobt der Siebenjährige Krieg, durchziehende Heere verwüsten das Land, die Leute hungern, Seuchen breiten sich aus … Mit ungeheurer Energie legt sich Anna Amalia in die Brassen, sucht sich kluge Berater, Leute der Praxis, legt den Finger auf jeden Posten, fragt: Wie kommt der hierher? Bringt Ordnung in die zerrütteten Finanzen, lernt, lernt, kümmert sich um Arme und Kranke, begreift, da Weimar abseits der großen Handelsstraßen liegt, dass Wandlung zum Besseren nur vom Kopf aus gehen kann. Holt als Erzieher für ihren ungestümen, oft aufbrausenden Sohn den Philosophie-Professor Wieland; Wieland holt den Dichter und Übersetzer Knebel; Knebel holt Goethe; Goethe holt Herder … Mit der Volksbildung hatte alles angefangen: Grundschule, Gymnasium, Universität. Kunst, Musik, Theater. Jedermann sollte teilhaben, jeder durfte einmal in der Woche unentgeltlich ins Theater!
Die Bibliothek meiner Schwiegereltern war für mich eine Offenbarung, ich begriff, was Thomas Mann mit der „vom Genie geadelten Stadt“ auf sich hatte.
Im Abendsonnenschein wanderte ich nach Tiefurt, um im Schlösschen der Anna Amalia das Bild wiederzufinden, das Lilienfein so köstlich geschildert hatte: „Kerzenlicht fällt über den eckigen Tisch, hellt dort ein Gesicht auf, eine Haube, eine Epaulette. Die Dame des Hauses selbst: löckchenumkraust, ein leises Lächeln auf den Lippen, den Zeichenstift führend; Herder, den Blick eines Sehers ins Weite tauchend, und über eine Stickerei gebeugt, hochschultrig-verwachsen, schalkhafte Bosheit im scharfen Profil, die Göchhausen …“ So bildhaft stand mir alles vor Augen. Über die Göchhausen hätte ich gern schreiben wollen. Wie mochte ihr zumute gewesen sein als arme, bucklige alte Jungfer, der Hoffart von Leuten ausgesetzt, die ihr nicht das Wasser reichen konnten … Mit einer Serie von Feuilletons wollte ich dazu beitragen, den Zufalls-Weimarer zum echten Weimaraner zu machen, der, seiner kulturellen Schatzinsel bewusst werdend, sich strebend bemüht, das Beste aus seinen Anlagen und Talenten zu machen – zum Wohle der Allgemeinheit.
„Paulchen“ sah mich fassungslos an: Wozu sollte das gut sein, in alten Zeiten rumzukramen!? Natürlich würde er Goethe kennen: „Da steh ich nun, ich armer Tor“ und „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ … ein edler Anspruch, aber im Kapitalismus nicht durchsetzbar. Und auch in Zeiten der Revolution nicht, denn Brecht hatte Recht, wenn er schrieb: „Ach, wir, die wir für Freundlichkeit waren in der Welt, durften selber nicht freundlich sein“.„Paulchen“ war unfreundlich – aus Prinzip. Nur wenn er von seiner zwergenhaft kleinen Frau sprach, lockerten sich seine Züge. Als liebenden Ehemann vermochte ich ihn mir nicht vorzustellen. Gab mir auch keine Mühe. „Goethe und Konsorten“ schminkte er mir kategorisch ab: „Der fällt ins Ressort der Chefredaktion.“ Punkt.
Stattdessen schickte er mich bei scheußlichem Sauwetter aufs Land, um das Hohelied auf die Rinderoffenställe zu singen, die neueste, von der Sowjetunion übernommene Errungenschaft! Ich fand Kühe, die klapperdürr und frierend fußhoch im Morast standen und war entsetzt. „Jaaa“, erklärte mir der Verantwortliche des Volkseigenen Gutes: „Rinderoffenställe sind eine gute Sache, – auf der Krim! Aber unsere Kühe haben Zeit ihres Lebens in dunklen, dumpfen und warmen Ställen gestanden, die verkraften so viel ‚frische Luft’ nicht. Da müssen erst Rassen gezüchtet werden, die das Klima hier vertragen, und das braucht Zeit, das kann man nicht auf Parteibeschluss übers Knie brechen …“
Wieder daheim, zerbrach ich mir den Kopf, wie ich dem Ganzen einen positiven Drall geben könnte. Das Gesehene war jedenfalls niederschmetternd. Froh war ich nur, nicht meine einzigen Lederschuhe angezogen zu haben, sondern die verhassten Igelitschuhe, deren Wasserundurchlässigkeit mit Schweißfüßen bezahlt wurde. Was machte „Paulchen“? Er ließ „die gute Sache“ stehn und strich den Rest zusammen. Ich schämte mich und traute mich kein zweites Mal in dieses Dorf. Mehr und mehr hasste ich seine dämlichen Bevormundungen. Einmal sollte ich über stinklangweilige Versammlungen berichten, die man eigentlich nur mit einem Zitat des alten Juvenal kommentieren konnte: „Difficile est, satiram non scribere!“ Satire aber war bei ihm nur erlaubt, wenn es gegen den „Klassenfeind“ ging. Er verzweifelte an meiner Art zu schreiben genauso wie ich an der seinen. Ich versuchte, ihm zu helfen und erzählte ihm von Dr. Sachse, meinem Chef im Schulfunk, der mir jungem Hüpfer als Hauptregel eintrichterte: „Verben, Verben, Adjektive! Substantivierte Verben, noch dazu in Verbindung mit Genitiven sind Todsünde!“ Ich hatte damals lachend gemeint, dann sei das halbe „ND“ Todsünde beziehungsweise zum Wegschmeißen. „Paulchen“ fand das überhaupt nicht zum Lachen. Er hatte diese pervertierte Art sich auszudrücken derart verinnerlicht, dass er gar nicht anders konnte. Er sprach auch so! Ich habe es hingegen nie gelernt, weil sich nicht nur mein Sprachgefühl dagegen sträubte.
Als echte Bereicherung empfand ich die ungewohnte Arbeit in der Druckerei, in der die versierten Setzer mit bewundernswerter Geschwindigkeit die einzelnen Buchstaben aus den Kästen klaubten und zusammensetzten. Auch mit dem Korrektor verstand ich mich gut. (Vermutlich war er Gymnasiallehrer mit NS-Vergangenheit, den man nicht in den Schuldienst übernommen hatte.)
Ich weiß nicht mehr, wie ich zu der Ehre kam, aber eines Tages durfte ich Thüringens Ministerpräsidenten Werner Eggerath nach Buchenwald begleiten, nachdem das Lager endgültig geschlossen worden war. Es sollte zu einer Mahn- und Gedenkstätte umgestaltet werden. – Kein Mensch weit und breit. Beklommen durchschritt ich das Tor mit dem infernalischen Spruch: „JEDEM DAS SEINE!“ 250 000 Menschen sind hier durchgegangen – und 56 000 davon sind umgekommen.
Bruno Apitz, den ich vom Sender Leipzig her kannte und der sich damals schon mit seinem Roman-Manuskript „Nackt unter Wölfen“ abquälte, hatte mir davon erzählt. Doch davon zu hören ist etwas anderes, als plötzlich unmittelbar damit konfrontiert zu sein. Wir überquerten den endlos scheinenden Appellplatz, auf dem Tausende ausgemergelter Gestalten stundenlang stehen mussten, bei Wind und Wetter, Kälte und Gluthitze. Wer zusammenbrach, war verloren. Ich versuchte, es mir vorzustellen, doch Eggerath hatte es am eigenen Leibe erfahren, zehn endlos lange Jahre, zwei davon in Einzelhaft. „Hier hast du gelernt, den Wert eines Menschen zu schätzen“, sagte er, mehr zu sich selbst, „wie er Belastungen durchstehen kann, das macht seinen Wert aus. Und dann öffneten sich die Tore und du wirst in eine andere Welt geschleudert – und sollst ‚normal’ reagieren. Das war zu viel verlangt. Gefangene reagieren nicht wie normale Menschen. Schon die Tiere in Gefangenschaft sind gereizt, – wie der Panther, der in seinem Käfig hin und her läuft, hin und her, ohne Rast und Ruh. Wir hätten eine Anlaufzeit gebraucht, aber die hatten wir nicht.“ Ich erzählte ihm von einer Jüdin in Leipzig, die Buchenwald überlebt und geschworen hatte, lebenslang grausame Rache zu üben. Er schüttelte den Kopf: „Gewiss müssen die Täter bestraft werden, lebenslänglich, wenn es sein muss, aber ‚grausame Rache’ ist kein Lebensgefühl, das das Leben lebenswert macht. Manchmal kann es einem schon vor diesem oder jenem grausen und dennoch denke ich, dass in ihm mehr Gutes steckt, als es äußerlich scheint. Wir müssen verhindern, dass sich so etwas wiederholen kann. Das ist es!“
Das Krematorium lag verwaist, seit April 1945 war kein Rauch mehr aufgestiegen, doch in den maroden Baracken lagen noch ausgetretene Galoschen, ein Kohlstrunk, die Fetzen eines Hemdes. Das Grauen schüttelte mich. Wie musste es dem Manne neben mir zu Mute sein? Fast ehrfürchtig schaute ich zu ihm auf, der alles ertragen und andere noch getröstet hatte. Elend machte mich nur der Gedanke, dass dies alles nicht im April 1945, sondern erst vor wenigen Wochen endgültig zu Ende war. Eggerath konnte wohl Gedanken lesen, jedenfalls sagte er unvermittelt: „Was danach hier passierte, ist mit dem vorher nicht zu vergleichen, sicher auch kein Ferienlager, aber es wurde niemand mehr verbrannt oder zu Tode geprügelt. Und die meisten wussten auch, warum sie hier einsaßen, waren Schinder oder kapitale Nutznießer des Hitlerregimes. Waren auch Unschuldige darunter, ja, wie der S-Bahn-Zugführer aus Berlin, der durch irgendein Versehen zum SS-Zugführer wurde … So was passiert angesichts weltbewegender Umwälzungen. Aber ich vermute, er fährt längst wieder S-Bahn …“ Und damit ging Eggerath zur Tagesordnung über.
Nicht für einen Moment kam mir der Gedanke, dass auch Siegi womöglich hier gelandet wäre, hätte man ihn zwei Jahre früher „enttarnt“.
Auf dem Heimweg sprachen wir kaum. Ich bewunderte rückhaltlos den Mann, der nun so viel Macht besaß und sich nicht von ihr berauschen ließ, der in jedem Gegenüber zuerst den Menschen sah und der so selbst seinen Gegnern Respekt einflößte. Zwei Nächte lang bemühte ich mich mit heißem Herzen, ihm und meinen Gefühlen gerecht zu werden. Der Artikel wurde nie gedruckt. Das KZ Buchenwald war nach der gängigen Lesart 1945 durch den Mut der politischen Häftlinge befreit worden – und es sollte nicht daran erinnert werden, wie es danach weiterging ….
* * * *
Es ergab sich zu der Zeit, dass eine Unwetterkatastrophe das thüringische Dörfchen Bruchstedt heimsuchte. Walnussgroße Hagelkörner durchschlugen Dächer und Fenster, stauten sich stellenweise zwei Meter hoch, die Wassermassen brachten die Heilinger Höhen ins Rutschen, der Fernebach schwoll an und riss Menschen und Tiere mit sich. Nichts war verschont geblieben. Der Katastrophenschutz war damals mehr Katastrophe als Schutz. Schon wurden Stimmen laut, das Dörfchen einzuebnen. Doch die Bruchstedter wehrten sich. Da organisierte die Partei 20 000 freiwillige Helfer und versprach, innerhalb von 50 Tagen das Dorf wieder aufzubauen, neue Tiere, neues Saatgut, Hausrat und Kleidung zu besorgen. Kaum einer glaubte daran. Doch sie schafften es und setzten noch eins drauf, indem sie zusätzlich Schule, Krankenstation und Kindergarten wieder herrichteten, mit Wasch- und Brauseanlage! Dieses wahrhaft beispielhafte Hilfswerk füllte die Zeitungen. Mit Recht. Denn es war der Beweis, dass „gemeinsam und unter Führung der Partei ALLES erreichbar war.“ – Buchenwald tauchte nirgends auf.
Eggerath hatte mich nach meinen Plänen und Zielen befragt und ich erzählte ihm von unserer Jugendgruppe am Leipziger Sender, unsern Sprach-, Theater- und Literaturzirkeln und dem Bemühen, andere mitzureißen, alle Talente und Fähigkeiten auszubilden. Er ermutigte mich und meinte, ich solle doch mal bei Marie Torhorst vorsprechen, sie sei Ministerin für Volksbildung und habe sicher eine Idee, was man da machen könne. Gerade wäre beschlossen worden, in einem Wettbewerb Lerneifer und Wissbegier anzukurbeln. So klopfte ich – mit „Paulchens Segen“ – an die Tür der ersten Ministerin Deutschlands. Es war Liebe auf den ersten Blick. Damals hielt ich die Zweiundsechzigjährige bereits für eine „alte Dame“, aber von überwältigender Energie: Zum Glück kannte ich ihr Vorleben nicht, sonst wäre ich vor Ehrfurcht glatt in den Boden versunken. Marie Torhorst stammte aus einer kinderreichen Pfarrersfamilie im stockkatholischen Köln, hatte Mathematik, Physik, Geografie und Volkswirtschaft studiert. In den sogenannten „Goldenen Zwanzigern“ fand sie wegen ihrer sozialistischen Anschauungen keine Arbeit, also lehrte sie an einer Handelsschule, nur für Frauen, und gab in Berlin in Abendkursen armen Volksschülern Gelegenheit, das Abitur nachzumachen. Überstand die Hitler-Zeit irgendwie als Küchenhilfe und Krankenschwester und stieg nach dem Kriege, befreit von allen Fesseln, voll in die Volksbildung ein. Ich entsann mich, sie im Jahr zuvor auf einem Foto gesehen zu haben, das durch alle Zeitungen ging. Sie mit Thomas und Katia Mann vor dem Nationaltheater in Weimar. Sie nickte: „Ja, das war nach der Goethe-Preis-Verleihung. Thomas Mann hatte sich sehr positiv über den Versuch der jungen DDR geäußert, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen, die Kriege in Europa ein für alle Mal ausschlösse. Daraufhin habe man im Westen mit blindem Hass reagiert. Die FAZ geiferte, ‚der einstige Freiheitsheld habe sich aus lauter Eitelkeit zum Anwalt der östlichen Schinderwelt gemacht’. Nach Amerika zurückgekehrt war er vor den McCarthy-Ausschuss für Unamerikanische Tätigkeit zitiert worden.“ Von all dem, was sich da hinter den Kulissen abgespielt, wusste ich natürlich nichts. Das Leben schrieb manchmal Pointen, die man nicht besser hätte erfinden können.
Was den Wettbewerb zum „Abzeichen für gutes Wissen“ betraf, mit dem der Lerneifer der Jugend angekurbelt werden sollte, so plauderte sie ein wenig aus dem Nähkästchen: Er ginge zwar vom Zentralrat der FDJ aus, aber die Meinungen dort seien geteilt. Die einen hielten die Beschäftigung mit Literatur für „bürgerlichen Luxus“, die andern, mit Stefan Hermlin an der Spitze, für unerlässlich. Die Klassiker des Kommunismus zu zitieren war immer gut. Also stellte Hermlin Lenin als Beispiel hin, der die Jahre des Exils überwiegend in Bibliotheken verbrachte, und Stalin, der nicht nur Puschkin und Lermontow, sondern auch Rolland liebte, den Franzosen, der Anfang der Dreißigerjahre nach dem Besuch einer westlichen Schriftstellerdelegation in der jungen Sowjetunion sagte, in 50 Jahren werde ganz Europa kommunistisch – oder nicht mehr vorhanden sein. Dichter sind Enthusiasten und man muss wissen, wann es opportun ist, sie zu zitieren – und wann nicht. Hermlin wusste es. – Und ich lernte es auch – mit der Zeit. Mit der Ministerin im Rücken, kümmerte ich mich darum, dass Weimar in diesem Wettbewerb des Wissens glänzend abschnitt – und „Paulchen“ konnte mir dabei nicht in die Suppe spucken. Im „Haus der Jugend“, unserer murkeligen Redaktion gegenüber, saßen unternehmungsfreudige Leute, die die „Kampagne“ hocherfreut aufgriffen. Mit meinen Schulfunk-Erfahrungen konnte ich mir ausrechnen, welche Themen (wenigstens auf dem Gebiet der Kultur) infrage kämen. Und so schafften sie Filme und Bücher herbei, die mit großer Wahrscheinlichkeit drankommen würden. Alles kostenlos. Eisenstein und Pudowkin, Staudte und Maetzig, Thomas und Heinrich Mann, Goethe, Gorki, Kisch, Arnold Zweig, Ehrenburg, Seghers, Feuchtwanger, Becher, Brecht, Bredel, Hermlin, – die ganze Palette, immer der Denkweise des Zentralrats der FDJ nachempfunden.
Es war ein voller Erfolg. Weimar „stand auf dem Treppchen“. Natürlich schrieb ich ausführlich darüber und hielt „Paulchen“ mein eigenes Abzeichen in Gold unter die Nase. Er akzeptierte mich – zum ersten und wohl auch zum letzten Mal.
* * * *
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: