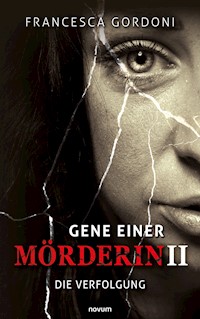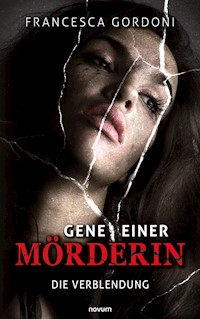
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Susanne trägt ein gut gehütetes, familiäres Geheimnis mit sich herum. Eines Tages offenbart sie es ihrem Mann Herbert, mit dem sie ihr großes Glück gefunden zu haben scheint. Der Sohn eines wohlhabenden Anwalts hat seine Jugend in ganz anderen Kreisen verbracht als Susanne. Man hält auf sich, man hat Stil, man lebt mondän. Sein Freund Manuel ist nahezu immer mit von der Partie, ein freundlicher, aber manchmal merkwürdig erscheinender Typ. Als Kind soll er mit Vorliebe Frauenkleider getragen haben, erzählt Herberts Vater. In ihrer Lieblingsstadt Paris klärt sich alles auf. Mit fatalen Folgen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Impressum 3
I 4
II 7
III 15
IV 27
V 32
VI 43
VII 55
VIII 58
IX 67
X 77
XI 80
XII 92
XIII 97
XIV 99
XV 102
XVI 116
XVII 120
XVIII 122
XIX 126
XX 131
XXI 144
XXII 149
XXIII 151
XXIV 159
XXV 160
XXVI 169
XXVII 171
XXVIII 184
XXIX 186
XXX 190
XXXI 191
XXXII 201
XXXIII 203
XXXIV 210
XXXV 215
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-488-2
ISBN e-book: 978-3-99131-489-9
Lektorat: Volker Wieckhorst
Umschlagfoto: Carlo Dapino, Releon8211 | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
I
Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln in meiner Nase. Ich erwache langsam und spüre, wie mein Kopf dröhnt. Meine Decke habe ich rausgestrampelt, und ich versuche, sie mir mit meinen noch steifen Fingern zu angeln. Mit Mühe kann ich sie ins Bett zurückzerren. Ich igle mich ein.
Mit halb offenen Augen blinzle ich auf die zweite Hälfte meines Doppelbettes. Sie ist leer und kalt. Die Daunendecke liegt ordentlich zusammengefaltet auf dem unbenutzten Laken. Langsam krampft sich mein Magen zusammen, ein Gefühl, mit dem ich in den letzten Tagen leben lernte. Ich spüre, wie die Übelkeit in mir hochsteigt, der ich nicht entrinnen kann und derer ich auch nicht in der Lage bin, mich zu entledigen. Mein Bauch ist leer.
Vorsichtig betaste ich mit den Fingerspitzen meine Backen, meine halb geschlossenen Augenlider, mein Gesicht. Es fühlt sich alles aufgequollen und heiß an. Mein Kissen ist feucht und kalt. Ich muss im Schlaf geweint haben, wie jede Nacht seit damals.
Kraftlos richte ich mich auf, reibe mir die Augen und lasse mich wieder zurückfallen. Meine Gedanken kreisen um jenen Tag, der meinem Leben eine Wende geben sollte, die ich nie für möglich gehalten hatte. Kurze Momente tauchen in meinem Kopf auf. Erinnerungen, die mich frösteln lassen. Notrufnummer, Polizei, das traurige Gesicht des Notarztes, der Leichenwagen, das offene Grab, der Eiffelturm, Paris. Gänsehaut bildet sich auf meinen Armen. Der kalte Schauder, der mir über den Rücken läuft, ist unangenehm. Ich schüttle meinen Kopf, um all die Gedanken zu verscheuchen, und richte mich abermals auf.
Langsam steige ich auf den Vorleger, suche mit meinen Zehenspitzen nach den Pantoffeln, angle mir meinen Hausmantel vom Haken und streife ihn mir über. Vorsichtig stehe ich auf. Das Zimmer beginnt sich zu drehen. Wenn ich diese Schwindelanfälle doch nicht hätte! An der Bettkante suche ich Halt und schiebe mich vorsichtig hoch. Mit schlurfenden Schritten erreiche ich schließlich die Küche. Ein Kaffee wird mir helfen, auf die Beine zu kommen.
Es ist alles wie immer. Nichts erinnert hier an die vergangenen Tage. Die Vase mit dem getrockneten Strauß Rosen steht wie eine stumme Zeugin in der Mitte des Esstisches. Endlich ist meine Kaffeemaschine betriebsbereit, was sie mit einem lauten Gurgeln und Keuchen ankündigt, und ich kann mir mein morgendliches Lebenselixier zubereiten. Ich nehme meine Lieblingstasse – ein Mitbringsel von seiner letzten Reise vor seinem Tod –, blau und weiß mit einem roten Herz. In der Mitte steht „Je t’aime“. Bis jetzt hatte ich nicht die Kraft, sie in den Müll zu werfen.
Er brachte sie mir aus Paris mit, meiner Lieblingsstadt, meiner zweiten Heimat. Auf meiner ersten Reise dorthin vor unzähligen Jahren hatte ich mich in sie verliebt. Besonders hatte ich immer den Frühling in Paris gemocht, mit den wunderbar duftenden Blumen in den Tuileries, dem zarten Frühlingswind, wenn er durch meine Locken fuhr, dem einzigartigen Geschmack der Croissants mit Café au lait zum Frühstück.
Er hatte mich gebeten, ihn zu begleiten, aber mein voller Terminkalender und mein Pflichtbewusstsein hatten es nicht zugelassen. Jammerschade! Hätte ich sein Angebot angenommen, wäre das Bett neben mir nun wahrscheinlich nicht kalt und ich nicht einsam.
Ich lasse mich auf einen Sessel nieder, auf einem zweiten stapeln sich Zeitschriften, alte Tageszeitungen und die ungeöffnete Post der letzten Tage. All die Kondolenzschreiben zu sichten, zu lesen oder gar zu beantworten, war mir bis jetzt unmöglich erschienen. Ich bin kraftlos, willenlos. In meiner Phantasie stelle ich mir vor, dass gleich die Türe aufgeht und die vertrauten Schritte auf mich zukommen mit den Worten „Guten Morgen, mein Schatz, gut geschlafen?“ Ich warte und lausche. Nichts dergleichen geschieht.
In Gedanken versunken trinke ich die Tasse leer, ohne es zu bemerken. Ich stehe auf, um nachzugießen. Wie spät ist es eigentlich? Was ist heute für ein Tag? Samstag? Sonntag? Ich muss mich konzentrieren.
Doch, es ist Sonntag, der 22. Mai, und ich kann von draußen die Kirchenglocken hören. Es ist später Vormittag. Ich suche in meiner Brotdose nach Gebäck. Ein altes Stück Kuchen liegt darin. Auch im Kühlschrank ist nichts zu finden, was meinem knurrenden, aber doch sehr sensiblen Magen gefallen würde. Ein Joghurt aus unbekannten Zeiten, ein Stück Hartkäse, dessen Rand bereits dunkelgelb und eingetrocknet ist, zwei Eier, von denen ich keine Ahnung habe, wie lange sie schon in der Eiertasse stecken.
Sonntag, das heißt, der Supermarkt um die Ecke hat geschlossen, und die nächste Tankstelle, wo man was Essbares erwerben kann, ist sechs Kilometer entfernt.
II
Ich lebe nicht mehr im Stadtzentrum Wiens, wo man rasch zu etwas Essbarem kommt.
Herbert und ich waren vor fünf Jahren in diese Gegend gezogen. Nach vielen Jahren Stadtleben wollten wir es ruhiger angehen lassen. Davor, also zur Studienzeit, hatten wir das Pulsieren der Großstadt geliebt. Unzählige Abende hatten wir in den wunderbaren und einzigartigen Kaffeehäusern der Stadt verbracht. Wie oft waren wir eng umschlungen durch die schöne Altstadt Wiens geschlendert, vorbei am imposanten Opernhaus, entlang der bekannten Einkaufsstraße bis hin zum Wahrzeichen Wiens. Gerne hatten wir das umfangreiche Veranstaltungsangebot dieser Stadt wahrgenommen, ob Kabarett, Musical, Theater oder Konzert, alles war uns willkommen gewesen. Wir hatten uns als Teil der Kultur gefühlt, am bunten Geschehen teilgenommen, uns treiben lassen.
Es hatte uns nichts ausgemacht, dass die Straßenbahn direkt vor dem Schlafzimmerfenster vorbeigefahren war und wir jeden Tag zur ersten Fahrt um 5:00 Uhr kurz erwacht waren. Es hatte uns nie gestört, dass der morgendliche Lärm des geschäftigen Treibens der arbeitenden Bevölkerung unsere oft kurze Nacht jäh beendet hatte.
Wir vereinten uns zum Morgengruß, anschließend genossen wir gemeinsam eine kalte Dusche. Danach noch meine morgendliche Sportrunde mit meinen Übungen, und der Tag konnte kommen. Wie hatten wir diese letzten Monate von Herberts Studienzeit genossen, zumindest an jenen Tagen, an denen wir uns trafen.
Kennengelernt hatte ich Herbert in Brüssel. Er war Student der Biochemie an der Universität Wien und absolvierte sein Erasmus-Semester. Ich studierte Kunstgeschichte und Französisch und hielt mich in dieser Stadt auf, um meine Sprachkenntnisse aufzubessern. Um meinen bescheidenen Lebensunterhalt zu bestreiten, musste ich einen Job als Billeteurin im Musée Fin-de-Siècle annehmen.
Es war im Dezember, und ein dichter, undurchdringbarer Nebel hatte sich seit Wochen in fast ganz Belgien festgesetzt. Es hatte auch nicht den Anschein, als ob die Sonne ihre Strahlen noch einmal vor März über Brüssel scheinen ließe. Eine trostlose Zeit, und mir fehlte jegliche Motivation, mich neben meinem Halbtagesjob und den Vorbereitungen für meine Abschlussprüfungen auf diese Stadt und ihre Schönheiten einzulassen.
Nach getaner Arbeit im Museum ging ich für gewöhnlich in mein kleines Apartment, das ich mit einer hiesigen Medizinstudentin teilte. Michelle war ein lebensfroher und offenherziger Typ. Ihr Optimismus und ihre Fröhlichkeit waren ansteckend, und manchmal schaffte sie es tatsächlich, mich aus meiner Lethargie zu reißen und in ein Café oder eine Bar zu verschleppen. Selten blieb ich länger als bis Mitternacht, mich interessierten die oberflächlichen Unterhaltungen und plumpen Annäherungsversuche der männlichen Gäste nicht im Geringsten. „Wenn schon ausgehen, dann mit Niveau“, war immer meine persönliche Devise. Für das Rumgehopse in einer Diskothek war ich generell zu spröde, und laute Musik zu hören gehörte nie zu meinen Leidenschaften.
Ich hatte nie geraucht und auch kaum Alkohol getrunken, weil er mir viel zu schnell ins Blut ging und ich den Konsum üblicherweise mit ausgedehnten Kopfschmerzen büßte. Außerdem wollte ich mein straffes morgendliches Sportprogramm, das ich seit Jahren absolviere, nie für eine unterdurchschnittliche Abendunterhaltung sausen lassen.
Jeden Tag lief ich von meinem Haus in der Rue des Sols zum Quai de L’Industrie, weiter die Senne entlang Ich liebte seit jeher das Glücksgefühl, welches in solchen Momenten in jede Faser meines Körpers dringt und mich mit Energie versorgt, von der ich einen ganzen Tag zehren kann, auch wenn an manchen Tagen eine anständige Portion Überwindung vonnöten ist, um in Kälte, Finsternis und Nieselregen joggen zu gehen. Gerade in jenen unwirtlichen Morgenstunden war es doppelt schwierig, den inneren Schweinehund zu besiegen. Nur mein eisener Wille meine Figur zu erhalten und die Gewohnheit, sich täglich zu bewegen, trieben mich an, kaum Ausnahmen zu erlauben.
Auf dem Rückweg machte ich einen kleinen Umweg über den Parc de Bruxelles, um hier meine Karateübungen durchzuführen.
Dass ich einen Sport wie Karate mache, habe ich in erster Linie meiner Mutter zu verdanken. Sie hatte mich im zarten Alter von sechs in einen Karatekurs gesteckt. Mehr aus einer Laune als aus wirklicher Überzeugung, denn in unserer Nachbarschaft wurde diese Möglichkeit angeboten. Sie hatte befunden, es wäre besser, sich zweimal in der Woche vernünftig zu bewegen, anstatt sich debil einem Gameboy zu widmen.
Im Laufe der Jahre hatte ich mich an diese Trainingseinheiten gewöhnt, und ich hatte begonnen, den tieferen Sinn dieser Sportart zu verstehen und zu lieben. So war sie zu einem fixen Bestandteil meines Lebens geworden. In meiner Pubertät war ich schließlich froh, dass ich diese in Österreich nicht sonderlich verbreitete Kampfsportart erlernen durfte. Nicht nur einmal hatten mir meine Fähigkeiten geholfen, ungebetene Verehrer in die Flucht zu schlagen. Ich war ein durchaus attraktives Mädchen gewesen, zwar etwas burschikos und überaus schlank geraten, aber meine dunkelblauen Augen mit den langen und dichten Wimpernkränzen sowie den darüber liegenden buschigen Augenbrauen hatten so manchen Jüngling fasziniert. Meine dunkelbraunen lockigen Haare trage ich seit jeher stets kurz geschnitten, wobei mir immer ein bis zwei Locken frech in die Stirn hängen. Zusätzlich bin ich noch immer von sportlicher Statur, und mein durchtrainierter Oberkörper sowie meine langen Beine waren damals und sind heute noch ein Blickfang für so manchen Mann.
Obwohl ich, ohne als Narzisstin abgestempelt zu werden, mich selbst nach wie vor als hübsch bezeichne, war ich nie darauf aus, auf Männer Eindruck zu schinden und Kapital aus meinem wohlgeformten Körper zu schlagen. Meine Liebschaften beschränkten sich auf sehr wenige One-Night-Stands. Einer ernsthaften Beziehung war ich lange Zeit aus dem Weg gegangen.
Meine Mutter hatte mich immer bestärkt, Sport zu machen, auf meine Figur zu achten und Vorsicht gegenüber Männern walten zu lassen. Warum ihr Vertrauen in Männer zutiefst erschüttert war, konnte ich erst nach ihrem Tod in Erfahrung bringen. Sie starb viel zu früh an einem Herzinfarkt. Damals war ich 16 Jahre alt gewesen.
So war ich eben zu einer ernsten jungen Frau herangereift, die früh für sich selbst sorgen musste und nie das Bedürfnis verspürte, nächtelang durch Städte zu ziehen, stattdessen bereitete mir ein gutes Buch oder eine optimale Vorbereitung auf meine Prüfungen wesentlich größere Befriedigung.
Bald sollte ich wieder nach Wien zurückkehren und mein Studium zu Ende bringen. Noch hatte ich keine Vorstellung, was ich mit meinem Diplom anfangen könnte. Meine wenigen Freunde hatten mich davor gewarnt, Kunstgeschichte zu studieren – kein Mensch würde das brauchen in Zeiten wie diesen. Oft kam die Frage: „Willst du in einem Museum versauern?“ Meine Vorstellung war eher, als Gutachterin für Versicherungen zu arbeiten. Eine andere beinahe fixe Idee von mir war, bei der Wiederbeschaffung von geraubten Kunstgegenständen oder deren Bewertung mithelfen zu können. In meinen Augen gab es ein reiches Betätigungsfeld für jemanden, der Kunstgeschichte studiert hatte. In jedem Fall aber hätte ich mich mit dem Nachhilfeunterricht in Französisch oder mit dem Abhalten von Sprachkursen über Wasser halten können, bis sich für mich ein interessanterer Job auftäte.
Meine monatlichen Ausgaben hielten sich zum Glück in Grenzen. Von meinen Eltern hatte ich eine passable und schuldenfreie Eigentumswohnung in Wien geerbt, die ich benutzen und im schlimmsten Fall verkaufen und mir im Gegenzug etwas Kleineres zulegen konnte. Die Betriebskosten waren gering, und ich selbst schwelgte lange Zeit meines Lebens nicht im Luxus. Solange mein Vater gelebt hatte, war es finanziell zwar einfacher, aber Verschwendung oder Übermaß waren selbst in dieser Zeit in unserer Familie verpönt gewesen. Nach seinem Tod wurde der Gürtel beachtlich enger geschnallt. Meine Jeans trug ich so lange, bis sie völlig verblichen waren und an manchen Stellen schon das Innengewebe durchschien. Die Ärmel meiner Sweatshirts hatten selten die richtige Länge. Anfangs waren sie immer zu lang, sodass ich sie zweimal umschlagen musste, irgendwann hatten sie modische Dreiviertelärmel und waren so ausgewaschen, dass es schon wieder cool aussah. Mit dem bescheidenen Gehalt meiner Mutter als Buchhalterin in einer Steuerberatungskanzlei und der kleinen Waisenrente war man angehalten, keine großen Ansprüche zu stellen.
Die Erinnerungen an meinen Vater sind sehr vage und beinhalten keine besonders glücklichen Momente. Er war ein stattlicher, überaus attraktiver Mann gewesen, der vermutlich viele Frauenherzen gebrochen hatte. Wenn er zur Arbeit gefahren war, hatte er stets einen dunkelblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine blitzblaue Krawatte getragen. Mit diesem Outfit wurden sein dunkelbrauner Lockenkopf und seine stahlblauen Augen perfekt betont.
Manchmal hatte ich als kleines Kind Angst, wenn ich tief in sie blickte. Fix bildete ich mir ein, dass in seinem Kopf eine Hexe wohnte und ich den Besen in seinen Augen ganz deutlich sehen konnte. Nie wagte ich es aber, ihm meine Phantastereien zu erzählen. Die Hexe würde den Verrat ihres Verstecks bestimmt bitter rächen und mir mit ihrem Besen den Hintern weichklopfen. Was sich Kinder doch so zusammenspinnen!
Als Finanzbeamter verdiente mein Vater zwar kein Vermögen, aber es reichte aus, um eine schöne Eigentumswohnung in einem ruhigen Viertel Wiens anzuschaffen, in den Sommerferien Italiens Strände zu genießen und im Winter den einen oder anderen Tag auf der Skipiste zu verbringen.
Standardmäßig sprach er mich mit Püppi an, was ich verabscheute. Ich fand, dass ich keine Puppe war, sondern ein ganz normales Mädchen, und so wollte ich auch behandelt werden. Meine Mama nannte mich immer bei meinem vollen Namen. Susanne gefiel mir gut.
Die Ehe meiner Eltern war bestimmt nicht das gewesen, was sich beide zum Zeitpunkt ihrer Heirat erwartet hatten. Meine Mutter war sehr jung, als sie meinen Vater kennenlernte, und sie war viel zu schnell seinem Charme erlegen. Kaum, dass sie sich kannten, wurde meine Mutter mit mir schwanger. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Umstand nicht in Vaters Lebenskonzept passte. Vielleicht hatte meine Mutter sich auch bewusst schwängern lassen, in der Hoffnung, diesen attraktiven Kerl ganz für sich zu haben. Jedenfalls zogen sie zusammen und heirateten.
Es dauerte nicht lange, bis mein Vater seinem Jagdtrieb wieder freien Lauf ließ und die eine oder andere außereheliche Affäre hatte. Wie oft er meine Mutter tatsächlich betrogen hatte, weiß ich nicht. Aber ihr trauriger Blick, wenn er wieder einmal spätabends heimkam oder angeblich samstags ins Büro musste, verriet mir, dass etwas nicht stimmte. In meiner Gegenwart bemühte sie sich, das Bild von der heilen Familienwelt aufrecht zu halten. Kein Ton kam ihr über die Lippen, die verdächtig bebten, wenn Vater grußlos die Wohnung verließ und sie auf meine Frage, wann er zurückkehren werde, keine Antwort wusste. Vielleicht waren ihr Eifersuchtsszenen in meiner Gegenwart peinlich, oder sie fürchtete, dass ihr Mann gar nie mehr den Weg zurück nach Hause nehmen würde. Sie litt still und heimlich, aber sie wusste, dass sie diesen Mann für ihre restliches Leben mit anderen Frauen würde teilen müssen. Wieso sie diesen Mistkerl nicht verlassen hatte, war mir selbst nach ihrem Tod noch ein Rätsel.
Mein Vater neigte überdies zu cholerischen Anfällen, die aus Nichtigkeiten entstanden wie einer zerbrochenen Tasse oder einem Loch in meiner Hose. Nicht selten rutschte ihm bei solchen Anlässen die Hand aus, und ich kassierte eine schallende Ohrfeige. Dafür hasste ich ihn aus tiefstem Herzen und manchmal wünschte ich mir, die Hexe in seinen Augen möge ihn in eine Spinne verwandeln, die ich genüsslich zwischen meinen kleinen Fingern zerquetschte. Als mich die Nachricht traf, dass er tödlich verunglückt sei, wusste ich daher anfänglich nicht, ob ich traurig sein oder mich darüber freute sollte.
III
Der Tod ereilte ihn an einem schönen sonnigen Herbstnachmittag. Ich spielte mit den Nachbarskindern auf der nahegelegenen Wiese Fußball, als ein Polizeiwagen vor dem Wohnblock anhielt, in dem unsere Wohnung lag. Unmittelbar danach traf ein Rettungsauto mit Blaulicht ein. Neugierig verließ ich den Spielplatz, um nachzusehen, was denn passiert war.
Just in diesem Moment stürzte meine Mutter schreiend und tränenüberströmt aus dem Haus. Mein Herz begann zu rasen, und ich lief los, langsam, dann immer schneller. Ein Polizeibeamter kam mir entgegengerannt, und ich stolperte geradeaus in seine ausgebreiteten Arme. Er fing mich auf und hob mich vom Boden ein Stück hoch.
„Lass mich!“, schrie ich aus Leibeskräften und wollte mich mit einem gezielten Tritt, den ich von meinem Karateunterricht kannte, befreien.
Doch der Beamte war schneller. Er wich meinen Füßen geschickt aus, kriegte meine Beine zu fassen und stellte mich wie eine zerbrechliche Vase vorsichtig auf den Boden.
„Nein!“
Ich schrie mir meine Seele aus dem Leib, ohne zu wissen, was hier eigentlich vor sich ging. Der Beamte redete langsam und bedächtig auf mich ein, bis ich endlich zu schreien aufhörte und leise schluchzend dastand. Aus einigen Schritten Entfernung konnte ich beobachten, wie meine Mutter in sich zusammensackte. Ein Rettungshelfer konnte sie gerade noch auffangen, sodass sie nicht mit voller Wucht auf den Boden knallte. Ein zweiter Sanitäter eilte zu Hilfe, und vorsichtig hoben die beiden Männer sie auf die Trage im Rettungswagen. Mit tränenerstickter Stimme fragte ich den Beamten, was denn geschehen sei. Er antwortete nicht und sah mit ernster Miene in mein kleines, verheultes Gesicht. Angst kroch in mir hoch, ich spürte, wie ich am ganzen Körper zu zittern begann. Mir war plötzlich kalt.
„Bitte sagen Sie mir, was los ist“, bettelte ich ihn an.
Doch er blieb stumm. Behutsam hob er mich auf, streichelte mir ein paarmal über meine Haare und trug mich zu meiner Mutter. Sie war augenscheinlich nicht bei Bewusstsein. Er setzte mich auf den Sessel neben der Trage, schaute mich lange an und sagte ruhig zu mir: „Halte die Hand deiner Mama, sie wird dich spüren. Dann wird es ihr bald wieder besser gehen.“
Traurig schaute er mich an.„Wo ist Papa?“, fragte ich ihn zaghaft.
Statt einer Antwort fragte mich der Polizist: „Wie alt bist du denn?“
„Acht, und du?“
Er lächelte jetzt und antwortete verschmitzt: „Junge Dame, so was fragt man einen alten Herrn nicht.“
Auch ich musste nun lächeln. Ich schätzte den Mann ungefähr gleich alt ein wie meinen Vater, doch ich hatte meinen Vater noch nie in die Kategorie der alten Herren abgeschoben. Nochmals setzte ich an: „Wo ist mein Papa?“
Wieder erhielt ich keine Antwort auf meine Frage, dafür sagte er: „Begleite deine Mama nun ins Krankenhaus, sie wird bald wieder gesund sein. Du bist bestimmt ein tapferes und liebes Mädchen. So wie meine Tochter. Wir kümmern uns inzwischen um deinen Papa.“
Ein Ersthelfer schloss nun die Tür des Rettungswagens. Der Polizist winkte mir zu, und ich winkte zurück. Dann fuhren wir los.
Im Fond des Wagens hatte eine sympathische Frau mit dunklen langen Haaren und einem weißen Kittel Platz genommen, die meine Mutter an verschiedene Schläuche anschloss, ihren Brustkorb mit einem Stethoskop abhorchte und ihr eine Spritze in die Armbeuge gab. Nachdem sie die Injektion verabreicht hatte, schaute sie zu mir herüber.
„Hallo, ich bin Lisa. Ich bin Notärztin und werde deiner Mama helfen, damit sie bald wieder aufwacht. Und wer bist du?“ fragte sie und wendete ihren Blick wieder den Monitoren zu.
„Ich heiße Susanne. Was hat Mama? Ist Mama tot?“
Verzweifelt wanderte mein Blick zwischen dem Gesicht meiner Mutter, den Bildschirmen auf denen grüne und weiße Striche wie von selbst liefen und Lisa hin und her.
„Nein. Deine Mama hat einen Schock. Sie ist bewusstlos, aber bald wird sie wieder ihre Augen öffnen.“
Lisa war mir sympathisch. Sie hatte eine samtweiche, vetrauensbildende Stimme. Endlich bemerkte ich, wie meine Mutter blinzelte.
„Mama!“, rief ich und sprang von meinem Sitz auf.
Gleichzeitig konnte ich Lisas mahnenden Blick spüren, und sofort setzte ich mich wieder hin. Der Rettungswagen war sehr flott unterwegs, und sie wollte bestimmt nicht riskieren, dass ich mich verletzte.
Langsam hob meine Mutter ihre rechte Hand und ergriff die meine. Sie drückte sie. Ihr Körper begann zu zittern, zuerst leicht, dann immer stärker. Tränen rollten über ihre Wangen, anfangs vereinzelt, dann immer mehr und mehr, bis sich ein regelrechter Sturzbach über ihr kahlweißes Gesicht ergoss. Was war geschehen? Völlig verwirrt und mit einem Gefühl der totalen Hilflosigkeit saß ich da und beobachtete sie. Ein riesiger Kloß saß in meinem Hals, ich brachte keinen Ton hervor. Lisa griff nach der anderen Hand meiner Mutter und hielt sie fest. Dann nahm ich allen Mut zusammen, atmete tief durch und öffnete den Mund. Mehr als ein zittriges „Mama?“ brachte ich nicht hervor, obwohl hundert Fragen durch mein Gehirn geisterten.
Sie nickte mir zu und presste ihre Lippen fest aufeinander. Umständlich versuchte meine Mutter, sich aufzurichten. Lisa half ihr dabei und stützte mit ihrem Arm den Rücken. Mit viel Anstrengung stieß Mama endlich hervor: „Dein Vater hatte einen Unfall mit dem Auto. Er ist tot, Susanne!“
Tot? „Was bedeutet das genau?“, fragte ich mich. Hieß das etwa, er würde nicht wieder heimkommen? Er würde nie mehr seine Wutanfälle haben und mich ohrfeigen? Fast machten mich diese Gedanken ein wenig glücklich. Was wusste man im zarten Alter von acht Jahren über den Tod? War Papa im Himmel oder anderswo? Wieso hatte er sich nicht verabschiedet? Mir schwirrte der Kopf. Ich hatte unendlich viele Fragen, die zu formulieren ich nicht in der Lage war.
Nach einer langen Nachdenkpause war ich zu einem für mich überzeugenden Schluss gelangt.
„Macht nichts, Mama, wir können auch ohne Papa leben. Er kann uns doch vom Himmel aus beobachten, wenn er möchte.“
Auch wenn meine Stimme zitterte, wollte ich einen legeren Ton anschlagen. Es war ein fataler Irrtum, als ich dachte, mit diesen Worten meiner Mutter Trost zu spenden. Auf ihrer Stirn bildeten sich Falten und ihre Augen wurden schmal und funkelten zornig.
„Wie kannst du es wagen?“, brüllte sie mich mit einer Stimme an, die mir völlig fremd war.
Erschrocken und gleichzeitig hilfesuchend blickte ich zu meinem Gegenüber und erwartete, dass Lisa für mich Partei ergriff. Was hatte ich in meiner kindlichen Naivität Falsches von mir gegeben? Lisa war ein Engel. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen gelang es ihr in kurzer Zeit, die überhitzte Atmosphäre in ruhigere Bahnen zu lenken.
„Bitte, regen Sie sich nicht so auf, Frau Schöder. Sie müssen sich schonen. Ihre Tochter ist noch ein kleines Mädchen, das die Bedeutung von Tod und dessen Tragweite noch nicht erfassen kann. Gehen Sie nicht so hart mit ihr ins Gericht.“
Und an mich gewandt: „Susanne, du musst stark sein für deine Mutter. Deine Mama hat deinen Papa geliebt und du wirst ihn bestimmt auch vermissen. Von nun an seid ihr beide allein. Auch wenn dein Papa dich vom Himmel aus beobachtet und beschützt, er ist nicht mehr hier, und das ist sehr schwer zu ertragen. Verstehst du das?“
Ich nickte, obwohl ich grübelte, ob ich meinen Papa tatsächlich geliebt hatte und ob er mir in Zukunft fehlen würde. Ich wusste es nicht. Er war einfach immer da in meinem Leben, manchmal hätte ich ihn mir aber weggewünscht.
Meine Mutter ließ sich zurückfallen und schloss ihre Augen. Die Erschöpfung zeichnete sich in ihrem kreidebleichen Gesicht ab. Sie wirkte unendlich müde und schien auf einen Schlag um zehn Jahre älter geworden zu sein.
Nach einer für mich unendlich langen Fahrt waren wir im Krankenhaus angekommen. Man brachte uns in ein Zimmer, in dem zwei Betten standen. In das eine wurde meine Mutter gelegt. Sie dämmerte vor sich hin und sprach an diesem Tag kaum mehr mit mir. Die Krankenschwestern waren sehr nett und brachten mir Malbücher, Stifte und ein paar Comics zum Lesen, aber im Grunde langweilte ich mich furchtbar. Lieber wäre mir gewesen, ich hätte auf der Station herumschlendern und die Ärzte bei ihrer Arbeit beobachten können. Das durfte ich aber nicht. Die Stunden bis zum Schlafengehen vergingen unsagbar langsam, und als es finster wurde und ich auf dieser harten und nach Desinfektionsmittel riechenden Matratze lag, konnte ich erst recht nicht einschlafen, weil ich immerzu an Papa denken musste und mir ausmalte, was er denn gerade im Himmel tun würde.
Am folgenden Morgen wurde Mama wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Man gab ihr Rezepte für Medikamente, die wir auf dem Heimweg, den wir mit einem Taxi bestritten, besorgten. Ihr Zustand war stabil, sagten die Ärzte, was immer das auch bedeuten mochte, und langsam schien sie sich mit dem Tod ihres Mannes abzufinden. Ich wollte sie nach dem Unfall fragen, aber sie wehrte unwirsch ab.
„Eines Tages werde ich dir erzählen, was passiert ist. Jetzt kann ich es einfach nicht. Bitte, liebe Susanne, verzeih mir.“
Ja, irgendwann würde sie es mir erzählen. Damit gab ich mich zufrieden, weil ich wusste, dass meine Mutter ihre Versprechen hielt.
Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit Vorbereitungen für die Erdbestattung meines Vaters, Amtswegen und Behördengängen. Unentwegt läutete das Telefon. Freunde, Bekannte, Verwandte boten ihre Hilfe an oder kondolierten. Zuerst wollte mich die Schule für ein paar Tage vom Unterricht freistellen. Ich bettelte aber darum, zur Schule gehen zu dürfen. Was hätte ich daheim schon ausrichten können? Meine Mutter war sicherlich froh, dass ich zumindest einen halben Tag beschäftigt war und sie sich nicht auch noch um mich kümmern musste. Nur am Tag des Begräbnisses blieb ich zu Hause.
Die Beerdigung meines Vaters fand an einem trüben Novembertag statt. Es war unangenehm kalt, und ich fror entsetzlich in meinem schwarzen Rock und den dünnen Halbschuhen. Um mir die Zeit während der Verabschiedungszeremonie kurzweiliger zu gestalten, zählte ich die roten Rosen auf dem hellen Eichensarg und lauschte aufmerksam der Trauermusik. Die Worte des Pfarrers interessierten mich nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit gingen die Trauergäste in einer Zweierreihe zum Friedhof. Fast war es wie in der Schule. Ich durfte mit Mama direkt hinter dem Sarg hergehen, worüber ich richtig froh war., In der Mitte einer Menschenschlange zu gehen und auf den Rücken des Vordermannes zu starren, war mir von klein auf ein Gräuel und verursachte ein klaustrophobisches Gefühl. Danach musste ich eine Ewigkeit vor dem offenen Grab stehen. Zuerst kam der Pfarrer. Er spritzte jede Menge Weihwasser in die Grube und auf den Sarg, dazu murmlte er mir unverständliche Segensworte. Auch der Kirchenchor war mitgekommen und untermalte das letzte Geleit musikalisch. Jedes Mal wenn sich die Stimmen erhoben, fing Mama von Neuem an zu weinen. Als der Sarg endlich in die Grube hinabgesenkt war, kam Bewegung in die Menschenmenge. Viele Leute, die ich nicht einmal kannte, defilierten. Manche schüttelten Mama und mir die Hand, manche umarmten uns. Ich ließ die Szenerie über mich ergehen und hoffte, dass alles bald vorbei war. Meine Zehen hatten sich zu Eiszapfen geformt, und meine Nasenspitze spürte ich gar nicht mehr. Ich ließ meinen Blick über die Gräber schweifen, versuchte mir die Namen, Geburts- und Sterbedaten, die in die Steine gemeißelt waren, zu merken und hoffte auf ein baldiges Ende des traurigen Schauspiels.