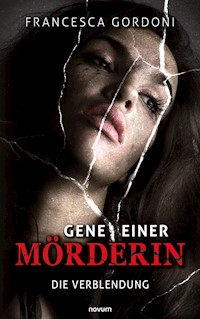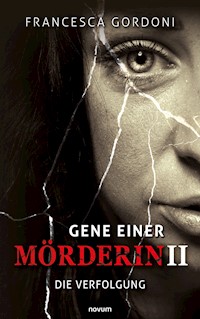
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor drei Jahren hat Susanne einen Mordversuch überlebt. Seitdem hat sie langsam in den Alltag zurückgefunden. Nicht nur das: vor Kurzem hat sie ihr erstes Kind geboren. Sie ist überglücklich. Als ihr kleiner Sohn aber plötzlich aus dem Krankenhaus verschwindet, bricht ihre Welt zusammen. Er wurde entführt und das von niemand anderem als Manuel, dem Mann, der sie hatte ermorden wollen. Als dann auch noch ihr Freund unauffindbar ist, hält sie nichts mehr. Susanne fasst einen Entschluss: Nichts wird sie daran hindern, ihr Kind wiederzubekommen. Weder Manuel noch die Polizei. "Bleib ruhig, Susanne, denke ich mir, sehr bald wirst du dein Kind wiedersehen und in die Arme schließen können. Vorher werde ich Dinge tun, die getan werden müssen, um endlich Frieden zu finden."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99131-779-1
ISBN e-book: 978-3-99131-780-7
Lektorat: Theresia Riegler
Umschlagfotos: Releon8211, Fotoduki | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
1.
Ich sehe seine funkelnden Augen hinter einer abgedunkelten Windschutzscheibe. Sie leuchten wie zwei Smaragde. Wie angewurzelt stehe ich da.Lauf Susanne, lauf weg!,befiehlt mein Kopf, aber meine Füße sind in einen Betonklotz eingegossen. Er gibt Gas, das Augenpaar kommt näher, noch näher. Mein Mund öffnet sich zum Schrei, aber ich bleibe stumm. Hunderte Leute stehen am Straßenrand und beobachten das Spektakel. Sie lachen, schwatzen und stoßen mit den Bierflaschen, die sie in ihren Händen halten, an. Wieso greift keiner ein? Warum hilft mir niemand? Das Motorengeräusch hämmert an mein Trommelfell, das Quietschen der Reifen schmerzt in den Ohren. Jetzt, genau jetzt! Bumm!
Schweißgebadet schrecke ich auf. Wo bin ich? Alles um mich herum ist weiß. Die Wände, der Fußboden, die Türen. Da! Ein Fenster! Ein durchsichtiger Store bauscht sich nach innen. Ganz sanft. Eine leichte Brise streicht über meinen Kopf hinweg, die Sonne lächelt mir freundlich ins Gesicht.
Ein Traum, es war nur ein böser Traum! Ich liege in einem Krankenbett. Krankenhaus? Verdammt, was mache ich hier? Meine Hand tastet nach meiner Kehle. Sie schmerzt nicht. Sie ist frei, ich kann atmen, kein Druck, der die Gurgel abschnürt. Langsam, ganz langsam komme ich im Heute an. Ich lächle erleichtert. Ja, ich liege in einem Krankenbett, besser gesagt im Wochenbett. Gestern habe ich einen Sohn zur Welt gebracht. Mühevoll, qualvoll. Doch die Schmerzen sind vergessen. Julian ist geboren. Drei Wochen zu früh. Er hatte es eben eilig. Aber er ist gesund und kräftig. Ich versuche mich zu bewegen. Vorsichtig. Noch bekomme ich Infusionen und mein Unterleib ist verbunden. Julian kam per Kaiserschnitt.
Meine Blase fordert, entleert zu werden. Kurz überlege ich, einfach die Füße auf den Boden zu stellen, den Ständer mit der Infusionsflasche zu schnappen und loszutraben. Hatte die freundliche Schwester aber nicht genau davor gewarnt? Ich solle läuten, wenn ich aufstehen müsse. Oder war das schon gestern gewesen? Das Zeitgefühl hat mich verlassen. Ich suche nach der roten Glocke mit dem Schwesternsymbol und drücke drauf. Das Rot beginnt zu blinken. Bald höre ich Schritte am Gang und die Türe zu meinem Zimmer öffnet sich. Schwester Nina tritt ein.
„Ah, Frau Kramer, wieder munter?“
„Ja. Ich muss mal.“
Sie schaut mich freundlich an.
„Warten Sie, ich helfe Ihnen.“
Sie kommt auf mein Bett zu. Ich setze mich auf und schwinge meine Beine heraus. Im gleichen Moment spüre ich, wie sich das Zimmer im Kreis zu drehen beginnt.
„Uch.“
Ich brauche meine ganze Kraft, um nicht rücklings wieder in die weiche Matratze zu plumpsen.
„Ja, das kann schnell gehen, dass einem schwindlig wird“, stellt Schwester Nina lapidar fest.
Sie ist eine kräftige Person. Ich mutmaße, dass ihr Pensionsantrittsalter in nicht allzu weiter Ferne liegt. Gekonnt hilft sie mir auf die Beine und ich kann mich bei ihr unterhaken. In die andere Hand nehme ich mein fahrendes Gestell. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Es kostet mich viel Mühe und Konzentration. Endlich erreichen wir die Toilette. Diskret verzieht sich Schwester Nina aus dem Badezimmer. Sie wartet vor der Türe. Nach etwa zwei Minuten höre ich sie.
„Alles in Ordnung, Frau Kramer?“
„Ja“, antworte ich matt.
Als sie die Spülung hört, öffnet sie wieder die Tür und wir gehen Hand in Hand zurück. Erschöpft lasse ich mich in mein Bett fallen.
„Wo ist Julian?“, frage ich, während ich mir die Decke wieder über meinen Körper ziehe.
„Er ist im Säuglingszimmer und schläft. Ich denke, in etwa zwei Stunden wird er wiederkommen. Dann wird er hungrig sein. Wie geht es Ihnen beim Stillen?“
„Gut.“
Ein bisschen schwindle ich. Der Kleine trinkt brav, aber er ist sehr ungestüm und meine Brustwarzen sind außerordentlich empfindlich. Ich werde über kurz oder lang Stillhütchen verwenden müssen, wenn ich nicht schon nach drei Tagen aussehen will, als ob die Ratten an mir genagt hätten.
Eine andere Schwester hatte diesen Umstand bereits im Blick und mir vorsorglich zwei von diesen Dingern in meinen Nachtkasten gelegt.
Schwester Nina geht zum Fenster.
„Ein herrlicher Frühlingstag, nicht wahr?“
Ich nicke, obwohl sie mit dem Rücken zu mir steht und ich den Himmel gar nicht sehen kann.
„Soll ich das Fenster schließen?“
„Nein, bitte nicht. Die frische Luft tut mir gut.“
Sie dreht sich um, lächelt mich zustimmend an und geht aus dem Zimmer. Ich inhaliere den frischen Frühlingsduft und schließe meine Augen. Mein Gott, was habe ich für ein Glück, dass ich noch lebe und dass ich Mutter werden durfte!
Seit Manuel versucht hat mich umzubringen, sind drei Jahre vergangen. Das erste Jahr nach dem Vorfall war die Hölle. Zuerst lag ich über zwei Monate im Krankenhaus. Die Ärzte wussten nicht, ob ich je wieder gesund werden würde. Zwei Wochen lag ich im Koma, meine Motorik war von der Sauerstoffunterversorgung durch das Würgen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Als ich endlich wieder wach war und aus dem Spital entlassen wurde, begannen unzählige Therapien. Physiotherapie, kinetische Übungen, Koordinationsgymnastik, Gedächtnisübungen. Eine Psychotherapie, um die Todesangst, die ich ausgestanden hatte, zu verarbeiten. Manchmal hatte ich mir gewünscht, Manuel hätte seine Tat zu Ende geführt. Aber meine gute körperliche Konstitution und mein Wille, mich irgendwann an Manuel zu rächen, hielten mich wohl am Leben. Den einzigen Schaden, den ich von diesem Ereignis behalten habe, ist, dass auf dem rechten Auge meine Sehkraft eingebüßt hat und mich gelegentlich migräneartige Kopfschmerzen für ein bis zwei Tage ans Bett fesseln.
Nach dieser ganzen Tortur musste ich auch noch damit leben, dass Manuel mich bei den Gerichtsverhandlungen schwer belastete und behauptete, dass ich Herbert und davor Marie getötet hätte. Hunderte von Befragungen durch die Kriminalpolizei musste ich über mich ergehen lassen. Unzählige Male musste ich auf ein Polizeipräsidium zur Einvernahme. Zweimal wurde mein Haus gründlich durchsucht. Kein Beweis, nicht einmal irgendein Hinweis, der wenigstens als Indiz brauchbar gewesen wäre, war zu finden.
Fast hätte man Herberts Leiche exhumiert. Aber jener Arzt, der nach Herberts Tod die Obduktion durchgeführt hatte, war ausgesprochen überzeugend gewesen. Herbert war demnach den Verletzungen, die er sich beim Sturz über die Kellertreppe zugezogen hatte, erlegen.
Einzig meine damalig beste Freundin Nathalie war eine unberechenbare Komponente. Sie hatte die letzten Worte Manuels gehört, die er an mich richtete, bevor ich die Besinnung verloren hatte. In ihr keimten Zweifel auf, ob ich nicht doch meine Hand bei Herberts Unfall im Spiel gehabt hatte. Oft versuchte sie, mich aus der Reserve zu locken und einmal hätte sie es fast geschafft, dass ich mich ihr anvertraut hätte. Sie besuchte Manuel sogar in der Untersuchungshaft. Was die beiden dort gesprochen hatten, erfuhr ich nie. Sie hatte ihn nie besonders gemocht, deswegen war ich umso überraschter, als ich davon erfuhr. Sie war meine Freundin, meine einzige Vertraute, aber ihr unbändiger Gerechtigkeitssinn ließ sie ihre Nase in Dinge stecken, die sie nichts angingen. Sie war die Einzige, die mich je nach den Schuhen fragte, mit denen Herbert ausgerutscht war. Nicht einmal der Polizei war dieser Umstand aufgefallen.
Das hätte sie nicht tun sollen. Woher sie davon Wind bekommen hatte, kann ich nur erahnen. Von Manuel. Sie war für mich zu einer tickenden Zeitbombe geworden. Ich konnte nicht einschätzen, wann und ob sie je explodieren würde.
Tja, Nathalie! Sie fehlt mir wirklich. Wie würde sie sich, unter normalen Voraussetzungen gedacht, freuen, wenn sie wüsste, dass ich Mama geworden bin! Schade! Wir waren seit unserer Schulzeit eng befreundet gewesen, auch wenn sie nicht jedes Detail von mir wusste.
Vier Monate nach dem grässlichen Attentat Manuels auf mich wurde Nathalie auf einem Zebrastreifen in Wien von einem Autofahrer niedergestoßen und dabei getötet. Der Lenker stand unter Drogeneinfluss, sagt man. Ihm wurde der Prozess gemacht, in dem er allerdings immer wieder beteuerte, dass er sich nicht entsinnen könne, jemals das Unglücksfahrzeug gesteuert zu haben. Er erzählte stets die gleiche Geschichte. Er sei von einem Unbekannten für unmäßig viel Geld angeheuert worden, ein Fahrzeug zu mieten und sich zur Unglückszeit genau an der Kreuzung einzufinden, an der Nathalie zu Tode kam. An mehr konnte er sich beim besten Willen nicht erinnern. Es gab keine Augenzeugen. Für die Staatsanwaltschaft war der Fall allerdings sonnenklar. Ein durchgeknallter Junkie, der in seinem Rausch ein Auto lenkte und dabei unglücklicherweise eine junge Frau und Mutter überfuhr. So wurde er wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr Haftstrafe und zu einem Zwangsentzug verurteilt.
So furchtbar ich damals den Verlust meiner Freundin empfunden hatte, so froh war ich gewesen. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob Nathalie es nicht irgendwann geschafft hätte, die Wahrheit aus mir herauszubekommen. Womöglich wäre es ihr sogar gelungen eine dichte Indizienkette zu stricken, die mir zum Verhängnis hätte werden können.
So blieben nur noch Manuel und ich. Er ahnte und ich wusste, was geschehen war. Dass man vor Gericht einem potenziellen Mörder weniger Glauben schenken würde, hatte ich gehofft. Ein Jahr lang hatte sich der Prozess gezogen und am Ende wurde Manuel wegen versuchten Mordes zu vier Jahren Haft verurteilt. Sämtliche Ermittlungen gegen mich wurden eingestellt.
Herberts Vater setzte, unmittelbar nachdem er hatte erfahren müssen, dass sein Sohn schwul war, seinem Leben mit einem Jagdgewehr ein Ende. Er wollte sich nicht der vermeintlichen Schmach aussetzen, der Vater eines Homosexuellen zu sein. Nicht in dem biederen und streng traditionellen Umfeld, in dem er zu leben gewohnt war. Herberts Mutter ging zurück nach Frankreich und lebte fortan bei ihrer Schwester in Grenoble.
Was Manuels Eltern betrifft, weiß ich nichts Genaueres. Ich sah sie zum ersten und letzten Mal bei seiner Urteilsverkündung. Als wir damals das Gerichtsgebäude verließen, spuckte mir sein Vater verächtlich vor die Füße. Seine Mutter blickte mich mit rot verweinten, bittenden Augen an. Hatte sie etwa erwartet, dass ich umdrehe, zurück in den Gerichtssaal gehe und einen oder zwei Morde gestehe? Das hätte nichts an der Verurteilung Manuels geändert, er war eben ein potenzieller Mörder.
Nachdem der Prozess endlich vorbei war, gab es für mich in Wien nichts mehr zu tun. Ich verkaufte mein Haus südlich der Stadt, kündigte meinen Job und zog nach Strasbourg. Selbst den Kontakt zu meiner zweiten Freundin Christine sowie zu Nathalies Mann Gernot und seinen Kindern brach ich endgültig ab. Meinen Nachnamen ließ ich auf Kramer ändern. Ich wollte meine ganze Vergangenheit hinter mich wissen und ein neues Leben beginnen.
Durch den Verkauf des Hauses hatte ich genug Rücklagen. In Strasbourg erstand ich ein nettes Apartment im letzten Geschoss eines stilvollen Fachwerkbaus und richtete es mir gemütlich ein. Ich wollte mich nicht mehr binden und wählte bewusst eine kleine, aber feine Wohnung, die für einen Single optimal und für mehr als eine Person einfach zu beengend war.
Mein Körper hatte sich von all den Strapazen gut erholt, nur mein Kopf spielte mir immer wieder Streiche. Ganz plötzlich und ohne Vorwarnung bekam ich Schwindelanfälle oder starke Schmerzen, sodass ich mich augenblicklich hinsetzen oder ins Bett legen musste. Die Ärzte hatten gesagt, dass sich diese Anfälle im Laufe der Jahre bessern würden, was tatsächlich stimmte. Vor allem während der Schwangerschaft durfte ich mich freuen, dass mich keine einzige Migräneattacke heimsuchte.
Als ich mich gut in diesem französischen Städtchen eingelebt hatte, begab ich mich auf Arbeitssuche. Es dauerte keine zwei Monate und ich bekam eine fixe Anstellung als Co-Unterrichtende in Deutsch an einer Schule für angehende Modedesigner. Als alleinstehende Frau ohne Kinder war ich willkommen auch am Nachmittag als Lernbetreuung eingeteilt zu werden. Die Arbeit mit den Schülern machte mir Spaß und ich ging förmlich darin auf.
Lange Zeit vermied ich es, wieder engeren Kontakt zum anderen Geschlecht zu suchen. Zu tief saß die Enttäuschung und vor allem hatte ich Herbert über alles geliebt, obwohl ich schändlich hintergangen und benutzt worden war. Immer wenn ich mit einem Kollegen ausging, stellte ich im Unterbewusstsein Vergleiche mit Herbert an, und jedes Mal scheiterte der Beginn einer Beziehung an einer Kleinigkeit. Einmal fand ich, dass ein potenzieller Kandidat zu wenig sportlich wirkte, ein anderer hatte in meinen Augen keinen guten Geschmack, was die Kleiderwahl betraf, und ein Dritter schied aufgrund seiner unkonventionellen Tischmanieren aus. Keiner konnte es mit Herbert aufnehmen, obwohl gerade er mich zutiefst verletzt hatte.
Als vor etwa eineinhalb Jahren im Rahmen eines Projektes ein neuer Designer an die Schule kam, erwachte mein Interesse an Männern wieder. Er hätte vom Aussehen, von Mimik und von der Gestik Herberts Zwillingsbruder sein können. Seine dunklen Locken und die stechend blauen Augen hatten es mir angetan. Seine sportliche Figur und die langen Beine betonte er mit eng geschnittenen Hosen. Meist trug er ein helles Leinenhemd, das er nicht in den Hosenbund steckte, und einen Pulli, den er lässig um seine Schultern gehängt hatte. Seine an Arroganz angelehnte Körperhaltung, sein bisweilen laszives Lächeln und seine ungemein gewählte Ausdrucksweise ließen meinen Puls, wenn er in der Nähe war, um einen Zacken schneller schlagen. Ich musste mich jedes Mal beherrschen, ihn nicht wie ein verliebter Teenager anzuhimmeln, wenn wir uns im selben Raum befanden. Er verströmte eine Aura, der man sich nur sehr schwer entziehen konnte. Auch so manche Kollegin schien sowohl von seinem über die Maßen gepflegten Äußeren als auch von seinem Verhalten, das so manchen britischen Gentleman vor Neid hätte erblassen lassen, zutiefst beeindruckt zu sein. Im Konferenzzimmer war er stets von einer Schar Frauen umgeben, die, wenn er gerade wieder einmal über die Welt der Schönen und Reichen referierte, an seinen Lippen hingen. Jede Lehrerin wollte diesen Mann für ihre Klasse in Projektarbeiten eingebunden wissen.
Selbst die Schülerinnen der höheren Klassen hatten Gefallen an ihm. Sie drehten ihre Köpfe reihenweise nach ihm um, tuschelten und grinsten, wenn er an ihnen vorbeiging. So manche frühreife Dame versuchte ihn anzumachen und änderte flugs ihren Kleidungsstil und ihre Schminkgewohnheiten, wenn er an der Schule tätig war.
Dass er sich für mich interessieren könnte, daran hatte ich nicht im Traum gedacht. In meinem Kopf war er entweder bereits vergeben, ein ausgepuffter Frauenheld oder noch schlimmer: homosexuell.
Als Lucca, so hieß er, mich nach der Schule auf einen Kaffee einlud, hielt ich das Ganze für einen freundschaftlich-kollegialen Akt. Ich nahm die Einladung an und erwartete mir, dass er sich eher für mich als Lehrerin als für meine Weiblichkeit interessierte. Wir plauderten über Belanglosigkeiten und meine anfängliche Skepsis ihm gegenüber schwand rasch. Er entpuppte sich als ein scheuer, freundlicher und sehr zurückhaltender Zeitgenosse. Seine Ernsthaftigkeit und seine korrekte Art, die manchmal so gar nicht im Einklang mit seiner Erscheinung standen, gefielen mir zusehends. Es dauerte nicht allzu lange und Lucca und ich wurden ein Paar. Nicht dass ich diese Beziehung unbedingt eingehen wollte, aber es ergab sich an einem lauen Sommerabend, nach einem exquisiten Abendessen bei meinem Lieblingsitaliener. Ohne Vorwarnung legte Lucca seine Hand auf meinen Arm, beugte sich über den Tisch und küsste mich einfach auf den Mund. Ich war auf diesen Überfall nicht vorbereitet, aber im Grunde hatte ich nichts dagegen. Am selben Abend landeten wir in meiner Wohnung und schließlich in meinem Bett. Wider Erwarten war Lucca ein zärtlicher bisweilen beinahe langweiliger Liebhaber, ganz anders als Herbert. Aber gerade seine Art, mich anzufassen, mich zu lieben, gaben mir Vertrauen und Sicherheit. Ich fühlte mich geborgen wie schon lange nicht mehr und hegte keinen Zweifel daran, dass Lucca und ich gemeinsam alt werden könnten.
Berufsbedingt reiste Lucca viel und war selten länger als zwei bis drei Tage am Stück in Strasbourg. Er wohnte, wenn er vor Ort war, in einer kleinen Frühstückspension. Nach ein paar Monaten zog er schließlich zu mir. Seinen Hauptwohnsitz, den er jedoch kaum nutzte, weil er ständig auf Achse war, hatte Lucca allerdings, wie er mir erzählte, in Genua. Von unserer Liaison erzählten wir in der Schule niemandem. Das ging so lange gut, bis ich vor acht Monaten schwanger wurde. Wir hatten zwar gemeinsame, aber noch sehr vage Zukunftspläne. Sie waren weder ausgegoren, noch wollten wir sie rasch umsetzen. Zudem hatte ich Lucca kaum etwas über meine Vergangenheit berichtet, und ich wusste von ihm auch nicht viel mehr. Ihm hatte ich lediglich erzählt, dass ich Witwe war, weil mein erster Mann durch einen unglücklichen Sturz zu Tode gekommen war, und ich aus Trauer Österreich den Rücken gekehrt hatte. Es war nicht meine Intention, Lucca näher in mein erstes Leben einzuweihen. Es schien ihn auch nicht sonderlich zu stören, dass er wenig von mir wusste, sondern machte eher den Eindruck, dass ihm die Gegenwart das Wichtigste war. Ehrlich gestanden, war ich sehr froh darüber, denn ich hätte nicht gewusst, wo ich mit meiner Lebensgeschichte anfangen und wo ich aufhören hätte sollen. Daher gestand ich ihm das gleiche Recht zu und fragte ihn kaum bis gar nicht darüber aus, was er bis zu dem Tag, als wir uns kennenlernten, alles so gemacht hatte.
Als ich meine Schwangerschaft bemerkte, wusste ich zuerst nicht, ob ich mich freuen sollte. Vor allem, weil ich nicht einschätzen konnte, ob Lucca meinen persönlichen Jubel teilen würde. Im Grunde war es mir aber egal. Ich hatte mir schon lange ein Kind gewünscht, damals mit Herbert.Aber auch Lucca würde ein guter Vater sein,dachte ich mir,wenn er auch wenig zu Hause wäre.Als ich ihn behutsam mit der Tatsache meiner anderen Umstände konfrontierte, reagierte er wesentlich euphorischer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Er freute sich sehr und machte den Vorschlag, ich solle mir bald eine größere Wohnung zulegen. Immerhin seien wir in Kürze, zumindest zeitweilig, zu dritt. Das Thema Hochzeit sparte er aus und es war mir auch kein großes Bedürfnis, mein kleines Glück durch eine Heirat zu legalisieren. Ich suchte mir eine größere Bleibe und fand rasch ein passendes hübsches Reihenhaus mit adrettem Vorgarten und einer großzügigen sonnigen Terrasse auf der Rückseite. Alles war perfekt.
Einzig die quälenden Träume, die mich bis zum heutigen Tag verfolgen, und unerwartete Migräneattacken erinnern mich daran, dass es ein Leben vor Lucca gab.
Ich liege in meinem Krankenhausbett und seufze. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die Schwester mir Julian bringen wird. Dieser Gedanke zaubert ein glückliches und zufriedenes Lächeln auf mein Gesicht. In diesem Moment klopft jemand zaghaft an die Tür meines Krankenzimmers.
„Herein!“
Die Tür geht langsam auf und zuerst sehe ich nur rote Rosen. Viele langstielige rote Rosen. Dahinter taucht Luccas Kopf auf.
„Hallo, meine Liebe, bist du wach?“
„Ja.“ Ich strahle mit der Sonne um die Wette. Lucca kommt auf mein Bett zu und küsst mich. „Eine Vase findest du im Bad.“
Er legt den Blumenstrauß auf die Decke. Ich nehme ihn in die Hand und sauge den Duft der Blumen ein.
„Wow, die sind wunderschön, danke!“
Lucca kehrt mit der Vase, die er vorher mit Wasser angefüllt hat, zurück.
„Wie geht es unserem Nachwuchs? Wo ist er?“ Er schaut mich fragend an.
„Er ist im Säuglingszimmer, damit ich mich ausruhen kann. Aber ich denke, der Hunger wird dafür sorgen, dass er in den nächsten Minuten gebracht wird.“
Nachdem Lucca den Strauß in die Vase gesteckt und sie dekorativ auf den Tisch gestellt hat, nimmt er einen Sessel und setzt sich zu mir ans Bett. Er nimmt meine Hand.
„Susanne, du hast mich sehr glücklich gemacht. Ich hoffe, dir geht es gut und du wirst die Schmerzen der Geburt bald vergessen können.“
„Habe ich schon“, antworte ich und lächle ihn verschmitzt an. Einerseits leisten die Schmerztabletten gute Arbeit und andererseits scheint mein permanenter Adrenalinausstoß den Genesungsprozess massiv voranzutreiben.
Wieder klopft es an der Tür. Zum Klopfen gesellt sich der Schrei eines Babys, das seine Mahlzeit einfordert. Eine Schwester bringt mir meinen hungrigen Julian. Sie legt ihn in meine Hände, die ich ihr ungeduldig entgegenstrecke. Ich öffne mein Nachthemd und während ich beruhigend auf den Kleinen einrede, stopfe ich ihm mit noch ungeübten Gesten meine Brust in seinen herzigen Mund. Gierig versucht er, mit seinem kleinen Mäulchen die Brustwarze zu umfassen und raunzt dabei. Endlich kann er sich festsaugen und augenblicklich beginnt er heftig zu ziehen und zu schmatzen. Lucca sieht mir dabei ohne Worte zu.Ich habe eine Familie,denke ich. Eine Mischung aus Glück, Stolz und Euphorie durchströmt meinen Körper. Ich glaube, noch nie in meinem ganzen Leben war ich so selig, wie ich es jetzt gerade bin.
Es dauert eine Zeit, bis Julian satt von meiner Brust ablässt. Ich hebe ihn hoch, wie es mir die Schwestern gezeigt haben, und warte auf sein Bäuerchen. Danach übergebe ich das kleine lebendige Bündel vorsichtig an Lucca. Julian schmiegt sein kleines Köpfchen an seine Brust und schläft zufrieden ein.
„Oje, ich wollte ihn noch frisch wickeln lassen.“
Lucca deutet mir an, leise zu reden.
„Mein Lieber. Der schläft nun und es wird ihn nicht groß stören, ob wir reden oder nicht. Glaube mir“, belehre ich den Vater meines Kindes.
Während der Kleine friedlich in Luccas Armen ruht, unterhalten wir uns über die letzten Vorbereitungen für zu Hause, damit der neue Erdenbürger sich von Anfang an in unserem Heim geborgen und sicher fühlt. Es gibt nicht mehr viel zu tun. Das Kinderzimmer ist eingerichtet, ein Gitterbett steht bereits an meiner Seite des Doppelbettes. Obwohl Julian fast ein Monat zu früh auf die Welt gekommen ist, sind wir vollends auf seine Ankunft vorbereitet. Lucca wollte nichts dem Zufall überlassen. In seinem Job weiß er selten, ob er in zwei Tagen noch immer am selben Ort ist, daher sollte alles gut organisiert sein, vor allem, um mich zu entlasten, wie er immer betont.
Nach zwei Stunden verabschiedet sich Lucca. Ein kleiner Wermutstropfen gesellt sich zur guten Stimmung. Lucca wird sehr bald abreisen. Die Pflicht ruft. Diesmal führt sie ihn nach Barcelona.
Julian wird auf die Säuglingsstation gebracht und ich bin froh, wieder ein bisschen schlafen zu können. Auch wenn die Geburt des eigenen Kindes ein wundervolles Ereignis ist, so hinterlässt ein Kaiserschnitt doch seine Spuren, und der Körper verlangt Erholung und Ruhe. Ermattet und glücklich schlafe ich ein.
2.
Als ich erwache, scheinen die letzten Strahlen der bereits tief stehenden Sonne in mein Zimmer. Irgendjemand muss das Fenster geschlossen haben. Langsam setze ich mich auf und blinzle auf meine Armbanduhr. Es ist fast 18 Uhr. Bald wird man Julian wieder zu mir bringen. Vorsichtig lenke ich meine Beine aus dem Bett und angle mit den Zehen nach meinen Pantoffeln. Etwas wackelig stehe ich nun auf festem Boden. Ein leichtes Schwindelgefühl stellt sich ein. Ich wage ein paar Schritte und halte mich dabei abwechselnd an der Wand und am Bettgestell fest. Stolz lächle ich in mich hinein, dann setze ich mich wieder hin. Bald, sehr bald werde ich wieder gehen können, ohne dass sich in meinem Kopf ein ganzes Karussell dreht. In diesem Moment klopft es leise an die Tür. Eine Schwester, die ich zuvor noch nie gesehen habe, steckt den Kopf zur Tür herein.
„Ah gut. Sie sind wach, Frau Kramer. Ihr kleiner Spross ist hungrig, ich bringe ihn gleich.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, ist sie wieder draußen. Gleich darauf kommt sie mit dem kleinen Bündel auf dem Arm. Der Kleine weint nicht, aber er quiekt und quengelt vor sich hin. Ich strecke meine Arme aus und nehme mein Kind in Empfang. Langsam gewöhne ich mich an die Prozedur. Kurz blickt er mir mit seinen blauen Augen ins Gesicht. So als ob er für die Mahlzeit Danke sagen möchte. Dann saugt er sich an meinen Brustwarzen fest. Diskret verzieht sich die Krankenschwester wieder. Ich genieße diesen Augenblick, als ich allein mit meinem Sohn auf dem Arm dasitze. Außer seinem Schmatzen ist kein Geräusch zu hören. Ich halte ihn mit meinem linken Arm fest. Mit meiner rechten Hand streiche ich ihm über seinen noch etwas unförmigen, kahlen Kopf. Er scheint die Berührung zu genießen. Kurz hält er beim Saugen inne, um dann noch kräftiger mit seinen Lippen an meiner Brustwarze zu ziehen. Es schmerzt.Ich werde wohl oder übel das nächste Mal die Stillhütchen ausprobieren müssen,überlege ich. Sein Kopf wird schwerer und schwerer, er saugt nicht mehr mit voller Kraft. Er ist satt und müde. Für so ein kleines Kerlchen ist Essen Schwerarbeit. Vorsichtig hebe ich ihn hoch, während ich eine Stoffwindel schnappe und sie mir über die Schulter lege. Ich warte auf sein Bäuerchen, danach halte ich ihn in meinen Armen und betrachte sein Gesicht.
Noch könnte ich nicht sagen, wem er ähnelt. Es gibt Leute, die behaupten, bei einem Neugeborenen unverkennbar Züge von dem einen oder dem anderen Elternteil ausmachen zu können. Ich selbst hatte bis jetzt selten ein Baby auf meinem Arm. Nur Christines und Nathalies Kinder durfte ich hin und wieder halten. Nie hätte ich mit Gewissheit behaupten können, dass das jeweilige Kind Vater oder Mutter gleich gewesen sei. Babys sahen für mich immer alle sehr ähnlich aus. Ein rundliches Gesicht mit großen Kulleraugen, Stupsnase und kleinen Ohren. So gesehen bin ich der Meinung, dass nur die Phantasie des Betrachters elterliche Züge entdecken kann. Aber beim eigenen Kind scheint es anders zu sein. Ich glaube, die weichen Konturen um seinen Mund kann er nur von seinem Vater geerbt haben und die hohe Stirn mit den kleinen Grübchen, dort, wo der Haaransatz sein müsste, ist ein Erbe von mir. Mit meinem Zeigefinger fahre ich behutsam die Unebenheiten seines Gesichtchens nach. Julian schläft bereits. Sein kleiner Mund steht leicht offen, die Augen sind nicht vollständig geschlossen. Er atmet ruhig und beim Ausatmen kann ich einen leisen Schnarchton vernehmen. Das hat er definitiv von seinem Vater geerbt. Ich schmunzle.
Ich drücke die Klingel und läute nach der Schwester. Es dauert eine Weile, bis sich die Türe öffnet.
„Ja, Frau Kramer. Was kann ich für Sie tun?“
„Hm. Könnte Julian bei mir bleiben?“
Kurz überlegt sie.
„Ja, das kann man einrichten. Warten Sie, ich bringe ihn zuerst zurück in das Säuglingszimmer, dann stellen wir hier ein Gitterbett auf, danach bringe ich Ihnen Ihr Herzblatt wieder.“
„Danke.“
Sie nimmt mir mein Kind ab und trägt es hinaus. Ich werfe ihm noch eine Kusshand zu.
3.
Mein Handy vibriert. Lucca wünscht mir eine gute und erholsame Nacht. Ich antworte mit zwei Herzen. Gleich darauf höre ich ein Poltern vor meiner Türe. Jemand macht sie auf. Zwei Pfleger tragen ein Gitterbett herein.
„Wo dürfen wir es hinstellen, Frau Kramer?“
„Bitte auf der rechten Seite“, antworte ich. Die beiden Männer stellen das Bett auf und montieren noch das Gitter auf jener Seite ab, die meinem Bett zugewandt ist.
„Recht so?“, fragt der eine.
„Ja, danke vielmals.“
Die beiden Herren verschwinden. Mit meiner rechten Hand streiche ich einmal über das Laken. Instinktiv will ich es anwärmen. Gleich wird mein Nachwuchs hier Auge in Auge mit mir liegen.
Während ich auf Julian warte, muss ich eingenickt sein. Irgendwann erwache ich aus meinem Halbschlaf. Haben sie mein Kind in der Zwischenzeit gebracht? Ich mache die Leselampe an, draußen ist es bereits finster. Nein, das Bettchen ist noch leer. Aha, ich bin eingeschlafen. Wahrscheinlich wollten sie mich nicht wecken. Ich läute nach der Schwester. Leise geht die Tür auf.
„Das Gitterbett ist schon da. Würden Sie mir bitte meinen Sohn bringen?“, bitte ich die Schwester, die den Kopf zur Türe hereinstreckt. Es muss eine neue sein, ich habe sie zuvor noch nie gesehen.
Etwas an ihrem Gesichtsausdruck irritiert mich.
„Aber. Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr Mann hat Julian vor etwa einer halben Stunde aus dem Säuglingszimmer geholt. Er sagte, er wird ihn zu Ihnen bringen.“
Sie wirkt verlegen und unsicher.
„Mein Mann?“ Ich überlege. Nein, Lucca war am Nachmittag hier.
„Wie spät ist es?“, frage ich.
„Nun, es ist kurz vor 20 Uhr,“ verrät sie mir mit einem Blick auf ihr Handgelenk.
„Nein, das muss ein Irrtum sein. Lucca war am Abend nicht mehr hier.“ An meiner Aussage zweifle ich keine Sekunde. „Julian muss im Säuglingszimmer sein“, stelle ich fest, ohne einen Widerspruch zu dulden.
Ich stehe aus meinem Bett auf. Langsam. Zu schnelle Bewegungen verursachen Schwindel und das ist gefährlich. Die Schwester greift mir unter die Arme.
„Kommen Sie, wir gehen Julian holen“, sage ich in einem versöhnlichen Ton zu ihr. Sie ist jung, wahrscheinlich sogar noch in der Ausbildung.
„Aber, aber ich habe sogar mit Ihrem Mann gesprochen“, stottert sie.
„Nein, nein, das muss ein Irrtum sein.“
Rasch schlüpfe ich in meine Pantoffel und lasse keinen Zweifel aufkommen, dass ich sie auf die Säuglingsstation begleite. Unbehagen keimt in mir auf. Eine unbestimmte Hektik erfasst mich, ich werfe meinen Morgenmantel im Gehen über und werde immer schneller.
„Frau Kramer!“, ruft die Schwester hinter mir her, „Vorsicht bitte, Sie sind noch nicht besonders fit.“
Jetzt beginne ich zu laufen, soweit man in meinem Zustand die Fortbewegung Laufen nennen darf. Den Gang entlang, weiße Wände rauschen an mir vorbei.
Endlich sehe ich die Glastüre mit der AufschriftSÄUGLINGSSTATION. Die Schiebetüre öffnet sich automatisch. Schnurstracks gehe ich in den Raum, in dem die Neugeborenen in Reih und Glied in ihren Bettchen schlafen. Julians Bett ist das dritte. Schon von der Türe kann ich es sehen. Es ist leer. Hektisch gehe ich von einem Baby zum anderen. Ich blicke in die schlafenden Gesichter, kontrolliere die kleinen Streifchen, die jedes Kind um sein Handgelenk trägt. Namen, Daten, Geschlecht. Keines der Kinder ist Julian. Mein Herz beginnt wild zu pochen. Nochmals schreite ich die Reihe ab.
„Ist er vielleicht im Wickelraum? Hatte er womöglich Probleme und man hat ihn zum Arzt gebracht?“
Immer aufgebrachter, lauter, weinerlicher wird meine Stimme. Die Schwester nimmt mich am Arm und führt mich aus dem Raum.
„Pst! Sie wecken ja die Kleinen auf.“, flüstert sie vorwurfsvoll.
Ihr Gesicht ist hochrot angelaufen, auf dem Hals zeichnen sich weiße und rote Flecken ab. Eine Kollegin kommt aus einer Türe mit der AufschriftTeeküche.
„Was ist denn hier los?“
Schnell erfasst sie die Situation und bemerkt, dass etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein muss. Lina, so heißt die Schwester, die mich am Arm führt, antwortet mit tränenerstickter Stimme:
„Julian, Julian Kramer ist weg. Sein Vater hat ihn hier abgeholt und hätte ihn zu Frau Kramer bringen sollen. Aber weder der Kleine noch sein Vater sind auffindbar.“
Mit hängenden Schultern lasse ich mich auf einen Sessel in der Teeküche nieder. Leise, aber für jeden vernehmbar sage ich:
„Das war nicht Lucca. Ein anderer Mann hat mein Kind entführt.“
Die beiden Frauen sehen mich verständnislos an. Lina fasst sich als Erste.
„Wenn das stimmt, müssen wir sofort die Polizei alarmieren!“
Sie rennt zum Telefon und tippt die Nummer des Polizeinotrufes ein.
„Wie sah der Mann aus, der Julian geholt hat?“, frage ich beinahe tonlos.
„Ich habe ihn nicht gesehen. Lina hat mit ihm gesprochen.“
Im Hintergrund höre ich, wie Lina in kurzen Sätzen die Situation schildert und in den Hörer brüllt:
„Und machen Sie schnell!“
Sie kommt wieder auf mich zu und geht vor mir in die Hocke, um mit mir auf Augenhöhe zu sein.
„Die Polizei ist gleich da!“
Für mich gibt es kein Halten mehr. Ich springe vom Sessel auf und packe Lina an ihrem weißen Mantel.
„WO IST MEIN SOHN?!“
Ich schreie aus Leibeskräften. Die namenlose Schwester versucht mich von Lina loszureißen und mir den Mund zuzuhalten. Lina beginnt zu weinen.
„WIE, verdammt, wie hat der Mann ausgesehen?“ Ich halte ihren Mantelkragen in meiner rechten Hand und blicke wütend in ihr tränennasses Gesicht.
Mit weinerlicher Stimme beschreibt mir Lina die Person, die sich als Julians Vater ausgegeben hat. Es besteht kein Zweifel. Manuel! Manuel war hier. Manuel hat meinen Sohn entführt.
Mir wird schwindlig. Den Stuhl erreiche ich nicht mehr. Ich sacke in mir zusammen. Mit voller Wucht knalle ich auf den harten Boden. Dann kann ich mich an nichts mehr erinnern.
4.
Eine Hand tätschelt meine Wange. Ich öffne zuerst ein Auge, dann das zweite. Das Bett, in dem ich liege, ist weich. Der Polster riecht nach säuerlicher Milch. Lucca schaut mich traurig an. Was ist passiert? Nur schwach kehrt meine Erinnerung wieder. Mein linker Arm schmerzt. Warum? Ich versuche ihn anzuheben. In der Schulter sticht es unangenehm. Je länger ich in Luccas Gesicht blicke, desto deutlicher wird meine Erinnerung. Tränen rinnen über meine heißen Wangen. Lucca hält meine Hand und streichelt sie wie automatisch. Ich bemerke zuerst gar nicht, wie nahezu lautlos die Zimmertüre geöffnet wird. Ein Mann in Polizeiuniform nähert sich meinem Bett. Erst als er das Fußende erreicht hat und sich räuspert, registriere ich ihn.
„Ähm, entschuldigen Sie. Ich bin Gilbert Cloudieux. Könnte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen?“ Matt nicke ich ihm zu, obwohl mir gar nicht nach Reden zumute ist.
Lucca will einwenden und mich schonen, doch ehe er seinen Mund auftun kann, sage ich:
„Lass nur.“ Und an den Beamten gerichtet: „Fragen Sie.“
Mit Mühe richte ich mich in meinem Bett auf. Der Beamte nimmt sich einen Hocker und setzt sich neben Lucca.
„Frau Kramer. Haben Sie einen Verdacht, wer Ihren Sohn entführt haben könnte?“ Ich wische mir die Tränen aus dem Gesicht und schaue mich um ein Taschentuch um. Währenddessen nicke ich.
Bedächtig und ständig von Weinkrämpfen unterbrochen erzähle ich Cloudieux von Manuels Mordversuch an mir vor über drei Jahren.
„Meines Wissens ist dieser Mann allerdings noch hinter Schloss und Riegel. Aber die Beschreibung der Schwester trifft haargenau auf ihn zu. Vielleicht hat man ihn vorzeitig aus der Haftanstalt entlassen“, mutmaße ich.
„Das kläre ich mit den österreichischen Behörden“, antwortet Cloudieux mitfühlend. „Frau Kramer, wir werden Ihren Sohn finden und ihn bestimmt bald unversehrt an Sie übergeben können. Wir arbeiten auf Hochdruck.“ Zweifelnd schaue ich ihn an.
„Können Sie sich vorstellen, wieso er Ihnen das antut?“, hakt der Inspektor nach.
Klar!,denke ich. Ich antworte:
„Nun, vielleicht ist es ein Racheakt, weil er meinetwegen im Gefängnis war.“
Cloudieux runzelt die Stirn.
„Aber wieso wollte er Sie töten, Frau Kramer? Das Motiv zu dieser Gewalttat erkenne ich aus Ihren Schilderungen nicht.“
Ich stocke. Unwillig, Cloudieux näher einzuweihen, nehme ich ein Taschentuch, schnäuze mich und antworte unfreundlich:
„Ist das zum jetzigen Zeitpunkt wichtig? Das Ganze ist eine lange Geschichte und nun sollten Sie mein Kind finden, ich denke das ist jetzt Ihre vorrangige Aufgabe.“
Cloudieux schaut verwundert von seinem Notizblock auf und mir direkt in die Augen. Meine Antwort gefällt ihm nicht. Lucca wirft mir ebenfalls einen irritierten Blick zu. Er muss sich noch elendiger fühlen als ich. Einerseits verliert er sein Kind an einen Wahnsinnigen und zum ersten Mal hört er Auszüge aus meinem alten Leben und dass ich irgendwann dem Tod nur knapp entkommen war.
Nun werfe ich mir vor, naiv gewesen zu sein. Hatte ich tatsächlich geglaubt, dass Manuel seine Strafe absaß und es das dann für ihn gewesen wäre? Ich hätte wissen müssen, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach mir suchen würde. Schließlich ist er der einzige Mensch, der ungefähr eine Ahnung hat, was an Herberts Todestag passiert war, auch wenn er nie einen Beweis hatte vorlegen können. Offensichtlich ist er noch immer gewillt, mich zu töten, sonst hätte er mich nicht gesucht, gefunden und schließlich mein Kind entführt. Aber was will er mit einem Neugeborenen anstellen? Er wird von der Polizei gejagt. Er wird sich nicht ewig verstecken können. Ein Mann mit einem Säugling ohne dazugehörige Mutter fällt auf. Oder hat er eine Frau, die ihm behilflich ist?
Mein Schädel brummt. Wieder schießen mir Tränen ins Gesicht.
Ohne weiter auf mich einzugehen, beginnt der Polizist Lucca zu befragen. Dieser antwortet mit heiserer Stimme. Er erzählt, dass er nach dem Besuch bei mir heimgefahren sei. Danach habe er eine Kleinigkeit gegessen und Koffer gepackt, da seine Abreise nach Barcelona bevorstehe.
Während der Inspektor sich zum Aufbruch bereit macht, vibriert mein Handy. Wer mag das sein? Mitten in der Nacht? Zögerlich nehme ich es vom Nachttisch und öffne eine SMS von einer unbekannten Nummer. „Schrecklich, wenn man einen geliebten Menschen verliert, nicht wahr? Gruß, M.“
Das Mobiltelefon fällt mir aus der Hand wie eine heiße Kartoffel.
„Da“, würge ich hervor, „da, eine Nachricht.“ Ohne weitere Worte überreiche ich mein Telefon Cloudieux, der gerade im Begriff ist, zu gehen. Er nimmt es und starrt auf die Nachricht.
„Bon“, meint er, „dieser Manuel scheint nicht mehr in Haft zu sein.“ Er kratzt sich den Dreitagebart. „Wieso tut er so, als ob er sich für etwas rächen wollte?“
Ich verstehe Cloudieux nicht gleich.
„Nun, er schreibt ‚nicht wahr‘, das klingt, als ob er schon jemanden verloren hätte und er Sie, Frau Kramer, für den Verlust verantwortlich macht.“
Röte steigt in meinem Gesicht auf. Das Detail, dass Herbert und Manuel ein Paar gewesen waren, verschweige ich vorerst besser. Vor Lucca kann und will ich nicht darauf eingehen. Nicht jetzt werde ich Cloudieux erzählen, was es damit auf sich hat. Es wird mir aber nicht erspart bleiben, denn die französische Polizei wird wohl oder übel in Österreich nachfragen, befürchte ich.
„Also“, beginne ich langsam, „ich kann Ihnen nicht folgen. Außerdem bin ich erschöpft.“
Cloudieux wiegt seinen Kopf hin und her, aber ich sehe, dass dieses Thema für ihn noch lange nicht gegessen ist. Er verabschiedet sich von uns und geht zur Tür hinaus.
„Susanne, ich hatte keine Ahnung, was du in der Vergangenheit alles durchgemacht hast. Wieso hast du mir nie davon erzählt?“
Luccas Stimme klingt mitleidig und vorwurfsvoll zugleich. Er zieht seine Hand, die meine bis jetzt gehalten hat, zurück. Mein Rechtfertigungsversuch ist halbherzig.
„Ich wollte dich nie in die Sache reinziehen. Das ist eben meine Vergangenheit. Wieso Manuel bis heute glaubt, dass ich Herbert etwas angetan haben könnte, weiß ich nicht. Es ist ein Hirngespinst. Oder glaubst du von mir, dass ich eine eiskalte Mörderin bin?“
Lucca steht auf und nimmt mich wortlos in die Arme. Er küsst mich auf die Stirn. Was er denkt, weiß ich nicht.
Wieder vibriert mein Handy. Es istprivat. „Versuche uns gar nicht zu suchen, du wirst uns nicht finden. Gestehe den Mord an Herbert, dann hast du eine Chance, deinen Sohn wiederzusehen. Vielleicht kannst du dich auch zu Maries und Nathalies Tod äußern. Du weißt bestimmt mehr als die Polizei.“
Lucca schaut mich fragend an. Ich lege das Handy weg. Momentan habe ich weder die Kraft noch die Lust Lucca zu erklären, wer Marie und Nathalie waren und wieso Manuel mir auch ihren Tod anlastet.
„Nichts, er schreibt nur, dass wir nicht nach ihm suchen sollen, wir würden ihn nicht finden.“, quittiere ich Luccas stumme Frage.
Die Miene von Lucca verfinstert sich, auf seiner sonst so glatten Stirn bilden sich Runzeln.
„Susanne, bitte, verschweige mir von jetzt an nichts. Es ist auch mein Kind, das entführt wurde, und ich muss wissen, wieso dieser Kerl uns das antut. Das ist dir hoffentlich klar.“
Seine Stimme ist nun weder ängstlich noch bittend, fast klingen die Worte wie eine Drohung.
Beschämt schaue ich zu Boden. Nie werde ich ihm die Wahrheit sagen können! Für den Rest meines Lebens werde ich mit Lügen leben und penibel darauf achten müssen, dass ich mir genau merke, wem ich was erzähle. Die Situation ist schwierig, sehr schwierig. Mit einem Seufzer, der aus meiner tiefsten Seele kommt, lasse ich mich in das Kissen zurückfallen. Mir fehlen die richtigen Worte. Mein Mund ist trocken, meine Lippen fühlen sich an, als wären sie versiegelt.
Lucca wartet auf eine Erklärung, das kann ich sehen. Ich bin nicht im Stande zu reden. Er klopft mit seinem rechten Fuß auf den Fußboden, was er immer tut, wenn sich Ungeduld in ihm breit macht, dann steht er plötzlich auf und verlässt grußlos das Zimmer.