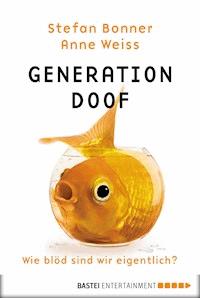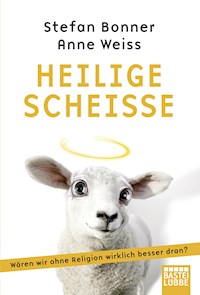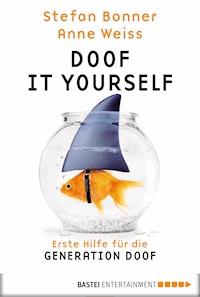9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ungewöhnlich heiße Sommer, Superstürme, Dauerregen, Überschwemmungen – der Klimawandel ist da. Das Bestsellerduo Bonner/Weiss ("Generation Doof") nimmt sich in "Generation Weltuntergang" die Erderwärmung und den Klimawandel vor und sagt, wie es so weit kommen konnte, wie sehr uns die klimatischen Veränderungen betreffen und was wir jetzt tun müssen. Obwohl in den Nachrichten Daueralarm herrscht, das Wetter Kapriolen schlägt, der Meeresspiegel steigt und die Pole schmelzen, wettern Scharfmacher allerorten gegen die Klimawissenschaft, und die Politiker haben keinen Plan. Und wir selbst sehen dem Geschehen hilflos zu oder stecken den Kopf in den Sand. Denn was können wir schon tun? Eine ganze Menge, sagen Stefan Bonner und Anne Weiss. In "Generation Weltuntergang" erzählen sie auf aufrüttelnde und zugleich leicht verstehbare Weise die Geschichte des Klimawandels und sagen, welche Konsequenzen er für unser aller Leben hat. Denn letztlich geht es um nichts weniger als die Frage: Ist die Menschheit noch zu retten oder sind wir die die Letzten unserer Art?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Stefan Bonner / Anne Weiss
GENERATION WELTUNTERGANG
Warum wir schon mitten im Klimawandel stecken, wie schlimm es wird und was wir jetzt tun müssen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ungewöhnlich heiße Sommer, Superstürme, Dauerregen, Überschwemmungen – der Klimawandel ist da. Das Bestsellerduo Bonner/Weiss (»Generation Doof«) nimmt sich in »Generation Weltuntergang« die Erderwärmung und den Klimawandel vor und sagt, wie es so weit kommen konnte, wie sehr uns die klimatischen Veränderungen betreffen und was wir jetzt tun müssen.
Obwohl in den Nachrichten Daueralarm herrscht, das Wetter Kapriolen schlägt, der Meeresspiegel steigt und die Pole schmelzen, wettern Scharfmacher allerorten gegen die Klimawissenschaft, und die Politiker haben keinen Plan. Und wir selbst sehen dem Geschehen hilflos zu oder stecken den Kopf in den Sand. Denn was können wir schon tun? Eine ganze Menge, sagen Stefan Bonner und Anne Weiss.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Zweieinhalb Minuten bis Mitternacht
Kapitel 2
Global Warning
78° 13’ N, 15° 38’ O LONGYEARBYEN, SPITZBERGEN DIE GROßE SCHMELZE
25° 47’ N, 80° 13’ W MIAMI, FLORIDA DIE PERFEKTE FLUTWELLE
18° 38’ N, 74° 07’ W JÉRÉMIE, HAITI DIE STURMMASCHINE
12° 19’ S, 76° 49’ O PUNTA HERMOSA, PROVINZ LIMA, PERU BETTER CALL SAÚL LUCIANO
1° 25’ N, 173° 2’ O TARAWA, KIRIBATI, PAZIFIK PARADISE LOST
37° 48’ S, 144° 57’ O MELBOURNE, AUSTRALIEN WO DER HIMMEL BRENNT
10° 2’ N, 105° 47’ O CaN THo, MEKONGDELTA, VIETNAM KLIMA-APOKALYPSE NOW
35° 53’ N, –5° 18’ W CEUTA, NORDAFRIKANISCHE KÜSTE GET OUT OF AFRICA
49° 11’ N, 9° 47’ O BRAUNSBACH, DEUTSCHLAND DER TAG, AN DEM DEN MENSCHEN DER HIMMEL AUF DEN KOPF FIEL
Kapitel 3
Was bisher geschah
Kapitel 4
Denn sie wissen nicht, was sie alles wissen
Kapitel 5
Heiter bis Weltuntergang
90° 0’ N DER NORDPOL SCHWARZES EIS
62° 14’ S, 58° 40’ W CARLINI-STATION, KING GEORGE ISLAND, ANTARKTIS DER HOLY-SHIT-MOMENT
55° 22’ N, 38° 43’ W NORDATLANTIK DER MIT DEM BLOB
Höhe: 12 000 Meter TROPOPAUSE, ZWISCHEN TROPOSPHÄRE UND STRATOSPHÄRE VOM WINDE VERDREHT
Kapitel 6
Wir Klimawandler
CO2-TAGESZÄHLER: +23 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +586 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +0 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +670 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +4000 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +632,4 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +1500 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +4 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER: +273 Gramm
CO2-TAGESZÄHLER INSGESAMT: 8573,4 Gramm oder: 8,6 Kilogramm
Kapitel 7
We will survive
1 Hinterm Mars gleich links. Retten wir unser Zuhause
2 We have a Dream. Lernen wir, wieder zu träumen
3 Wenn nicht jetzt, wann dann? Denken wir revolutionär
4 Wat nix kost, is nix. Geben wir CO2 einen Preis!
5 Zu Lande, zu Wasser und mit guter Luft. Bringen wir neue – Bewegung in die Zukunft
6 Iss nicht Wurst. Ändern wir unsere Ernährung
7 Die stille Rebellion. Konsumenten an die Macht
8 Ich bin so sauer, ich habe ein Plakat gebastelt! Engagieren wir uns
9 Das Ende der Dummschwätzerei. Machen wir uns wieder schlau
10 To boldly go … Erfinden wir uns eine neue Welt
Nachwort
Das Ende
Wir sind dankbar
Literatur & Co.
Literatur
Datenlage zum Klimawandel im Internet
Aufschlussreiche Apps – der Planet, die Satelliten und alle Daten für die Hosentasche:
Demogelegenheiten (jede Menge, also nur die wichtigsten):
Museen und Ausstellungen
Filme
Kapitel1
Zweieinhalb Minuten bis Mitternacht
Als wir plötzlich die Generation Weltuntergang waren
It’s the end of the world
as we know it.
R.E.M.
Es ist ein ganz normaler Donnerstag im Januar 2018, als in Chicago der drohende Weltuntergang verkündet wird. Die meisten von uns warten wohl gerade im Büro auf den Feierabend, als auf der anderen Seite des Atlantiks drei unscheinbare ältere Herren und zwei Damen vor die internationale Presse treten und wie bei Paulchen Panther an der Uhr drehen – nicht an einem beliebigen Zeitmesser, sondern an der Doomsday Clock, der Uhr des Jüngsten Gerichts.
Die Damen sind Rachel Bronson und Sharon Squassoni, beide Expertinnen für internationale Angelegenheiten. Die Herren sind der Physiker Lawrence Krauss, der Astrophysiker Robert Rosner und der Klimaforscher Sivan Kartha. Sie sind Mitglieder des Direktoriums der Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists, deren Aufsichtsrat derzeit dreizehn Nobelpreisträger angehören – also alles Leute, die nicht gerade auf den Kopf gefallen sind und von denen man annehmen kann, dass sie Gefahren erkennen, wenn sie welche sehen.
Die Wissenschaftler enthüllen eine stilisierte Uhr auf einem Flipchart. Die Doomsday Clock soll verdeutlichen, wie hoch das Risiko einer globalen Katastrophe ist, die der Menschheit den Garaus machen kann. Und an jenem Donnerstag stellen die Experten die Zeiger ihrer Uhr auf zwei Minuten vor Mitternacht.
Ein Schock, denn die Uhr existiert bereits seit 1947, und die Atomforscher wähnten uns schon lange nicht mehr so nahe am globalen Exitus. Genauso nah an der Zwölf waren wir bislang nur ein einziges Mal: 1953, als die Amerikaner und Sowjets mit ihren Wasserstoffbomben Wettpinkeln spielten und gute Chancen bestanden, dass der Kalte Krieg außer Kontrolle geriet.
Nun also steht die Welt abermals am Abgrund. Und die amerikanischen Wissenschaftler machen neben den vielen Atomwaffen vor allem eine Bedrohung für die Menschheit aus: den Klimawandel.
Der Klimawandel, so ihre Erkenntnis, könne einem globalen Atomkrieg in puncto Zerstörungskraft durchaus das Wasser reichen.
Sie meinen, die Bombe tickt – nicht nur eine der rund 16 300 Atombomben, die es weltweit gibt, sondern eine aus Klimagasen: Gelingt es der Menschheit nicht, den Klimawandel zu stoppen, werden wir unsere eigene Lebenswelt unwiderruflich auslöschen.
Willkommen im Weltuntergang.
Jetzt vor unserer Haustür.
Wir sind nicht die letzte Generation,
die den Klimawandel erleben wird,
aber wir sind die letzte Generation,
die etwas gegen den Klimawandel tun kann.
Barack Obama
What the fuck?! Das fragen sich vor allem jene, die wie wir in den Achtzigern aufwuchsen. Unsere Generation kann sich nämlich noch gut daran erinnern, wie Tschernobyl, saurer Regen und Ozonloch uns damals das Lied vom Tod gespielt haben. Geboren zwischen der ersten Mondlandung und dem Mauerfall waren wir die erste Generation, die bereits im Kindergarten kapierte, dass wir mit der Natur pfleglich umgehen müssen – weil wir bislang eben nur diesen einen Planeten haben, auf dem wir durchs ansonsten lebensfeindliche Weltall eiern. Eine lange Zeit lebten wir in dem Glauben, der Rest der Welt hätte das auch verstanden.
Unsere Kindheit und Jugend waren regelrechte Bootcamps für Umweltretter: Um uns herum wimmelte es nur so von selbst gestrickten Wollsocken, Norwegerpullis, Birkenstocks, Jutetaschen und Müslimühlen, dazu umgab uns eine veritable Menagerie aus Friedenstauben, Blauen Engeln und WWF-Pandas. Wer sich für Flora und Fauna starkmachen wollte, hatte dazu jede Menge Gelegenheit. Das gehörte auch zum guten Ton, und zwar quer durch die Gesellschaft – die Sorge um die Umwelt einte alle, vom Lodenjackenbesitzer bis zum Palituchträger: Gefühlt jeder Zweite trug einen Anti-Atomkraft-Button mit der gelben Sonne auf rotem Grund, ganze Klassenverbände rückten aus, um den Wald von Müll zu befreien, und wenn jemand seinen Benz an der roten Ampel laufen ließ, musste er mit einem Anschiss rechnen.
Wer etwas mehr tun wollte, trieb sich auf Demos herum, von denen damals alle naselang eine stattzufinden schien. Dabei hatten viele gute Chancen, ein polizeiliches Foto fürs Familienalbum zu ergattern – zum Beispiel jene, die auf Bäume kletterten und Blockaden auf der Autobahn errichteten, um die Startbahn West zu verhindern, andere, die es sich in Gorleben auf dem Bohrplatz des geplanten Atommülllagers bequem machten, oder auch die, die in Wackersdorf Hüttendörfer gegen die Wiederaufarbeitungsanlage errichteten.
Die Proteste in unserer Jugend waren der Auftakt zu einer zumindest etwas besseren Welt: Bleifreies Benzin wurde eingeführt, es wurde über Müll und die Laufzeiten der Atomkraftwerke diskutiert. Und so wurden langsam die Flüsse wieder sauberer, der Wald bekam eine frischere Farbe, das Ozonloch verschwand – zumindest aus den Schlagzeilen. Anfangs kauften wir in Reformhäusern noch kleine Portionen teurer Ökolebensmittel, dann gab es irgendwann Biosupermärkte, wir tauschten den Benziner gegen einen Hybrid, und die meisten von uns freuen sich heute über den Atomausstieg. Überdies lernten wir so virtuos wie sonst keine andere Nation auf der Klaviatur des Mülltrennungssystems zu spielen: braune und blaue Tonnen, grüne Punkte und gelbe Säcke – da machte uns so schnell keiner was vor. Die New York Times verlieh uns Deutschen sogar den Titel »World Recycling Champion«. Kurz: Soweit es uns betraf, war die Sache mit dem Umweltschutz auf einem guten Weg.
Viele von uns haben die Geschicke der Umwelt seit damals ein wenig aus dem Blick verloren. Was zum einen daran liegt, dass wir in letzter Zeit ziemlich beschäftigt waren: Nach dem Langzeitstudium mit anschließendem Dauerpraktikum war der Weg in den ersten bezahlten Job für die meisten von uns so mühsam wie ein Hindernisparcours im Dschungelcamp. Ein wenig später stand zwischen lauter Überstunden, um die nächste Karrierestufe zu erklimmen, die Familiengründung an, eine größere Wohnung musste gefunden, am besten sogar gekauft und finanziert werden. Und heute mühen wir uns damit ab, dass uns der Haushalt nicht um die Ohren fliegt, das nächste Meeting pünktlich vorbereitet ist und die Elternabende in der Schule nicht zum Kleinkrieg ausarten. Und wenn mal gerade kein Alarm herrscht, lassen wir uns erschöpft aufs Sofa fallen und gönnen uns eine Staffel unserer Lieblingsserie.
Wir tun das mit reinem Gewissen, denn beim Durchscrollen der Online-Gazetten erliegen wir dem Eindruck, Deutschland spiele eine würdige Vorreiterrolle im Klimaschutz. Immerhin haben wir die »Energiewende« erfunden und waren damit so schnell, dass andere Sprachen sie sogar als deutsches Lehnwort übernahmen – ein so viel positiverer Wortexport als »Blitzkrieg«. Einige von uns trinken sogar ausschließlich fair gehandelten Biokaffee, essen veganen Wurstersatz und verzichten an der Supermarktkasse auf die Plastiktüte. Überall stehen Windräder herum. Und jeder, der ein Dach sein Eigen nennt, überlegt früher oder später, ob sich eine Solaranlage lohnt.
Wer derart bewusst lebt, hat das Gefühl, voll im Plan zu liegen. Nur: Welcher Plan eigentlich? Statt des geordneten Rückzugs aus dem Atomstrom und der Kohle scheint auf höherer Ebene planloses Chaos zu herrschen: Wenn die Bundesregierung CO2 einsparen will, warum wird dann noch immer billige Braunkohle verstromt – und das unter anderem mit vier der fünf klimaschädlichsten Kraftwerke in Europa? Warum wird über die Hälfte unseres sorgsam getrennten Verpackungsmülls am Ende durch den Schornstein der Verbrennungsanlagen geblasen? Und warum gibt es Autos, die mit einem sprechen und via App gestartet werden können, aber keine Elektrowagen mit vernünftiger Reichweite und passender Lade-Infrastruktur?
Und das sind nur drei Dinge, die zeigen, wie planlos Deutschland beim Klimaschutz vorgeht.
Blöderweise haben wir inzwischen selbst den Durchblick verloren, was, wie und wo da eigentlich genau gerettet werden muss. Früher schienen die Probleme übersichtlicher und auch einfacher aus der Welt zu schaffen.
Dünnsäureverklappung in der Nordsee? Dagegen konnte man mit Umweltverbänden demonstrieren.
Ozonloch? Kein Problem – FCKW abschaffen und nicht mehr so viel Haarspray auf die Tolle.
Saurer Regen? Filter in Auspuffe und Schornsteine stopfen.
Borkenkäfer? Erledigt sich von selbst, denn gesunde Bäume trotzen den Krabblern.
Heute weiß man hingegen gar nicht mehr, wo man angesichts des maroden Zustands der Natur anfangen sollte. Bei der Abholzung des Regenwalds? Bei den übersäuerten Ozeanen? Beim Plastikstrudel im Pazifik? Beim Protest gegen die Ölpipelines in Alaska? Bei der Luftverschmutzung? Oder doch lieber bei dem Sterben der Gartenvögel?
Und das sind nur die Umweltprobleme. Sie finden auch noch mitten in einer Wirtschaftskrise statt, in der es Deutschland zwar prächtig geht, aber dauernd andere Staaten pleitezugehen drohen, während die EU langsam auseinanderfliegt, Trump sich mit einem Land nach dem anderen anlegt und die Deutschen als »böse, sehr böse« verunglimpft, die NATO Truppen und Kriegsgerät nach Osteuropa verlegt, um Putin abzuschrecken, und allerorten hässliche rechtsradikale Bewegungen Zulauf finden.
Das alles erscheint uns doch ziemlich komplex.
Wir überlassen das Weltretten deshalb heute lieber anderen.
Unseren Politikern, die sich in zig Konferenzen den Kopf heißreden. Den Leuten von BUND und Greenpeace, die aus Erfahrung gut im Umweltschutz sind. Oder wir hoffen, dass schließlich doch irgendein findiger Tüftler etwas ausknobelt, das die großen Probleme unserer Zeit lösen wird. Vielleicht ja sogar unser eigener Nachwuchs?
Obwohl wir damit die Arbeit an der besseren Zukunft praktisch outgesourct haben, glaubten wir bislang noch an sie. Selbst wenn eine Welt mit grüner Energie, heiler Umwelt und stetem Wachstum – digital, wohlhabend, friedlich und fair gehandelt – noch nicht erreicht war, sie war machbar. Alles eine Frage der Zeit.
Doch jetzt schwebt plötzlich ein neues Label über uns: Wir sind die Generation Weltuntergang – falls die Befürchtungen der amerikanischen Doomsday-Clock-Apokalyptiker eintreten sollten. Wir sind die Letzten, die noch einmal beschwingt über diesen Planeten hüpfen, bevor das große Chaos ausbricht. Und ganz oben auf die Liste der Probleme hat sich irgendwie der Klimawandel gemogelt, ohne dass einer von uns davon etwas mitbekommen hätte.
Wie das?
Klimawandel war bisher nach unserer Auffassung etwas, das sich still und leise im Hintergrund abspielt und noch Hunderte Jahre so weiterlaufen kann, bevor man handeln muss. Denn von der Klimakatastrophe merken wir im Alltag nichts – außer, dass schon mal jemand scherzhaft der Erderwärmung die Schuld gibt, wenn es mal wieder tagelang wie aus Kübeln schüttet oder wenn wir an einem ungewöhnlich warmen Oktobertag noch spätabends bei lauer Witterung auf dem Balkon unser Bierchen trinken.
Den Borkenkäfer konnte man damals wenigstens noch sehen, der saure Regen zeigte sich an Lametta-Syndrom und Kahlschlag, und das Ozonloch sorgte dafür, dass wir fortan nicht mehr ohne zweistelligen Lichtschutzfaktor sonnen konnten, wollten wir nicht so rot werden wie Elmo aus der Sesamstraße.
Wie lange warnt uns nun schon Greenpeace vor der Erderwärmung und verkauft Al Gore uns Eine unbequeme Wahrheit? Von Frank Schätzings Der Schwarm über T. C. Boyles Ein Freund der Erde bis zu Maja Lundes Die Geschichte des Wassers schildern Romanschriftsteller in düsteren Farben ihre Weltuntergangsfantasien. Neuerdings wähnt uns ja sogar Leonardo DiCaprio Before the Flood, und Gore legte den zweiten Teil seines Klimathrillers vor. Wahrscheinlich waren die alle noch nie in Oer-Erkenschwick, Obersulzbach und Untereschbach – denn da ist von der drohenden Katastrophe wenig zu sehen. Soll auch keiner von zu warmen Wintern reden: Der letzte war gefühlt immer zu kalt. Und was den Sommer angeht, waren wir ja sowieso noch nie zufrieden. Rudi Carrell hat doch schon in den Siebzigern genölt: »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?« Früher war das Wetter also auch nicht besser.
Vielleicht haben ja doch die ganzen Skeptiker recht, wenn sie meinen: Das Klima war noch nie konstant. Die Temperaturen steigen gar nicht so rasant wie behauptet. Und was Klimakurven, Messungen und statistische Befunde betrifft, gilt doch bestimmt wie sonst auch der Grundsatz: Traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast.
Und auch wenn wir glauben, die Welt ginge unter: Müssen wir deshalb in panischen Aktionismus verfallen? Reicht es nicht, wenn wir ein bisschen öfter mit den Öffis fahren und ab und an auch mal Gemüse auf den Grill legen?
Außerdem schrauben die da oben doch fleißig an einer Lösung, und die Klimakonferenz in Paris hat 2015 den großen Durchbruch gebracht: Die globale Erwärmung soll bei 1,5 Grad Celsius, schlimmstenfalls bei zwei Grad gestoppt werden. Angie ließ sich sogar im roten Parka medienwirksam vor einem der schmelzenden Gletscher ablichten, bereit, die Welt zu retten. Also alles paletti.
Doch wenn wir die Doomsday-Clock-Vorhersage ernst nehmen, täuschen wir uns da vielleicht gewaltig.
Zumal die Damen und Herren mit der Weltuntergangsuhr nicht die Einzigen sind, die vor einer finsteren Klimazukunft warnen: Der Weltklimarat mahnte in seinem Sonderbericht 2018, dass uns selbst dann schwerwiegende Konsequenzen drohen, wenn wir die Ziele von Paris einhalten. Und eine internationale Forschergruppe des Stockholm Resilience Center, der Universität Kopenhagen, der Australian National University und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung fürchtete im selben Jahr, dass bereits zwei Grad Erwärmung die Erde in eine »Heißzeit« katapultieren würden, die den Planeten für uns Menschen irgendwann unbewohnbar macht.
Es könnte daher am Ende eher so sein wie in einem dieser Katastrophenfilme, die Flammendes Inferno oder Erdbeben hießen und in unserer Kindheit immer nach dem Wort zum Sonntag im Ersten kamen: Während die ganz gewöhnlichen Menschen – also wir – sich in Sicherheit wähnen und ihr gewohntes Leben weiterleben, ahnen nur ein paar Topchecker, dass die Katastrophe vor der Tür steht. Und dann ist es zu spät, und kaum einer kann sich noch retten.
Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Machen wir uns ein richtiges Bild davon, was gerade in Sachen Klimawandel abgeht. Wie sieht es auf der Erde aus – alles halb so wild, oder stehen wir wirklich kurz vor dem Weltuntergang?
Kapitel 2
Global Warning
Wo der Klimawandel schon in vollem Gang ist
Uns bleiben 100 Jahre,
um einen neuen Planeten zu finden.
Stephen Hawking
James Balogs Leben hängt am seidenen Faden, als er sich auf dem Bauch liegend mit der Kamera in der Hand an den Rand der Gletscherspalte robbt. Jedenfalls sieht es so aus, denn das einfache Seil, mit dem er gesichert ist, wirkt im Vergleich zu den gigantischen Eismassen um ihn herum wie dünner Zwirn. Unter ihm stürzt ein türkisfarbener Wasserfall aus Schmelzwasser durch die Gletscherspalte in die Tiefe. Bricht die Eiskante, stürzt Balog hinab. Doch das interessiert ihn nicht, genauso wenig wie seine Knie, die er auf Rat seines Arztes nach einer Operation eigentlich schonen sollte. Balog hat Wichtigeres zu tun. Er will für den Rest der Welt, also für uns, dokumentieren, wie es wirklich um unseren Planeten steht. Deshalb quält er sich auf Krücken durch Schneestürme, kraxelt in Gletschern herum und tut das, was er am besten kann: Fotos machen. Davon, wie das Eis zerfällt.
Balog ist Geowissenschaftler und einer der besten Naturfotografen weltweit. Und er hat selbst lange nicht an den Klimawandel geglaubt. »In den Neunzigern habe ich die Berichterstattung über globale Erwärmung verfolgt, und offen gestanden gehörte ich auch eine Zeit lang zu den Skeptikern«, sagt er. »Schließlich ließ ich mich überzeugen, dass der Klimawandel sehr real ist.«
2007 gründet er deshalb ein Projekt, das er Extreme Ice Survey nennt, kurz und knackig: EIS. Mit Forschern, Fotografen und dem Regisseur Jeff Orlowski reist er mehrere Jahre nach Montana, Alaska, Island und Grönland, um in den entlegensten und bitterkältesten Winkeln der Welt Kameras mit Zeitschaltuhren und automatischen Auslösern zu installieren. Die Geräte sollen über einen längeren Zeitraum in regelmäßigen Abständen Bilder von Gletschern und Eismassen schießen und so die Veränderungen erfassen.
Klingt nach einer ziemlich abenteuerlichen Idee.
Doch sie funktioniert.
Aus Balogs Aufnahmen entsteht unter anderem die mehrfach prämierte Doku Chasing Ice. Die Fotos der Gletscher sind darin im Zeitraffer zu sehen. So werden Prozesse sichtbar, die sich über lange Zeiträume hinziehen und dem Auge des Betrachters normalerweise verborgen bleiben.
Die Botschaft der Bilder ist so eindeutig wie erschreckend: Das Eis rund um den Nordpol schmilzt. Und zwar massiver und schneller, als sich selbst viele Wissenschaftler in ihren düstersten Prognosen dies ausgerechnet haben.
Der isländische Sólheimajökull-Gletscher schrumpfte unter den Blicken von Balogs Kamera in etwas mehr als vier Jahren wie ein Soufflé. Der Columbia-Gletscher in Alaska zog sich sogar im Winter zurück, wenn sich das Eis üblicherweise ausdehnt, und verlor in drei Jahren vier Kilometer an Länge.
Balogs Beobachtungen schließen perfekt an die Analysen der University of Alberta in Kanada an, in denen es um die Veränderung von Gletschern im Yukon-Gebiet zwischen 1958 und 2008 ging: Von rund 1400 Gletschern, die es 1958 gab, vergrößerten sich vier. Etwa 1000 Gletscher aber wurden deutlich kleiner. Und über 300 verschwanden komplett. Der grönländische Eisschild, die zweitgrößte permanent vereiste Fläche nach der Antarktis, verliert nach neuesten Berechnungen der NASA jährlich 286 Gigatonnen an Masse. Das ist ungefähr fünfmal der Bodensee, der sich da jedes Jahr in den Ozean ergießt.
Um den Eisdeckel ganz oben auf dem Planeten steht es schlecht: Nach Berechnungen von Ted Scambos vom National Snow & Ice Data Center in Colorado ist das arktische Meereis in den vergangenen fünfzig Jahren dreimal schneller geschmolzen als zuvor in Computermodellen simuliert. Läuft es also richtig blöd, meint er, ist schon 2020 im Sommer kein Meereis mehr da.
Nun könnte man sich ja freuen, dass dann die sagenumwobene Nordwestpassage endlich befahrbar wäre. Der Haken an der ganzen Sache ist nur: Das Schmelzwasser der Gletscher löst sich nicht einfach in Luft auf – es lässt den Meeresspiegel steigen. Weltweit haben sich die Ozeane seit 1901 im Schnitt um etwas mehr als zwanzig Zentimeter angehoben – und sie steigen jedes Jahr weiter um rund drei Millimeter.
Wie rasant das Eis sich in Wasser verwandelt und die Meere füllt, zeigen James Balog und sein Team sehr eindrucksvoll am Beispiel des grönländischen Ilulissat-Gletschers. Zwischen 1902 und 2001 hat er sich um zwölf Kilometer zurückgezogen. Allein von 2000 bis 2010 dann um weitere 14,5 Kilometer. Noch mal zum Mitschreiben: Der Eiskoloss verlor also innerhalb von zehn Jahren mehr Masse als in den vorangegangenen einhundert Jahren.
Es schmilzt. Auf breiter Front. Mit zunehmender Rasanz.
»Ich hätte nie gedacht, dass so große Massen in so kurzer Zeit verschwinden könnten«, sagt Balog in seinem Film und hält eine SD-Karte hoch. »Dies ist die Erinnerung an eine Landschaft, die für immer verschwunden ist. Nie wieder in der Menschheitsgeschichte wird jemand sie sehen können.«
Schuld an dem Desaster ist die globale Erwärmung.
Durch den Ausstoß von Klimagasen wie CO2 und Methan, unter anderem aus Auspuffen und Fabrikschornsteinen, hat sich die Erde laut dem Sonderbericht des Weltklimarats IPCC von 2018 seit der Zeit der Industrialisierung durchschnittlich um 1 Grad Celsius erwärmt.
1 Grad.
Klingt harmlos.
Ist es aber nicht.
Erstens, weil die Temperaturen nicht überall gleich schnell steigen – in Europa ist es zum Beispiel schon 1,3 Grad wärmer als in vorindustriellen Zeiten, Kanada hat sich allein in den vergangenen 63 Jahren um 1,8 Grad erwärmt und die Arktis im gleichen Zeitraum sogar um rund 3 Grad, womit sie eine der sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Erde ist. Weltweit war die Zeit seit Beginn der Achtziger mit einiger Wahrscheinlichkeit die wärmste Periode in den vergangenen 1400 Jahren. Und die Fieberkurve steigt weiter.
Zweitens, weil bereits das Ergebnis dieser gering scheinenden Erwärmung gravierend ist. Und das können wir uns inzwischen rund um den Globus ansehen. 1 Grad – das verändert das Wetter, das Klima und ganze Landschaften. Überall.
In diesem Kapitel machen wir eine Reise um eine Welt, die schon ziemlich im Eimer ist. Betroffen sind nicht nur entlegene Eilande, sondern Regionen, die zu unseren liebsten Urlaubsländern zählen. Sie stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Schäden, die das veränderte Klima anrichtet, nicht nur dort, sondern in vielen Gegenden rund um den Globus.
Während man woanders auf der Welt noch debattiert, ob der Klimawandel nicht eine Erfindung der Chinesen oder der Solarbranche ist und vielleicht mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt, eint die Menschen in den betroffenen Gebieten die Gewissheit: Das Klimasystem spielt verrückt.
Die Wetterkapriolen, mit denen sie zu kämpfen haben, lassen in ihrer Häufung und Heftigkeit nämlich nur einen Schluss zu: dass genau das geschieht, wovor Klimaforscher immer gewarnt haben. Und dass es vielleicht keine gute Idee ist, die globale Temperatur, wie auf der Pariser Klimakonferenz beschlossen, noch weiter bis auf zwei Grad steigen zu lassen, falls die 1,5 Grad sich nicht halten lassen.
Die globale Erwärmung verändert die Biosphäre und schickt sich an, ehemals sichere und fruchtbare Regionen in unbewohnbare Katastrophengebiete zu verwandeln. Auch bei uns zu Hause in Deutschland.
Aber fangen wir von vorne an, dort, wo die Dinge buchstäblich ihren Lauf nehmen.
78° 13’ N, 15° 38’ OLONGYEARBYEN, SPITZBERGENDIE GROßE SCHMELZE
Longyearbyen ist einer der nördlichsten Orte der Welt und das Tor zu den arktischen Inseln. Klingt ziemlich entlegen, ist es aber nicht. Es ist die größte Stadt und das Verwaltungszentrum von Spitzbergen, und man erreicht es mit einem Flug der Scandinavian Airlines von Berlin, Hamburg oder München aus. Jedes Jahr starten neben Norwegern, Schweden, Briten, Dänen, Franzosen und Niederländern auch Tausende von uns Deutschen von diesem Ort aus mit Hurtigruten zu Fjorden, Gletschern, Eisbären und Polarlichtern.
Longyearbyen, das eingekuschelt in einem der für diese Gegend typischen Trogtäler zwischen schneebedeckten Plateaus liegt, ist auch die Heimat von Eva Grøndal, die hier seit fast zehn Jahren eine Galerie führt. Und nun könnten ihre Tage im Eis gezählt sein, das hat sie vor Kurzem begriffen.
2015. Es ist später Samstagvormittag, kurz vor Weihnachten, und Eva ahnt nicht, was da buchstäblich auf sie zurollt. Die Galeristin hat es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht, während draußen ein heftiger Schneesturm tobt, tatsächlich der schlimmste seit dreißig Jahren, wie die Meteorologen später feststellen werden. Die Bretter und Balken ihres kleinen roten Holzhauses knarzen, während Eva die letzten Geschenke verpackt. Normalerweise müsste sie um diese Jahreszeit zwei oder drei Lagen dicker Klamotten tragen, weil die betagte Heizung nicht mehr gegen die Temperaturen ankommt, die hier oben auf den Inseln am Rande der Arktis gerne mal Tiefkühlfachniveau erreichen. Doch in diesem Jahr genügen ein Pulli und ein Paar warme Puschen, denn der Winter 2015 ist ungewöhnlich mild. Die Jahresmitteltemperaturen sind hier oben in den vergangenen fünfunddreißig Jahren um knapp drei Grad gestiegen, und in diesen Tagen schwankt das Thermometer gerade mal um den Gefrierpunkt.
Als Eva in die Küche geht, um Tee aufzusetzen, spürt sie, wie das Haus plötzlich unter ihren Füßen vibriert. Sie glaubt zunächst an ein Erdbeben. Das wäre in dieser Gegend seltsam genug, doch als sie einen Blick aus dem Küchenfenster wirft, sieht sie, was sich draußen abspielt: Eine riesige Schneewand rast auf das Dorf zu. Einige Nachbarhäuser sind bereits zertrümmert oder unter den weißen Massen begraben worden. Bevor sie sich in Sicherheit bringen kann, erfasst die Lawine auch Evas Haus. Sie wird zu Boden geschleudert, während um sie herum Töpfe, Pfannen und Geschirr aus den Schränken schießen, Glas bricht und der Schnee durchs Fenster dringt.
So schnell, wie der Spuk begonnen hat, ist er wieder vorbei. Eva ist mit dem Schrecken davongekommen. Ihr Haus ist von einem letzten, schwachen Ausläufer der Lawine mitgerissen und gegen ein anderes Haus geschoben worden. Nur wenige haben solches Glück gehabt. Die Siedlung im Osten von Longyearbyen, in der Eva wohnt, liegt in Trümmern. Rund 170 Menschen können nicht in ihre Häuser zurück. Viele Nachbarn sind verletzt. Ein Mann und ein Kind tot.
Eva Grøndal und die anderen Bewohner der Siedlung werden in Notunterkünfte gebracht – aus denen sie allerdings schon wenige Monate später wieder flüchten müssen, als das Areal von einer Schlammlawine überspült wird.
Und das Chaoswetter lässt die Spitzbergener nicht zur Ruhe kommen. Der Ausnahmezustand wird zur Gewohnheit, die Region stellt neue Rekorde in Sachen Wärme und Niederschlagsmenge auf.
Ein Jahr nach der Zerstörung von Evas Siedlung, im Winter 2016, regnet es auf der Insel, statt zu schneien (das ist in Nordpolkreisen zu der Jahreszeit nicht vorgesehen) – eine außergewöhnlich milde Luftströmung bringt feuchte Warmluft aus der Karibik in die Polarregion, wo sie als Regen herunterkommt. Es schüttet so heftig, dass in Longyearbyen einige Straßen gesperrt und etliche Bewohner wegen Überschwemmungsgefahr evakuiert werden. Ein paar Monate darauf, im Februar 2017, geht dann erneut eine Lawine ab, die mehrere Häuser und Wohnungen unter ihren Schneemassen begräbt. Diesmal stirbt zum Glück niemand. Und wenige Tage später müssen wieder alle Bewohner der Stadt ihre Bleibe räumen, weil eine neue Lawine droht.
Schuld an den katastrophalen Zuständen, da sind sich lokale Klimaexperten und Bewohner einig: die globale Erwärmung. 2016 war bis dato das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen 1889 – es war fast sieben Grad wärmer als normal, und am nicht weit entfernten Nordpol wurden im November sogar lauschige null Grad registriert – zwanzig Grad mehr als üblich.
Das gab’s noch nie.
Inzwischen tauen sogar die Permafrostböden, auf denen Orte wie Longyearbyen gebaut sind. Schon bald könnten Teile von Spitzbergen für immer unbewohnbar sein, wenn die Wetterbedingungen sich noch weiter verschlechtern und die aufgeweichten Böden Infrastruktur und Gebäude bedrohen.
Das Klima wandelt sich so rasant und nachhaltig, dass sogar der Svalbard Global Seed Vault bedroht ist. Der unterirdische Bunker in der Nähe von Longyearbyen – übrigens auch »Doomsday Vault« genannt – ist der Saatguttresor der Welt. Sollte mit der Flora wegen Naturkatastrophen oder Kriegen mal etwas schiefgehen, sind hier Pflanzensamen aus allen Erdteilen eingelagert, auf die die Menschheit zurückgreifen kann. Die botanische Arche ist für den schlanken Preis von 45 Millionen US-Dollar hier errichtet worden, weil man das ewige Eis für einen besonders sicheren, unverwüstlichen Ort hielt. Nun aber scheint es mit der Ewigkeit vorbei zu sein: Wegen der großen Hitze lief im Oktober 2016 erstmals ein Zugangstunnel mit Wasser voll. Um die Back-up-Samenbank vor dem Klimawandel zu sichern, braucht es inzwischen Schutzwände und Entwässerungsgräben – eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
Es gäbe noch viele solcher Geschichten aus dem hohen Norden zu erzählen. Denn nicht nur auf Spitzbergen, sondern rund um die Arktis hat das Wetter eine Macke. Bestätigen kann das beispielsweise Matilda Hardy, die der indianischen Gemeinde von Shaktoolik, Alaska, vorsteht und die mit den anderen Einwohnern erbittert darum kämpft, dass ihre Stadt nicht vom Schmelzwasser, das die Flüsse in reißende Ströme verwandelt und den Meeresspiegel steigen lässt, beim nächsten Sturm oder Starkregen von der Landkarte gespült wird. Oder die rund 47 000 Inuit, die noch immer in Grönland leben und denen die Lebensgrundlage buchstäblich unter den Füßen wegschmilzt. Auf lange Sicht, da sind sich Forscher und Einheimische einig, werden viele Menschen hier oben ihre angestammten Gebiete verlassen müssen.
Die große Schmelze hat allerdings auch Folgen für den Rest der Welt. Denn was hier oben verschwindet, schwappt weiter südlich in flüssiger Form wieder an Land.
25° 47’ N, 80° 13’ WMIAMI, FLORIDADIE PERFEKTE FLUTWELLE
Mit dem Labradorstrom wälzt sich das kalte Süßwasser, das dem schmelzenden Eis in der Arktis und Grönland entspringt, zum Großteil entlang der kanadischen Küste nach Süden. Ihm kommt an der Neufundlandbank der Golfstrom entgegen, die Wärmepumpe, die für das Wetter in Nordamerika und Europa bestimmend ist. Der Golfstrom, den der Austausch von warmen und kalten Wasserschichten in Gang hält, wird durch das kalte Süßwasser gehemmt, sodass er sich in den vergangenen 100 Jahren nach Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) bereits verlangsamt hat – es wäre also nicht gut, sollte sich dieser Trend verstärken, denn das könnte das Wetter auf beiden Seiten des großen Teichs gehörig durcheinanderbringen. Noch allerdings fließt der größte Teil des geschmolzenen Eises mit dem Labradorstrom weiter an der amerikanischen Ostküste entlang bis hinunter nach Florida, gemeinhin auch Sunshine State genannt. Besonders angetan hat es ihm dort Miami, die Stadt des Art déco, von Sonny Crockett und Ricardo Tubbs und das Jagdrevier von Dexter Morgan. Das Schmelzwasser lässt hier wie an vielen anderen Orten auf der Welt den Meeresspiegel deutlich ansteigen. Und so bekommt Jessica Benitez neuerdings beim Einkaufen immer wieder nasse Füße.
Oktober 2016. Ein sonniger Tag mit strahlend blauem Himmel. Jessica stammt aus Venezuela und ist vor gut zwei Monaten in ein Apartment in Miami Shores gezogen, einer Gemeinde an der Biscayne Bay, direkt gegenüber von Miami Beach. Als sie vom Supermarkt nach Hause kommt, staunt Jessica nicht schlecht: Ihre gesamte Straße ist überspült. Die Nachbarn stehen in Gummistiefeln vor ihren Häusern.
Jessica ist geschockt. Niemand hat ihr gesagt, dass sich ihr neues Heim in einem Hochwassergebiet befindet. Als sie in der Nachbarschaft nachbohrt, erfährt sie aber, dass das wohl schon eine ganze Weile so geht: Erreicht die Flut einen hohen Stand, drückt das Meerwasser von unten durch den löchrigen Kalksteinboden, auf dem ihre Gemeinde gebaut ist. Was früher nur selten vorkam, ist nun schöne Regelmäßigkeit – und das, wo es doch neuerdings Fälle von Zikafieber in Miami gibt und die Larven der Mücken, die das Virus übertragen, in stehendem Wasser besonders gut gedeihen.
»Sunny Day Flooding« nennen es die Amerikaner, wenn auch unter blauem Himmel ganze Straßenzüge unter Wasser stehen. Ganz neu ist die Schönwetterflut nicht. Allerdings erwischt es jetzt immer öfter ganze Stadtteile, auch solche, die früher nicht betroffen waren.
In Miami zeigen lokale Wissenschaftler auf, dass die Stadt früher rund sechs solcher Ereignisse im Jahr erlebt hat. Bis 2045, so schätzen sie nun, kann eine Überflutung bis zu 380-mal im Jahr auftreten – das wäre dann in einigen Teilen der Stadt gleich zweimal an einem Tag.
Das Dumme: Schutzmaßnahmen wird es so schnell nicht geben. Zumindest nicht in Miami Shores, wo überwiegend Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen leben, die politisch keinen nennenswerten Einfluss haben. Zudem traut sich niemand, wegen der Flut öffentlich Großalarm zu schlagen. Alle haben Angst, dass der Wert ihrer Immobilien und Grundstücke ins Bodenlose fallen könnte. Dass das Hausbesitzern im Zweifelsfall droht, hat man ja drüben auf der anderen Seite der Biscayne Bay sehen können: Die ganze Stadt spricht über die Luxusimmobilien in Miami Beach, die bald weniger wert sein könnten als ein pappiger Burger von McDonald’s. Die Stadt tut alles, um das für die Reichsten zu verhindern – geplant sind aufwendige Drainage- und Pumpensysteme, Uferdämme und Straßenarbeiten für rund 400 Millionen Dollar. Denkmalschützer haben auch eine Idee, wie man die legendären Bauten der Stadt schützen könnte – indem man sie anhebt und aufbockt. Das kostet, funktioniert aber im Straßenbau schon prima: Die Stadt legt ganze Straßenzüge höher, um den Verkehr in Miami Beach vor dem Wasser zu schützen. Wobei klar ist, dass auch das nicht ewig halten wird, wenn immer mehr Eis oben bei Eva Grøndal den Bach runtergeht.
Einer Studie der US-Regierung zufolge ist Miami eine der Städte, die am stärksten vom Klimawandel bedroht sind. Bis 2060, so wird geschätzt, wird das Wasser dort um 60 Zentimeter steigen, bis 2100 um 1,20 Meter – ganz und gar keine rosigen Aussichten für die in zarten Pastelltönen gehaltenen Art-déco-Hotels, denn Miami Beach liegt nur 1,22 Meter über dem Meeresspiegel. Schon jetzt bedroht das salzige Meerwasser das Grundwasser. Miami Beach und andere Teile Floridas könnten dann trotz zu vielen Wassers ein echtes Trinkwasserproblem bekommen. Der Bürgermeister von Miami Beach, Philip Levine, sagt: »Die Zukunft von Miami Beach und anderen Küstenstädten ist unsicher.«
Wer halbwegs helle im Kopf ist, verkauft deshalb. Und zwar jetzt, nicht später.
Der steigende Meeresspiegel betrifft die gesamte amerikanische Ostküste. Von Boston über Charleston bis nach Key West – der Klimawandel macht sie alle nass.
Eines der Hauptkrisengebiete ist die Chesapeake Bay, die größte Flussmündung der Vereinigten Staaten. Dort ist der Wasserstand seit 1927 um vierzig Zentimeter gestiegen, also gut um das Doppelte des globalen Durchschnitts. An der Bay liegen Millionenstädte wie Washington, D. C., Norfolk oder Annapolis und Baltimore, wo es schon heute teilweise über 40 Fluttage pro Jahr gibt – mitunter zehnmal so viele wie vor vierzig Jahren.
Allein in den USA sind so schon heute einige Millionen Menschen vom steigenden Meeresspiegel betroffen. Weltweit sind es noch mehr, denn über eine Milliarde Menschen leben in Küstenregionen.
Der steigende Meeresspiegel und Überflutungen sind aber nicht das Einzige, was die amerikanischen Ostküstenbewohner fürchten. Durch die globale Erwärmung braut sich draußen über dem Atlantik ein Wetter zusammen, das die Menschen bis runter in die Karibik in Angst und Schrecken versetzt.
18° 38’ N, 74° 07’ WJÉRÉMIE, HAITIDIE STURMMASCHINE
An einem Dienstag im Oktober 2016 schreckt die achtjährige Loudina in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf hoch. Nacheinander werden nun auch ihre sechs Geschwister wach, die sich zuvor unruhig im Schlaf gewälzt haben. Das einfach gebaute Haus knirscht und knarzt unter einem wütenden Sturm; der Wind dröhnt so laut, als würde hinter der dünnen Wand ein Jumbojet vollen Saft auf die Turbinen geben. Loudina versucht, ihre Geschwister zu beruhigen, und will ihre Mutter holen – doch da bricht plötzlich das Haus über ihnen zusammen und begräbt sie unter den Trümmern.
Weiter östlich, in Croix-des-Bouquets, einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince, wacht auch die zehnjährige Rosemika auf. Der Sturm rüttelt an der Tür und lässt den Regen wie aus Eimern gegen die Fenster klatschen. Von draußen hört Rosemika die panischen Rufe der Nachbarn: »Wasser! Überall Wasser!« Das Mädchen springt auf und eilt zur Tür. Draußen sieht es aus, als ob die Sintflut da wäre. Eigentlich müsste es langsam hell werden, doch der Himmel ist pechschwarz, die Straßen sind vom Wasser überspült.
Bereits seit Tagen wird auf Haiti vor einem tropischen Sturm gewarnt, der sich zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie auswachsen kann. Hurrikane werden in eine Kategorienskala eingeteilt, die vom tropischen Sturm, der mit einem Orkan, also Windstärke zwölf, vergleichbar ist, bis zur Kategorie fünf für Stürme mit über 250 Stundenkilometern und Flutwellen von über fünf Metern reicht. Doch die Warnung hat keiner so richtig ernst genommen, sogar Fischerboote sind trotz des aufziehenden Tropensturms in See gestochen. Der Inselstaat, der an die Dominikanische Republik grenzt – die nicht nur wir Deutschen wegen der All-inclusive-Angebote, der frischen Tropenfrüchte und der Bilderbuchstrände so gerne anfliegen –, gehört zu den ärmsten Ländern der westlichen Hemisphäre. Viele Menschen hier sind den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert, da die meisten Häuser bautechnisch gesehen auf einem schlechteren Stand sind als eine hiesige Gartenlaube – und weil Haiti eine lange Küste hat, an der alle größeren Städte liegen. Deshalb warnt man lieber etwas öfter, auch wenn es am Ende nur regnet. Und deshalb sind nun auch alle überrascht, dass es doch so dicke kommt wie angekündigt.
Rosemika schnappt sich ihre Brüder und Schwestern, und gemeinsam mit ihren Eltern fliehen sie auf höher gelegenen Grund. Um sie herum werden Dächer abgedeckt, Palmen zerbrechen wie Streichhölzer, und der Wind macht viele Behausungen dem Erdboden gleich.
Während sich Rosemika und ihre Familie schließlich in eine Schule, eins der wenigen Gebäude aus Stahl und Beton, retten können, kämpft Anite Figaro wie viele andere noch ums Überleben. Sie wohnt in dem abgelegenen Bergdorf Cabi und ist mit den anderen Einwohnern auf der Flucht durch die Dunkelheit. Dreck, Äste, ganze Bäume und Trümmerteile aus dem Tal fliegen um sie herum, und der Wind ist so stark, dass sie sich schließlich auf den Boden legen müssen, um nicht fortgerissen zu werden. Kriechend schaffen sie es zu einer Höhle, wo sie warten, bis sich der Sturm ein wenig gelegt hat.
In Jérémie liegen Loudina und ihre Geschwister noch immer unter den Trümmern. Sie schreien ununterbrochen um Hilfe, viele Stunden lang. Erst nach einer Ewigkeit, als das Auge des Hurrikans über Haiti hinweggezogen ist, dringen die Helfer zu ihnen vor. Sie befreien Loudina und ihre Geschwister. Doch ihre Mutter ist tot – sie ist eine von eintausend Haitianern, die den Sturm nicht überleben.
Hurrikan Matthew, der stärkste tropische Sturm seit über fünfzig Jahren, hat Haiti an diesem 4. Oktober 2016 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern getroffen. Rund 175 000 Menschen verlieren ihr Obdach, und der Sturm macht ganze Städte wie Jérémie dem Erdboden gleich. 80 Prozent der Ernte sind vernichtet, die Lebensmittel werden knapp, und durch verschmutztes Wasser droht sich die Cholera auszubreiten.
Matthew indes zieht mit nur wenig verminderter Gewalt weiter über die Bahamas und an der amerikanischen Ostküste entlang bis hoch nach Virginia. Er bringt extreme Regenfälle, sorgt für Überflutungen und hinterlässt schwere Schäden. Auf dem Festland müssen elf Millionen Amerikaner in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt sterben im Verlauf des Sturms 1655 Menschen.
Was sich da in der Hurrikansaison 2016 über diesem Teil des Atlantiks zusammengebraut hat, würde einem Roland-Emmerich- oder Wolfgang-Petersen-Film zum Vorbild gereichen. Schon im Januar war es mit einem kleineren Hurrikan über den Bermudas sehr früh losgegangen. Anfang August zischte dann Earl mit 140 Stundenkilometern von Puerto Rico durch die Karibik, am Ende des Monats gefolgt von Hermine, die vorbei an der Dominikanischen Republik, Kuba, den Bahamas und der US-Ostküste raste – wie ihr Vorgänger ein Hurrikan der Kategorie eins, der es in der Spitze aber auch schon auf ordentliche 130 Stundenkilometer gebracht hat. Nach etlichen kleineren Stürmen rollte Anfang Oktober die Kategorie-fünf-Urgewalt Matthew an. Und direkt in seinem Windschatten nur wenige Tage später Nicole, als Hurrikan der Kategorie vier mit Windgeschwindigkeiten über zweihundert Stundenkilometern auch nicht ohne. Den Abschluss bildete dann Otto, ein Kategorie-zwei-Wirbelsturm, ebenfalls knapp zweihundert Kilometer die Stunde stark, der Ende November weiter südlich Panama, Nicaragua, Costa Rica und Kolumbien zu schaffen machte.
So turbulent ging es seit 2012 nicht mehr zu, als Hurrikan Sandy (ein Sturm der Kategorie drei, der zeitweise 185 Stundenkilometer erreichte) unter anderem New York City mit voller Wucht traf und unter Wasser setzte – und es sind seit 2005 nicht mehr so viele Menschen wegen eines tropischen Wirbelsturms ums Leben gekommen. Damals machte Hurrikan Katrina New Orleans platt.
Das Monsterduo Matthew und Nicole legte eine Premiere hin: Nie zuvor in der 165 Jahre dauernden Geschichte der Hurrikanbeobachtung wurden im Oktober zwei Stürme von solchem Kaliber verzeichnet. Zudem hatte sich Matthew innerhalb von nur vier Tagen von einem tropischen Sturmtief zu einem Hurrikan der stärksten Kategorie entwickelt – so schnell war vor ihm noch keiner gewesen.
Wetterexperten beobachten schon seit den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, dass die Stürme einen Gang zugelegt haben. Und den Verursacher haben sie ebenfalls ausgemacht: die globale Erwärmung.