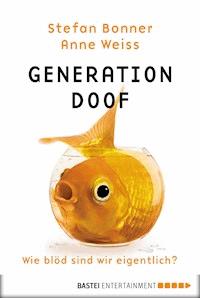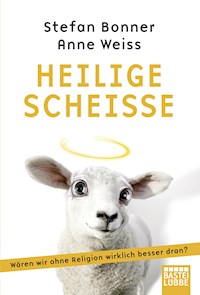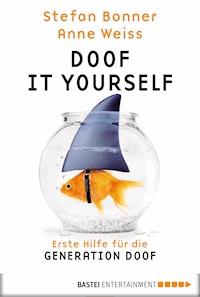9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heute sind sie legendär: die Achtziger. Es war das Jahrzehnt, als wir mit dem Kassettenrekorder Mix-Tapes aus dem Radio aufnahmen und Dallas-Frisuren und Hawaiihemden trugen. Wer in dieser Zeit zwischen Bandsalat und Neuer Deutscher Welle, Indiana Jones und YPS-Heft, Atomwaffen und Ententanz aufwuchs, erlebte ein epochales, seltsam unbekümmertes, oft albernes Jahrzehnt, in dem alle trotz des drohenden Weltuntergangs durch sauren Regen und Kalten Krieg den Eindruck einer lustig-bunten Zeit hatten. Und: irgendwie fing irgendwann in jener Zeit die Zukunft an! Mit einem Augenzwinkern schauen Stefan Bonner und Anne Weiss, selbst Kinder der Achtziger, zurück auf das Jahrzehnt, das uns prägte wie kein anderes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stefan Bonner / Anne Weiss
Wir Kassettenkinder
Eine Liebeserklärung an die Achtziger
Illustrationen von Jürgen Speh
Knaur e-books
Über dieses Buch
Heute sind sie legendär: die Achtziger. Es war das Jahrzehnt, als wir mit dem Kassettenrekorder Mix-Tapes aus dem Radio aufnahmen und Dallas-Frisuren und Hawaiihemden trugen. Wer in dieser Zeit zwischen Bandsalat und Neuer Deutscher Welle, Indiana Jones und YPS-Heft, Atomwaffen und Ententanz aufwuchs, erlebte ein epochales, seltsam unbekümmertes, oft albernes Jahrzehnt, in dem alle trotz des drohenden Weltuntergangs durch sauren Regen und Kalten Krieg den Eindruck einer lustig-bunten Zeit hatten. Und: irgendwie fing irgendwann in jener Zeit die Zukunft an! Mit einem Augenzwinkern schauen Stefan Bonner und Anne Weiss, selbst Kinder der Achtziger, zurück auf das Jahrzehnt, das uns prägte wie kein anderes.
Inhaltsübersicht
Für alle Kassettenkinder.
Und für unsere verstorbenen Helden, ohne die es nicht unser Lieblingsjahrzehnt gewesen wäre:
David Bowie
Michael Ende
Otto Šimánek
Carrie Fisher
Robin Williams
Telly Savalas
George Michael
Diether Krebs
Götz George
Michael Jackson
John Belushi
Dieter Hildebrandt
Larry Hagman
Leonard Nimoy
Rio Reiser
Freddie Mercury
Bud Spencer
Patrick Swayze
Falco
Peter Lustig
Peter Behrens & Kalle Krawinkel
Prince
Roger Moore
Und viele andere.
Und viele andere.
Let’s dance in style, let’s dance for a while,
Heaven can wait, we’re only watching the skies,
Hoping for the best, but expecting the worst,
Are you gonna drop the bomb or not?
Alphaville
Einleitung
Wir Kassettenkinder
Sonntagnachmittag, Anfang der Achtziger. Wenn sich der große Zeiger der Zwölf und der kleine der Drei näherten, lagen wir in den Kinderzimmern auf dem Teppich vor dem Monokassettenrekorder oder hockten im Wohnzimmer vor Papas Stereoanlage. Der Radiotuner war auf SWF3 eingestellt, die Kassette ruhte, auf Anfang zurückgespult, im Aufnahmedeck. In Reichweite hatten wir einen Bleistift deponiert, um spontan auftretenden Bandsalat zu beseitigen.
Wir warteten. Auf Elmar Hörig, den Radiomoderator mit den coolsten Sprüchen und der besten Musikauswahl. Es steigerte das eigene Ansehen, wenn man Elmis Sprüche und Witze am nächsten Tag auf dem Schulhof rezitieren konnte. Vor allem aber bot die Elmi Radio Show eine der wenigen Chancen, gratis an die angesagten Songs zu kommen. Noch gab es keine flächendeckende Besiedlung mit Saturn- und Mediamärkten, und die Erfindung des MP3-Downloads lag so weit in der Zukunft, dass nicht einmal Marty McFly davon träumte. Wer also für die Charthits nicht sein gesamtes Taschengeld im nächsten Plattenladen versenken wollte – nur, um sie dann auf dem elterlichen Plattenspieler im Wohnzimmer zu hören, weil wir selbst noch keinen hatten –, der nahm die Musik aus dem Radio auf.
Unser Daumen ruhte auf der roten Aufnahmetaste, der Zeigefinger auf der Playtaste, bereit, beide Tasten gleichzeitig zu drücken und damit die Aufnahme zu starten, sobald das erste Musikstück erklang. Das klappte natürlich in den wenigsten Fällen. Entweder hakten die Tasten, unsere Finger waren beim Warten eingeschlafen, oder wir verpassten den perfekten Moment, weil die kleine Schwester gerade hereinplatzte. Auch das Aufnahmeergebnis war meistens eher bescheiden. Oft quasselte Elmi in den Anfang oder das Ende des Songs rein, und manchmal zeichneten wir ungewollt eine aktuelle Staumeldung auf, die mitten im Lied eingespielt wurde. Ein vollständiger Song auf einer selbstaufgenommenen Kassette war daher schon fast so kostbar, als hätte die Band ihn bei uns zu Hause aufgeführt. Und über die Tonqualität brauchte man gar nicht erst zu diskutieren – bisweilen rauschte es so sehr, dass man glaubte, man hätte die Aufnahme in Elwoods Apartment gemacht, das im Film Blues Brothers bekanntlich direkt neben der Hochbahn liegt. Da unerwünschte Nebengeräusche aber mit zum Deal gehörten, wenn wir die Hits gratis aus dem Radio haben wollten, beschwerte sich kaum jemand über gelegentliche Frequenzstörungen, und wir nahmen auch in Kauf, dass manche Kassette vom häufigen Aufnehmen und Überspielen so ausgenudelt war, dass das Band wie eine Kirmesorgel leierte.
Musik aus dem Radio mitzuschneiden war eben eine echte Kunst, und gerade im Unperfekten lag der individuelle Charme unserer Mixtapes. Die genaue Reihenfolge der Songs auf einer bestimmten Kassette konnten wir schon nach ein paar Wochen aus dem Kopf hersagen – und Wettermeldungen und Sprüche ebenfalls auswendig mitsprechen. Wir denken selbst heute noch gelegentlich daran, wenn wir einen Song aus den Achtzigern im Radio hören.
Und so ist die alte Kassettensammlung von damals eine Art Audiotagebuch. Selbst wenn es Jahrzehnte her ist, fällt uns beim Abspielen eines dieser Mixtapes nach und nach alles wieder ein: wann und wo wir einen Song zum ersten Mal hörten, wovon wir in dem Moment träumten, zu welchem Lied wir unseren ersten Kuss bekamen und wie wir mit dem Walkman auf der Wiese lagen, uns ein Tütchen Ahoj-Brause in den Mund schütteten und den Inhalt prickelnd auf der Zunge zergehen ließen.
Egal, ob die gemischte Kassette aus der Elmi Radio Show, dem NDR2 Club Wunschkonzert,Mal Sondocks Hitparade, der HR3 Hitparade International oder der BFBS Top 40 stammte – die aus solchen Sendungen zusammengestoppelten Tonbänder waren unser Heiligtum. Sie kündeten von unserem Geschick und unserem Geschmack – auf ihnen war unsere Identität gebannt. Sie waren ein Archiv unserer Gefühle, das wir liebevoll beschrifteten, benutzten und bewahrten.
Wir tauschten die Tapes, und als sich endlich die bahnbrechende Erfindung des Doppelkassettendecks durchsetzte, überspielten wir jene, die uns besonders gut gefielen, wobei sich der Sound auf der Kopie noch ein bisschen verschlechterte. Wir sammelten sie in orangefarbenen Kassettenkarussells, die man übereinanderstapeln und drehen konnte und in deren Einheiten je zwanzig Kassetten passten. Und wir nahmen sie überallhin mit. Ob im Walkman oder im Autoradio, auf den Kassetten befand sich der Soundtrack zu unserem Leben – und, oh boy, wie gut der war: Opus schmetterte aus voller Kehle »Live is Life« und alle klatschten mit, Peter Schilling raunte die Geschichte von Major Tom, der zum Elektrobeat völlig losgelöst durchs All schwebte, David Lee Roth schrie uns »Jump« entgegen, und Eddie Van Halen legte dazu ein rasantes Gitarrensolo hin. Und wenn wir Liebeskummer hatten, sangen wir voller Inbrunst mit den Ärzten mit, dass wir uns eines Tages rächen würden, nämlich dann, wenn wir ein Star wären, der in der Zeitung stünde.
Solange die Liebe allerdings noch keimte, schenkten wir unserem Schwarm als Zeichen unserer Zuneigung ein selbst zusammengestelltes Mixtape – fast beiläufig, ohne darum besonders viel Aufhebens zu machen. Die dafür ausgewählten Lieder waren jedoch ebenso bedeutungsvoll wie die Worte in einem Liebesbrief. Es galt also, die Songs genau auszuwählen, mit ihnen zu verschlüsseln, was wir fühlten, und es gleichzeitig doch irgendwie anzudeuten, damit der andere es zwischen den Zeilen hören konnte. Stundenlang überlegten wir, welche Songs zum Empfänger des Bandes passten und in welcher Reihenfolge wir sie aufnehmen sollten. Nicht zu abgedreht, nicht zu bekannt, auf gar keinen Fall uncool, und jeder Track eine Botschaft an das Herz des geliebten Menschen. »I Want To Know What Love Is« von Foreigner oder »Love Is a Shield« von Camouflage? Vielleicht ein bisschen zu eindeutig, soweit wir das mit unserem frisch erworbenen Schulenglisch beurteilen konnten. »I Want Your Sex« von George Michael? Hilfe, viel zu anzüglich! »The Riddle« von Nik Kershaw? Wohl zu rätselhaft. Simply Red? Um Himmels willen, dann lieber Simple Minds.
Die Kassette bestimmte unser Leben, und zwar nicht nur die Musikkassette. Etwas später erlebten wir mit der Datasette die ersten virtuellen Abenteuer, holten uns mit der Videokassette unsere Lieblingsfilme nach Hause oder drehten – wenn wir eine so teure Spielerei besaßen wie eine Videokamera, die Mitte der Achtziger noch zwischen zweitausend und viertausend Mark kostete – gar die ersten eigenen Filme.
Kassetten sind daher heute nicht nur ein Symbol für die Achtziger – sie sind Speicher unserer Kindheit und Jugend. Ohne sie wäre alles anders gewesen. Noch heute bewahren wir die Mixtapes von damals auf, selbst wenn unsere Anlage gar kein Kassettenfach mehr hat. Wir gehören zu den Menschen, die grinsen müssen, wenn sie auf Facebook das Bild einer Musikkassette mit einem Bleistift daneben sehen. Wir sind die, denen ein Schauer über den Rücken läuft, wenn sie auf dem Speicher die alten Hörspielkassetten entdecken, und wir genießen es, sie heute unseren Kindern vorzuspielen. So manchen von uns überkommt irrationale Freude, wenn er in einem alten Auto ein Radio mit Kassettenfach entdeckt. Und wir versuchen verzweifelt, die analogen Medien vor dem Verfall zu retten, und stöbern im Internet nach Anleitungen zur Selbsthilfe: Denn die alten VHS-Kassetten, Floppy Disks und Tonbänder müssen digitalisiert werden, bevor das Magnetband spröde wird und es keine Geräte mehr gibt, mit denen man sie abspielen kann.
Es hat lange gedauert, bevor ich verstanden habe, dass wir damals bei Philips eine Revolution in Gang gesetzt haben.
Lou Otten, Erfinder der Audiokassette
Wir sind die Kassettenkinder. Aufgewachsen in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, Walkman-Erstbenutzer und Computerpioniere mit einem Hang zu waghalsigen modischen Experimenten. Wir heißen Stefanie, Jan, Katja und Michael, Martina oder Daniel, und wir gehören zu einem verschworenen Club, zu denjenigen, die das letzte unverfälschte Jahrzehnt noch selbst miterleben durften und das Glück hatten, ihre Kindheit und Jugend in der besten aller Zeiten zu verbringen. Wie viele auch heute noch mit einer Mischung aus Wehmut und Sehnsucht daran zurückdenken, wissen wir erst, seit jemand im Dezember 2015 bei der dpa die Umfrage in Auftrag gab, in welches Jahrzehnt wir gerne zurückkehren würden: Es sind die Achtziger.
Ein verständlicher Wunsch. Auch heute noch kriecht uns bei den ersten Takten von »What a Feeling« eine Gänsehaut über den Rücken, wir bleiben hängen, wenn Dokus über Zurück in die Zukunft laufen, und klicken uns in langen Nächten auf YouTube durch Werbespots, in denen ein Junge den MB-Gong schlägt, Manfred Krug Malteserkreuz Aquavit kippt (»Man gönnt sich ja sonst nichts«), eine Bank das grüne Band der Sympathie trägt und eine Frau gar nicht merkt, dass sie ihre Hände in Spülmittel badet. Von dort gelangen wir über Clips, in denen Patrick Swayze »Mein Baby gehört zu mir« raunt, und alten Ausschnitten aus der Tagesschau bis zum Vorspann von Ein Colt für alle Fälle, MacGyver oder Simon & Simon. In Foren schwelgen wir in der Erinnerung an den Geschmack von Eissorten wie Brauner Bär und tauschen uns über erste Konzerterlebnisse mit den Scorpions oder U2 aus, bei denen wir uns zum Schutz gegen die Lautstärke abgerissene Zigarettenfilter in die Ohren steckten. Die Bilder, Zitate und Melodien von damals sind inzwischen Kult, haben Synapsen zu einem unmittelbaren Wohlgefühl in unserem Gehirn gebildet. Sie bringen uns das Beste der Achtziger zurück. Ein sonnendurchflutetes, musikerfülltes, buntes Spektakel aus Freiheit, Unabhängigkeit, Freundschaft, Coming of age oder Coming-out, Kindheit, Jugend und den ersten Schritten als junger Erwachsener. Wir sind in die Achtziger verknallt wie in unseren ersten Schwarm.
Video killed the radio star.
In my mind and in my car, we can’t rewind
We’ve gone to far.
The Buggles
Unverstellt waren sie, die Achtziger. Originell und eindeutig. Aufgewachsen zwischen Bandsalat und Compact Disc, Brockhaus und YPS-Heft, Atomwaffen und Ententanz erlebten wir ein seltsam unbekümmertes, oft albernes Jahrzehnt, in dem alle trotz des drohenden Weltuntergangs durch sauren Regen und Kalten Krieg den Eindruck einer lustig-bunten Zeit hatten und eine ganze Nation »Dadideldum« verstand, als Falco in Wahrheit eigentlich sang: »Drah di net um, der Kommissar geht um.«
Diese Jahre waren so epochal, dass wir schon damals von »den Achtzigern« sprachen. Sie sind es auch deswegen, weil sich in dieser Zeit das eisige Schweigen zwischen Ost und West auflöste und sie mit dem Mauerfall im Herbst 1989 zum einzigen Jahrzehnt mit einem veritablen Happy End wurden.
Und irgendwie fing irgendwann in jener Zeit die Zukunft an. Vieles von dem, was unsere Welt heute ausmacht, hat seinen Ursprung in den Achtzigern – die Verbreitung des Computers ebenso wie das Internet, das Mobiltelefon, ein Europa ohne Grenzen, der Klimawandel oder Emoticons. Die Zeit, in der wir groß geworden sind, markiert die Grenze zwischen echt und künstlich, analog und digital, Original und Kopie. Die Siebziger waren gefährlich, die Neunziger glatt. Die Achtziger waren ein Schwellenjahrzehnt und wir eine Schwellengeneration, die mit dem Alten aufwuchs, während sie bereits mit dem Neuen experimentierte.
Die neue Technik begeisterte uns, weil es sie einfach gab, nicht, weil sie auch funktionierte. Wir freuten uns einen Ast ab über die Einführung des VHS-Rekorders – auch wenn er anfangs mehr Bildrauschen als Filmgenuss produzierte. Ganze Wochenenden verbrachten wir damit, unsere Rekorder aneinanderzustöpseln und Horrorfilme – meist vom großen Bruder aus der Videothek geliehen – zu überspielen. Eigenbau war das Gebot der Stunde. Unsere ersten Computerspiele mussten wir selbst programmieren, indem wir telefonbuchdicke Codelisten in die Tastatur hämmerten. Umso größer war dann die Begeisterung, wenn sich nach verrichteter Arbeit wie in Liftboy ein Pixelklumpen per Cursortasten auf einem sich senkrecht auf und ab bewegenden Strich steuern ließ.
Wir waren eben noch mit wenig zufrieden. Fernsehserien wie Trio mit vier Fäusten,Agentin mit Herz oder Hart aber herzlich brauchten keine komplexen Charaktere oder Handlungsmuster – in jeder Folge passierte eigentlich immer das Gleiche, und das fanden wir gut so. Das Telespiel Pong war für uns schon großes Tennis, Zini aus Spaß am Dienstag hielten wir für einen fortschrittlichen Special Effect, Die Montagsmaler für eine intellektuell-kreative Herausforderung, und wir waren schwer beeindruckt, als Godley & Creme mit »Cry« das erste Musikvideo mit (noch stümperhaft zusammengefrickeltem) Gesichter-Morphing präsentierten und Morten Harket im Clip von Take on me Abenteuer in einer Comicwelt bestand.
Viele der Neuerungen waren gerade deswegen so hinreißend, weil wir sie uns nicht auf Anhieb leisten konnten – und weil sie nicht sofort und überall verfügbar waren. Vorfreude war die schönste Freude, und die hatten wir in den Achtzigern zuhauf: ob es um das Urlaubsfoto ging, auf dessen Entwicklung wir warten mussten, die Fortsetzung von Indiana Jones – oder die neue Platte unserer Lieblingsstars, auf deren Erstverkaufstag wir hinfieberten. Musik war etwas Besonderes, wenn man sie sich durch langes Warten, sauer verdientes Taschengeld und die Anreise zum Plattenladen noch mühsam erarbeiten musste. Umso größer war die Enttäuschung, wenn herauskam, dass unsere Stars pfuschten, so wie Milli Vanilli, die gar nicht selbst gesungen hatten – beinahe ein Jahrhundertskandal, wären da nicht noch so viele andere gewesen.
Es war die Zeit der Flick- und Barschel-Kungeleien, der Glykolwein-Panscherei, der Dioxin-Babys. Doch Betrüger und Falschmünzer waren schnell ausgemacht. Denn alles schien eindeutig, und die Grenzen waren klar gezogen, zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch, zwischen Ost und West, Reagan und Khomeini, McDonald’s und Burger King, Schwarzenegger und Stallone.
Damals glaubten wir noch, dass die USA die Guten wären. Jedenfalls wurde uns das überall so verkauft, und selbst die Tagesschau-Sprecher von damals hören sich in der Retrospektive heute an, als läsen sie nur Pressemitteilungen aus dem Weißen Haus vor. Vielleicht waren wir einfach zu gutgläubig – immerhin hielten wir in den Achtzigern selbst Vokuhila, Poppertolle und Ententanz noch für schick – und fanden Klamauk urkomisch: Wir suchten mit Didi Hallervorden in Nonstop Nonsens nach dem Mittelteil von Doktor Schiwago, hörten Hänsel und Gretel lieber von Otto als von Oma und verzichteten mit Antiwitzen sogar auf eine Pointe.
Fährt ’ne Oma durch den Tunnel,
und die andere hat auch fünf Mark.
Antiwitz
Wir Kassettenkinder wuchsen seltsam sorglos auf, in einem Frieden, der eigentlich keiner war. Im Jane-Fonda-American-Apparel-Outfit (Mädchen), mit klassischer Top-Gun-Fliegersonnenbrille (Jungs) oder Minipli (beide) hüpften wir durch eine ebenso kaputte wie heile Welt.
Wenn es ein Rauschen in den Medien gab, dann weil wirklich eine Sensation passiert war: weil eine Kindergärtnerin einen echten Prinzen heiratete, weil ein Verwirrter zwecks Völkerverständigung mit seiner Cessna auf dem Roten Platz landete, weil Klaus Kinski mal wieder in der Öffentlichkeit herumpöbelte, Importbier nicht dem deutschen Reinheitsgebot entsprach, gequirlte Küken im Nudelteig waren, die Sommerzeit wieder eingeführt wurde oder weil Ronald Reagan bei einer Mikrofonsprechprobe verkündete, dass die Bombardierung der Sowjetunion soeben begonnen habe – was er kurz darauf zur Erleichterung der eigentlich so albernen Welt als Scherz zu erkennen gab.
Der drohende Dritte Weltkrieg, AIDS, die Katastrophe von Bhopal, das Tankerunglück der Exxon Valdez und die Entdeckung des Ozonlochs konnten uns nicht schrecken. Denn wir hatten alle die Idee einer besseren Welt. Wir jubelten, wenn Robin Wood sich an Bäume kettete, hofften mit der Crew der Rainbow Warrior, demonstrierten im Bonner Hofgarten, stürmten in Gedanken mit Joschka, Jutetasche und Jukkapalme den Bundestag, wünschten uns ein bisschen Frieden und forderten Petting statt Pershing.
Obwohl die Lage mit NATO-Doppelbeschluss und Tschernobylkatastrophe bisweilen düster aussah, glaubten wir Kassettenkinder fest daran, dass alles gut ausginge und uns eine glänzende Zukunft bevorstünde, die wir uns etwa so vorstellten wie im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft oder Star Trek – The Next Generation. Wir träumten von Hoverboards, kleinen schnurlosen Kommunikationsgeräten und sprechenden Autos, vom Replikator, der uns jeden materiellen Wunsch erfüllen, und vom Babelfisch, der uns die Verständigung in jedem Land erlauben würde, ohne dass wir vorher Vokabeln im Sprachlabor pauken mussten.
Einige unserer Träume sind wirklich wahr geworden. Von der Europäischen Union über 3-D-Drucker, die bald alles replizieren können, was man sich wünscht, bis hin zu sprechenden Computern und Autos oder Smartphones, die wie Captain Kirks Kommunikator aussehen und deren Apps uns jede Sprache übersetzen und die, mit speziellen Ohrstöpseln genutzt, dem Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis gar nicht so unähnlich sind.
Was uns heute immer öfter bewusst wird: Die Achtziger sind im Begriff, von der nahen Vergangenheit, die wir vor kurzem erlebt haben, in die Zeitgeschichte überzugehen. Und das macht uns – so blöd es klingt – unsere eigene Vergänglichkeit bewusst.
Auch unsere Helden von damals sterben langsam aus. Einer nach dem anderen segnen sie das Zeitliche oder zeigen zumindest deutliche Verfallserscheinungen. David Bowie hat sich verabschiedet, Motörhead-Gründer Lemmy Kilmister rockt jetzt im Himmel weiter, Leonard Nimoy alias Mr. Spock ist in die unendlichen Weiten des Weltraums eingegangen, Dallas-Fiesling J.R. Ewing ist tot, einen der Ghostbusters hat’s erwischt, und auch Babys große Liebe aus Dirty Dancing tanzt den Mambo inzwischen auf Wolke sieben.
Die Mitglieder unserer Lieblingsbands, so sie denn überhaupt so lange durchgehalten haben, bessern ihre Rente mit Playbackauftritten im ZDF-Fernsehgarten, mit Revivalkonzerten oder mit peinlichen Ausflügen ins Dschungelcamp auf. Und selbst der ehemals so robuste Terminator hat in seiner jüngsten Reinkarnation Falten bekommen und spricht öffentlich über sein künstliches Hüftgelenk.
Zeit, dass die alten Helden generalüberholt werden, um das Gefühl von damals aufzufrischen: Das Revival der Achtziger läuft auf vollen Touren. Als Kinder kannten wir Kinoremakes nur von Filmen aus den Fünfzigern, von denen wir damals dachten, sie seien eine Ewigkeit her – nun sehen wir die Neuauflagen von Flashdance, Mad Max und Karate Kid. Gerade gab es ein Wiedersehen mit Han Solo und Prinzessin Leia, und auch die Kultsendungen Formel Eins,Alf und Dallas sind wieder da. Genauso feiern stonewashed Jeans und Diadora-Schuhe ein Comeback, und Sony tauft seine MP3-Player wieder »Walkman«. Die Biographie von Thomas Gottschalk wurde zum Bestseller – und plötzlich fühlen wir uns selbst ein bisschen herbstblond.
Bist 900 Jahre alt,
wirst aussehen du nicht gut.
Yoda
Wir Kassettenkinder sind erwachsen geworden, haben einen Beruf ergriffen, Familien gegründet und unseren Lebensweg gemeistert. Wie den Babyboomern und den Achtundsechzigern vor uns wird uns mit voranschreitendem Alter immer klarer, dass unsere Geschichte einen Anfang und ein Ende hat. Und deswegen denken wir immer öfter zurück. An Samstagabende mit Saalwette, Cherry Coke, Gino-Ginelli-Eis und Trüller Paprika Chips in trauter Familienrunde auf dem Sofa. An toupierte Haare, Stirnband und Neonfummel, genauso wie an Starlight Express und Rollschuhdisco. An Frauen mit Dauerwelle und Männer mit Pornobalken auf der Oberlippe. An heiße Sommer, in denen immer aus irgendeinem Lautsprecher Hits wie »Club Tropicana«, »Carbonara« oder »Like Ice in the Sunshine« erklangen und wir uns mit Sonnenbrille in bester Wham-Videoclip-Pose am Freibadbüdchen anstellten, Hubba-Bubba-Blasen zum Platzen brachten und eine gemischte Tüte Gummizeug orderten.
Diese zehn Jahre haben uns geprägt und uns das mitgegeben, was unsere Ansichten und Meinungen auch heute noch bestimmt. Wir waren die Generation, die alle Möglichkeiten hatte, die davon träumte, als Filmstar oder Popsänger auf der Bühne zu stehen, im Sportverein als neues Talent entdeckt zu werden oder bei Jugend forscht eine tolle Erfindung zu machen. In diesem Jahrzehnt liegen die Wurzeln unserer computerisierten, schnellen und komplizierten Gegenwart, und es hat uns Werte und Überzeugungen mitgegeben, von denen einige drohen auszusterben: Dank Volkszählungsprotest gehen wir kritisch mit unseren Daten um, wir genießen Vorfreude umso mehr, weil sie heute durch Streamingdienste und permanente Verfügbarkeit immer seltener wird, wir wissen es zu schätzen, wenn sich jemand die Zeit nimmt, uns einen Brief zu schreiben statt einer E-Mail, und wir glauben immer noch an die Völkerverständigung.
Die Achtziger scheinen uns von heute aus betrachtet eine einzige große Party gewesen zu sein. Das letzte unbeschwerte Jahrzehnt. Unsere Lieblingsjahre, die nicht immer so einfach waren, wie es in der nostalgischen Rückschau oft den Anschein hat. Die uns aber die Träume schenkten, die wir heute noch nicht ganz aufgegeben oder sogar erreicht haben.
Begeben wir uns auf eine wundersame Reise in eine unglaubliche Zeit, in der Aufkleber (»Atomkraft? Nein danke«) tatsächlich noch etwas bewegten, ein Jahr lang derselbe Werbespot einer Firma im Fernsehen lief und man Zeit für Spaßbrillen und Spritzblumen hatte. Entdecken wir, welche Freiheiten wir verloren und verlernt haben. Und was wir heute noch aus den Achtzigern für uns schöpfen können.
Zeit zurückzuspulen.
1Das Spiel unseres Lebens
Matschbrötchen im Hausmeisterkabuff, große Träume und das gute Gefühl, ohne Helm Fahrrad zu fahren
Der kleine Schotterweg, an dessen Ende die Schule lag, führte leicht bergab. Die abgewetzten Reifen unserer Fahrräder drehten sich mit jedem Meter schneller, in den Speichen klackerten die Kiesel, und das an manchen Stellen angerostete Gestänge ächzte, wenn wir durch ein Schlagloch fuhren. Der Geruch von Wald und frisch gemähter Blumenwiese lag in der Luft, doch das nahmen wir kaum wahr. Der Fahrtwind sauste in den Ohren, zerzauste unsere Haare und bauschte die T-Shirts auf. Wir nahmen die Hände vom Lenker, einer nach dem anderen – ein Feigling, wer es nicht tat –, und rasten auf der holprigen Piste dem Schulgelände entgegen. Gleich würde die Glocke schrillen. Wir würden unsere Freunde sehen, mit Papierkügelchen schießen und die große Pause herbeisehnen. Die Hände am Sattel oder die Arme ausgestreckt, genossen wir die warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht und atmeten die letzten Meter Freiheit, bevor sich das Schultor für den Rest des Vormittags hinter uns schloss.
Gemessen an heutigen Sicherheitsstandards schwebten wir in Situationen wie diesen in den Achtzigern ständig in Lebensgefahr: Keiner von uns trug einen Helm. Niemand hatte sich mit Sonnencreme eingerieben. Und keines der Fahrräder, die wir gebraucht von den größeren Geschwistern und Nachbarskindern bekommen oder auf dem Trödelmarkt erstanden hatten, trug ein TÜV-Siegel, geschweige denn, dass irgendjemand in den zurückliegenden zwei Jahren mal die Bremsen überprüft hätte.
Doch darum sorgten sich weder wir noch unsere Eltern.
Wir fühlten uns sicher.
Natürlich war uns klar, dass wir hinfallen konnten und dass das dann wohl einigermaßen weh tun würde. Niemand rechnete jedoch ernsthaft damit, dass dieser Fall eintreten könnte – was er meistens auch nicht tat. Und wenn doch, dann hieß die zu ergreifende Maßnahme nicht Helm, sondern Pflaster.
Die Welt, in der wir aufwuchsen, erschien uns in etwa so geordnet und gesichert wie die Schrankwand im Wohnzimmer unserer Eltern. Darin gab es für jedes Ding einen festen Platz, und sie war nicht umgefallen, als wir im Kleinkindalter darauf herumgeturnt waren, weil Papa sie mit fetten Dübeln für die Ewigkeit an die Wand geschraubt hatte.
Die Schrankwand beherbergte alles, was unseren Eltern lieb und teuer war. Sie war eine Art überdimensionierter Setzkasten, in dem das Platz fand, was ein richtiges Leben ausmachte: die Rahmen mit dem Hochzeitsbild und den Familienfotos, bemalte Schalen und Kastagnetten aus dem letzten Spanienurlaub, die teuren Kristallgläser und daneben, hinter einer Schiebetür, Likör, Marillenbrand und Danziger Goldwasser. Sie zeigte eine Schau der Bücher, zu denen neben den Klassikern von Goethe und Schiller auch Werke von Johannes Mario Simmel wie Es muss nicht immer Kaviar sein und die Reportage Ganz unten des Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff über miese Arbeitsbedingungen gehörten. Die Schrankwand offenbarte, dass unsere Eltern aktuelle Bestseller wie Das Parfum, Der Name der Rose und Das Geisterhaus genauso schätzten wie die sechsbändige Ausgabe des Brockhaus und Der große Konz – 1000 ganz legale Steuertricks.
Unser kindliches Schrankwanduniversum war eine heile Welt, wie wir sie danach nie wieder erlebt haben. Sie schien sogar ein Netz und einen doppelten Boden zu besitzen, falls doch mal etwas schiefging: Für zerbrochene Fensterscheiben gab es eine Haftpflichtversicherung, wie sie der nette Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer vertrieb, schlimme Halsschmerzen lutschte man einfach mit Kinder Em-eukal weg, und wer zu doof war, eine Schleife zu binden, bekam eben Turnschuhe mit Klettverschluss.
In dieser Welt galt es nicht nur als vollkommen normal, dass zu einer Familie Mutter und Vater gehörten, sondern auch, dass diese gemeinsam unter einem Dach lebten. Oft war es sogar so, dass Mütter zu Hause blieben, um die Kinder zu erziehen und den Haushalt zu schmeißen, während die Väter das Geld nach Hause brachten. Natürlich gab es auch mal eine Scheidung, vereinzelte Single-Haushalte – damals noch »ewige Junggesellen« genannt – sowie Frühformen der Patchworkfamilie und alleinerziehende Mütter, die arbeiten gingen. Frauen, die Karriere machten, besaßen hingegen Seltenheitswert.
Hatten sich die Eltern eines unserer Klassenkameraden scheiden lassen, kam uns das vor, als wäre in dessen Haus ein Meteorit eingeschlagen – es machte uns baff und betroffen.
Über solche Störfälle unterhielten sich unsere Eltern am Gartenzaun nur hinter vorgehaltener Hand und in jenem ehrfürchtigen »Hast du schon gehört!«-Ton, den sie immer draufhatten, wenn in der Nachbarschaft jemandem etwas Schlimmes passiert war. Es hatte beinahe den Anschein, als fürchteten alle, sich an den modernen Lebensformen anzustecken und damit eine unbekannte Variable in die feinjustierte Schrankwandwelt zu bringen.
Wir wuchsen in einem Haushalt auf, der umsichtig geplant wurde, in dem zwischen Schrankwand, Fernseher und Sofagarnitur fernab aller Gefahren und Widrigkeiten Geburtstage, Weihnachten und Silvester gefeiert wurden, mit Urlauben, die sicher wie auf Schienen verliefen, und mit dem Gefühl, dass dies auf unserem weiteren Lebensweg genauso sein würde.
Eingeschult zwischen Mitte der Siebziger und Mitte der Achtziger war die Schule nach der ersten Freude über die Schultüte mit Spielzeug und Süßigkeiten einfach eine Einrichtung, deren regelmäßiger Besuch außer Frage stand und mit einem klaren Versprechen verbunden war: Wenn wir die Hürden bis zur Mittleren Reife oder zum Abitur genommen hatten, würden wir eine solide Ausbildung machen oder studieren, eine Familie gründen und im besten Fall so lange die Karriereleiter hochklettern, bis wir nicht nur für unser Auskommen sorgen, sondern uns auch jede Menge schöne Dinge kaufen konnten, von denen wir durch die Werbung zu träumen gelernt hatten. Die Zukunft hatte in unserer Vorstellung eine so klare und bunte Fahrbahn wie das Spiel des Lebens. Glück und Zahltage inklusive.
Als Kind ist einem doch die Welt ziemlich klar
– und wenn man stirbt, weiß man gar nichts.
Hans-Joachim Kulenkampff
Das Spiel des Lebens war eine Institution. Ohnehin gehörten Spielerunden mit Eltern, Geschwistern und Freunden zu unserer Kindheit wie Schneemannbauen zum Winter und Fischstäbchen zu Spinat. Wenn es im Herbst regnete, stürmte oder schneite, versammelten wir uns nachmittags um den Esstisch, und die Deckenlampe aus Korb warf ihr kreisrundes Licht auf das Spielfeld. Zum Spielen gehörte immer auch allerhand Naschkram: Es steckte viel Spaß in Toffifee, wir knabberten Salzletten, und es gab ausnahmsweise süße Getränke wie Mirinda oder Zitronentee, den wir aus einem körnigen Pulver zusammenrührten, das an eine Substanz erinnerte, die wir im Chemieunterricht über den Bunsenbrenner hielten.
Solchermaßen kulinarisch ausgestattet, verbrachten wir gemeinsam viele Stunden im Märchenwald von Sagaland, machten in Scotland Yard an der Themse Jagd auf Mister X und ermittelten so lange als Detektive in Cluedo, bis wir herausfanden, dass es Oberst von Gatow mit dem Kerzenständer im Musikzimmer gewesen war. Beim Spielen machte das reale Leben für ein paar Stunden Pause. Wir konnten in eine Rolle schlüpfen und für eine Weile davon träumen, ein Meisterdetektiv zu sein oder, wie in Hotel und Monopoly, ein ausgefuchster Geschäftsmann, der ein Imperium erschuf.
Beim Spiel des Lebens war es genauso, und doch war es anders, viel mehr als nur ein Zeitvertreib: Das Brettspiel mit dem bunten Glücksrad, das anstelle von Würfeln den Spielverlauf bestimmte, war eine Verheißung. Es erzählte von dem Leben, das noch auf uns wartete, einem Leben, in dem anscheinend alles nach einem einfachen Fahrplan ablief, der perfekt in die sichere, geordnete Schrankwandwelt passte, in der wir aufwuchsen. Unser Werdegang folgte einem abgesteckten Parcours – einer gewundenen Straße, die auf dem Spielplan vorbei an weißen Plastikhäusern, aufgemalten Seen und Pferdekoppeln sowie über kleine Brücken führte. Es ging gleich gut los: »Du bekommst 3000, ein Auto und eine Autoversicherung.« So durfte das später im richtigen Leben auch gerne sein.
Alle Autos waren Cabrios, und wir setzten unsere Spielfigur hinein. Nachdem wir am Glücksrad gedreht hatten, mussten wir nicht lange warten, bis eine der Zahlen am klackernden Plastikzeiger stehenblieb. An der ersten Kreuzung konnten wir wählen, ob wir direkt arbeiten gehen oder lieber studieren wollten. Unsere Eltern hätten uns die Bedeutung dieser Wahl nicht eindrucksvoller verklickern können, als das Spiel es tat: Fast alle entschieden sich fürs Studium, weil dann Berufe wie Anwalt, Arzt oder Journalist winkten, die langfristig mehr Geld einbrachten. In Wirklichkeit machten später etliche von uns eine Ausbildung bei der Deutschen Bank, vielleicht weil sich nichts besser anfühlte, als Herr der ganzen bunten Scheine zu sein – bei der größten Spielbank Deutschlands.
Der erste Pflichtstopp für unseren Wagen war das Standesamt, wo der Nutzen der Ehe sofort klarwurde: »Du heiratest. Sammle Geschenke ein.« Obwohl gleichgeschlechtliche Partnerschaften in den achtziger Jahren kein Tabu mehr waren, hatte die Wahl des Lebenspartners im Spiel streng dem traditionellen Modell zu folgen: Jungs setzten ein rosafarbenes Püppchen neben sich, Mädchen ein hellblaues. Dabei dachten viele an die Traumhochzeit des Jahrzehnts in der Londoner St Paul’s Cathedral, bei der Diana ein Brautkleid mit endlos langer Schleppe trug, Charles im Frack trotz der abstehenden Ohren ganz gut aussah und sie sich als erstes royales Brautpaar der Geschichte auf dem Balkon des Buckingham Palace küssten. Unsere eigene Hochzeit würde ähnlich sein. Nur ohne Palast. Der Balkon des eigenen Einfamilienhauses mit Pool, das wir uns ausmalten, würde es auch tun.
Auf dem weiteren Spielweg übten wir uns als gute Konsumenten, indem wir möglichst viele Statussymbole sammelten – den Privat-Jet, ein paar Rennpferde, eine Luxus-Yacht und die Villa in Südfrankreich. Kinder bekamen wir natürlich auch, weil sonst die zwei freien Plätze auf der Rückbank unseres Plastikautos frei geblieben wären, was irgendwie doof aussah. Deren Geschlecht durfte man sich immerhin selbst aussuchen.
Wenn wir es nicht in die herrschaftliche Villa geschafft hatten, endete unser Leben auf dem Altersruhesitz, und der sah auch ganz passabel aus. Wir waren deswegen davon überzeugt, dass unser Leben in ferner Zukunft auch einmal einen guten Ausgang nehmen würde, immerhin hatte Norbert Blüm gerade verkündet: »Denn eins ist sicher: die Rente.« Vom vorgezeichneten Weg konnten wir nicht abkommen, gestorben wurde im Spiel des Lebens sowieso nicht, und es ging vor allem darum, Glück und Geld anzuhäufen, was im Grunde irgendwie dasselbe zu sein schien.
Das Spiel des Lebens, die Schrankwandwelt und auch die Verheißungen unserer Eltern und Lehrer, dass uns die Welt offenstünde – auf uns Kassettenkinder wirkte das alles ungemein beruhigend, so, als hätten wir zum Nulltarif eine Vollkasko ohne Selbstbeteiligung für unser Leben abgeschlossen. Hätten wir damals schon das Kleingedruckte gelesen, wäre uns wahrscheinlich aufgefallen, dass das Mumpitz war. Wer wusste schon, was die Zukunft wirklich brachte? Immerhin gab es eine Unmenge von Problemen in Wirtschaft, Politik und Umwelt, die es hätten verhindern können, dass wir jemals erwachsen wurden. Oder eine Rente bekamen, von der wir auch leben konnten.
In der Familie, in der Schrankwandwelt, konnte uns jedoch nichts geschehen, wenn wir die Regeln befolgten. Eine davon lautete, dass wir jeden Tag zur Schule gingen, bevor wir irgendwann zum ersten Mal am Glücksrad drehen durften. Unseren großen Träumen würden wir bis dahin am Nachmittag nachhängen müssen, wenn wir spielten, Musik hörten oder uns beim Schlagzeugunterricht vorstellten, in ferner Zukunft mal ein so guter Drummer wie Phil Collins zu sein. Manchmal taten wir es aber auch schon in der Schulstunde, mit gedankenverlorenem Blick aus dem Fenster. Und so hatten wir nur dann ein Problem mit der Zukunft, wenn am nächsten Morgen eine Mathearbeit anstand.
Alle redeten von Schule, aber keiner tat was dagegen. Wer wir waren, was wir lernten und wie verdammt gut wir schummelten
Es schien noch mitten in der Nacht zu sein, wenn Mama mit energischem Schritt unser Zimmer durchquerte und die geblümten Vorhänge beiseiteschob. Die ersten Sonnenstrahlen drangen durch die zwei Glasscheiben, zwischen denen sich der besseren Isolierung halber ein luftdichter Hohlraum befand. »Hoch mit dir, ist schon spät!«, waren ihre Worte, bevor sie das Zimmer verließ und in die Küche eilte, um Kaffee aufzusetzen.
Wenn wir ihrer Aufforderung nicht sofort nachkamen, konnte das daran liegen, dass wir am Vorabend mit der Taschenlampe, die sonst für Nachtwanderungen auf Klassenfahrten bestimmt war, bis spät in der Nacht unter der Bettdecke gelesen hatten. Vor allem Fantasyromane wie Die unendliche Geschichte,Momo, Der Herr der Ringe oder Die Nebel von Avalon schlugen uns in ihren Bann und ließen uns davon träumen, dass es zwischen Himmel und Schrankwand noch etwas gab, das mit dem Verstand und dem, was sie uns in der Schule beibrachten, nicht zu erklären war. Wer es gruseliger mochte, las das neuste Werk von Stephen King oder Wolfgang Hohlbein. Und wer nach Friedhof der Kuscheltiere oder Der Hexer von Salem nicht schlafen konnte, warf spät noch einen Blick auf die Abenteuer von Asterix oder Lucky Luke.
Und so stopften wir Buch und Taschenlampe hastig unters Kopfkissen, bevor wir am Morgen die Bettdecke zurückschlugen, die bei den Jüngeren oft mit Motiven von Pumuckl, Biene Maja oder Heidi bedruckt war, und die, wenn wir älter waren, Garfield, K.I.T.T. aus Knight Rider oder das Logo unseres Lieblingsfußballvereins zierten.
Gerne hätten wir die Füße gleich wieder in die wärmenden Federn zurückgesteckt. Doch da unsere Mütter nie aufhörten, nach uns zu rufen, bis wir endlich am Küchentisch saßen, rieben wir uns die Augen und standen mit Schwung auf – nur um mit dem nackten Fuß auf einem Zauberwürfel, einer Chipstüte oder einer Musikkassettenhülle zu landen, die wir nicht weggeräumt hatten und die nun wie kantige Tretminen auf der Auslegeware verstreut lagen. Der Morgen begann nicht selten mit einem Schmerzensschrei.
Falls das Badezimmer frei war, ergriffen wir die günstige Gelegenheit beim Schopf und verbarrikadierten uns darin, bevor unsere Geschwister dies taten. Je älter wir wurden, desto mehr Mühe gaben wir uns mit dem morgendlichen Styling – und das, obwohl die Inneneinrichtung nicht gerade zum Verweilen einlud: Badezimmerfliesen und Keramik waren oft noch in kräftigem Orange, Dunkelgrün oder Braun gehalten, alles Farben, die mit den dunklen Holzverkleidungen an den Wänden und Dachschrägen besonders gut harmonierten.
Während der Look des Badezimmers noch mitten in den Siebzigern stehengeblieben war, sah es auf unseren Köpfen höchst modern und experimentell aus. Unsere Haare, oft mit Strähnchen, wasserstoffblond und dauergewellt, föhnten wir morgens, bis sie eine in der Natur kaum vorkommende Form annahmen. Dabei kamen Schaumfestiger und Gel zum Einsatz – und natürlich Haarspray. Tonnen von FCKW müssen in den Achtzigern jährlich allein von Teenagern mit Frisurentick in die Atmosphäre gepustet worden sein.
Nachdem wir uns die Zähne mit Blendax Antibelag oder Settima (machte nicht nur Zähne, sondern auch weiße Stoffturnschuhe wieder weiß) geputzt und uns die pubertierenden Gesichter mit Clearasil-Waschgel abgescheuert hatten, setzten wir uns, umhüllt von einer Wolke Stu-Stu-Studioline, Klippenspringer-Cliff oder meinem Bac, deinem Bac, an den Frühstückstisch. Die Kaffeemaschine sprotzelte friedlich vor sich hin, der Tisch war meist schon gedeckt. Mama setzte sich im Bademantel zu uns, während wir uns wahlweise in Orangensaft aufgeweichte Smacks oder ein Zuckerbrot (Graubrot mit »guter Butter« oder Rama bestrichen und mit Zucker bestreut) einverleibten. Dazu schlürften wir heißen Carokaffee, wenn wir den echten noch nicht mochten. Oder, vor allem im Sommer, kalten Kaba. Papa vergrub sich derweil hinter der Lokalzeitung, wenn er nicht längst ins Büro gefahren war.
Gemütlichkeit kam – so, wie es bis heute an deutschen Frühstückstischen der Fall ist – eher selten auf. Die meisten Mütter jener Zeit legten ein gerüttelt Maß an Unruhe an den Tag, bis sich die Eingangstür pünktlich hinter uns schloss. Sie trieben uns beständig an, wir sollten uns beeilen, während im Radio irgendeine Morgensendung lief, bei der ein gutgelaunter Moderator eine Tasse mit dem Logo der Sendung verloste und nach ein paar Takten Meeresbrise die Quetschkommodentöne von »Biscaya« erklangen. Selbst wenn wir schon aus der Tür waren, schreckte Mama beim Gedanken daran auf, wir könnten unseren Turnbeutel vergessen haben oder zum jährlichen Fototermin mit der Klasse nicht ordentlich angezogen sein.