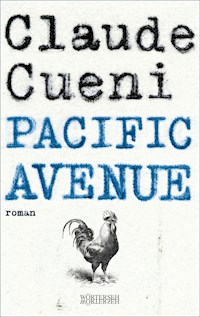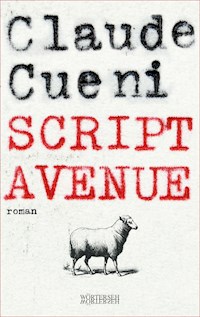17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das robuste Immunsystem der Ratten, das stärkste Immunsystem aller Säugetiere, ist dem des Menschen weit überlegen. In der Zeit des Schwarzen Todes übertrugen Ratten die Pest durch ein Bakterium, Yersinia pestis. Plötzlich häufen sich in London merkwürdige Todesfälle: Ein mit dem Pest-Bakterium verwandtes Bakterium wird wieder von den Ratten zu den Menschen gebracht! Nach einiger Zeit mutiert es und ist nun noch leichter übertragbar.
Großbritannien, Indien, die Antarktis und Sierra Leone sind Schauplätze dieses hochspannenden Thrillers, in dem eine brisante Entwicklung ihren Lauf nimmt. Mittendrin steckt Nadi, eine junge Inderin, die ihr Glück in London sucht und dort auf den Wissenschaftler Luis Mendelez trifft, der die menschliche DNA um jeden Preis optimieren will...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Claude Cueni
Pandemie aus dem Eis
Roman
Für Dina, einen anonymen Knochenmarkspender und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hämatologie des Basler Universitätsspitals
Tout ce qu’un homme est capable d’imaginer,
un autre est capable de le réaliser.
Alles, was sich ein Mensch vorstellen kann,
werden andere verwirklichen können.
Jules Verne (1828 – 1905)
1
Südgeorgien, Antarktis. September 2011
Nick Harris kniff die Augen zusammen und ließ den Blick über das südliche Polarmeer schweifen. Zwischen monumentalen Gletschern und zerklüfteten, schneebedeckten Gebirgen bewegte sich ein Schiff auf die Bucht King Edward Cole zu. Der Hafen Grytviken war das Ziel, ein verwaister Stützpunkt des früheren Verwaltungszentrums der britischen Überseegebiete Südgeorgien und Sandwich-Inseln. Harris nahm seinen Feldstecher und suchte wie jeden Morgen den Küstenstreifen ab. Massige See-Elefanten lagen reglos am Strand, paarungswillige Robben versuchten mit Grunzen und Heulen Weibchen anzulocken. Riesige Populationen von Königs- und Goldschopfpinguinen standen eng beieinander und stießen trompetenartige Laute aus. Ihre einzige Bestimmung: essen und sich vermehren.
Die rauen und nassen Wintermonate, die von Juni bis August dauerten, neigten sich dem Ende zu, an den Küsten schmolz die Schneedecke, doch das Klima blieb ruppig und feucht. Jetzt hatte der antarktische Frühling begonnen, es war Anfang September, die Schneestürme würden von nun an seltener, und die Nebeldecke, die wochenlang über den Inseln gelegen hatte, würde sich allmählich lichten.
Nick Harris stand auf einer windigen Anhöhe und lehnte am Shackleton’s Memorial Cross, einem schlichten Holzkreuz, das einst zu Ehren des legendären Polarforschers errichtet worden war. Mit seiner schwarzen Wollmütze und dem kurz getrimmten Bart sah Nick Harris aus wie die englischen Robbenjäger, die ab 1786 mit dem Jagdschiff Lord Hawkesbury auf Jagd gegangen waren. Die Reiseberichte des Seefahrers James Cook hatten sie angelockt. Nachdem die Robbenpopulation beinahe ausgerottet worden war, jagten die Männer See-Elefanten, bis schließlich die Inselgruppe an dieCompañía Argentina de Pesca vermietet wurde, die Südgeorgien zum weltweit größten Walfangzentrum machte. Als die Briten die Barbarei 1965 beendeten, waren rund 175.000 Wale geschlachtet, und das Polarmeer hatte sich in Küstennähe rot verfärbt. Wie Diebe in der Nacht waren die Jäger wieder abgezogen, zurück blieben gesunkene Schiffswracks entlang der Küste, verwaiste Walstationen, verrostete Tanks, die einst zur Walöl-Aufbearbeitung dienten. Die meteorologischen Observatorien und die Labors für ozeanische, chemische, biologische und geowissenschaftliche Studien verlotterten ebenso wie das argentinische Walfang-Schiff Petrel, dessen rostiges Wrack in Strandnähe mit der Bugspitze aus dem Wasser ragte. Die Petrel diente mittlerweile als Brutstätte für Albatrosse und andere Seevögel, doch für Harris wurde dieser Rosthaufen zum Totenschiff, das sein Leben veränderte. Letztes Jahr war seine Frau Grace, von Neugierde getrieben, in das Heck hinuntergetaucht und kam nie wieder hoch.
Harris senkte den Feldstecher. Er kniete nieder und strich über einen dicken Büschel Tussock-Gras, er mochte den Geruch, weil er ihn an Grace erinnerte. Doch nun war selbst der Schmerz der Erinnerung verblasst. Harris war Mitte vierzig. Das Angebot, nach London zurückzukehren, hatte er abgelehnt. Es störte ihn nicht, dass er hier auf Südgeorgien lediglich Platzhalter war, um Argentinien zu demonstrieren, dass die Inselgruppe nach wie vor zu den britischen Überseeterritorien gehörte. Hier am Ende der Welt würde er eines Tages sein Leben beenden. Ohne Grace. Seit ihm die Zukunft abhandengekommen war, dachte er oft an den Tod. Es hätte ihm nichts ausgemacht, schon morgen zu sterben. Dann hätte das Leid ein Ende. Gleichgültigkeit und Gelassenheit bestimmten seinen Alltag. Er erhob sich und hielt ein letztes Mal Ausschau. Jetzt erkannte er dasrote Forschungsschiff aus Fort Stanley. Es war ungewöhnlich groß und lieferte den Proviant für die nächsten Monate. Aber da war noch etwas anderes an Bord: drei Hubschrauber, 200 Tonnen Gift und 700 Fässer Treibstoff.
* * *
Orkanartige Stürme erschwerten die Navigation des britischen Forschungsschiffes Ernest Shackleton, drei Meter hohe Wellen klatschten gegen den Bug, hoben das Schiff wie eine Nussschale hoch und ließen es wieder fallen. Das Rat-Team saß mit gemischten Gefühlen in der schaukelnden Kapitänskajüte und wartete auf das letzte Briefing. Ein Hüne von Mann trat ein, hielt sich kurz am Türrahmen fest und setzte sich auf den freien Stuhl am Tischende. Mit seiner weißen Mähne und dem imposanten Bart sah Professor Luis C. Mendelez einem biblischen Propheten ähnlich, doch Mendelez’ Gesichtsausdruck und Körperhaltung waren auf eine sympathische Art unaufgeregt. Weder seine schlichte Kleidung, blaue Jeans und grünes Hemd, noch seine abgewetzten Schuhe, ließen auf die herausragende Bedeutung schließen, die der Professor in der Branche genoss. Er hatte der synthetischen Biologie bahnbrechende Impulse gegeben. Doch seine Lockerheit war nicht als Überheblichkeit abzutun.
Mendelez begrüßte das Team und sagte, ab jetzt seien sie auf sich selbst gestellt, der nächste Hafen liege 14.000 Kilometer entfernt. Er fuhr über die Karte, die auf dem Tisch fixiert war, und rekapitulierte den Auftrag: »Südgeorgien ist nicht größer als Mallorca. Als James Cook 1755 seinen Fuß auf die Insel setzte, lebten hier über hundert Millionen Tiere. Es war ein Paradies auf Erden. Heute ist Südgeorgien zwar immer noch weltweit die größte Brutstätte für Meeressäuger, aber die Seevögel sterben allmählich aus, denn die Bodenbrüter sind hilflos den Ratten ausgeliefert, die James Cook und später die Robbenschläger und Walfänger auf die Insel gebracht hatten. Die Nager plündern die Nester, fressen die Küken und greifen selbst erwachsene Vögel an.«
Mendelez nahm eine durchsichtige Plastiktüte aus seiner Tasche und hob sie hoch. Darin lag ein kleines Ding, das Größe und Form eines Weinkorkens hatte: »Wir haben zweihundert Tonnen Giftköder an Bord. Ratten sind schlau. Wenn sie etwas nicht kennen, schicken sie den schwächsten Artgenossen vor. Stirbt dieser, meiden die anderen den Ort. Neu am Rattengift des Londoner Institut Nilsor ist die Wirkungsweise. Die Ratte stirbt erst nach einigen Tagen an inneren Blutungen, so können die Artgenossen keinen Zusammenhang mit dem Tatort herstellen. Ratten sind schlau, aber der Mensch ist schlauer. Das Einzige, was uns die Ratte voraushat, ist das solidere Immunsystem. Kein Mensch hätte jemals im Reaktor von Tschernobyl überlebt, Ratten bauen heute noch ihre Nester dort.«
Mendelez nahm einen Stift aus seiner Brusttasche und zeigte auf den Norden der Inselgruppe: »Team 1 wird in Bird Island operieren, Team 2 im mittleren Teil auf der Höhe von Grytviken und Team 3 im Süden.«
Er steckte seinen Stift wieder ein und sagte, das sei ein historischer Moment, »was wir hier auf Südgeorgien durchführen, ist die größte Ratten-Ausrottung aller Zeilen. Wir sichern das Überleben von Millionen Seevögeln. Ich wünsche den Rat-Teams viel Erfolg!«
* * *
In Grytviken hatten einst mehrere hundert Walfänger gelebt, heute war der Küstenort ausgestorben, geblieben waren die Gräber mit den weißen Kreuzen hinter dem kleinen Museum in der ehemaligen Villa des Antarktisforschers Carl Anton Larsen. Bald würde die Saison beginnen, und ein paar wenige Touristen würden die winzigen Ausstellungsräume besuchen. Hier war Nick Harris der Chef. Bald brachten die Expeditionsschiffe die ersten Reisegruppen an Land. Sie durften die Insel nur für neunzig Minuten betreten. Die Guides sorgten dafür, dass die Zeit nicht überschritten wurde, denn sie wussten, dass mit Harris nicht zu spaßen war. Es war seine Insel. Harris machte einen letzten Kontrollgang durch die Räumlichkeiten. Gezeigt wurden Artefakte, alte Fotografien und Gerätschaften. Während des Falklandkrieges, 1982, hatten argentinische Truppen die Insel besetzt und die Forscher vertrieben.
Harris kam später als einer der ersten Briten wieder auf die Insel zurück. Er war damals ein junger Wissenschaftsassistent, der mit seinen Forschungsarbeiten bereits seinen kleinen Teil zum heutigen Verständnis des Klima- und Erdsystems beigetragen hatte. Tempi passati. Nach Graces Tod war sein Interesse an einer akademischen Laufbahn erloschen. Jemand betätigte draußen den Türklopfer. Harris schritt zum Eingang und öffnete die Tür. Vor ihm stand Professor Luis C. Mendelez. Für einen Augenblick war Harris wie gelähmt.
»Nick!«, rief Mendelez erfreut und umarmte seinen früheren Assistenten, »habe ich dich erschreckt?«
»Nein, komm rein Luis«, sagte Harris etwas verwirrt und spürte das schale Gefühl, das ihn beim Aufwachen oft überkam, wenn er für einen kurzen Augenblick Ort und Zeit vergaß und sich fragte, ob Grace tatsächlich gestorben war.
»Du machst einen etwas verstörten Eindruck, mein Lieber. Die Einsamkeit bekommt dir wohl nicht.«
Nick Harris ignorierte die Bemerkung und sagte, er mache jetzt einen Kaffee. Mendelez folgte ihm in den kleinen Vorraum, »ich soll dir liebe Grüße von Barry Venison ausrichten.«
»Oh, Barry, den gibt es also auch noch«, wunderte sich Harris, während er den Behälter der Kaffeemaschine mit Wasser füllte.
»Ja, er leitet das Londoner Institut Nilsor«, sagte Mendelez und grinste, »er ist mein Chef.«
»Barry? Kann ich mir gar nicht vorstellen«, meinte Harris, »zu unseren Studienzeiten ist er kaum aufgefallen. Ist er verheiratet?« Allmählich taute Harris auf und freute sich, dass Mendelez da war.
»Ja, seit zwanzig Jahren, drei halb erwachsene Töchter.«
»Oh«, machte Harris bloß, als er die Nespresso-Kapseln einstöpselte, »und du?«
»Nicht mehr«, antwortete Mendelez ohne Bedauern.
»Schwierige Ehe?«
»Keine Ahnung, ich war ja nie zu Hause.«
Beide gingen mit ihrem Kaffee zum Fenster und schauten, wie ein Helikopter ein riesiges Netz mit schwarzmarkierten gelben Fässern auf der Insel absetzte.
»Ich hab die Coverstory im Time-Magazin gelesen«, sagte Harris, »ich war schwer beeindruckt.«
Luis Mendelez winkte ab und sagte, die Medien würden immer übertreiben.
»Nein, Luis, du warst stets zu bescheiden. Einen derartigen Ruf muss man sich erarbeiten, sie nannten dich die weltweit unbestrittene Koryphäe auf dem Gebiet der Rattenbekämpfung. Ich war richtig stolz auf dich.«
Mendelez winkte erneut ab und sagte, seine eigentliche Leidenschaft gehöre bekanntlich der Immunologie. Die Rattenforschung sei mehr eine Liebhaberei. »Habt ihr viele Touristen?«, fragte Mendelez, um das Thema zu wechseln.
»Jetzt fängt bald die Saison an«, antwortete Harris und nahm einen Schluck Kaffee, »im Jahr kommen etwa sechzig Expeditionsschiffe mit siebenhundert Touristen. Aber sie dürfen hier nicht übernachten. Ihr werdet also kein Problem mit den Unterkünften haben.«
»Wir sind ein Team von fünfundzwanzig Leuten, in zwei Wochen sind wir wieder weg.«
Beide verfolgten die Arbeit der Männer, die draußen die gelben Fässer aufschraubten und mit einer Schaufel die Giftköder in einen riesigen Metalltrichter warfen.
»Tut mir leid wegen deiner Frau«, sagte Mendelez und presste die Lippen zusammen.
Harris war überrascht, dass Mendelez davon erfahren hatte. Er mochte nicht darüber sprechen. Stattdessen sagte er, dass die Giftköder wohl nicht nur die Ratten ausrotten würden.
»Das ist nicht zu vermeiden, Nick. Wenn wir in den nächsten Wochen Tonnen von Giftködern über den Inseln abwerfen, werden auch einige jener Vögel sterben, die wir eigentlich retten wollen. Aber der South Georgia Heritage Trust sagt uns, dass sich die Vogelpopulationen rasch erholen werden, wenn die Ratten einmal ausgerottet sind. Der langfristige Nutzen überwiegt.«
Ein Helikopter schwebte über dem Landeplatz, vier Seile wurden hinuntergelassen. Die Arbeiter befestigten den Trichter.
»Finanziert der Heritage Trust das Ganze?«
Harris schaute zu Mendelez hoch.
»Ja, elf Millionen, aber acht hat Barry gestiftet.«
»Barry Venison?«, fragte Harris ungläubig.
»Ja, unser Barry, er hat geerbt, ziemlich viel sogar, und irgendwie schämt er sich für seinen neuen Reichtum.«
Der Helikopter stieg langsam wieder hoch. Unter dem Trichter begann eine Art Sprinkleranlage zu rotieren und schleuderte Giftköder in alle Himmelsrichtungen.
»In zwei Jahren werden wir wissen, ob wir Erfolg hatten. Dann kommen wir zurück, stellen Fallen auf und überprüfen zum Abschluss die Insel mit Spürhunden.«
»Hast du deinen Giftköder eigentlich patentieren lassen?«, fragte Harris.«
»Nein, die Rechte gehören dem Institut Nilsor. Geld hat mich nie fasziniert, Nick. Ich bin auch nicht der ›Lord of the Rats‹, wie mich die Boulevardmedien mittlerweile nennen, ich bleibe bei der synthetischen Biologie. Ich will immer noch das Immunsystem der Menschen optimieren. Wir haben früher oft darüber gesprochen. Die grösste Gefahr, die der Menschheit droht, sind nicht Kriege, Meteoriteneinschläge, Klimawandel oder Negativzinsen, sondern eine Pandemie. Letztes Jahr starben in Europa bereits über dreißigtausend Menschen an Infekten, weil sie Antibiotikaresistenzen entwickelt hatten.«
2
Neun Jahre später
Rajasthan, Indien. Mittwoch, 29. Mai, 06:48 Ortszeit
Mit einem heftigen Knall schlug die Pendeltür gegen das Chromstahlbecken. Zwei junge Inder betraten die Küche der NGO Herorat. Sie waren außer sich vor Zorn. Hastig schauten sie sich in der schmucklosen Kantine um. Sie waren allein, allein mit der achtzehnjährigen Nadi Satpathi. Für einen Augenblick stand die junge Frau wie angewurzelt, starrte auf ihre beiden Cousins Ishwar und Kirshan. Jemand musste ihren Plan verraten haben. Sie wusste, was der Besuch zu bedeuten hatte.
Nadi war eine attraktive Frau von dunklem Teint mit langen schwarzen Haaren, schlank und hochgewachsen. Auf dem Forschungsgelände nannte man sie ›die Magierin‹. Nicht nur, weil sie so gut kochte, sondern vor allem, weil ihre Bewegungen graziös und ihre rabenschwarzen Augen mit den kräftigen Brauen ihr eine geheimnisvolle Aura verliehen. In Europa hätte man sie als exotische Schönheit wahrgenommen. Hier war sie unsichtbar. Eben hatte sie noch Kachori-Kugeln frittiert, eine Delikatesse aus Kartoffeln, Zwiebeln und Erbsen. Die Crew liebte diesen Frühstückssnack. Sie arbeitete im gegenüberliegenden Gebäude. Dort standen die gläsernen Rattenkäfige mit den ausgestanzten Duftlöchern im Boden. Nur wenn die Ratte beim Duftstoff TNT verweilte, klickte der Trainer mit einem Blechfrosch und belohnte die Ratte mit einer dünnen Scheibe Banane. So lernten die Tiere, dass ein Klick Futter bedeutete und dass sie damit nur belohnt wurden, wenn sie vor dem TNT-Duftloch stehen blieben. Nadi liebte diese Nager, sie konnte gut mit Ratten und hoffte, eines Tages im Westen mit Ratten arbeiten zu können. Doch ihr Vater hatte ihr stets eingebläut, eine Frau brauche keine Bildung, sondern einen Ehemann, und sie müsse nicht Ratten dressieren, sondern Kinder gebären, am liebsten Buben und keine Mädchen.
Cousin Ishwar schloss die Tür und lehnte sich provozierend dagegen. Kirshan hatte keine Eile, er wusste, dass die Trainer erst in zwei Stunden mit der Arbeit beginnen würden. Nadi konnte nicht auf Hilfe hoffen. Sie hatte Angst, fürchterliche Angst, dass ausgerechnet am Tag ihrer Flucht ihr geheimer Plan durchkreuzt würde. Die beiden Cousins genossen ihre Überlegenheit, Nadi wusste, wieso sie gekommen waren. Der Teppichhändler Qureshi aus Surangani hatte der Familie Satpathi ein Ultimatum gestellt, er bestand darauf, dass die Vereinbarung zwischen den Familien eingehalten wurde. Aber Nadi hatte sich geweigert, ihn zu heiraten, weil er »Frauen klopfte«, wie sie in Surangani erzählten. Ishwar und Kir-shan sollten die Familienehre retten, sie waren Brüder, orthodoxe Hindus, die vor Jahren einen muslimischen Lastwagenfahrer angezündet und gelyncht hatten, weil er angeblich Rindfleisch transportiert hatte. Die Regierung hatte wie üblich weggesehen, und sie würde auch wegsehen, wenn die beiden nun das taten, wozu sie hergekommen waren. Ishwar trug einen dünnen Schnauzer und machte einen auffallend dumpfen Eindruck, wobei man nie genau wusste, ob das eher harmlos oder ausgesprochen gefährlich war. Kirshan hingegen kleidete sich stets elegant und hatte Charisma. Die Familie hielt ihn für smart, tatsächlich war er zynisch. Er nahm einen bläulichen Flakon aus seiner Hosentasche und grinste. Dann schraubte er den Verschluss ab. Gleich würde Kirshan wie ein Rottweiler über Nadi herfallen, sie vergewaltigen, ihr vielleicht die Hüftknochen brechen – und ihr anschließend das Gesicht verätzen.
Nadi hatte schon so viele junge Frauen gesehen, deren Gesichter aus nichtigem Grund von gekränkten Verwandten verätzt worden waren. Auch ihre geliebte Tante Taneja hatte dieses Schicksal erlitten. Wulstig verwachsene Narben zeugten davon. Als Kirshan sich umdrehte und das Fläschchen Ishwar reichte, nutzte Nadi die Gelegenheit. Blitzschnell riss sie das Stromkabel aus der Fritteuse, nahm diese in beide Hände und schüttete Kirshan, als er sich wieder umdrehte, das heiße Öl ins Gesicht. Mit einem gellenden Aufschrei fiel er auf die Knie, bedeckte mit beiden Händen sein Gesicht, verbrühte sich dabei die Finger und wälzte sich brüllend auf dem Steinboden, als würde er vor Schmerz den Verstand verlieren. Ishwar stand mit dem Säurefläschchen konsterniert vor der Pendeltür. Er hatte nur ein paar Spritzer abbekommen, aber genug, um in Rage zu geraten. Nadi rannte ans andere Ende der Küche und verließ diese durch den Lieferanteneingang.
Sie hetzte über den Hof und stieg auf ihr altes Royal Enfield-Motorrad. Aber die Maschine stotterte, sprang nicht an. Nun rannte auch Ishwar über den Hof und stieß dabei wüste Drohungen aus. Nadi startete erneut den Motor, diesmal sprang er an und warf knatternd schwarzen Rauch aus. Nadi warf einen ängstlichen Blick zurück, sah, dass auch Ishwars linke Gesichtshälfte verbrüht war. Er würde sich fürchterlich rächen. Nadi raste über das abgelegene Firmengelände. Es lag in der Grenzregion Gamanewala, im Bundesstaat Rajasthan. Nadi folgte zuerst der Landstraße in Richtung pakistanischer Grenze, doch dann wendete sie abrupt und fuhr einen steilen, holprigen Feldweg hinauf. Ishwar hatte mit seinem stärkeren Motorrad die Verfolgung aufgenommen und holte auf. Oben auf dem Plateau war ein verdorrter Acker mit weißen Stoffbahnen abgesperrt, gelbe Warnschilder mit schwarzer Schablonenschrift warnten vor Minen, »Danger! Mine!«. Nadi wusste, dass diese Felder noch nicht freigegeben waren, doch als Ishwar allmählich aufholte, zögerte sie keine Sekunde. Sie bremste scharf ab, das Hinterrad drehte um neunzig Grad und wirbelte eine Menge Staub auf. Nadi gab wieder Gas und raste über den stoppeligen Acker, geradeaus, entlang der weißen Markierungen. Wie erhofft, wollte Ishwar ihr den Weg abschneiden und fuhr quer über das abgesteckte Feld. Eine kräftige Explosion erschütterte den Boden, eine staubige Fontäne aus brauner Erde schoss in den Himmel, Ishwars Motorrad wurde durch die Luft geschleudert und auseinandergerissen. Der Benzintank war gleich nach der Detonation der Landmine explodiert. Als ein zerfetzter Unterarm vom Himmel fiel, wusste Nadi, dass Ishwar ihr nichts mehr antun würde.
Südgeorgien, Antarktis
Zur selben Zeit saß Nick Harris in der Wohnung des Hafenkapitäns Fasmus Dahlström. Der eingebürgerte Schwede war um die fünfzig und hatte die Aufsicht über Zoll und Fischereiwesen. Gemeinsam vertraten sie die britische Regierung auf Südgeorgien. Harris’ Schultern waren zusammengefallen, den einst sorgfältig getrimmten Bart ließ er mittlerweile wild wuchern. Es schien, als spiegelten sich die zerklüfteten Gebirgsketten in den tiefen Furchen seines Gesichts. Schweigend saßen sich Harris und Dahlström gegenüber und nippten an einem Glas Whisky. Jeder für sich, gemeinsam allein. Aus der Küche hörte man das Klirren von Glas und Gelächter. Dahlströms junge Frau Neeletorkelte mit einer Flasche Champagner ins Wohnzimmer, blieb vor den beiden Männern stehen, versuchte das Gleichgewicht zu halten und prustete vergnügt los: »Was für ein trauriger Anblick, die Herren.« Sie setzte sich auf Nicks Sofalehne und legte ihm den Arm auf die Schulter: »Weißt du, Nick, wenn du mit einem Finnen den Abend verbringst, säuft jeder für sich, und am Ende sagt der Kerl, das sei ein schöner Abend gewesen.«
»Das hast du uns schon mal erzählt«, brummte Dahlström.
»Ach, wirklich? Und weißt du wieso, Fasmus? Weil es bei uns jeden Abend so ist. Und ich sage dir, es kotzt mich an. Frauen in meinem Alter machen nachts Party, und ich sitze hier herum und werde langsam fett wie die See-Elefanten da draußen. Ich habe nachgedacht. Und weißt du, zu welchem Schluss ich gekommen bin?«
»Du wirst es uns gleich sagen.«
»Ich fahr mit dem nächsten Schiff nach London zurück!«
»Haben wir auch schon gehört«, sagte Dahlström und starrte an die Decke. Wütend erhob sich Neele von Nicks Sofalehne und baute sich breitbeinig vor ihrem Ehemann auf: »Am Freitag bringt der Eisbrecher unsere Monatseinkäufe. Kannst du alles alleine fressen! Ich fahr mit den Jungs zurück, und in Fort Stanley nehm ich den nächsten Flieger nach London.«
Keiner der beiden Männer reagierte. Neele setzte sich provozierend auf Harris’ Schoß und drückte ihre Stirn gegen die seine: »Kannst du das verstehen, Nick? Für eure Pinguine mag das ein Paradies sein, für mich ist es die Hölle, eine Hölle aus Eis.«
»Lass Nick in Frieden, Neele, geh schlafen«, sagte Fasmus beherrscht und leerte sein Glas.
»Wozu?«, schrie Neele, »willst du etwa mit mir schlafen?«
»Du bist betrunken.«
»Nick, bin ich etwa betrunken?«
Nick Harris schwieg. Wie immer.
»Wieso sollte ich ins Bett gehen? Habe ich morgen irgendwelche Termine? Modeschau, Massage, Make-up? Ein Rendezvous mit einem feurigen Lover?«
Neele erhob sich wieder und löste den Verschluss des Champagners. Sie richtete den Flaschenhals auf ihren Ehemann: »Du wirst jetzt gleich putzmunter, Fasmus.«
Plötzlich ging das Licht aus, man hörte das Knallen des Champagnerkorkens und wie etwas Schweres auf dem Boden aufschlug. Nick erhob sich und stürzte über Neele, die auf dem Boden lag. Sie umarmte ihn lachend und versuchte ihn zu küssen. Nick befreite sich und tastete sich auf allen vieren vor. Ein Lichtstrahl blendete ihn. Fasmus Dahlström stand mit einer schweren Taschenlampe vor ihm: »Ich sehe im Technikraum nach.«
»Ich komme mit«, sagte Nick Harris. Er hatte wenig Lust, allein mit Neele im Haus zu bleiben.
»Großartig!«, rief Neele den Männern nach, »jetzt haben wir vermutlich auch kein Internet mehr. Wir sind komplett von der Welt abgeschlossen, ihr gottverdammten Freaks!«
Bei klirrender Kälte steuerte Harris den Land Rover Defender an verfallenen Holzbaracken durch die Nacht. Die verstärkten Scheinwerfer streiften über zerstörte Industrieanlagen und ließen die rostigen Gerippe wie surrealistische Skulpturen erscheinen. Harris hielt vor dem Eingang zu einer Bauruine und ließ die Scheinwerfer an, damit sie ins Innere leuchten konnten. Die beiden Männer betraten die Trafostation. Ein beißender Geruch lag in der Luft, im Inneren dösten See-Elefanten. Sie zeigten keinerlei Reaktionen. Nick Harris besprayte die Verschalung des Technikkastens mit einem Enteiser, Dahlström löste die Schrauben. Auf den ersten Blick war nichts Auffallendes festzustellen.
»Das blaue Kabel«, sagte Dahlström und zeigte mit dem Schraubenzieher ins Innere, »es ist durchtrennt.« Es war kein sauberer Schnitt, die beiden Enden waren ausgefranst. Dahlström hob die Hauptplatine aus der Verankerung. Harris beugte sich vor und leuchtete in die Tiefe. Irgendetwas sprang ihm ins Gesicht. Harris stieß einen Schrei aus und ließ die Taschenlampe fallen. Er stolperte rückwärts über eine abgebrochene Rohrleitung und schlug mit dem Hinterkopf hart auf. Er schrie wie von Sinnen. Dahlström kniete zu ihm nieder. Er sah, dass Harris irgendwas in den Händen hielt. Es war weiß, pelzig und zappelte. Das Ding hatte seine rasiermesserscharfen Krallen in Harrys’ linke Gesichtshälfte festgehakt und ihm Auge und Wange aufgerissen. Er blutete stark. Dahlström griff mit beiden Händen nach dem Tier und versuchte es zu erwürgen, aber es geriet in Panik, zappelte noch verzweifelter, piepste und riss mit seinen Krallen Dahlströms Handballen blutig. Plötzlich war es totenstill. Man hörte nur noch das Wimmern von Harris. Dahlström hielt die Bestie immer noch fest und suchte den Lichtkegel. Sie rührte sich nicht mehr. Jetzt sah er dem Ding direkt in die Augen.
Es war eine Ratte von ungewöhnlich großem Wuchs, eine Albino-Ratte. Sie starrte Dahlström direkt in die Augen, einen Moment lang lockerte er den Griff. In diesem Augenblick schlüpfte die Ratte aus der Umklammerung und erreichte mit einem gewaltigen Sprung die schwere Maschinenkette, die von der Decke hinunterhing. Als Dahlström hinaufleuchtete, fiel der Lichtstrahl auf einen rostigen Tank. Es mussten Dutzende Albino-Ratten sein, die lauernd auf ihn hinabschauten. Gleich würden sie zum Sprung ansetzen.
Deshnok, Indien.10:48 Ortszeit
Nadi fuhr auf der staubigen Landstraße Richtung Deshnok, eine Provinzstadt mit knapp 20.000 Einwohnern. Sie bereute, dass sie nochmals das Gelände der NGO aufgesucht hatte. Aber wie hätte sie sonst ihren letzten Lohn beziehen können? Sie würde jede Rupie brauchen. Den heutigen Tag hatte sie in den letzten Jahren oft durchgespielt, immer und immer wieder, aber jetzt, wo der Tag gekommen war, befand sie sich hart an der Grenze zur Panik. In dieser Hinsicht funktionierte ihr Gehirn wie das einer Ratte: Sie hatte alle ihre Sinne geschärft und war auf Flucht fokussiert.
Sie fuhr die Bikaner Nagaur Road hinauf bis zum mächtigen Tor des Karni Mata Tempels. Silberplatten mit Rattenmotiven zierten die Flügel des hinduistischen Heiligtums. Die Nager wurden mit Ganesha assoziiert, dem Hindugott mit dem Elefantenkopf. Die Ratte war Ganeshas Pferd.
Da die Temperaturen noch unter 40 Grad lagen, suchten bereits zahlreiche festlich gekleidete Inderinnen und Inder die sechshundert Jahre alte Pilgerstätte auf. Der Umweg über Deshnok war ein Risiko, aber Nadi wollte Ganeshas Schutz für ihre Flucht in den Westen erbeten. Sie wollte frei sein. Wie ihre Tante Taneja. Aber ohne verätztes Gesicht. Die Pilger trugen schildgroße Schalen gefüllt mit Reis und Gemüse, in einigen schwappte Milch. Nadi stieg von ihrem Motorrad, sicherte es und betrat den Vorraum des Tempels. Sie zog ihre Sandalen aus und durchquerte die Vorhalle. Der flach getretene Rattenkot auf den schwarz-weißen Bodenplatten klebte an ihren nackten Fußsohlen. Den beißenden Geruch von 20.000 fetten Ratten nahm sie nicht wahr. Zu groß war die Anspannung. Die dunkelgrauen Nager wuselten überall herum, quiekten.
Nadi kniete nieder und setzte sich mit einer Milchschale auf den Boden. Zwei Dutzend Ratten flitzten herbei, zogen sich am Schalenrand hoch und nippten, auf den Hinterbeinen balancierend, an der Milch. Einige Besucher hatten sich in einer Ecke schlafen gelegt, inmitten von Essensresten und Exkrementen. Sie dösten vor sich hin, griffen manchmal schlaftrunken nach Nahrungsresten in den silbernen Schalen, pressten mit drei Fingern Reisbrei zu einem Klumpen und steckten ihn in den Mund. Nadi tunkte die hohle Hand in eine Schale und schlürfte von der Milch. Es sollte Glück bringen, wenn man aus dem gleichen Gefäß trank wie die Tempelratten. Die Tiere kannten keine Scheu. Sie wussten, dass sie hier sicher waren vor den Spaten und Stockschlägen der Menschen draußen auf den Feldern. Die Nager außerhalb des Tempels waren nicht heilig, sie galten als Schädlinge, die man aber trotzdem nicht töten durfte. Man fing sie ein und ließ sie an einem anderen Ort wieder frei. So absurd konnte Religion sein. Und so schädlich. Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr hatte Nadi davon geträumt, eines Tages ihr Dorf zu verlassen. Zuerst war es nur ein vager Gedanke gewesen, der ihr half, die Erniedrigungen zu ertragen. Manchmal hatte sie befürchtet, manchmal aber auch gehofft, dieser innere Drang würde nachlassen, sich ihrer erbarmen, aber er war in all den Jahren stärker und fordernder geworden.
Begonnen hatte alles kurz nach ihrem zwölften Geburtstag. Ihre Mutter erklärte ihr, wieso sie in der Nacht geblutet hatte und wieso dies von nun an jeden Monat geschehen würde; dass dies notwendig war, um all den Schmutz aus ihrem Körper abfließen zu lassen. In dieser Zeit dürfe sie die heilige Basilikumpflanze nicht anfassen, das Kraut würde sonst absterben, sie dürfe auch weder Obst noch Gemüse berühren, denn sie sei in diesen Tagen unrein. Dies sei auch der Grund, wieso ihr Vater sie in dieser Zeit jeweils im Geräteschuppen hinter dem Hühnerhaus einsperren müsse. Zu ihrem eigenen Wohl. Nadi wusste damals nicht, was mit ihr geschah, sie hatte keine Ahnung, ob es allen Mädchen in ihrem Dorf so erging, denn darüber zu sprechen, war ihr ebenfalls verboten. Aber Nadi war nicht blind.
Wer zum Schweigen verdammt ist, hat mehr Zeit, um Gesichter zu lesen, und sie bemerkte, dass auch ihre Freundinnen im Dorf ihre Tage hatten und dass dann ihre Brüste größer und die Haut unreiner wurde. Jedes Mal, wenn Nadi die Tage ihrer Menstruation im stickig heißen Geräteschuppen verbrachte, dachte sie darüber nach, wieso der Schöpfungsgott Brahma blutende Frauen erschaffen habe. Sie hasste das Eingesperrtsein in der Dunkelheit und begann sich ein Leben fernab ihres Dorfes vorzustellen. Sie hatte es stets als unrecht empfunden, dass ihre gleichaltrigen Brüder und Cousins mit ihren Kumpels abends herumziehen durften, ihr hingegen alles verboten war, was einem jungen Mädchen Freude macht. Selbst ihr jüngster Bruder, der noch grün hinter den Ohren war, hatte die Erlaubnis, sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen und zu maßregeln. Obwohl er nicht mal richtig rechnen konnte. Sie hingegen war eine gute Schülerin, schon weil sie viel Zeit im Schulgebäude verbrachte, fernab von diesem beklemmenden Elternhaus. Vielleicht war sie deshalb die Zweitbeste ihrer Klasse geworden, aus Trotz.
Doch ihre guten Zeugnisse hatten zuletzt mehr Misstrauen als Stolz erweckt. Ihre Eltern warfen ihr vor, dass alle ihre Cousinen längst verheiratet seien und dass auch sie dieser Pflicht nachkommen müsse, um Schande von der Familie abzuwehren. Sie hätten für sie einen Ehemann gefunden, den Teppichhändler Qureshi aus Surangani, und es stehe ihr nicht zu, ihn abzulehnen. Nadi hatte versucht zu erklären, dass sich die Zeiten geändert hätten, dass sie studieren, ein eigenständiges Leben führen wolle, unabhängig von einem Mann. Ihr Vater war vor Zorn rot angelaufen, er hatte sie geschlagen, bis sie zu Boden fiel, und geschrien, dass eine Frau nach dem Gesetzbuch des Manu sinnlich und unrein sei und deshalb zum Bösen neige und in die Obhut eines Mannes gehöre. Er hatte die Rute, die an der Rückseite der Tür aufgehängt war, hervorgeholt und Nadi belehrt, dass eine Frau nur zur Erlösung gelangen könne, wenn sie als Mann wiedergeboren würde.
Nadi hatte sich zusammengerollt und schützend ihre Hände über den Kopf gehalten, während die Rute mit einem scharfen Pfiff über ihren gebeugten Rücken peitschte. Ihr Vater hatte gedroht, Nadi geknebelt und gefesselt in das Teppichlager von Qureshi zu schleifen. Schließlich war ihre Mutter eingeschritten und hatte dem Vater befohlen, aufzuhören, weil Qureshi keine Freude an roten Striemen hätte. Ihre Tochter würde Qureshi eine gute Ehefrau sein, sich um Haushalt und Kinder kümmern und ihre eigenen Ansprüche zurückstellen. Nadi hatte sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt und versprochen, zu gehorchen. Doch tief in ihrem Innern war etwas zerbrochen, und sie hatte einen Entschluss gefasst.
* * *
Nadi saß seit einer Stunde im Karni Mata Tempel und wartete auf ein Zeichen. Plötzlich äugte eine dunkelbraune Ratte aus einer Mauerritze und presste sich mit den Hinterpfötchen aus dem Loch. Die Besucher verstummten. Diese Ratte war anders als alle andern. Ihre Artgenossen schienen sie zu fürchten oder zumindest als Rudelführerin zu respektieren. Sie wuselte herum, trank ein bisschen Milch und hüpfte über den nackten Fuß einer alten Frau, die sogleich in einen tranceähnlichen Zustand verfiel und von ihren Verwandten gestützt werden musste. Nadi gab ein Geräusch von sich, das so leise war, dass es für Menschen kaum zu hören war. Aber Ratten haben das feinere Hörvermögen. Im Nu strömten die Nager auf Nadi zu und krabbelten über ihre Füße und Schenkel. Inmitten des Rudels war die dunkelbraune Ratte, Ganeshas Pferd. Sie allein konnte die Zukunft voraussagen.
»Sie kann dir sagen, was der Wind dir will, ehe noch die Blätter wehen«, hatte Tante Taneja gesagt. Als sich die Ratte aufrichtete und ihre Pfötchen an Nadis Knie aufstützte, war klar, dass nun alles gut würde. Aber zuerst musste Nadi ihre Reisedokumente bei Tante Taneja abholen. Diese hatte alles Notwendige für Nadis Flucht organisiert, den Reisepass, das Au-pair-Visum für London, Taschengeld für die Reise und natürlich das teure Flugticket. One Way. Tante Taneja wollte, dass wenigstens ihre Nichte Nadi glücklich wird. Es war ihre Art, sich an der Familie für das erlittene Unrecht zu rächen. Sie wohnte in Ambasar, einem kleinen Dorf. Bei ihr lebte auch Juko, Nadis dressierte Ratte. Ohne diese würde sie nicht fliegen. Der Gedanke, dass bereits alle ihre Verwandten hinter Tanejas Haus lauerten, kehrte ihr den Magen um. Aber sie hatte keine Wahl. Ohne das Ticket von Tante Taneja blieben ihre Flügel gestutzt.
Ratcontrol, London. 09:18 Ortszeit
»Beeil dich, wir kommen zu spät!« Jack Black stand ungeduldig neben seinem blank geputzten Van und wartete auf seinen zwanzigjährigen Sohn Alistair. Provozierend langsam schlenderte der junge Mann über den Hof des Firmenareals. Ungeduldig öffnete Jack Black seinem Sohn die Beifahrertür. Seine linke Gesichtshälfte war stark vernarbt, die Folge einer schlecht verheilten Verletzung. Auf dem ferrariroten Van stand in großen Lettern »Ratcontrol. You better call Jack«. Eine Ratte zierte die Schiebetür. Sie erweckte den Anschein, als hätte sie sich gerade durch die Metallwand des Fahrzeugs gefressen und würde nun gleich den Betrachter anspringen. Über den Kopf des Nagers war ein gelbes Fadenkreuz gelegt.
Alistair blieb vor seinem Vater stehen und grinste: »Slow down, old man.« Jack Black ließ sich nicht provozieren und setzte sich ans Steuer.
Alistair blieb noch eine Weile gelangweilt vor der offenen Tür stehen. Er hatte ein spitzes Gesicht mit ausgeprägten Kieferknochen und trug indische Tatoos auf den nackten Oberarmen, eines zeigte den abgetrennten Kopf des indischen »Transgender-Gottes« Aravan, das andere einen schelmisch lachenden Elefanten, den hinduistischen Gott Ganesha. Alistair trug Ripped Jeans und ein ärmelloses Jackett mit Fransen. Das halblange Haar hatte er mit einem mehrfarbigen Stirnband fixiert.
»Hattest du nichts anderes zum Anziehen?«, fragte Jack Black, als sich sein Sohn endlich auf den Beifahrersitz setzte.
»Was hast du erwartet?«, spottete Alistair, »so eine Art father & son-Look?«
Jack startete den Motor und spurte auf die Straße ein. Alistair genoss es, wenn sein Vater sich nicht traute, seinem Ärger freien Lauf zu lassen. Er wollte nicht riskieren, dass sein Sohn bei der nächsten roten Ampel ausstieg. Der heutige Anlass war ihm wichtig, sehr wichtig sogar.
»Und du? Hattest du nichts anderes zum Anziehen?«, fragte Alistair.
Jack trug stets sein unverwechselbares navyblaues Army-Hemd mit gelben Epauletten und einem breiten Ledergürtel, der mit silbrigen Ratten verziert war, darüber einen schwarzen Lederkittel.
»Daddy, dein Sohn spricht mit dir. Du läufst mit fünfundfünfzig noch wie ein Teenager rum, der zu einer Wildwest-Party eingeladen ist. Ein bisschen Christian Bale als Captain Joseph Joe Blocker in Hostiles ? Siebte US Cavalry und so?«
»Alistair«, antwortete Jack und gab sich Mühe, sich zu beherrschen, »ich habe in meinem Leben noch nie eine Universität von innen gesehen, das ist das erste Mal heute. Aber ich habe schon früh begriffen, dass man gegen die Konkurrenz nur bestehen kann, wenn man zur Marke wird. Mein Outfit mag etwas verrückt sein, aber ich bin in London so bekannt wie Starbucks, weil mein Outfit eben unverwechselbar ist.«
»Ist ja schon gut, wir spielen heute Hostiles. Ich bin Wes Studi als Chief Yellow Hawk oder ist’s eher Little Big Man ?«
Jack Black schüttelte den Kopf: »Alistaire, du weißt, wen die Boulevardmedien interviewen, wenn irgendwo in London eine Riesenratte auftaucht, die alle in Angst und Schrecken versetzt. Sicher keinen normalen Schädlingsbekämpfer.«
»Endlich gibst du zu, dass du nicht ganz normal bist«, grinste Alistair.
»The Sun mag mein Outfit. Sie hat unsere Firma groß gemacht.«
Alistair gähnte. »Und irgendwann bist du so groß, dass du reif bist für den tiefen Fall und den medialen Tod.«
»Wieso sollten sie das tun?«
»The Sun: ›Jack Black bumst die Freundinnen seines Sohnes‹.«
Jack fädelte in die Schnellstraße ein. Den heutigen Tag würde er sich von niemandem versauen lassen. Alistair warf ihm ab und zu einen Blick zu und schien enttäuscht, dass sich sein Vater nicht provozieren ließ. Schließlich stichelte er weiter: »›Jack Black fickt tote Ratten‹, das wäre doch eine geile Schlagzeile.«
»Alistair, die Medien sind heute vorsichtiger, sie schätzen Leute, die ehrlich und authentisch sind, Antworten, die originell, kurz und prägnant sind, nicht das übliche Geschwurbel.«
»Und all das verkörpert General Custer?«
Jack Black hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sein Sohn eines Tages die schwierige Phase der Adoleszenz überwunden haben würde. Alistair war elf Jahre alt, als seine Mutter vor neun Jahren mit einem Pizzabäcker durchbrannte. Alistair hatte ihm, Jack, die Schuld gegeben, weil er sich angeblich zu wenig um seine Frau Joline gekümmert hatte. Jack Black erinnerte sich noch genau an den Tag, als die Postkarte aus der Toskana eintraf. »I won’t come back no more.« Sie würde nie zurückkehren schrieb sie, sie sei glücklich, und Alistair würde es eines Tages verstehen und darüber hinwegkommen. Der Junge hatte am folgenden Wochenende sein Zimmer mit morbiden H. R. Giger-Postern tapeziert und sich in eine finstere Welt von biomechanischen Wesen zurückgezogen. »Irgendetwas ist damals mit meinem Jungen passiert«, pflegte Jack Black zu sagen.
Er bog in die Gover Street ein und nahm Kurs auf die Keppel Street. Ob er sich denn nicht wenigstens ein bisschen freue, fragte er seinen Sohn. Sie würden eine Berühmtheit kennenlernen, die seit Jahren auf der Kandidatenliste für den Nobelpreis stand.
»Ist mir scheißegal, Jack.«
Als er sah, wie tief er seinen Vater mit dieser Bemerkung verletzt hatte, fügte er grinsend hinzu: »Du liebst es doch ehrlich und authentisch, nicht wahr, Daddy?«
* * *
Der Hörsaal der London School of Hygiene & Tropical Medicine war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Universität gehörte zum Verbund der University of London und galt weltweit als eine der renommiertesten Institutionen in den Bereichen Epidemiologie, Globale Gesundheit, Tropenmedizin und Infektionskrankheiten. Eingeladen hatte das Biotechnology and Biological World Science Research Center. Aus der ganzen Welt waren sie herangereist, Immunologen, Fachärzte, Forscher und Vertreter von Pharmaunternehmen. Aus Goodwill hatte man auch den Amtsleiter der Londoner Verwaltungsstelle »Straßenreinigung und Ungezieferbekämpfung« eingeladen. Nicht auf der Liste, und dennoch anwesend, waren Jack Black und sein Sohn Alistair. Der Hauptredner hatte Jack persönlich eingeladen. Sie hatten sich vor etlichen Jahren im Jazzlokal Cellar Door kennengelernt und angefreundet. Jack hatte den Mann zuerst für einen Musiker gehalten.
Der Direktor des Biotechnology and Biological World Science Research Center begrüßte die Anwesenden und stellte in wenigen Sätzen den Gast des Abends vor: Professor Luis C. Mendelez. Er lobte ihn als unkonventionellen Forscher, der mit der Entwicklung des Rattenköders »Exterma Five« Südgeorgien vor zehn Jahren von der Rattenplage befreit habe. Er habe das Paradies auf die Inseln im Südpazifik zurückgebracht.
»Das ist Professor Mendelez«, sagte Jack Black voller Stolz.
»Ja«, antwortete Alistair gelangweilt, ohne seinen Vater anzuschauen, »das habe ich mir beinahe gedacht.«
»Wir sind die einzigen Nichtakademiker, die heute hier im Saal sitzen«, flüsterte Jack Black.
»Toll«, grinste Alistair, »und jetzt holen wir uns einen runter?«
Als sein Vater nicht reagierte, fragte er ihn, ob er denn seine blauen Pillen vergessen habe. Jack Black ignorierte auch diese Provokation.
»Alistair«, flüsterte er eindringlich, »Marketing und Networking ist alles. Eines Tages übernimmst du Jack Blacks Ratcontrol und …«
»Echt? Wusste ich gar nicht.« Alistair zeigte auf die Bühne und gab seinem Vater zu verstehen, dass er still sein sollte.
»Juramaia sinensis«, begann Professor Luis C. Mendelez seinen Vortrag, »ist die Urzeit-Ratte, eine ausgestorbene Art von Säugetieren, die vor rund hundertsechzig Millionen Jahren in Zentralasien auf Beutejagd ging. Juramaia sinensis ist die früheste Vertreterin der Plazentatiere. Neunzig Prozent der modernen Säugetiere gehören in diese Kategorie, auch wir hier im Saal gehören dazu.« Einige Zuhörer lachten leise, Mendelez hatte sie bereits auf seiner Seite.
»Als Juramaia sinensis den Planeten bevölkerte, gab es die Familie der Hominoidea, der Menschenartigen, noch nicht. Und eines Tages wird der Homo Sapiens von der Erdfläche verschwunden sein, aber die Nachfahren der Urzeit-Ratte werden in den Ruinen von New York, Delhi, Shanghai, São Paulo und Kairo überleben und weiter herumwuseln.«
Der Professor ließ den Blick über die Köpfe der geladenen Gäste schweifen: »Wir mögen keine Ratten. Sie sind schmutzig, ekelig, auf jedem Rattenpfötchen lassen sich bis zu fünf Millionen Erreger nachweisen. Sie sind verantwortlich für über siebzig verschiedene Infektionskrankheiten. Ratten leben dort, wo wir nicht enden wollen, unter der Erde. Nachts huschen sie in Rudeln die Hauswände entlang, schnüffeln an unseren Müllsäcken, reißen sie mit ihren spitzen Krallen auf, fressen sich satt und flitzen wieder davon. Sie verschwinden in der Kanalisation, in den Zuläufen von Metzgereien, Gaststätten und Spitälern.«
Auf der Großleinwand wurde der Querschnitt einer Karavelle eingeblendet, die Lagerräume des Handelsschiffes waren gelb markiert.
»Um das 14. Jahrhundert herum gelangten Ratten als blinde Passagiere auf die viermastigen Handelsschiffe europäischer Seefahrer, die unsere Häfen ansteuerten. Sie hangelten sich über Taue und Schiffsketten an Land, strömten in alle Himmelsrichtungen aus, vermehrten sich rasend schnell. Auf Feldern, in Kellern, Lagerräumen und dunklen Gassen lauerten sie auf das Einbrechen der Nacht. Menschen erkrankten an einem merkwürdigen Fieber, dunkle Geschwüre wucherten auf ihrer Haut: Im Mittelalter starben zweihundert Millionen Menschen an der Pest, allein in Europa waren es in den Jahren 1346 bis 1353 fünfundzwanzig Millionen. Das ist ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Überträger waren die Flöhe im Fell der Ratten. Jede Katze, die eine solche Ratte fraß, brachte die Pest ins Haus.«
Mendelez legte erneut eine Pause ein, um seine Worte wirken zu lassen, und fuhr in ruhigem Ton fort: »Die Nager waren gekommen, um zu bleiben. Wieso sollten sie sich nicht in der Nähe der Menschen niederlassen? Dort wo Menschen leben, türmt sich der Müll, ein Festmahl für die kleinen Nager. Und das Todesurteil für tausend andere Tierarten.« Er nahm einen Schluck Wasser. Auf der Großleinwand wurde eine Statistik eingeblendet: »Jedes Jahr sterben auf unserem Planeten elftausend bis achtundfünfzigtausend Tierarten aus. Es ist das sechste große Artensterben der letzten fünfhundertvierzig Millionen Jahre, das Gleichgewicht der Ökosysteme ist in Schieflage geraten, es entstehen neue Lebensräume, Freiräume, in denen sich Ratten in epidemischem Ausmaß vermehren. Mein geschätzter Kollege Jan Zalasiewicz von der Universität Leicester sagt den Ratten deshalb eine große Zukunft voraus.Wir werden Ratten in einer Größe von Schafen erleben, prophezeiht er.«
Mendelez ließ den Blick erneut über das Auditorium schweifen.
»Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Riesenwuchs von Tieren und dem Klimawandel. Vor fünfundfünfzigMillionen Jahren stieg die Temperatur innerhalb von zweihunderttausend Jahren um sechs Grad. Bei vielen Tieren fördert ein wärmeres Klima das Wachstum. Aus jener Zeit stammen Fossilien von riesigen Boas, Schildkröten und Riesenratten. Mammuts, Säbelzahntiger und gepanzerte Gürteltiere von enormem Wuchs, vor zehntausend Jahren waren sie alle noch da. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts könnte es wieder so weit sein. Überall auf der Welt beobachten wir Ratten von ungewöhnlicher Größe. Auch in London. Durch eine Mutation im Erbgut könnten sie resistent werden gegen alle gebräuchlichen Gifte. In Südgeorgien hat das Institut Nilsor Geschichte geschrieben. Aber London ist nicht Südgeorgien. Hier leben acht Millionen Menschen. Wir können nicht einfach Tonnen von Giftködern über London, New York, Paris oder Rom abwerfen. Was können wir also tun? Ratten haben die besseren Überlebenschancen, die bessere Anpassungsfähigkeit, das stärkere Immunsystem. Und was haben wir?«
Mendelez ließ sich Zeit und genoss die Anspannung in den Gesichtern.
»Wir haben Crispr/Cas9, die Genschere. Crispr ist ein mächtiges Instrument, das aufregendste Werkzeug, das die Biologie je besessen hat. Falls wir willens sind, es auch zu benutzen. Mit dieser biochemischen Schere lassen sich Teile unseres Erbgutes wie bei einem Textverarbeitungsprogramm löschen, überschreiben und korrigieren. Wir kennen die Technik. Aber uns fehlt der Mut. Meine Damen und Herren, hier geht es nicht um Ethik, es geht ums Überleben der menschlichen Rasse.«
Auf der Leinwand wurde ein Eisberg eingeblendet, der im Zeitraffer unter den Meeresspiegel sank.
»Mein Kollege, Professor Peter Frankopan von der Universität Oxford, hat nachgewiesen, dass das in Permafrostböden über Millionen Jahre konservierte Pestbakterium Yersinia pestis wieder freigesetzt werden könnte. Wie tausend andere Bakterien und Viren, über deren Existenz wir noch gar nichts wissen und gegen die wir somit auch kein Gegenmittel haben. In der mobilen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wird kaum ein Mensch vor einer Ansteckung sicher sein. Aber Ratten werden erneut überleben.«
Professor C. Mendelez trank unter dem Geraune des Publikums einen Schluck Wasser: »Wieso sind Ratten immun? Wieso ist es der Mensch nicht? Können wir ein Immunisierungs-Gen isolieren?«
Er machte erneut eine Pause.
»Ja, wir können. Dürfen wir? Ja, wir müssen!«
Die Unruhe im Publikum nahm spürbar zu. Es knisterte förmlich.
»Als Wissenschaftler fühle ich mich moralisch verpflichtet, es zu tun.« Ein Raunen ging durch den Saal.
»Ich habe das Gen, das die Immunabwehr von Ratten steuert, isoliert und menschlichen Embryonen eingepflanzt.«
Im Saal wurden die Stimmen lauter. Mendelez bat um Ruhe: »Es geht nicht mehr darum, Ratten zu töten oder ihre Population mit einem Unfruchtbarkeitsgen zu reduzieren, es geht nicht mehr um genetisch modifizierte Ratten, es geht nicht mehr darum, Menschen von Erbkrankheiten zu heilen, es geht darum, die menschliche DNA zu optimieren. Damit unsere Spezies überlebt.«
Als Mendelez seinen Vortag beendet hatte gab es nur noch verhaltenen Applaus. Die Zuhörer verließen den Saal, Jack Black und sein Sohn blieben noch eine Weile im Auditorium. Jack wusste nicht so recht, ob sie zur Bühne gehen und den Professor begrüßen sollten.
»Komm schon, ich mach euch miteinander bekannt.«
Alistair verzog den Mund zu einer mürrischen Grimasse.
»Der Mann kriegt eines Tages den Nobelpreis«, sagte Jack eindringlich, »das ist ein ganz Großer. Ihm bringen wir jeweils Ratten von außergewöhnlichem Wuchs«, flüsterte Jack.
Alistair nickte gelangweilt: »Dann bist du wenigstens etwas Kleines von etwas ganz Großem. Wie aufregend.«
»Jetzt halt mal die Klappe, verdammt nochmal, und tu, was ich sage.«
Jack Black ging zur Bühne und winkte Mendelez freundlich zu. Dieser schien erfreut, grüßte zurück und stieg zu Jack hinunter.
»Das ist mein Sohn Alistair.«
Jack drehte sich um, aber Alistair war ihm nicht gefolgt. Er winkte ihn energisch herbei, »er wird eines Tages Ratcontrol übernehmen«.
Alistair verdrehte genervt die Augen und begrüßte den Professor.
»Sie scheinen nicht begeistert, junger Mann«, sagte Mendelez freundlich.
»Das kommt schon noch«, beteuerte Jack.
In diesem Augenblick klingelte Mendelez’ Handy. Er hatte eine SMS erhalten. Aus Port Stanley. Auf Südgeorgien hatte sich etwas Schreckliches ereignet.
Südgeorgien, Antarktis
Als die Crew des Forschungseisbrechers Winston am späten Vormittag die Antarktis-Insel betreten hatte, waren sie nicht wie üblich von der lebenslustigen Neele empfangen worden. Das, was von ihr übrig geblieben war, lag tiefgefroren auf dem menschenleeren Platz vor dem Haus des Hafenkapitäns. Das Besondere an der Leiche war, dass ihre Augen fehlten. Der Kapitän hatte nach Harris und Dahlström suchen lassen, doch sie waren spurlos verschwunden. Deshalb hatte er gegen Abend die Royal Air Force Station Mount Pleasant auf den Falklandinseln informiert. Auf diesem Militärstützpunkt waren seit dem Krieg mit Argentinien über tausend britische Soldaten stationiert. In den Hangars standen vier Eurofighter Typhoon Kampfflugzeuge, SAR-Hubschrauber, ein Vickers VC-10-Tankflugzeug und eine Herkules Transportmaschine, die dreimal wöchentlich den Warenverkehr zwischen Fort Pleasant und der 14.000 Kilometer entfernten Luftwaffenbasis Brize Norton in der Grafschaft Oxfordshire sicherten.
Als der Funkspruch eintraf, wurde umgehend der Befehlshaber der Royal Marines im fünfzig Kilometer entfernten Port Stanley benachrichtigt. Dort ankerten eine Korvette, eine Fregatte und sechs Patrouillenboote, die im Winter den Eisgang in der britischen Antarktis überwachten. Die Leiche auf Südgeorgien fiel in ihren Verantwortungsbereich. Der diensthabende Kommodore setzte ein Marineteam und einen Ermittler im Rang eines Leutnants in Marsch. Sie sollten nach den beiden verschollenen Männern suchen, den Schauplatz erkennungsdienstlich erfassen und die weibliche Leiche der Gerichtsmedizin in Port Stanley übergeben.
Ambasar, Indien
Tante Taneja wohnte am Stadtrand, dort, wo vor Jahren fünfstöckige Mietshäuser mit kleinen Balkonen und mächtigen Ventilatoren an den Außenwänden errichtet worden waren. Die Gebäude wurden jedoch nie fertiggestellt. Es gab weder eine Straße noch Hausnummern. Nur die Motorräder vor den Häusern ließen vermuten, dass in diesen Neubau-Ruinen Menschen wohnten. Zusammen mit einigen Nachbarinnen saß Nadis Tante unter einem Regenbaum. Dessen schirmförmige Krone überragte das Gebäude und ließ den kräftigen Stamm kleiner erscheinen. Die Frauen trugen senfgelbe oder rote Saris und nähten von Hand lederne Rohlinge für Mokassins. Weil sie von morgens bis abends vornübergebeugt arbeiteten, schmerzte der Rücken nach wenigen Stunden. Tante Taneja hatten dicke Schwielen an den Händen und zunehmend Mühe, die kleinen vorgestanzten Einstichlöcher zu sehen. Stach sie daneben, trug sie eine Verletzung davon. Oft entzündete sich die Wunde, denn die Chemikalien im Leder lösten allergische Reaktionen aus.
Tante Taneja hatte nach dem Säureattentat nie mehr nach einem Ehemann Ausschau gehalten. In jungen Jahren war es schwer, nicht zu verbittern, aber jetzt war sie über fünfzig, und es war ihr egal,was die Leute dachten. Im Gegenteil, sie schien dieses Gesicht nun als permanente Anklage gegen eine frauenverachtende Kultur zur Schau zu stellen. Es war auch ein Trost, wenn ihre Nachbarinnen sich über ihre faulen Männer beklagten, die nur herumsoffen und laut schnarchten. Deshalb hatte sie sich wohl mit ihrem Schicksal abgefunden und auch akzeptiert, dass ihre Mokassins, die sie für vierzehn Cents zusammennähte, in den Schaufenstern von Berlin, Paris und Rom für hundert Euro angeboten wurden. Zara, Timberland, Esprit, Gabor, Bugatti, Marco Polo, sie alle ließen hier produzieren, und kein Richter hinderte sie daran, lumpige Löhne von gerade mal hundert Rupien am Tag zu bezahlen.
Es tat ihr im Herzen weh, dass sie heute Nadi für immer verlieren und ganz allein zurückbleiben würde, aber der Wunsch, ihrer Nichte ein Leben in Freiheit zu ermöglichen, wog stärker. Sie führte Nadi in ihre Wohnung, ein schmales Zimmer mit Kochnische. Aus einer Blechdose, die sie hinter Gewürzen versteckt hatte, klaubte sie Geldscheine hervor. Nadi tat so, als könne sie das Geld nicht annehmen, aber sie konnte sehr wohl, sie musste sogar, wenn sie dem Kerker der Patriachen entkommen wollte. Draußen fuhr ein Laster vor. Nadi stockte der Atem, aber Taneja beruhigte sie, das seien die Mittler, die neue Rohlinge brachten und die fertigen Mokassins einsammelten, um sie in der Fabrik abzuliefern. Das Motorengeräusch verstummte nicht. Jetzt wurde auch Tante Taneja stutzig. Nadi packte hastig ihre Habseligkeiten zusammen und versprach, Geld zu schicken, sobald sie in London welches verdient habe. Sie beugte sich zu einem Rattenkäfig hinunter und nahm ihre Ratte Yuko eilig, aber zärtlich in den Arm. Dann öffnete sie den Boden des kleinen Zwingers und zog den Plastiksack mit ihrem druckfrischen Reisepass und den ersparten Ruppienscheinen heraus. Yuko war eine Ratte aus dem indonesischen Regenwald. Ursprünglich hatte man sie zur Minensuche ausbilden wollen, aber sie war durch das Examen gefallen, und der Prüfungsexperte hatte vermutet, dass Yuko sich zu sehr auf Menschen fixierte. Wenn Ratten nach einem Jahr Training im freien Gelände zur Prüfung zugelassen wurden, mussten sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielen. Ein einziger Fehler, und sie flogen aus dem Programm. Nadi hatte Yuko deshalb zu sich genommen und ihr kleine Kunststücke beigebracht. Das Tier konnte mittlerweile über gespannte Seile laufen, die indische Flagge hissen, auf einem Mini-Skateboard fahren, Kalenderblätter abreißen und durch Plastikringe springen. Mit Süßigkeiten und dem Knackfrosch aus Blech konnte man Yuko fast alles beibringen. Am liebsten mochte sie Bananenscheiben und die hellen Töne von Nadis Bambusflöte.
Draußen wurde es lauter, man hörte raue Männerstimmen. Sie riefen Nadis Namen. Als die beiden Frauen ins Freie traten, standen ein Dutzend Verwandte im Halbkreis auf dem Vorplatz. Nadi presste Yuko schützend an sich.