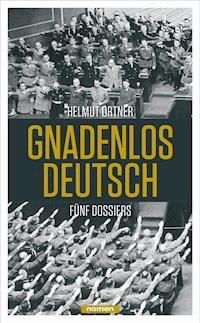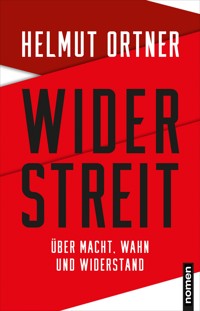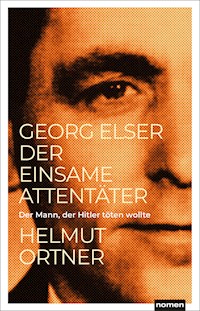
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nomen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 8. November 1939 um 21.20 Uhr explodiert eine Bombe im Münchener Bürgerbräukeller und reißt sieben Menschen in den Tod. Doch der, dem der Anschlag gilt, ist bereits früher als geplant aufgebrochen: Adolf Hitler. Noch am selben Abend wird der Schreinergeselle Georg Elser an der Schweizer Grenze festgenommen. Er hat die Bombe gebaut. Eine jahrelange Odyssee als »besonderer Schutzhäftling« durch Gefängnisse und Konzentrationslager beginnt - sie endet mit seiner Ermordung in Dachau, 20 Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner. Doch wer war der Mann, der Hitler töten wollte? Auf der Basis von umfangreichen Recherchen sowie von Gesprächen mit Zeitzeugen rekonstruiert Helmut Ortner die Lebensgeschichte des Attentäters. Georg Elser war kein Held. Er war ein einfacher, mutiger Mann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helmut Ortner
Der einsame Attentäter
Georg Elser – Der Mann, der Hitler töten wollte
Für Jennifer
Ungekürzte Paperback-Ausgabe der gebundenen Ausgabe von 2013
Copyright © Nomen Verlag, Frankfurt am Main 2022
www.nomen-verlag.de
Umschlaggestaltung: BlazekGrafik, Frankfurt am Main
Druck und Bindung: BookPress.eu, Olsztyn
ISBN 978-3-939816-88-1
eISBN 978-3-939816-89-8
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Erstes Kapitel
Die Verhaftung
Zweites Kapitel
Das Attentat
Drittes Kapitel
Die Verhöre
Viertes Kapitel
Ein Volk, ein Reich, ein Führer
Fünftes Kapitel
Das Geständnis
Sechstes Kapitel
Geheime Gestapo-Sache
Siebentes Kapitel
Königsbronner Jahre
Achtes Kapitel
Aufbruch in die Fremde
Neuntes Kapitel
Rückkehr in ein »deutsches Dorf«
Zehntes Kapitel
Der Entschluß – Der Plan
Elftes Kapitel
Die Nächte im Saal
Zwölftes Kapitel
»Verschärfte Vernehmung«
Dreizehntes Kapitel
Der Tod des Schutzhäftlings E.
Epilog
Georg Elser – Ein Mann ohne Ideologie
ANHANG
Zeittafel
Quellen- und Literaturverzeichnis
Nachwort zur Neuausgabe
Das Leben macht
alle Menschen gleich;
der Tod enthüllt
die Hervorragenden.
GEORGE BERNARD SHAW
Erstes Kapitel
Die Verhaftung
Die Grenze lag in leichtem Nebel. Der Zollbeamte Xaver Reitlinger blickte über die Büsche hinweg zum Maschenzaun, der im Licht der Bogenlampe eigenartig bizarr wirkte. »Wir stellen die Stühle hierher, da können wir den Abschnitt im Aug’ behalten und die Rede gut hören«, meinte Reitlinger und winkte Zapfer herbei, einen jungen Hilfszollangestellten, der ihm vor zwei Tagen zur Seite gestellt worden war. Zapfer rückte die beiden Stühle unter das Fenster. Wortlos setzten sie sich. Ihre Karabiner lehnten sie gegen die Hauswand. Von hier aus konnten sie den gesamten Kontrollabschnitt überblicken: den Garten des Wessenbergschen Kinderheims, zweihundertfünfzig Meter parallel zur Grenze und nicht breiter als fünfzig Meter. Hier gab es keinen Übergang. »Grüne Grenze« nannten die Zöllner den Grenzstreifen.
Seit vier Jahren tat Xaver Reitlinger seinen Dienst. Besondere Vorkommnisse hatte er in dieser Zeit nicht erlebt. Jetzt aber, nach Kriegsbeginn, zog es Deserteure in die Schweiz. Manchmal stellte er sich vor, einen dieser illegalen Grenzgänger festzunehmen. Dann überlegte er, ob dieser Wunsch der zähen Langeweile von stundenlangen Patrouillengängen entsprang oder seinem heimlichen Bedürfnis, es möge doch einmal etwas Unvorhergesehenes, etwas Aufregendes passieren. Vielleicht verbarg sich hinter ihm auch nur der tiefe Wunsch nach Anerkennung. Einmal ein Lob für die Arbeit, wer brauchte das nicht? Wie aber konnte er gelobt werden, wenn an der Grenze nichts passierte? Reitlinger ging immer wieder seinen Träumen nach, wenn er stundenlang am Grenzzaun entlangstreifte, auf die immer gleichen Häuser, Bäume und Hügel schaute. Dann schien es, als sei die Zeit stehengeblieben. Wenn ihm danach war, erzählte er seiner Frau von seinen Gedanken und Träumen. Vor Wochen hatte er ihr beim Frühstück von einem nächtlichen Traum berichtet, der Festnahme eines Mannes. »Mir scheint, du brauchst Abwechslung, sonst wirst du noch phantasieren«, hatte sie kopfschüttelnd zu ihm gesagt.
Nach dem Frühstück war er damals – trotz seines freien Tages – hinüber zum Zollhaus gegangen, um dem Postenführer seinen Traum zu erzählen. »Du solltest mal Nachtwache machen, da passiert mehr als am Tag – wenn was passiert«, riet ihm Trabmann. Danach berichtete der Postenführer, ein untersetzter Mann, dem man seine Fünfzig nicht ansah, wie er selbst vor Jahren mit einem Kollegen zwei illegale Grenzgänger unten am Kreuzlinger Tor gestellt habe. »Die wollten gerade über den Zaun, aber wir waren schneller«, erzählte er stolz. »Doch was haben wir dafür bekommen? Einen warmen Händedruck.« Trabmann lächelte spöttisch.
Gestern, er hatte die Angelegenheit längst vergessen, war Reitlinger in das Büro des Postenführers gerufen worden. Trabmann fragte ihn, ob er noch immer Nachtdienst machen wolle. Ein Kollege sei ausgefallen. Reitlinger hatte sofort zugesagt. In der Früh war er mit Zapfer zum Vormittagsdienst angetreten, von acht bis zwölf. Routinearbeit. Danach hatte er freigehabt bis abends um acht Uhr. Im »Löwen«, gleich neben dem Zollhaus, hatten sie sich eine halbe Stunde vor Dienstbeginn getroffen. Über Politik wurde geredet, darüber, daß die Deutschen Lebensraum brauchten. Der Wirt rief: »Freilich, wie soll sich denn sonst ein so großes Volk wie unseres ernähren?« Der junge Zapfer nickte zustimmend.
Nach dem Essen gingen sie ins Zollhaus und nahmen ihre Karabiner aus dem Regal. Reitlinger ließ sich vom Postenführer noch ein Nachtfernglas aushändigen. Dann brachen sie zu ihrem Postenbereich auf. »Heut abend werden wir keine Langeweile haben, wir werden uns die Bürgerbräu-Rede des Führers anhören«, sagte Reitlinger zu Zapfer, während sie langsam am Grenzzaun entlanggingen. »Ich habe schon mit der Leiterin gesprochen, sie hat es uns angeboten.«
Jetzt saßen sie auf den Stühlen vor dem geöffneten Fenster und schauten hinüber zur Grenzwiese. Dünne Nebelschwaden lagen in der Luft. Im Kinderheim verfolgte das Personal aufmerksam Hitlers Rede aus dem Volksempfänger. An der Wand des kargen Raumes hing ein Bild des Führers. Das Licht brannte. »Wieso darf hier eigentlich Licht brennen?« fragte Zapfer überrascht. Reitlinger, der seinen Kopf in regelmäßigem Intervall nach rechts und links bewegte, nahm sein Fernglas von den Augen: »Heut müssen sie auf der anderen Seite ihr Licht ausmachen. Das wird jeden Abend gewechselt. Des ist wegen dem Feind. Schließlich wollen wir denen des hier in Konstanz nicht zu leicht machen. Des ist Vorschrift. Heut die, morgen wir …« Zapfer war es peinlich, die Frage gestellt zu haben. Als angehender Zollbeamter sollte er darüber Bescheid wissen. Doch Reitlinger war nicht nachtragend, das beruhigte Zapfer.
Aus dem Volksempfänger dröhnte Hitlers markige Stimme: Unser Wille ist genauso unbeugsam im Kampfe nach außen, wie er einst unbeugsam war im Kampfe um diese Macht im Innern. So wie ich Ihnen damals immer sagte: Alles ist denkbar, nur eines nicht, daß wie kapitulieren, so kann ich das als Nationalsozialist auch heute nur der Welt gegenüber wiederholen: Alles ist denkbar, eine deutsche Kapitulation niemals! Wenn man mir darauf erklärt: Dann wird der Krieg drei Jahre dauern, so antworte ich: Er kann dauern, so lange er will, kapitulieren wird Deutschland niemals. Jetzt nicht und in alle Zukunft nicht …
»Niemals!« rief eine Stimme im Raum. Die Zuhörer klopften mit ihren Handflächen auf den Holztisch. Reitlinger und Zapfer machten eher nachdenkliche Gesichter. Keiner von beiden sprach ein Wort. Die Wanduhr zeigte halb neun. Mittlerweile war die Sicht besser geworden. Auf der Schweizer Seite sah man zwei Laternen brennen, deren Lichtkegel bis zum Grenzzaun fielen. Als Reitlinger für einen Moment nach links blickte, glaubte er schemenhaft die Gestalt eines Mannes wahrzunehmen, der sich in Richtung schweizerische Grenze bewegte. War da jemand? Er nahm sein Fernglas: Tatsächlich, der Mann war jetzt stehengeblieben und schaute vorsichtig um sich.
Reitlinger stieß Zapfer mit dem Arm an und reichte ihm das Fernglas: »Schau mal, siehst du den Mann?«
Zapfer hielt es vor seine Augen: »Da müssen wir hin, da ist was faul …«
Reitlinger reagierte unwirsch: »Ich geh’ da hin. Du bleibst hier sitzen.« Das war seine Sache, er trug hier die Verantwortung. Er sprang auf und ging von der Terrasse hinunter in Richtung Birnbaum nahe dem Zaun. Der Mann stand noch immer regungslos, so als würde er Geräuschen lauschen.
Reitlinger schlich sich von hinten an ihn heran. »Hallo!« rief er ihn an. »Wo wollen Sie hin?«
Der Mann drehte sich ruckartig herum. Stotternd antwortete er: »Ich glaub’, ich hab’ mich verlaufen.«
Reitlinger sah ihm ins Gesicht: ein längliches, weiches Gesicht, bartlos, fast scheue Augen. Er trat einen Meter zurück und musterte den Mann. Dieser war von kleiner Gestalt, schmächtig und trug einen Mantel, aber keine Kopfbedeckung. Sein Haar war leicht gewellt und nach hinten gekämmt. Nein, aggressiv wirkte dieser Mann nicht …
Er schien sich rasch von seinem Schrecken zu erholen. Mit ruhiger Stimme betonte er noch einmal, sich verlaufen zu haben: »Ich suche einen Mann mit dem Namen Feuchtlhuber, aber ich weiß es nicht mehr genau.«
Reitlinger war für einen Augenblick verwirrt. Hierher konnte sich kein Mensch versehentlich verlaufen, das mußte schon absichtlich geschehen. Wer läuft im Dunkeln an der Grenze herum? »Ja, Sie können doch nicht hier suchen, hier ist doch niemand«, antwortete er knapp. »Haben Sie Ausweispapiere? Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere.«
Der Mann reagierte sofort und griff in seine linke Rocktasche. Konzentriert blickte Reitlinger auf die Hände des Fremden. Wollte dieser etwa eine Waffe ziehen? Ihn überrumpeln? Er hielt den Atem an. Der Mann zog umständlich eine rote Grenzkarte hervor. Im Schein seiner Taschenlampe sah Reitlinger sofort, daß die Karte längst abgelaufen war – ausgestellt von der Paßstelle des Stadtrates in Konstanz für eine Dauer von zwei Jahren: 1933–1935, ausgestellt auf den Namen Georg Elser.
»Bist du das wirklich?« fragte Reitlinger skeptisch. Das Lichtbild auf der Karte zeigte einen jungen Burschen, der, in einen Trachtenanzug gekleidet, eine Ziehharmonika vor sich hielt.
»Ja, das bin ich«, antwortete der Mann und nickte heftig.
Reitlinger sah hinüber zu Zapfer, der noch immer vor dem Fenster saß und darauf wartete, von ihm ein Zeichen zu bekommen. Er fühlte sich gar nicht wohl in seiner Haut. Einerseits wirkte dieser Mann ganz und gar ungefährlich, ja geradezu schüchtern; andererseits konnte er sich nicht vorstellen, daß es sich bei ihm nur um einen harmlosen Grenzgänger handelte. Hatte er nicht vor Wochen dieses Traumbild gehabt? War es nicht fast identisch mit der jetzigen Situation gewesen? War es darin nicht auch um einen illegalen Grenzgänger gegangen? Handelte es sich hier um eine Vorsehung?
Er wandte sich wieder dem Mann zu: »Kannst du tatsächlich Ziehharmonika spielen?« fragte er mit gespieltem Interesse.
»Ja, das ist meine große Leidenschaft, das mach’ ich sehr gerne«, antwortete der it einem leichten Lachen.
Für Reitlinger war mittlerweile klar: Er mußte diesen Mann, der sich als Georg Elser ausgab, ohne viel Aufhebens zur Aufsichtsstelle bringen. Möglichst ohne Scherereien. Er klopfte ihm beruhigend auf die Schulter: »Das ist eine ganz harmlose Geschichte. Du gehst jetzt mit mir zur Aufsichtsstelle. Dort macht ein älterer Kollege Dienst, der kann dir sicher Auskunft geben über den, den du suchst.« Der schmächtige Mann nickte geistesabwesend. Reitlinger rief zu Zapfer hinüber: »Ich geh’ mit dem zur Aufsichtsstelle vor, du bleibst hier sitzen. Ich komm’ gleich wieder zurück.« Zapfer winkte bestätigend. Ihm war es recht, so konnte er die Rede des Führers weiter verfolgen.
Reitlinger forderte den Mann auf, rechts von ihm zu gehen, nicht ohne Überlegung. Zum Zollhaus in der Kreuzlinger Straße waren es gut hundertfünfzig Meter. Parallel zum schmalen Pfad verlief links – kaum dreißig Fuß entfernt – die Grenze; auf der rechten Seite reihten sich Gärten aneinander, die mit Holzzäunen eingegrenzt waren. Nach rechts gab es also kein Entkommen, und auch eine Flucht zurück war unmöglich. Nicht umsonst hatte er Zapfer angewiesen, auf seinem Posten zu bleiben. Der Mann würde Zapfer direkt in die Arme laufen. Trotzdem war Reitlinger erleichtert, als er am Zollhaus ankam. Grenzpolizist Mauer, ein drahtiger Gestapo-Mann, der in dieser Nacht Dienst tat, trat gerade aus dem Haus, um frische Luft zu schnappen.
»Du, Mauer, komm mal her!« rief Reitlinger ihn an. »Da ist ein Mann, der sucht einen mit Namen Feuchtlhuber. Er hat sich unten an der Grenze verlaufen. Kennst du einen Feuchtlhuber?«
Mißgelaunt wies Mauer zur Tür. »Das machen wir drinnen.«
Das Zollgebäude war ein zweistöckiger maroder Bau. Im ersten Stock wohnte Zollinspektor Strauber, den Reitlinger nicht mochte. Er fand ihn einfach unsympathisch, ein Angeber, ein Aufschneider; was ihn weiter nicht zu stören brauchte, denn dienstlich hatte er kaum mit ihm zu tun. Das Haus hatte zwei Eingänge: einen für die Privatwohnung von Strauber im ersten Stock, einen weiteren für die Zolldurchsuchungsbüros, zwei karge, nüchterne Räume. Tisch, Telefon, Stühle, Regale. Das Bild des Führers an der Wand.
Reitlinger zeigte Mauer die rote Grenzkarte: »Den solltest du noch mal durchsuchen. Ich muß wieder vor zum Postenbereich.«
Mauer blickte ihn verärgert an. »Mach dir deinen Dreck selber fertig! Was interessiert mich dieser Mann und sein Feuchtlhuber oder wie der heißt …« Dabei gab er dem Mann mißgelaunt seine Grenzkarte zurück.
Reitlinger zuckte mit den Schultern. »Das ist doch nicht mein Bier. Ich hab’ den Mann hierher gebracht, jetzt seid ihr dran …«
»Wir gehen hinüber ins Hauptzollamt, dort sind die Räume heller. Hier sieht man ja nichts«, brummte Mauer und zeigte auf die Deckenlampe, die den Raum nur spärlich erleuchtete. Zu dritt verließen sie das Haus. Reitlinger ging voraus, ihm folgte der im Vergleich zu seinen Bewachern recht klein wirkende Mann, der in den vergangenen Minuten kein Wort mehr gesagt hatte, dahinter lief Mauer.
Das Gebäude, in dem sich das Hauptzollamt befand, war das letzte Haus auf deutschem Boden. In die Schweiz waren es nicht einmal fünfzehn Meter. Es gab keinen Schlagbaum; oft standen die Schweizer Zöllner vor ihrem Zollhaus und schauten herüber. Früher war viel miteinander geredet worden, in kalten Winternächten bot man einander warmen Tee und Zigaretten an. Sie waren Kollegen. Doch in den letzten Jahren gab es kaum mehr Kontakte, und seit Ausbruch des Krieges wurde kein Wort mehr gewechselt. Stumm standen sich die Beamten gegenüber.
Auch jetzt, als Reitlinger und Mauer den Mann aufforderten, in das Zollamt zu gehen, wurden sie von den Schweizer Kollegen stumm beobachtet. »Geh da rein!« befahl Reitlinger. Der Mann stand wortlos vor den Stufen und blickte hinüber zur Schweizer Seite. Wollte er flüchten? Mit ein paar schnellen Sprüngen könnte er es schaffen. Reitlinger schob ihn einfach durch die Tür. Dann bat er Mauer, für einen Augenblick auf den Mann aufzupassen, und verständigte den Postenführer, der im Nebenraum sein Büro hatte und gerade die Hitler-Rede am Volksempfänger verfolgte.
»Trabmann, ich glaube, ich hab’ einen guten Fang gemacht. Komm mal mit rüber, wir müssen da einen durchsuchen«, platzte Reitlinger mit einem Anflug von Stolz in das Büro. Beide mußten lachen. Sie erinnerten sich an ihr Gespräch, das Wochen zurücklag. An die Traumbilder …
»Na, dann wollen wir mal …«, antwortete Trabmann, erhob sich von seinem Stuhl und ging voraus zum Durchsuchungszimmer.
Da stand der Mann. Er blickte schüchtern in die Runde: Drei Uniformierte starrten ihn an – Mauer, Trabmann, Reitlinger.
Trabmann trat auf ihn zu. »So, jetzt zieh dich erst einmal bis aufs Hemd aus und leg raus, was in den Taschen ist.«
Zögernd leerte der Mann seine Taschen und legte die Gegenstände Stück für Stück auf den Tisch: ein Taschentuch, die Grenzkarte, eine Ansichtskarte vom Münchener Bürgerbräukeller mit NSDAP-Stempel, eine Geldbörse mit fünf Reichsmark sowie allerlei Messingteile: eine Uhrfeder, kleine Schrauben und ein Aluminiumröhrchen.
»Was ist das?« fragte Reitlinger und deutete auf die Utensilien.
»Mein Gott«, erklärte der Mann stockend, »ich bin ein Bastler. Ich mach’ halt immer solche Sachen, da sammle ich allerlei …«
Wütend schrie Trabmann dazwischen: »Du, daß ich dir nicht gleich eine schmiere! Meinst du, ich kenne das nicht?«
Der Mann verstummte. Langsam begann er sich auszuziehen. Er trug einen hellen, leicht abgenutzten Anzug. Als er seine Jacke an den Türhaken hängen wollte, entdeckte Reitlinger unter dem Revers eine Anstecknadel – eine geballte Faust: das Zeichen des Rotfrontkämpfer-Bundes.
»Warum trägst du das Abzeichen?« fragte Trabmann.
»Nun ja, aus Blödsinn halt«, kam die Antwort kleinlaut.
»Und warum hast du eine Bürgerbräu-Karte mit dem Partei-Poststempel dabei?«
»Aus Sympathie!«
Reitlinger, Trabmann und Mauer sahen sich kopfschüttelnd an. Was war das für ein Bursche? Verläuft sich im Dunkeln an der Grenze, trägt eine abgelaufene Grenzkarte bei sich, hat auffällige Kleinteile in der Tasche, die sich als Bombenzünder eignen, heftet sich ein illegales kommunistisches Abzeichen an seine Jacke. Ein Verrückter? Ein Angeber? Oder tatsächlich ein harmloser Mann, der sich hier unten an der Grenze nur verlaufen hatte?
Trabmann ging zum Telefon hinüber und wählte die Nummer des Zollassistenten Obertz. »Rufen Sie die Gestapo an. Die sollen hier einen Mann abholen, das ist deren Angelegenheit. Und packen Sie die Gegenstände auf dem Tisch hier unten zusammen«, befahl er knapp. Dann verließ er mit Mauer das Durchsuchungszimmer.
Reitlinger ging in den angrenzenden Raum zurück, wo er kurz nach der Ankunft seinen Lodenumhang, den Karabiner und das Fernglas abgelegt hatte. Während er sich wieder dienstfähig machte, schaute er durch den Türspalt hinüber in das andere Zimmer. Da stand der Mann, den er eine knappe Stunde zuvor in den Grenzwiesen gestellt hatte. Da stand er, entkleidet bis auf die Unterwäsche, frierend, schüchtern. Er wirkte verloren. Für einen kurzen Augenblick trafen sich ihre Blicke.
Reitlinger verließ das Zollgebäude. Im Dunkeln ging er zurück zu seinem Postenbereich, wo Zapfer schon auf ihn wartete.
Wer, ging es ihm durch den Kopf, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Georg Elser?
Zweites Kapitel
Das Attentat
Im Münchener Bürgerbräukeller ertönt der Badenweiler Marsch. Jubel bricht aus, orkanartig stoßen dreitausend uniformierte Männer Heil-Rufe aus. Die Stimmung erreicht ihren Siedepunkt. Schon seit zwei Stunden sind Saal und Empore dicht gefüllt. Die Kellnerinnen haben alle Mühe, die gefüllten Maßkrüge zu den durstigen Kehlen zu bringen. Jetzt, um zwanzig Uhr, überschlägt sich der Lärm. Der Führer ist da.
München, 8. November 1939: In der »Hauptstadt der Bewegung« trifft sich Hitler, wie schon in den Jahren zuvor, mit seinen »alten Kämpfern«, um jener sechzehn »Märtyrer« zu gedenken, die am 9. November 1923 für seine verfrühte nationale Revolution starben. Seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten gehört dieser »Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung« zu den besonders wichtigen Daten des NS-Feierjahres.
Am 8. und 9. November 1933, zehn Jahre nach dem gescheiterten Putsch, feierte Hitler zum ersten Mal im Kreise seiner Getreuen die Erinnerung an die Toten von 1923. Damals hatte er seine Rede mit dem Hinweis begonnen, er habe zehn Jahre zuvor im Auftrag höherer Gewalt gehandelt, um die Schande des November 1918 zu beseitigen. Den 9. November vom Odium der gescheiterten Revolution zu befreien und ihm die Aura einer »nationalen Tat« zu verleihen, war seither zum Leitmotiv aller seiner November-Reden im Bürgerbräukeller geworden. Dazu paßten auch Hitlers propagandistische Absichten, die er in seiner Rede von 1936 preisgab: Ich will aus diesen Toten die ersten Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung machen, sechzehn Menschen, die gefallen sind im Glauben an etwas ganz Neues, das zehn Jahre später erst Wirklichkeitwurde. Sechzehn Menschen, die unter einer ganz neuen Fahne marschierten, auf die sie den Eid leisteten und ihn mit ihrem Blut besiegelten. Diese sechzehn haben das größte Opfer gebracht und verdienen es, daß für alle Zeiten, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, die nationalsozialistische Partei und damit ganz Deutschland an diesem Tag dieses Opfer immer feiern sollen und daß sie sich so immer wieder dieser Männer erinnern.
Was aber geschah damals am 8. und 9. November 1923? An welche Ereignisse sollte sich ganz Deutschland erinnern? Welche Erinnerungen trieben diese »alten Kämpfer« zusammen, die jetzt, am Abend des 8. November 1939, in ihren Braunhemden dicht gedrängt im Saal darauf warten, daß ihr Führer das alljährliche Feier-Ritual mit seiner Rede eröffnet? Schließlich: Was hatte dieser Saal, der sich hinter der anspruchslosen Fassade des Bürgerbräukellers im Münchener Arbeiterbezirk Haidhausen verbarg, mit den Ereignissen von damals zu tun? Was machte ihn zur Kultstätte?
Januar 1923: Als französische und belgische Truppen in das Deutsche Reich einmarschierten und das Ruhrgebiet besetzten, empörten sich vor allem die nationalen Kräfte, deren politische Identität durch die Folgen des Versailler Vertrages ohnehin tief getroffen worden war. Immense Reparationsforderungen durch die Siegermächte des Ersten Weltkrieges hatten zu Inflation und Massenarbeitslosigkeit geführt. Davon war vor allem die Arbeiterschaft betroffen, deren soziale Lage sich von Tag zu Tag verschlechterte. In diesen Zeiten wirtschaftlicher, sozialer und politischer Instabilität formierten sich antirepublikanische Gruppen und Verbände: von der Weimarer Verfassung nicht begeistert, gegen die Sozialdemokraten eingestellt, vor allem aber von der Vorstellung getrieben, Deutschland müsse seine »Wehrhaftigkeit« wiedergewinnen, eine »ehrenhafte« Außenpolitik entwickeln und seine Staatsautorität durch eine starke Regierung, unterstützt durch die Reichswehr, wiederherstellen.
In Bayern hatte die Regierung am 26. September 1923 den Ausnahmezustand ausgerufen und den Regierungspräsidenten Gustav von Kahr in den Rang eines Generalstaatskommissars erhoben. Kahr, der sich als deutscher Patriot sah und dessen politische Ambitionen längst über die Grenzen Bayerns hinausgingen, wartete nur darauf, daß das fortschreitende Chaos auch die Mitwirkung der Reichswehr im fernen Berlin für seine Pläne sicherstellen würde. Kontakte und Geheimtreffen mit national-konservativen Kräften waren vorangegangen. Die drei starken Männer in Bayern – neben von Kahr der Reichswehrgeneral von Lossow und der Befehlshaber der Landespolizei, Hans Ritter von Seisser – waren sich einig, die »Freiheit Bayerns« verteidigen und das deutsche Vaterland von der verräterischen republikanischen Regierung befreien zu wollen.
Sie waren nicht allein. Ihnen standen bewaffnete Verbände zur Verfügung, die, wenn sich ihnen Teile der Reichswehr anschlössen, eine erfolgreiche, geordnete und, wie sie meinten, längst überfällige Revolution – von Bayern ausgehend – durchführen könnten.
So dachten auch die Kräfte um Hitler, Göring und Röhm, die sich im nationalsozialistischen Lager sowie im rechtsradikalen »Kampfbund« gesammelt hatten und die ebenfalls einen Umsturz planten. Um sich das Gesetz des Handelns nicht aus der Hand nehmen zu lassen, waren Hitler und seine Anhänger fest entschlossen, von Kahr und seinen Mitstreitern zuvorzukommen. Als günstiger Termin erschien ihnen der 8. November 1923. An diesem Tag wollte Kahr auf einer Großkundgebung der »nationalen« Verbände im Haidhauser Bürgerbräukeller die Ziele seiner Politik erläutern. Er hatte das Datum mit Bedacht gewählt: Fünf Jahre zuvor, am 8. November 1918, war der deutsche Kaiser zum Thronverzicht aufgerufen worden, einen Tag später hatte der Sozialdemokrat Scheidemann die Republik ausgerufen – aus Sicht der Nationalisten ein Punkt der tiefsten Schmach in der deutschen Geschichte.
Hitler und seine Gefolgsleute hatten den Putsch sorgsam vorbereitet. Aus geheimen Waffenlagern in der Umgebung von München waren Pistolen, Gewehre und Handgranaten herbeigeschafft worden, um die beteiligten Truppen zu bewaffnen. Zum Putsch entschlossen war keine kleine Truppe von Rechtsradikalen, sondern eine Vielzahl von Verbänden, Einheiten und Kompanien, die sich für die bevorstehenden Kampfhandlungen bereithielten: 1500 Mann des SA-Regiments München, dessen Führer Röhm unter dem Vorwand, er wolle mit seinen Leuten eine Nachtübung abhalten, sich zuvor die notwendigen Waffen ganz offiziell beschafft hatte; hinzu kamen 12 5 Manndes »Stoßtrupps Hitler«, die ebenfalls zur SA gehörten, 300 Mann aus südbayerischen SA-Einheiten und 2000 Kämpfer des »Bundes Oberland«, des ehemaligen Freikorps »Oberland«. Zwei Infanterieeinheiten stellte der Verband »Reichskriegsflagge«; weitere 200 Getreue des »Kampfbundes München« hielten sich ebenfalls bereit.
Um den Eindruck zu vermeiden, Generalstaatskommissar von Kahr fürchte sich vor Münchener Bürgern, hatten die Veranstalter zur Sicherung der Bürgerbräukeller-Veranstaltung nur die notwendigsten Sicherungsmaßnahmen getroffen. Die beiden nahe gelegenen Polizeireviere wurden zum Schutz der Versammlung um jeweils dreizehn Mann verstärkt. In einer nur 500 Meter vom Bürgerbräu entfernt gelegenen Kaserne wurden weitere 45 Polizisten bereitgehalten. Um für Ruhe und Ordnung vor dem Veranstaltungsort zu sorgen, waren dreißig Beamte der Münchener Hauptwache eingesetzt. Etwa 150 Mann wurden zum Versammlungsschutz innerhalb des Saales aufgeboten, unterstützt von zwölf Kriminalbeamten, die im Saal und auf der Galerie Stellung bezogen. Viele der zum Schutz aufgebotenen Polizisten waren selbst Nationalsozialisten.
Während Kahr gerade mit seiner Rede begann, in der er eine flammende Kritik an der Novemberrevolution von 1918 äußern wollte, näherte sich Hitler mit seinen Getreuen in einem roten Mercedes dem Bürgerbräukeller. Kurz vor zwanzig Uhr trafen sie dort ein, und Hitler gab den dienstleitenden Polizisten den Befehl, den Platz vor dem Bierkeller von nicht mehr eingelassenen Besuchern zu räumen. Obwohl Hitler über keinerlei Befehlsgewalt verfügte, begannen die Beamten tatsächlich damit, die Menge in die angrenzenden Seitenstraßen abzudrängen. Danach trafen die Verbände des »Stoßtrupps Adolf Hitler« auf mehreren Lastwagen ein. Der Bürgerbräukeller wurde von ihnen umstellt und abgeriegelt. Jetzt begann Hitlers großer Auftritt. Umgeben von einer Gruppe bewaffneter Kampfgenossen, darunter Rudolf Heß und Hermann Göring, betrat er, mit einem geladenen Revolver in der Hand, den überfüllten Saal. Unruhe brach aus, zahlreiche Besucher versuchten, durch Seiteneingänge den Saal noch schnell zu verlassen. Vergeblich: Die Putschisten hatten alle Eingänge gesperrt und davor Maschinengewehre in Stellung gebracht.
Um sich Ruhe zu verschaffen, gab der in einen schwarzen Bratenrock gekleidete Hitler einen Schuß aus dem Revolver in die Saaldecke ab. Dann stürmte er durch die Tischreihen zum Rednerpodium, stieß von Kahr zur Seite und schrie: Soeben ist die nationale Revolution ausgebrochen! Der Saal ist von sechshundert Schwerbewaffneten besetzt. Niemand darf den Saal verlassen! … Die Kasernen der Reichswehr und der Landespolizei sind besetzt, Reichswehr und Landespolizei rücken bereits unter Hakenkreuzfahnen heran.
Davon konnte keine Rede sein. Weder waren die Kasernen der Reichswehr und Landespolizei besetzt, noch rückten Soldaten und Polizisten unter Hakenkreuzfahnen in Richtung Bürgerbräukeller heran. Es war die erste Rede Hitlers im Bürgerbräukeller an jenem Abend, und nachdem er sie gehalten hatte, forderte er Lossow, Kahr und Seisser auf, ihm in ein Nebenzimmer zu folgen. Da Hitler bewaffnet und offensichtlich auch zu schießen bereit war, hörten sie ihm wenig erbaut etwa eine Viertelstunde zu. Ultimativ erklärte Hitler: Jeder hat den Platz einzunehmen, auf den er gestellt wird, tut er das nicht, so hat er keine Daseinsberechtigung. Sie müssen mit mir kämpfen, mit mir siegen oder mit mir sterben. Wenn die Sache schiefgeht, vier Schüsse habe ich in der Pistole, drei für meine Mitarbeiter, wenn sie mich verlassen, die letzte Kugel für mich! Neben Hitler stand sein stämmiger Leibwächter Ulrich Graf, von Beruf Fleischer in der Münchener Freibank, mit einer Maschinenpistole im Anschlag. Vor dem Fenster des Nebenzimmers patrouillierten Verbände der SA.
Draußen im Saal war es inzwischen stiller geworden. Göring hatte die Menge beruhigt: Ruhe, Ruhe, Sie haben ja Ihr Bier! rief er immer wieder. Aufgeregt und eingeschüchtert zugleich warteten die Besucher darauf, was geschehen würde. Plötzlich erschien auf dem Podium wieder Hitler, der aufgrund der stockenden Verhandlungen mit Kahr, Lossow und Seisser das Nebenzimmer wieder verlassen hatte. Wenn es jetzt keine Ruhe gibt, lasse ich ein Maschinengewehr auf der Galerie aufstellen! schrie er in den Saal. Dann begann er mit einer weiteren Rede, um die gegen den Putsch eingestimmte Menge auf seine Seite zu ziehen. Ein Augenzeuge schilderte später diese Minuten: Er begann völlig ruhig und ohne jedes Pathos. Was geschehe, richte sich in keiner Weise gegen Kahr. Dieser habe sein volles Vertrauen und solle Landesverweser Bayerns werden. Gleichzeitig abermüsse eine neue Regierung gebildet werden: Ludendorff, Lossow, Seisser und er. Ich kann mich nicht erinnern, je in meinem Leben einen solchen Umschwung der Massenstimmung in wenigen Minuten, fast Sekunden erlebt zu haben …
Hitler erklärte, die Regierung sei aufgelöst. Am selben Tag noch werde in München eine neue Reichsregierung ausgerufen, und bis zur Abrechnung mit den Verbrechern, die Deutschland in die Auflösung führten, wolle er die Führung der provisorischen Regierung übernehmen, in der Ludendorff Chef der Reichswehr, Lossow Reichswehrminister und Seisser Reichspolizeiminister sein sollten. Aufgabe der provisorischen Regierung sei es, alle Kräfte Bayerns und des übrigen Reichs zu sammeln, ins »Sündenbabel« Berlin zu marschieren und das deutsche Volk zu retten. Hitler gab zu, es sei ihm nicht leichtgefallen, Kahr, Lossow und Seisser zum Eintritt in die neue Regierung zu bewegen, aber sie hätten schließlich zugesagt, und er fragte die Leute im Saal, ob sie diese Lösung der deutschen Frage billigten. Die Menge brüllte ihm ihre Zustimmung zu.
Auch General Ludendorff applaudierte. Er, der zur Vermeidung unangenehmer Begegnungen mit Verspätung in den Bierkeller gekommen war und jetzt in voller Uniform und mit allen Orden geschmückt auftrat, hatte sicherlich nicht im Sinn, neben dem Gefreiten Adolf Hitler eine zweitrangige Rolle zu spielen. Trotzdem erklärte er, er stehe der nationalen Regierung zur Verfügung. Er wolle der schwarz-weiß-roten Kokarde die Ehre wiedergeben, die die Revolution ihr genommen habe. Dies sei ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte, und er vertraue auf Gottes Segen für das Unternehmen. Danach erhob sich Kahr, der inzwischen mit Lossow und Seisser in den Saal hatte zurückkehren dürfen, und ging zum Rednerpult. In diesem Augenblick höchster Not sei er bereit, die Leitung der bayerischen Staatsgeschäfte als Statthalter der Monarchie zu übernehmen, die vor fünf Jahren so schmählich zerschlagen worden sei. Er tue das schweren Herzens und, wie ich hoffe, zum Segen unserer bayerischen Heimat und unseres lieben deutschen Vaterlandes.
Beifallsrufe, Applaus. Die Begeisterung ergriff die Menge. Alle stimmten in das abschließende Deutschlandlied ein.
Überzeugt davon, daß der Umsturz gelungen sei, wurde umgehend folgende Proklamation veröffentlicht: An das deutsche Volk! Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seisser.
Hitler verließ danach siegestrunken mit seinen Leuten den Saal. Das Kommando vor Ort übernahm fortan General Ludendorff, und er ließ zum späteren Ärger der Nazi-Putschisten die drei Erpreßten gegen ihr Ehrenwort auf freien Fuß.
Kaum hatte Kahr sich freimachen können, eilte er zusammen mit dem Chef der bayerischen Reichswehr, Lossow, in die Kaserne des Infanterie-Regiments 19. Hier widerriefen sie die erzwungene Teilnahme am Hitler-Putsch noch in derselben Nacht. Die Münchener Reichswehr-Garnison wurde gegen die Umstürzler mobilisiert, die NSDAP verboten. Der nächste Morgen würde die Entscheidung bringen: Kahr oder Hitler?
Kahr ließ in der Nacht Plakate drucken und in ganz München ankleben, auf denen er Hitler Wortbruch vorwarf und die Auflösung der Nationalsozialisten sowie der Bünde »Oberland« und »Reichskriegsflagge« erklärte.
Am Morgen des 9. November 1923 sammelten sich Kolonnen der SA und Mitglieder des Kampfbundes einschließlich des »Bundes Oberland«, stärkemäßig der Polizei weit überlegen, am Bürgerbräukeller. Gegen sie standen die Polizeieinheiten der Stadt, des Landes und notfalls der Reichswehr. Die Putschisten hatten mit einer darartig massiven Gegenwehr nicht gerechnet. Je deutlicher sich ihre Niederlage abzeichnete, desto verzweifelter wurden ihre Aktionen. So wurden auf Befehl Görings »Marxisten« unter den Münchener Stadträten als Geiseln genommen, ohne zu wissen, was mit ihnen eigentlich geschehen sollte. Als »strategische Maßnahmen« wurden an verschiedenen Standorten der Innenstadt Geschützstellungen errichtet. Gleichzeitig wurde versucht, die wichtigsten militärischen und politischen Einrichtungen der Stadt unter Kontrolle zu bringen. Außer beim Wehrkreiskommando scheiterten die Putschisten kläglich. Weder das Polizeipräsidium noch die Regierungsräume in der Maximilianstraße konnten besetzt werden.
Beispielhaft für die Konzeptionslosigkeit der Nationalsozialisten war die Zerstörung der sozialdemokratischen »Münchener Post«. Auf ausdrücklichen Befehl Görings waren die Verlagsräumlichkeiten besetzt, die Redaktionsbüros verwüstet, Maschinen und Material zerstört worden. Als alles in Scherben lag, kam der »Befehl« Hitlers, die Redaktionsräume zu erhalten. Er hatte vorgesehen, Druckerei und Verlag der nationalsozialistischen Zeitung »Heimatland« zu übereignen. Zu spät.
Die Lage wurde für die Putschisten immer aussichtsloser. Es mußte etwas geschehen. Noch einmal sollte versucht werden, das Ruder herumzureißen. Um die nationale Revolution doch noch zu erkämpfen, beschlossen sie einen Marsch durch die Innenstadt. Ziel: die Feldherrnhalle. In drei Kolonnen zu vier Reihen nahmen die Putschisten Aufstellung. Insgesamt füllte der zwölf Mann breite Zug die gesamte Straße – links der »Stoßtrupp Hitler«, in der Mitte das SA-Regiment München und rechts der »Bund Oberland«. An der Spitze marschierten der Führer und Ludendorff, vor ihnen eine Schützendivision und zwei Reihen von Fahnenträgern.
Zunächst gelang es den Nazis, die erste Kette der Landespolizei an der Ludwigsbrücke zu durchbrechen. An der Feldherrnhalle jedoch beendete eine Salve der Polizei den voreiligen »Marsch auf die Feldherrnhalle«. Ein Augenzeuge erinnerte sich: Ein Geknatter von Dutzenden von Schüssen bricht los, schlägt in die Reihen, fetzt den Zug auseinander. Eine unbeschreibliche Panik folgt in den dicht gedrängten Massen, die nun auseinanderbersten, wie wenn eine Riesenhand dazwischengefahren wäre. Frauen kreischen auf, Männer brüllen, Dutzende haben sich auf den Boden geworfen, um den hereinfetzenden Geschossen auszuweichen, Dutzende, Hunderte drängen zurück aus dem Bereich des verheerenden Feuers.
Sechzehn Nationalsozialisten sollten ihren »Marsch« schließlich mit dem Leben bezahlen. Die Putschisten-Führer selbst kamen glimpflich davon: Hitler renkte sich die Schulter aus, als er entweder hinfiel oder aufs Pflaster gerissen wurde. Göring wurde verwundet, in ein Münchener Krankenhaus gebracht und danach von Parteigängern über die Grenze nach Österreich geschmuggelt.
Der Putsch war gescheitert. Was als Zündpunkt der nationalen Revolte propagiert worden war, hatte sich zu einem kurzen Wahn verflüchtigt. Doch das Feuer sprühte noch bedrohliche Funken. Als Polizeieinheiten am Abend des 9. November vor dem Bürgerbräukeller vorfuhren, um die gefangengesetzten Geiseln zu befreien, wurden sie von der aufgebrachten Bevölkerung beschimpft: »Pfui! Vaterlandsverräter! Bluthunde! Heil Hitler!«
Zwei Tage später erschien die Polizei am Staffelsee im Landhaus des Hitler-Spezis Ernst Hanfstaengl, um den geflüchteten Führer zu verhaften. Kurz vor dem Eintreffen der Polizisten griff Hitler zur Pistole und schrie: Dasistdas Ende. Mich von diesen Schweinen verhaften zu lassen, niemals! Lieber tot! Hanfstaengls Frau schlug ihm die Waffe aus der Hand. Hitlers Ende war verhindert worden, doch die Funken, die dieser Mann geschlagen hatte, waren nicht gelöscht.
Am 8. und 9. November 1933 gedachten die mittlerweile an die Macht gekommenen Nationalsozialisten erstmals ihrer gefallenen »Märtyrer« von 1923. Sie trafen sich an jenem historischen Ort, wo sie einst die »nationale Revolution« ausgerufen hatten, die nun, zehn Jahre später, Wirklichkeit geworden war: im Münchener Bürgerbräukeller. Die Feierlichkeiten begannen am 8. November mit Propaganda-Veranstaltungen in der Münchener Innenstadt, gipfelten in einer zweistündigen Rede Hitlers vor den »alten Kämpfern« im Bürgerbräukeller und wurden mit einem Erinnerungsmarsch zur Feldherrnhalle und der Vereidigung von SS-Rekruten gekrönt. Den »historischen Marsch« vom Haidhäuser Bürgerbräu über die Ludwigsbrücke zur Feldherrnhalle schilderte ein Augenzeuge von 1933: Es war zweifellos eine eindrucksvolle Demonstration, die ernsten Männerim Braunhemd, die schweigende Menge und die brennenden Pylonen an den Straßenfronten, dazu das trübe Novemberwetter. Das Glockenspiel des Rathauses spielte, als der Zug den Marienplatz erreichte, das Horst-Wessel-Lied. Salutschüsse kündigten das Eintreffen der Spitze an der Feldherrnhalle an. Eine Minute des Schweigens folgte.
An diesem Abend wurde an der seitlichen Bogenöffnung der Feldherrnhalle feierlich ein Bronzedenkmal enthüllt. Hitler forderte von den Rekruten, ihr Leben ebenfalls der »nationalen Revolution« zu opfern, so wie die sechzehn, die hier an dieser Stelle gefallen sind. Für euch darf es nichts anderes geben im Leben als die Treue … Diese Toten sind euer Vorbild …
Seit dieser ersten Gedenkfeier waren die Rituale festgelegt. Die NS-Führer und ihre »alten Kämpfer von 1923«, die sich nun alljährlich im Bürgerbräukeller trafen, inszenierten eine Jubelveranstaltung, die vor allem der Umdeutung des Fiaskos von 1923 in einen patriotischen Akt diente. Der Ausgang des Prozesses, der ihnen damals nach dem Putschversuch gemacht worden war, half ihnen bei dieser Geschichtsfälschung. Die meisten kamen als »Mitläufer« und »Befehlsempfänger« ungeschoren davon, die Anführer erhielten milde Urteile. Hilfreich war dabei, daß die Richter ganz offen mit den Putschisten sympathisierten. Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, die Untersuchungshaft angerechnet. Und auch die fünf Jahre mußte er nicht verbüßen. Nach nur einem knappen Jahr befand er sich wieder auf freiem Fuß. Sein Kampf konnte erneut beginnen. Das Feuer konnte wieder entfacht werden.
Hitler hatte seine Kampfgenossen von damals nicht vergessen, vor allem nicht die Toten. Sie wurden zu »Blutzeugen der Bewegung« stilisiert und zu »Märtyrern« erklärt. Den Weggefährten von einst blieb der »Blutsorden« vorbehalten, den ihnen der Führer 1934 an die rechte Brustseite knöpfte. Den trugen sie seither voller Stolz. Auch an diesem 8. November 1939.
Das blutrote Band, am Knopf der rechten Brusttasche befestigt, hebt sich unübersehbar von den braunen Hemden ab; daran eine mattsilberne Medaille, die das Profil eines auf einem Eichenkranz sitzenden Adlers zeigt. Darauf steht: 9. November – München 1923. Auf der Rückseite ist die Feldherrnhalle eingraviert, darüber das Hakenkreuz auf Sonnenstrahlen und im Bogen die Worte: Ihr habt doch gesiegt.
Ja, wir haben gesiegt. Wir waren dabei, als die »nationale Erhebung« in diesem Saal begann; wir haben unsere patriotische Pflicht erfüllt. So denken sie, die Männer, die stolz ihre Orden an der Brust tragen. Wie in all den Jahren zuvor ist es »ihre« Feier, ihr Abend.
Als der Führer, gefolgt von der NS-Prominenz, zum Podium schreitet, wo vor einer großen Hakenkreuzfahne die Mikrophone aufgebaut sind, bricht enthusiastischer Jubel aus. »Heil, Heil! …« schallt es durch den Saal. In den Gesichtern spiegeln sich Begeisterung, Stolz, ja Ehrfurcht. Alle sind sie versammelt: dicht vor dem Führer die NS-Prominenz, dahinter die »alten Kämpfer« und die Hinterbliebenen der sechzehn »Gefallenen des 9. November«, die Reichs- und Gauleiter, die Obergruppenführer und Gruppenführer der SA und SS, die Arbeitsgauführer und sonstige Parteimitglieder. Der Saal platzt aus allen Nähten.
Der Führer spricht – das Volk lauscht. Nicht nur das Parteivolk hier im Saal. Im gesamten Reich sitzen die Menschen vor den Volksempfängern und verfolgen die Rede. Bemerkenswert an diesem Abend ist, daß Hitler die übliche »Partei-Erzählung« auf wenige Passagen beschränkt und daß sich seine Rede statt dessen vor allem in einer einzigen Schimpf- und Hetzkanonade gegen England erschöpft. Unter frenetischem Beifall weist er England die Schuld am Kriegsausbruch zu:
Diejenigen Kräfte, die 1914 gegen uns standen, haben auch jetzt wieder den Krieg gegen Deutschland angezettelt – und mit den gleichen Phrasen und mit den gleichen Lügen …
Wenn Lord Halifax in seiner gestrigen Rede erklärte, daß er für die Künste und die Kultur eintritt … so können wir nur sagen: Deutschland hat schon eine Kultur gehabt, als die Halifaxe davon noch gar keine Ahnung hatten. Und in den letzten sechs Jahren ist in Deutschland mehr für die Kultur getan worden als in den letzten einhundert Jahren in England …