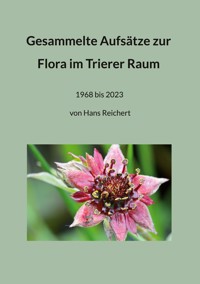
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch vereint 54 Aufsätze von Dr. Hans Reichert, die in den Jahrbüchern Trier-Saarburg (JTS) von 1968 bis 2023 erschienen sind.
Das E-Book Gesammelte Aufsätze zur Flora im Trierer Raum wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Botanik, Hans Reichert, NABU Trier, Pflanzenbestimmung, Biotope
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Eine Kuriosität am Wegesrand - weißes Weidenröschen, 1969
Eine Brennessel wird „erwürgt“ – die Nesselseide, 1973
Der grüne Knollenblätterpilz, 1973
Die Mistel, 1981
Löwenzahn, 2023
Gefährdete Pflanzenarten im Trierer Land, Teil 1
Der Lochschlund, 1983
Der Efeublättrige Hahnenfuß, 1990
Die Kornrade, 1991
Der Rundblättrige Sonnentau, 1992
Zwei seltene Dickblattgewächse, 1993: Rötliches Dickblatt und Zierlicher Mauerpfeffer
Eine 100 Jahre lang verschollene Wildrose wiedergefunden, 1994: Die Essigrose
Vier Zwerge unter den botanischen Raritäten unserer Heimat, 1995: Streifenklee, Platterbsen-Wicke, Frühe Haferschmiele und Weißmiere
Gefährdete Pflanzenarten im Trierer Land, Teil 2
Orchideen – Die Ragwurz-Arten, 1984
Vier Orchideenarten als Vorposten südländischer Flora, 1985
Orchideen auf saurem und kalkarmem Boden, 1986
Die Knabenkräuter, 1987
Die Orchideengattung Epipactis, 1988
Die Orchideengattung Waldvöglein, 1989
Farnpflanzen unserer Heimat
Adler- und Königsfarn, 1974
Der Wurmfarn, 1975
Eichen- und Buchenfarn, 1977
Die Streifenfarne, 1978
Hirschzungen- und Rippenfarn, 1979
Die Schildfarne; Blasen- und Tüpfelfarn, 1980
Neulinge in der Flora von Trier und Umgebung
Einführung in die Artikelserie, 1996; Der Riesenbärenklau
Eingeschleppte Pflanzen als Landplage, 1997: Japanische Knöteriche
Soll man Fremdlinge dulden? 1998; Die Goldruten
Topinambur, der Eroberer der Flussufer, 1999
Springkraut-Arten: ein Ureinwohner und drei Neubürger, 2001
Die Gattung Greiskraut (Senecio) auf Erfolgs- und Expansionskurs, 2002
„Blinde Passiere“ der Eisenbahn, 2003: Götterbaum, Sommerflieder, Nachtkerze, Purpur-Storchschnabel und Liebesgras
Zwei umstrittene Waldbäume aus Übersee, 2004: Robinie und Späte Traubenkirsche
Viel beachtete und unbemerkte Einwanderer, 2005: Zarte Binse, Strahlenlose Kamille, Drüsiges Weidenröschen und Franzosenkraut
Einwanderer am Flussufer, 2006: Breitblättrige Kresse und Zucker-Spitzklette
Dänisches Löffelkraut, Salz-Schuppenmiere, Klebriger Alant, Kurzfrüchtiges Weidenröschen, 2007
Gebietserkundungen
Das Ochsenbruch bei Börfink, 1968
Rockenburger Urwald, 1972
Eine Uferflora entsteht; Beobachtungen am Stausee in Kell, 1976
Die Flora des Feuchtgebietes bei Konz-Könen und ihre fortschreitende Vernichtung seit dem 19. Jahrhundert, 2008
Der ehemalige Standortübungsplatz Hermeskeil im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz, 2009
Der „Unterste Büsch“ bei Körrig – ein naturkundlich interessantes Waldgebiet im Saargau, 2011
Ralingen – reich an naturkundlichen Besonderheiten, 2012
Der „Schock“, ein botanisch bemerkenswertes Waldgebiet am Moselhang oberhalb Longen, 2014
Das Naturschutzgebiet Nitteler Fels und seine Umgebung – eines der vielfältigsten Landschaftselemente im Landkreis, 2016
Verschiedenes
„Volkszählung“ im Pflanzenreich, 1970
Narzissenwiesen – Blütenpracht in der heimatlichen Natur. Erstes rheinl-pfälz. Narzissenfest im Frühjahr 2006 in der Verbandsgemeinde Kell am See. Von Walburga Meyer u. Hans Reichert, 2007
Was sind Stinzenpflanzen? 2010
Blumenreiche Wiesen vor dem Aus? 2015
Seltene Wildkräuter der Weinberge im Kreisgebiet, 2020
Heinrich Rosbach – Arzt und Botaniker, 1979
Kräuterbücher vom Mittelalter bis zum 17. Jhd. in der Trierer Stadtbibliothek – bibliophile Kostbarkeiten, 2000
Im Umkreis von Trier gesammelte Pflanzen in einem prachtvollen botanischen Abbildungswerk aus dem 19. Jhd., 2022
Was beim Sammeln von Heilkräutern bedacht werden sollte, 2013
Dr. Hans Reichert mit dem Umweltpreis des Landes ausgezeichnet, 2000. Von Barbara Weiter-Matysiak
Vorwort
Im Rahmen einer Recherche stieß ich in der Trierer Stadtbibliothek vor einigen Jahren auf die botanischen Aufsätze von Dr. Hans Reichert. Ihre tief im Sinnenhaften wurzelnde Art, ihre scheinbare Leichtigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erklären, das immense Wissen ohne Pedanterie und ausuferndes Fachchinesisch entfachten in mir eine regelrechte Begeisterung und schon bald den Wunsch, sie neu zusammenzustellen und als Buch herauszugeben.
Die Aufsätze umfassen einen Zeitraum von über einem halben Jahrhundert und zeigen auf, wie sich die Landschaften im Trierer Raum verändert haben. Diese Prozesse sind seit Jahrhunderten im Gange. Die Industrialisierung hat den Vorgang beschleunigt. Eine umfangreiche Infrastruktur, Flächenversiegelungen und Monokulturen haben unsere natürliche Umgebung eingeengt und zerschnitten, was nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Tiere in Bedrängnis brachte, denen freies Bewegen und Revierwechsel in der freien Natur kaum mehr möglich sind. Die Flora hat sich nach Kräften den neu entstandenen Verhältnissen angepasst. Viele Arten verschwanden oder wanderten aus, andere kamen hinzu.
Das vorliegende Buch vereint 54 Aufsätze, die in den Jahrbüchern Trier-Saarburg (JTS) von 1968 bis 2023 erschienen sind. Die technischen Entwicklungen während mehr als einem halben Jahrhundert machten den Ersatz der meisten Originalfotos notwendig. Bildlegenden mussten behutsam angepasst werden. Die Schwarz-weiß-Fotos stammen aus den Jahrbüchern selbst. Die Aufsätze sind nach Themen neu angeordnet. Bis 1999 wurden sie in der älteren Duden-Schreibung gedruckt. Ich habe dies unverändert übernommen. Die Originale sind jederzeit in öffentlichen Bibliotheken einsehbar. Die lateinischen Bezeichnungen einiger Pflanzen haben sich in den letzten Jahrzehnten geändert, was in den Fußnoten erwähnt wird. Die Fotografen habe ich mit Kürzeln gekennzeichnet. Die mit SE bezeichneten Fotos stammen von mir.
Ich hoffe, hiermit ein reiches Handbuch über etliche Pflanzen und deren Verbreitungsgebiete in unserer Region vorlegen zu können, gleichermaßen lesbar für Laien und Experten, und zugleich eine spannende Chronik über die Veränderungen der Lebensräume im Trierer Land seit den 1960er Jahren.
Sigrid Ertl,
Trier, im Juli 2023
Ein herzliches Dankeschön:
an Hans Reichert für das mir bei meiner Aufgabe geschenkte Vertrauen;
für die Fotos von: Michael Hassler (MH), Thomas Muer (TMu), Herbert Sauerbier (HSb), Horst Kretzschmar (HK), Armin Schuckart (AS), Julia Kruse (JK), Joachim Rheinheimer (JR), Thomas Meyer (TMe), Harald Geier (HG), Stefan Schweihofer (SS), Werner Becker (WB), Hans-Jörg Dethloff (HJD), Michael Lüth (ML), Hans Reichert (HR), Kurt-Werner Augenstein (KWA), Tourist-Information Kell am See;
an Michael Hassler (Internetportal FLORA GERMANICA), der die meisten Fotos zur Verfügung stellte und mir in Einzelfragen jederzeit freundlich zur Seite stand;
an Frau Eva Jullien vom Kreisarchiv des Landkreises Trier-Saarburg für die Nachdruckerlaubnis;
dem NABU-Region Trier, der dieses Buch unterstützte und finanzierte.
HR
Eine Kuriosität am Wegesrand
JTS 1969
Dr. Reichert beobachtete den „Albino“ unter den Weidenröschen
Nachdem die goldgelbe Pracht des Besenginsters verblichen ist, schmückt leuchtendes Rot die Kahlschläge, Wald- und Wegränder unserer Heimat: Fingerhut und Weidenröschen entfalten jetzt unzählige Blüten. Wer in dieser hochsommerlichen Zeit die Landstraße von Hermeskeil nach Birkenfeld befährt, kann in der Nähe des Hofgutes Retzenhöhe an der rechten Straßenböschung einen großen Bestand rein weißer Weidenröschen bewundern (siehe Bild). Nicht nur den Blüten fehlt jede Spur roter Farbe – auch die unteren Stengelteile lassen den normalerweise vorhandenen rötlichen Schimmer vermissen. Es handelt sich hier um einen sogenannten Albino. Vielen Lesern wird der Begriff aus der Tierkunde geläufig sein. Von weißen Rehen oder Hirschen wird gelegentlich in Zeitungen berichtet, weiße Mäuse oder Kaninchen mit den typischen rötlichen Augen wird mancher schon selbst gesehen haben.
Alle echten Albinos sind dadurch gekennzeichnet, daß die normale Farbstoff-(Pigment)-Bildung in der äußeren Haut unterbleibt.
Im Pflanzenreich gibt es solchen Farbstoffmangel ebenfalls, nur werden diese Abnormitäten weniger beachtet. Wer jedoch bei Spaziergängen die Augen offen hält, wird hier und da pflanzliche Albinos entdecken. Vor allem bei rot-, violett- oder blaublühenden Gewächsen wie z. B. Fingerhut, Veilchen, Glockenblumen und Kornblumen fehlt gelegentlich die Blütenfarbe. Meist findet man nur einzelne abnorme Exemplare.
Daß unser Weißes Weidenröschen gleich in Massen auftritt, hängt mit der Wuchsform dieser Pflanzenart zusammen: sie vermehrt sich durch unterirdische Ausläufer. Der ganze Bestand ist auf diese Weise aus einem einzelnen Albino hervorgegangen. Dessen Same stammte möglicherweise von einem normalen, rot blühenden Weidenröschen. Der Farbstoffmangel wird nämlich in der Regel durch eine plötzliche, unvorhergesehene Änderung der Erbanlagen (Mutation) verursacht.
Durch diesen Vorgang können sich auch völlig neue, vorher nie dagewesene Abarten bilden. Für den Züchter sind sie wertvoll; sie erlauben es ihm, den Blumenmarkt hin und wieder mit „modischen Neuheiten“ zu beliefern.
Noch bedeutsamer aber sind die Mutationen für die biologische Forschung. Viele Erkenntnisse der Vererbungs- und Abstammungslehre stützen sich auf solche „Launen der Natur“.
Eine Brennessel wird „erwürgt“ Die Nesselseide
JTS 1972
Beobachtungen an einer Schmarotzerpflanze an der Moselaue
MH
Schmarotzerpflanzen lenken in besonderem Maße die Aufmerksamkeit der Naturfreunde auf sich. Die Faszination geht so weit, daß der Laie eine ganze Reihe von Pflanzen fälschlicherweise der parasitischen Lebensweise verdächtigt. So sind zum Beispiel die baumbewohnenden Orchideen der Tropen keineswegs Parasiten, sondern harmlose „Aufsitzerpflanzen“ (Epiphyten). Sie ernähren sich von Humusansammlungen in Astgabeln und Rindenspalten. Den Bäumen entnehmen sie nicht das geringste. Die Mistel, die oft als Musterbeispiel eines Schmarotzers angesehen wird, lebt nur teilweise auf Kosten des von ihr besetzten Baumes. Sie zapft ihm lediglich Wasser und Mineralsalze ab, also das, was der Baum zuvor dem Boden entzogen hat. Ansonsten lebt sie wie alle grünen Pflanzen im wahrsten Sinne von der Luft. Mit Hilfe des Blattgrüns fängt sie die Energie des Sonnenlichtes auf und verarbeitet damit das Kohlendioxid-Gas, einen Bestandteil der Luft, zu Eiweiß und allen anderen lebenswichtigen Aufbaustoffen. Die „Ganzschmarotzer“ bringen selbst das nicht fertig, da sie kein Blattgrün besitzen. Sie müssen alle Nährstoffe einem anderen Lebewesen wegnehmen.
Man nennt dieses Lebewesen beschönigend den „Wirt“. „Sklave“ wäre zutreffender, denn es wird bis zur Erschöpfung ausgebeutet. In der einheimischen Flora gibt es drei Gattungen von Ganzparasiten. Es sind überwiegend seltene und deshalb wenig bekannte Pflanzenarten. Wer als aufmerksamer Naturbeobachter am Moselufer spazierengeht, hat am ehesten Gelegenheit, einen dieser Parasiten kennenzulernen. Dort, wo auf nährstoffreichem Auenboden saftige Stauden mannshoch emporwachsen, wo Kleine Sonnenblume (Topinambur), Brennessel, Spießmelde, Knöterich und Schwarzkohl dichte Bestände bilden, entdeckt man hie und da ein Gewirr ineinander verschlungener „Zwirnsfäden“, welches Brennesseln überzieht.
MH
An den grünlichen bis rötlichen Fäden hängen in Abständen von einigen Zentimetern Büschel von vielen winzigen Blüten, die weiß bis hellrot gefärbt sind. Die Blütezeit reicht vom Juni bis zum September. Gegen Ende der Blühperiode findet man neben den etwa 1 cm dicken Blütenknäueln auch schon Büschel unreifer, grünlicher Früchte. Diese Pflanze, die völlig blattlos ist, wird Nessel-Seide oder auch Teufelszwirn genannt. Ihr wissenschaftlicher Name ist Cuscuta europaea. Sie gehört zur entfernteren Verwandtschaft der Ackerwinde. Die Nessel-Seide befällt hauptsächlich Brennesseln, daneben aber auch andere Stauden der Flußufervegetation. Eine Abart tritt als Gartenschädling in Hülsenfruchtfeldern auf, ist aber recht selten. Als junges Keimpflänzchen bildet die Nessel-Seide vorübergehend eine kleine Wurzel. Das Stengelchen streckt sich sofort zu einem dünnen Faden, der waagerecht auf der Erde entlangwächst. Nach wenigen Tagen schon stirbt die Wurzel ab, und auch der rückwärtige Teil des Stengels schrumpft. Das Vorderende wächst jedoch mit aufgerichteter Spitze weiter, indem es dem rückwärtigen, absterbenden Teil die Nährstoffe entzieht. Das Vorderende vollführt unmerklich Drehbewegungen und „ertastet“ sich so eine Wirtspflanze. Beinahe wie eine kleine Schlange „kriecht“ das Keimpflänzchen somit im Zeitlupentempo über die Erde. Sobald es mit einer Staude in Berührung kommt, beginnt es zu klettern. In vielen Windungen umschlingen schließlich die dicker werdenden Fäden die Wirtspflanze. Da, wo die Fadensprosse den Stengel der Wirtspflanze berühren, pressen sie sich dicht an und bilden reihenweise Saugorgane, die wie Stummelfüße einer Raupe aussehen. Die Saugorgane dringen in den Stengel ein und zapfen die Leitbündel an.
Von den acht in Deutschland vorkommenden Seidenarten ist außer der Nessel-Seide nur noch die viel kleinere Thymian-Seide weiter verbreitet. Man findet sie auf Thymian, Ginster und Heidekraut schmarotzend, auf Magerwiesen und Heiden. Eine Abart von ihr tritt in Wärmegebieten als Schädling in Kleefeldern auf. Auch zwei aus Amerika eingeschleppte Arten schmarotzen auf Klee und Luzerne. In unserer engeren Heimat spielen diese Schädlinge keine Rolle.
Deutschlands giftigste Pflanze1
Der grüne Knollenblätterpilz
JTS 1973
Was jeder über ihn wissen sollte.
Schwere Pilzvergiftungen haben sich in unserem Raum in den letzten Jahren glücklicherweise selten ereignet. Das hängt wohl hauptsächlich damit zusammen, daß die zehn tödlichen Giftpilzarten Deutschlands hier entweder fehlen oder nicht gerade häufig vorkommen. Deswegen darf man sich aber keineswegs zu leichtsinnigem Sammeln verleiten lassen. Der grüne Knollenblätterpilz, der in Mitteleuropa die meisten tödlichen Vergiftungen verursacht, tritt auch in den Wäldern des Trierer Landes auf. Im Hochwald ist er ziemlich selten und fast ganz auf die Täler beschränkt (das abgebildete Exemplar wurde 1970 im Lösterbachtal bei Hermeskeil gefunden)2. Immerhin kann er auch dort an günstigen Wuchsplätzen (lichte, mäßig feuchte Buchen- und Eichenwälder) in größeren Trupps auftreten. Häufiger findet man ihn nördlich der Mosel; in manchen Bereichen der Eifel trifft man ihn auf Schritt und Tritt an. Beängstigende Berichte über die Wirkung des Pilzes sind nicht übertrieben: Schon ein einziges Exemplar genügt, um einen Menschen zu töten. Den Chemikern, die den Knollenblätterpilz in den letzten Jahrzehnten gründlich analysierten, tat sich eine wahre Giftküche auf: Nicht weniger als zehn lebensgefährliche Stoffe wurden gefunden, ihrer chemischen Natur nach durchweg Eiweißverbindungen. Erstaunlich, daß gerade unter den Eiweißstoffen, wichtigen Baustoffen des Lebens, einige so verteufelt giftig sind, daß 7 Milligramm einem erwachsenen Menschen den Garaus machen können.
Besonders heimtückisch ist die Wirkungsweise der zehn Gifte: Sie zerstören die Leber, ohne dabei zunächst Beschwerden hervorzurufen. Das heftige Erbrechen und der Durchfall, die 10 bis 24 Stunden nach dem Genuß des Pilzes plötzlich auftreten, haben mit den tödlichen Giftstoffen nichts zu tun, sondern werden von anderen, „harmloseren“ Inhaltsstoffen des Pilzes verursacht. Diese Symptome klingen vielfach sogar wieder ab. Diese scheinbare Besserung kann aber über den fast hoffnungslosen Zustand des Patienten nicht hinwegtäuschen. Die Zerstörung der Leber ist jetzt soweit fortgeschritten, daß ein recht qualvolles Sterben einsetzt. Wie die Gifte im einzelnen in den Stoffwechsel der Leber eingreifen und dort ein Chaos verursachen, wissen die Biochemiker noch nicht.
Hoffnungsvolle Kunde erreichte uns vor einigen Jahren aus Polen und der CSSR, wo Pilzvergiftungen recht oft vorkommen. Selbst in fortgeschrittenen Stadien der Leberzerstörung hat man dort anscheinend mit dem Medikament Thioctsäure beachtliche Heilerfolge erzielt. Verwechslungen eßbarer Pilze mit dem grünen Knollenblätterpilz beruhen auf Oberflächlichkeit und bodenlosem Leichtsinn. Wenn gelegentlich berichtet wird, ein „guter Pilzkenner“ sei einer solchen Verwechslung zum Opfer gefallen, so ist dies entweder unwahr, oder der Pilzkenner war nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte.
SS
Der grüne Knollenblätterpilz ist durch so auffällige Merkmale ausgezeichnet, daß man ihn einfach nicht verkennen dürfte. Er sieht genauso aus, wie er in guten Pilzbüchern abgebildet ist: Unten am Stiel befindet sich eine dicke Knolle. Der Pilz war in ihr wie in einem Ei eingeschlossen. Bei seinem Hervorbrechen aus diesem „Hexenei“ hinterließ der Pilzkörper eine unregelmäßig aufgerissene, häutige Scheide, aus der der Stiel herausragt. Der Hut ist anfangs gewölbt und an der Unterseite mit einer dünnen Haut bedeckt. Sobald sich der Hut ausbreitet und abflacht, reißt diese Haut ab und hängt als „Ring“ oder „Manschette“ rings um den oberen Teil des Stiels. Die Hutoberfläche ist oliv grün gefärbt, glänzend und etwas streifig. Die Lamellen auf der Hutunterseite sind weiß oder grünlich überhaucht, niemals aber ockerfarben, rötlich oder braun bis schwarz wie bei den Champignons. Der Pilz riecht kaum (nur alte Exemplare entwickeln zunächst einen honigartigen, später immer unangenehmer werdenden Geruch) und hat einen angenehmen Geschmack. Er verfärbt beim Anschneiden nicht, und alle angeblichen „Giftproben“, wie der Silberlöffel oder die Zwiebel, die beim Mitkochen schwarz werden sollen, versagen. Solcher hartnäckig überlieferter Aberglaube sollte endlich verschwinden und der Erkenntnis Platz machen, daß es nur eine Möglichkeit zur Verhütung schwerer Pilzvergiftungen gibt: ein gründliches Kennenlernen der zehn gefährlichsten Giftpilze.
Nur wenige Sammler werden Gelegenheit bekommen, alle diese Arten in der Natur zu sehen. Es genügt aber schon, wenn man sich ihre Merkmale anhand guter Abbildungen und ausführlicher Beschreibungen einprägt. Buchhandlungen bieten eine Reihe von ausgezeichneten Pilzbüchern zu durchaus erschwinglichen Preisen an. Die Qualität dieser Bücher läßt sich am ehesten daran abschätzen, wieviel beschreibender Text den Abbildungen beigegeben ist.
1 Früher wurden die Pilze noch dem Pflanzenreich zugeordnet, heute bilden sie ein eigenes Reich
2 Foto wurde ersetzt
Die Mistel
Die Zauberpflanze in den Baumkronen
JTS 1981
MH
Den jungen und älteren Lesern der Asterix-Bildgeschichten ist der Druide Miraculix wohlbekannt, der in wallendem Gewand und mit einer goldenen Sichel ausgerüstet, in Bäumen herumklettert, um Misteln für seine Zaubertränke zu schneiden. Daß Kelten und Germanen das Sammeln von Misteln tatsächlich mit allerlei Zauberriten umgaben, ist durch viele Berichte überliefert. So schreibt der im 16. Jahrhundert in der Nähe von Zweibrücken beheimatete Hieronymus Bock in seinem berühmten Kräuterbuch: „Und wann sie gedachte Mistel wolten von den beumen bringen, mußten zuvor etliche Ceremonien unnd Opffer geschehen. Alsdann steiget der Priester inn weißen Kleiderern auff den baum, schneidt sie mit einem gulden waaffen heraber. Das ward dann inn einen weißen Mantel entpfangen. Da hielt man wieder Ceremonien unnd ein Gebett, das Gott solchem Gewächß sein krafft wolte lassen.“
Bock berichtete weiter, daß nicht nur die Misteln, sondern auch die Bäume, auf denen sie wuchsen, für heilig gehalten wurden. Man sprach der Mistel, besonders wenn sie von einer Eiche geholt worden war, eine umfassende Heilkraft zu, sogar gegen Gespenster und bösen Zauber. Kindern hängte man gerne Mistelteile als Amulett um den Hals. Es gibt plausible Erklärungen dafür, daß man gerade dieser Pflanze derartige Kräfte zusprach. Auch bei nüchtern wissenschaftlicher Betrachtung erweist sie sich als in vieler Hinsicht erstaunliches Gewächs. Sie blüht schon, wenn der Winter noch nicht vergangen ist und bringt – eine Einmaligkeit in der heimischen Pflanzenwelt – bereits im Februar und März reife Früchte hervor. Sie wächst niemals auf dem Erdboden, sondern immer auf den Ästen von Bäumen. Im Winter, wenn diese ihr Laub abgeworfen haben, prangen die Mistelbüsche weiterhin in strotzendem Grün auf dem kahlen Geäst. Ihre dicklichen, ledrigen Blätter wirken ebenso robust wie die gedrungenen Zweige.
Ein Mistelbusch kann 70 Jahre alt werden und einen Durchmesser von einem Meter erreichen. Kein Wunder, daß man einer so vitalen Pflanze übernatürliche Kräfte zusprach. Die Tatsache, daß die Misteln auf den Bäumen wachsen, regte schon in frühen Zeiten die Phantasie der Naturbeobachter an. Dabei interessierte sie der Parasitismus noch am wenigsten. Parasiten oder Schmarotzer nennt man bekanntlich Lebewesen, die anderen Nährstoffe entziehen.
Unter den Pflanzen fallen Parasiten besonders auf; ist es doch gerade ein Wesensmerkmal pflanzlicher Lebensweise, in der Ernährung nicht auf andere Lebewesen angewiesen zu sein. Mit Hilfe der Sonnenenergie vollbringen die grünen Pflanzen das Kunststück, aus Kohlendioxid, Wasser und Bodensalzen all die energiereichen und kompliziert gebauten organischen Stoffe zu bilden, aus denen Lebewesen bestehen. Der „Zauberstab“, mit dem dieses raffinierte chemische Verfahren in Gang gesetzt wird, ist das Blattgrün (Chlorophyll).
Parasitische Pflanzen sparen sich diesen Aufwand und holen sich die fertig fabrizierten Nährstoffe kurzerhand aus anderen Pflanzen (selten Tieren). Sie brauchen deshalb auch kein Blattgrün und sind deshalb von bleicher Farbe. Zu diesen Parasiten im strengen Sinn kann die Mistel nicht gehören, denn sie hat Blattgrün in reichem Maße, sogar im Winter. In manchen Ländern dient sie ja unter anderem deswegen als Weihnachtsschmuck. Sie ist also durchaus in der Lage, auf die oben geschilderte Weise organische Stoffe zu bilden. Sie holt sich aus dem Baum, auf dem sie sitzt, lediglich Wasser und Mineralsalze; also das, was „normale Pflanzen“ mit ihren Wurzeln aus dem Boden holen. Die Mistel spart sich sozusagen die Mühe, ein weit verzweigtes Wurzelsystem bilden und mit allerlei chemischem und physikalischem Aufwand das Wasser und die fein verteilten Mineralsalze aufsammeln zu müssen. Sie zapft die Leitungsbahnen an, in denen der Baum diese Stoffe nach oben transportiert. Als „Halbparasit“ zehrt sie demnach nicht von der organischen Substanz des Baumes. Deshalb kann nur ein sehr starker Befall den Baum schädigen. Da unsere Vorfahren in vergangenen Jahrhunderten diese Sachverhalte pflanzlicher Ernährung nur zum geringen Teil kannten, beschäftigte sie mehr die Frage, wie die Misteln auf die Bäume gelangen. Nach dem Glauben der Germanen fielen sie vom Himmel; sie galten deshalb als heilig.
Alles an den Misteln wirkt dicklich, fast aufgedunsen. So auch die grünlichen und unscheinbaren weiblichen Blüten. Zu dritt sitzen sie auf einem kurzen Stiel.HR
Hieronymus Bock hatte beobachtet, daß die kleinen dunklen Samen, die man in der weißen Mistelbeere findet, im Boden nicht keimen. Daraus zog er den kuriosen Schluß, daß es sich nur um Scheinsamen handelt, die nichts mit der Fortpflanzung zu tun haben.
Und nun ließ er seiner Phantasie freien Lauf: Ebenso wie einige Knabenkräuter, meint er, entstehen die Misteln aus Samen (Sperma) von Vögeln, nämlich von Amseln und Drosseln. Diese lassen aus ihrer „überflüssigen geylheit“ etwas herunterfallen, aus dem dann die Pflanze aufkeimt.
Vögel haben beim Schnabelwetzen Reste der klebrigen Mistelbeeren auf der Rinde eines herabhängenden Zweiges verschmiert.HR
Wie viele Phantasiegeschichten alter Autoren enthält auch diese ein Körnchen Wahrheit. Amseln und Drosseln bewerkstelligen tatsächlich Aussaat und Ausbreitung der Misteln, allerdings auf eine Weise, die sich viel mehr im Rahmen des üblichen hält. Da Vögel ihren Kot oft fallenlassen, wenn sie auf Ästen sitzen, gelangen die unverdaulichen Samen der von ihnen verzehrten Mistelfrüchte dorthin, wo sie keimen können: an die Baumrinde. Auch wurde beobachtet, daß die Vögel ihre Schnäbel mit dem klebrigen Fruchtfleisch verschmieren und sie dann an Ästen sauberwetzen. Auch hierbei gelangen Samenkörner an die Baumrinde. Der Samen ist nur ganz kurze Zeit keimfähig und keimt nur in vollem Tageslicht. Schon allein deshalb kann er am grasbewachsenen Boden nicht aufgehen. Anscheinend üben auch Stoffe, die in der Baumrinde enthalten sind, hemmende oder fördernde Wirkungen auf die Keimung aus. Die Mistel befällt nämlich keineswegs alle Baumarten. Genauer müßte man von „den Misteln“ sprechen: es gibt nämlich in Deutschland drei Arten, von denen in unserem Gebiet fast nur die Laubholz-Mistel (Viscum album) vorkommt. Sie wächst hauptsächlich auf Apfelbäumen, seltener auf anderen Obstbäumen. Eine gewisse Vorliebe hat sie auch für Pappeln und Robinien. Selten findet man sie auf Buchen, Hainbuchen und Birken. Aus dem Samen wächst zunächst eine kleine Scheibe, danach ein senkrecht in die Rinde eindringender Fortsatz. Dieser durchstößt zunächst den Teil des Leitgewebes, in dem die organischen Stoffe transportiert werden, ohne dort etwas aufzusaugen. Erst die weiter innen liegenden Leitungsbahnen für das Wasser und die Mineralsalze werden angezapft. Wenn dies bewerkstelligt ist, bildet der Keimling Zweige und Blätter. Unter der Rinde kann er waagerechte grüne Wurzeln vorantreiben, aus denen Tochterpflanzen hervorgehen.
Die runzelige Rinde des Kurztriebes an einem Apfelbaum hat die Keimung eines Mistelpflänzchens erleichtert. Der Samen blieb gut haften, und das Pflänzchen konnte seine Saugwurzel in die Rinde vortreiben.HR
Auch in der Fortpflanzung ist die Mistel ein Außenseiter; sie gehört zu der Minderheit von Pflanzen, deren Blüten nicht zwittrig sind. Es gibt also männliche und weibliche Mistelbüsche. Die Blüten sind klein und grünlich und werden teils vom Wind, teils von Fliegen bestäubt. Wenn der Mistel einst eine universelle Heilwirkung zugeschrieben wurde, so war das übertrieben. Doch haben auch moderne Forschungen eine ganze Reihe pharmazeutisch wirksamer Inhaltsstoffe zutage gefördert: herzwirksame Viscotoxine, die unverdünnt giftig sind; Cholin und Acetylcholin, die bei der Funktion des Nervensystems eine wichtige Rolle spielen; Histamine, die den Blutdruck beeinflussen; Saponine, die schleimlösende und drüsenanregende Wirkungen haben. Immer wieder ist in alten Kräuterbüchern auch von der Wirkung gegen Geschwüre und Geschwülste die Rede. Das weckte das Interesse der Krebsforscher, die tatsächlich gewisse Anhaltspunkte für eine tumorhemmende Wirkung fanden. Zum Teil beruht diese wohl auf einer Stärkung des Immunsystems durch Inhaltsstoffe der Mistel. Hierüber ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen, und man tappt bezüglich der chemischen Zusammensetzung dieser Wirkstoffe noch weitgehend im dunkeln. Gerade weil sie noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben hat, sollten wir dafür sorgen, daß die Mistel ihren Platz in der heimischen Pflanzenwelt behält. Leider aber ist sie durch den Sauberkeitsfimmel in unserem technisierten Zeitalter bedroht. So wurden vor Jahren Prämien dafür bezahlt, daß alte Obstbäume aus den Fluren entfernt und damit auch die Misteln beseitigt wurden. Zum Glück gab es Leute, die die Fragwürdigkeit einer solchen Aktion erkannten und sich überlegten, ob Steuergelder nicht sinnvoller verwendet werden können. Einem für seine Zivilcourage bekannten Ortsbürgermeister an der Mosel verdanken wir es zum Beispiel, daß Anordnungen zu den Akten gelegt wurden, die Misteln unbehelligt blieben und so all die Bilder entstehen konnten, die diesen Artikel illustrieren.
(Spätere Ergänzung: Im Jahrbuch 1981 wurde im Aufsatz über die Mistel auf Seite 208 angegeben, diese sei selten auf Buchen zu finden. Offenbar ist aber die Mistel auf Rotbuchen noch nie gefunden worden. Dagegen wächst sie selten auf Eichen.)
Löwenzahn – einfach für Kräutersammler, schwierig für Botaniker
JTS 2023
Wahrscheinlich ist der Löwenzahn (Abb.1) die Wildpflanze, die bei uns am häufigsten für Speisezwecke gesammelt wird. Die Gründe liegen auf der Hand: Er ist weit verbreitet und leicht zu erkennen. Es gibt keine Giftpflanze, die auf Wiesen zusammen mit ihm vorkommt und ihm ähnlich sieht. Auch wer kein großer Pflanzenkenner ist, braucht deshalb keine Verwechslung zu befürchten.
Abb. 1WB
Im Kreisgebiet hat man vor allem im Hochwald reichlich Gelegenheit, Löwenzahn fern von Straßenrändern und anderen belasteten Örtlichkeiten zu sammeln. Es ist deshalb eine gute Idee, dort alljährlich die ,Bettsächertage' zu veranstalten. Der derbe volkstümliche Name, ,Bettsächer', der dem französischen ,pissenlit' entspricht, verweist auf die harntreibende Wirkung des Löwenzahns. Diese ist jedoch bestimmt nicht stärker als beim Bier und es ist eine drastische Übertreibung, gleich vom Bettnässen zu reden. Als Salat zubereitet sind die jungen Blätter im Frühjahr mit ihrem leicht bitteren Geschmack recht delikat und appetitanregend. Bei schon blühenden Pflanzen nimmt der Gehalt an Bitterstoffen zu. Es lohnt sich dann aber immer noch, einzelne Blätter z. B. unter Kopfsalat zu mischen und dadurch das Angebot an Mineralstoffen und Vitaminen zu erhöhen. Man zählt den Löwenzahn auch zu den Heilpflanzen.
Seine Bitterstoffe regen auf mehrfache Weise die Verdauung an, steigern die Gallenproduktion und damit indirekt die Leber- und Nierenfunktion. Man spricht deshalb volkstümlich von entschlackender oder blutreinigender Wirkung. Wie jedes Heilmittel ist auch der Löwenzahn nicht ohne Nebenwirkungen. Menschen mit Gallen- oder Nierenerkrankungen sollten ihn meiden. Auch wer gegen Arnika, Kamille oder Ringelblume allergisch ist, muss vorsichtig sein.
Botaniker haben mit Löwenzahn ganz andere Probleme. Diese fangen schon damit an, dass es gleich zwei Pflanzengattungen gibt, die in der Fachliteratur mit dem deutschen Namen Löwenzahn bezeichnet werden. Die eine hat den wissenschaftlichen Namen Taraxacum und ist genau das, was wir als Salatsammeln und im Volksmund ,Bettsächer' oder Pusteblume nennen. Die andere heißt wissenschaftlich Leontodon, was dem klassischen Griechisch entnommen ist und ,Löwenzahn' bedeutet. Wenn man so will, ist dies deshalb die eigentliche Gattung Löwenzahn. Bei uns ist sie durch den Rauen Löwenzahn (Leontodon hispidus) vertreten, ebenfalls eine Wiesenpflanze mit ähnlichen, aber meist rau behaarten Blättern, kleineren Blütenköpfen und etwas späterer Blütezeit. Da auch bei deutschen Pflanzennamen in der Fachliteratur Eindeutigkeit gefordert wird, hat man vorgeschlagen, die Gattung Taraxacum nicht mehr Löwenzahn, sondern Kuhblume zu nennen. Damit werden sich die Verfasser von Wildkräuterliteratur aber wohl nicht anfreunden können.
Abb. 2HR
Das ist aber noch ein kleines Problem gegenüber der Tatsache, dass wir es bei Taraxacum nicht mit einer, sondern mit vielen Arten zu tun haben, die zum Teil nur schwer zu unterscheiden sind. Eine Ahnung davon bekommt man, wenn man sich Löwenzahn-Blätter anschaut, die auf einer einzigen Wiese gesammelt wurden (Abb. 2).
Solche Unterschiede zeigen sich nicht nur bei den Blattformen. Die hohlen Stängel sind unterschiedlich gefärbt und behaart. Und erst die Blütenköpfe, die eine einzelne Blüte vortäuschen, aber ein Komplex von vielen kleinen, zungenförmigen Blüten sind (Abb.1), weisen vor allem in der Gestaltung der Hüllblätter eine große Mannigfaltigkeit auf. Hüllblätter nennt man die dicht gedrängten, grünen Blätter, welche die gelben Zungenblüten umrahmen (Abb. 3 und 4). Botaniker und aufmerksame Kräutersammler haben diese Vielfalt seit eh und je beobachtet, aber lange für individuelle Variabilität gehalten, so wie ja auch bei Mensch und Tier kein Individuum dem anderen gleicht. Vereinzelt ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, verstärkt im 19. und 20. Jahrhundert erkannte man aber, dass nur manche dieser Merkmale individuelle Varianten sind. Andere werden – meist sogar als Merkmalskombinationen – konstant von Generation zu Generation weitergegeben. Das bestätigte sich auch bei Kulturversuchen.
Anfangs waren es vor allem skandinavische Forscher, die sich den Löwenzähnen widmeten und erkannten, dass es sich bei den im Großen so ähnlichen, im Kleinen jedoch konstant verschiedenen Sippen um Klone handelt. Sie entstanden dadurch, dass irgendwann infolge von Mutationen die Fähigkeit zur geschlechtlichen Fortpflanzung verloren ging und sich stattdessen Samen ungeschlechtlich d.h. ohne Befruchtung bildeten. Diese enthalten genau das Erbgut der Mutterpflanze, so dass alle Nachkommen genetisch gleich sind, also Klone darstellen. Da diese fortpflanzungsbiologisch isoliert sind, d.h. sich nicht mit anderen Klonen kreuzen können, müssen sie nach der geltenden Definition als Arten bewertet und mit eigenen wissenschaftlichen Artnamen versehen werden. So ergab sich die interessante Tatsache, dass im gut erforschten Europa neue Arten zu entdecken waren und von Spezialisten immer weiter entdeckt werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand unterscheidet man in Deutschland schon etwas mehr als 400 Taraxacum-Arten. Ausgehend von der Stelle, an der die Mutation stattfand, verbreitete sich eine neue Löwenzahn-Art je nach ihren Umweltansprüchen, aber auch abhängig vom Zeitraum seit der Mutation, über ein kleineres oder größeres Gebiet. Dies kann beispielsweise nur so groß wie ein Teil eines Bundeslandes sein oder fast ganz Europa umfassen. Die meisten Botaniker sind nicht in der Lage, viele oder gar alle Löwenzahn-Arten zu kennen. Das ist schon deshalb Spezialisten vorbehalten, weil für das Suchen und Sammeln gut bestimmbarer, blühender und fruchtender Exemplare nur ein Zeitraum von nicht viel mehr als einem Monat im Frühjahr zur Verfügung steht.
Oft trifft sich in dieser Zeit die ‚Fan-Gemeinde‘ der Taraxacologen zu Exkursionen, bei denen gemeinsam Landstriche durchkämmt werden. Es ist ein fast schon kurioses Erlebnis, mit einer Gruppe dieser Spezialisten über eine Löwenzahnwiese zu wandern.
Viele Exemplare kaum eines Blickes würdigend, erspähen sie plötzlich schon aus mehreren Metern Entfernung eines, das sich bei näherer Betrachtung als seltene Art erweist oder das in seinen Merkmalen so sehr von Bekanntem abweicht, dass es sich um eine neue, noch unbeschriebene Art handeln könnte.
Abb. 3HR
Abb. 4HR
Im restlichen Jahr benötigt der Löwenzahn-Experte viel Zeit für das Herbarisieren und Studieren der gesammelten Exemplare im Vergleich mit Literatur und anderen Herbarien. Vor allem wenn er eine neue Art gefunden zu haben glaubt, muss er sorgfältig recherchieren, ob nicht doch schon ein anderer sie entdeckt und beschrieben hat. Für den nicht spezialisierten Botaniker gibt es immerhin einige kleinere Löwenzahn-Gruppen, die sich aus der Masse der Arten durch auffällige Merkmale hervorheben und wegen ihrer geringeren Artenzahl leichter zu überschauen und zu bestimmen sind. Etwas Besonderes hat man zum Beispiel immer dann vor sich, wenn die äußeren Hüllblätter nicht wie bei der großen Masse der Löwenzahn-Arten zurückgekrümmt sind (Abb. 3), sondern dem Blütenkopf kelchförmig anliegen (Abb. 4). Diese Löwenzähne sehen daher weniger struppig und irgendwie vornehmer aus. Dazu gehören unter anderem die Sumpf-Löwenzähne, die nur auf feuchten und nährstoffarmen Wiesen vorkommen. Da diese durch die Intensivierung der Landwirtschaft selten geworden sind, gehören die Sumpf-Löwenzähne zu den seltenen und schutzwürdigen Pflanzenarten.
Dass der Kräutersammler sie ahnungslos aussticht und in den Sammelkorb wandern lässt, ist gerade wegen der selten gewordenen Vorkommen unwahrscheinlich. Um es mit Sicherheit zu vermeiden, sollte man Löwenzahn bewusst nicht auf feuchten Wiesen sammeln.
Müller, Frank/Ritz, Christiane M./Welk, Erik/Wesche, Karsten (Hg.): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband. Berlin 22 2021.
Gefährdete Pflanzenarten im Trierer Land, Teil 1
Der Lochschlund
JTS 1983
Vorwort:
Eine große Anfrage im Landtag von Rheinland-Pfalz im Sommer 1980 galt der Gefährdung von Pflanzen- und Tierarten. Die Anfrage selbst und die umfangreiche Antwort des zuständigen Ministeriums legen Zeugnis davon ab, daß auch Politiker das Seltenwerden vieler einheimischer Pflanzen und Tiere besorgt wahrnehmen. Sind diese Sorgen berechtigt? Starben nicht zu allen Zeiten der Erdgeschichte Arten aus? Man denke nur an die Riesensippe der Saurier, die ziemlich plötzlich von der Bildfläche verschwand. Hat nicht der als Umweltzerstörer angeprangerte Mensch in Mitteleuropa die Zahl der Pflanzen- und Tierarten sogar vermehrt, indem er seit frühgeschichtlicher Zeit durch seine Rodungstätigkeit die Eintönigkeit der Urwälder unterbrach und mit Wiesen, Äckern, Gebüschen, Wegrändern, Lesesteinhaufen, Gärten, Teichen, Steinmauern und Hütten zahlreiche neue Lebensformen schuf? Es besteht bei Fachleuten Einigkeit darüber, daß dies der Fall war, und es gibt bereits Schätzungen über die Zunahme der Artenzahl. Erst im Zeitalter der Technik und der Industrialisierung kehrte sich die Entwicklung um. Die rasch zunehmende Bautätigkeit, die Intensivierung der Landwirtschaft und die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen bedrohten zunehmend die Existenz empfindlicherer Pflanzen- und Tierarten.
Als wichtigste Ursache für das Seltenwerden und Aussterben hat sich die Zerstörung von Biotopen herausgestellt. Unter einem Biotop versteht man einen abgrenzbaren Raum, in dem eine bestimmte Gemeinschaft von Pflanzen und Tieren lebt. Zu den Biotopen, die dem Menschen bei der Nutzung der Landschaft oft im Wege sind, gehören z. B. Sümpfe, Heiden, Brachflächen, ausgefahrene Feldwege, verwilderte Bäche, stillgelegte Sandgruben und altes Gemäuer. Sein Bestreben geht meist dahin, solche Flächen „in Ordnung zu bringen“ oder „besser zu nutzen“. So legt er Sümpfe und nasse Wiesen trocken, forstet Brachflächen auf, begradigt Bäche und asphaltiert Feldwege. Weiß er aber mit einer Fläche gar nichts mehr anzufangen, kippt er Abfälle hin. Auch in einer Zeit gut organisierter Müllabfuhr ist dies leider gang und gäbe. Gerade auf die solchermaßen geschädigten und zerstörten Biotope ist aber eine große Zahl heimischer Lebewesen angewiesen. Eng angepaßte Arten können bei einer Biotopzerstörung nicht auf benachbarte Flächen ausweichen, sondern gehen zugrunde. Eine Schmetterlingsraupe, die an eine bestimmte Futterpflanzenart gebunden ist, verhungert, wenn man sie auf eine andere Pflanzenart setzt.
Mit dem Hinweis auf Darwins „Kampf ums Dasein“ könnte man sich auf den Standpunkt stellen, es sei ein natürlicher Vorgang, wenn sehr stark spezialisierte und dadurch anspruchsvolle und weniger robuste Arten aussterben; dies auch dann, wenn der Mensch seine Hand im Spiel hat. Man kann auch ihn als Naturfaktor betrachten.
Ein Menschenverächter mag folgenden Gedankengang anschließen: Das Naturwesen Mensch hat sich durch seine Intelligenzentwicklung gegenüber allen Lebewesen durchzusetzen vermocht. Nichts hindert es daran, sich maßlos zu vermehren. Wie alle Massenvermehrungen wird auch diese in einer Katastrophe enden, die zur Selbstausrottung führt. Dann wird die Erde wieder Ruhe haben. Auf dem Trümmerfeld, welches das Ende der kurzen Episode „Menschheitsgeschichte“ in der Erdgeschichte markiert, wird sich in Jahrmillionen Leben in neuer Artenfülle entwickeln. Es lohnt sich also nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Je eher der Mensch von der Erde verschwindet, umso besser.
Dieser kurze Ausflug in die Gedankenwelt eines Misanthropen möge klarmachen, daß Naturschutz ein Gebot der Menschlichkeit ist. Es gilt, uns und unseren Nachkommen eine Welt der Vielfalt und der Schönheit zu erhalten, in der es sich leben und nicht nur überleben läßt. Die Fülle der Pflanzen- und Tierarten ist unverzichtbarer Bestandteil einer Umwelt, in der der Mensch Ruhe und Erholung findet und schöpferische Kräfte entwickeln kann. Religiöse Menschen werden darauf verweisen, daß uns die Schöpfung anvertraut ist wie ein kostbares Gut, mit dem es behutsam umzugehen gilt. Wem diese Begründungen nicht rational genug sind, der möge über folgendes nachdenken: Mit jeder aussterbenden Pflanzen- und Tierart geht eine Fülle genetischer Information verloren. Schon mehrfach haben Züchter die Eigenschaften von Kultursorten verbessert, indem sie Wildarten einkreuzten. Nach wie vor gibt es kompliziert aufgebaute Stoffe, die von Lebewesen billiger produziert werden, als dies im chemischen Labor möglich ist. An anscheinend nutzlosen Tieren haben technisch ausgebildete Biologen schon manchen Konstruktionstrick entdeckt, der zur Verbesserung von Geräten und Maschinen benutzt werden konnte.
Ökologen rechnen uns vor, daß Lebensgemeinschaften umso anfälliger gegen Störungen sind, je geringer die Artenzahl ist. Je weniger Arten, desto größer die Gefahr der Massenvermehrung von Schädlingen, umso größer der Bedarf für die Anwendung von Giftstoffen, die ihrerseits wieder zur Verminderung der Artenzahl beitragen – ein Teufelskreis! Die Artikelserie, die mit diesem Vorwort beginnt, soll diejenigen Pflanzenarten des Trierer Landes vorstellen, die am stärksten vom Aussterben bedroht sind. In der kürzlich erschienenen Roten Liste der verschollenen und gefährdeten Blütenpflanzen von Rheinland-Pfalz sind sie unter den Gefährdungskategorien 1 und 2 („vom Aussterben bedroht“ bzw. „stark gefährdet“) eingeordnet. In den Aufsätzen wird auch erläutert, welche Ursachen im einzelnen zur Bedrohung dieser Arten geführt haben.
Der Lochschlund (Anarrhinum bellidifolium)
Dieser unauffällige Rachenblütler aus der Verwandtschaft des Löwenmäulchens gehört zu den seltensten Pflanzen Deutschlands. Er kommt in keinem anderen Bundesland als in Rheinland-Pfalz vor, und auch hier nur an der unteren Saar, im Ruwertal, im Feller Tal und im Moseltal bei Neumagen. Auch außerhalb Deutschlands hat die Pflanze nur ein beschränktes Verbreitungsgebiet. Es umfaßt Spanien und Portugal, große Teile Frankreichs, die Westschweiz und den Alpensüdrand in Italien. Man kann also Südwesteuropa als die Heimat der Pflanze bezeichnen, und ihr Verbreitungsgebiet reicht im Trierer Land gerade noch nach Deutschland hinein. In der geographischen Verbreitung einer Pflanze spiegeln sich ihre klimatischen Ansprüche. Mit einiger Vorsicht kann man deshalb schlußfolgern, daß der Lochschlund auf die milden Winter Südwesteuropas und auf die hohe Luftfeuchtigkeit der dem Atlantik angenäherten Region angewiesen ist. Er meidet das Innere des Kontinents, das durch strengere Winter und trockenere Sommer gekennzeichnet ist. Andererseits sagen ihm offenbar auch die kühlen Sommer Nord- und Nordwesteuropas nicht zu; schon in Nordwestfrankreich wächst der Lochschlund nicht mehr, erst recht nicht in Norddeutschland, Großbritannien und Skandinavien.
MH
Aber auch innerhalb des Areals, das ihm großklimatisch zusagt, ist der Lochschlund wählerisch. Er gedeiht nur in Felsspalten, auf Hangschutt, an steinigen Böschungen und auf steinigen Brachäckern. Das sind Standorte, die nur lückenhaft von Pflanzen bewachsen und deshalb der Sonne ausgesetzt sind. Bei Sonnenschein werden diese Stellen stark erwärmt, was aber wegen der sommerlichen Niederschläge und gut Wasser speichernder, lehmiger Böden fast nie zu starker Trockenheit führt. Wer sich in der Landwirtschaft auskennt, wird bestätigen können, daß Stellen, die all diese Bedingungen erfüllen, rar sind. Lückenhafter Pflanzenwuchs ist fast nie von Dauer: Über kurz oder lang kommt auf Brachflächen Gebüsch auf, und Kräuter werden verdrängt. Die Vorkommen des Lochschlunds sind deshalb unbeständig. In der Umgebung von Trier kommt die Pflanze in der Regel auf Böschungen mit Schieferschutt vor, z. B. in alten Steinbrüchen, an Weinbergswegen und am Fuß felsiger Böschungen im Weinbergsgelände. So lange solche Schieferhalden locker und in Bewegung sind, siedelt sich der Lochschlund nicht an.
Er benötigt schon etwas zur Ruhe kommenden Rohboden. Es liegt auf der Hand, daß auf solchen Böden auch bald andere Pflanzen als Konkurrenten auftreten und dem Lochschlund den Platz streitig machen. Gefahren drohen ihm aber auch von Seiten des Menschen. Flurbereinigungsmaßnahmen in Weinbergslagen führen zum Verschwinden kleiner Brachflächen und Felsriegel. Herbizide driften bei Hubschrauberspritzungen ab und beeinträchtigen die Wildpflanzen auf all den kleinen Flächen, auf denen sie inmitten des bewirtschafteten Landes Zuflucht gefunden haben. Durch solche Einwirkungen sind in den letzten Jahren fast alle Vorkommen des Lochschlunds im unteren Saartal, bei Wawern, Ockfen usw. vernichtet worden. Die meisten Fundstellen liegen heute im Ruwertal bei Waldrach. Neu entdeckt wurden Vorkommen im Feller Tal und bei Neumagen.
Am wenigstens Gefahr droht dem Lochschlund durch das Blumenpflücken. Obwohl er 70 cm hoch werden kann, ist er – wie bereits erwähnt – sehr unauffällig. Als ausdauernde Pflanze (Staude) bringt er nach der Keimung zunächst eine Blattrosette hervor, die der Erde dicht angeschmiegt ist. Die Rosettenblätter sind über einen Zentimeter breit und stark gezähnt. Wegen einer gewissen Ähnlichkeit der Blattrosette mit der des Gänseblümchens hat der Lochschlund den wissenschaftlichen Artnamen „bellidifolium“, d. h. „gänseblümchenblättrig“ bekommen. Völlig andere Gestalt haben die vielen Blättchen an den langen, steif aufgerichteten Stengeln. Sie sind beinahe so schmal wie Tannennadeln. Die blauen Blütchen sind nur wenige Millimeter lang, haben eine gebogene Röhre und nahe dem Blütenstiel einen winzigen, nach vorn gerichteten Sporn. An ihrer Mündung, die wie ein kleines rundes Loch aussieht (daher der Name Lochschlund) bildet die Blütenröhre einen flachen Saum mit mehreren Lappen. Alles dies ist fast nur mit der Lupe zu sehen.
Vom Frühsommer bis in den Herbst hinein entwickelt die Pflanze eine Vielzahl an Blüten. Der in die Länge wachsende Stengel produziert an seiner Spitze laufend neue Knospen. Von unten nach oben schreitet das Aufblühen der Knospen fort, und im Hochsommer findet man an derselben Pflanze Knospen, offene Blüten, verwelkte Blüten, unreife und schon reife Früchte. Die so wählerische Pflanze hat es nötig, eine Unzahl von Samen zu produzieren. Nur wenige davon haben die Chance, an einen neuen geeigneten Wuchsort zu gelangen. Vor Jahren glückte es dem Lochschlund bei Waldrach, eine durch Baggerarbeiten an einem Feldweg neu entstandene Böschung neu zu besiedeln. Diese Stelle liegt abseits der Weinbergsflur, so daß vorerst keine Beeinträchtigung durch Herbizide zu befürchten ist. Hoffen wir, daß dort und anderswo der Lochschlund als Spezialität der trierischen Flora erhalten bleibt.
Literatur:
Busch, P.J. (1939): Drei seltene Pflanzen des Trierer Gebietes. - Rhein. Heimtpfl. 11 143. HEGI, G. (1956): Illustrierte Flora von Mitteleuropa VI/1. München.
Die steif aufrechten Stengel tragen ganz schmale Blättchen, winzige Blüten und zahlreiche Früchte.MH
Der Efeublättrige Hahnenfuß (Ranunculus hederaceus)
JTS 1990
Als der Mensch in frühgeschichtlicher Zeit seßhaft wurde und Landwirtschaft zu betreiben begann, hatte dies zumindest im mitteleuropäischen Raum zur Folge, daß die Zahl der Pflanzen- und Tierarten stetig zunahm. Durch das Roden des Waldes, durch extensive Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, durch das Bauen mit Steinen und Holz entstand eine Vielzahl von Biotopen. In ihnen konnten sich auch solche Pflanzen- und Tierarten ansiedeln, die in einer durchweg von Wald bedeckten Urlandschaft keine geeigneten Lebensstätten gefunden hätten.
Nach einem Höhepunkt biologischer Vielfalt im 18. und 19. Jahrhundert führte dann die Intensivierung aller Wirtschaftsbereiche zu dem dramatischen Artenrückgang, den man heute mit geringem Erfolg durch Naturschutzmaßnahmen zu bremsen versucht. Neben den Arten, die früher recht häufig waren und eindeutig durch Intensivierungsmaßnahmen wie Düngung, Drainage, Saatgutreinigung usw. selten geworden sind, gibt es aber auch einige, die so ausgefallene Ansprüche an ihre Umwelt stellen, daß sie schon immer nur an vereinzelten Stellen leben konnten. Zu ihnen gehört der Efeublättrige Hahnenfuß. Er benötigt zum Gedeihen folgende Umweltbedingungen: ständig nasse, saure und humusarme Schlamm- oder Sandböden; kühles, langsam fließendes Wasser, welches den Boden seicht bedeckt oder ihn zumindest tränkt; volles Tageslicht oder höchstens sehr schwache Beschattung; wohl hauptsächlich wegen dieses Lichtbedürfnisses keine Konkurrenz durch andere Pflanzen. Wer genug Phantasie hat, sich unsere Landschaft vorzustellen (auch in naturnahem Zustand), wird erkennen, daß dies beinahe unerfüllbare Ansprüche sind. Seichtes, kühles Wasser mit Sand- oder Schlammbänken gibt es nur in Quellbächen höherer Lagen – und die fließen normalerweise im Wald und somit in mehr oder weniger starkem Schatten.
Passieren solche Bäche Wiesengelände, sind ihre Sand- oder Schlammufer meist üppig mit Röhrichten bewachsen. Stärkere Bäche, die durch Unterspülen von Ufern Abbrüche bewirken, gelegentlich ihren Lauf verlegen und dadurch immer wieder offene Schlamm- und Sandbänke schaffen, haben dann, wenn sie langsam fließen, im Sommer nicht das vom Efeublättrigen Hahnenfuß benötigte kühle Wasser. Am ehesten ist das noch in Gegenden der Fall, wo aus klimatischen Gründen die Erwärmung des Wassers im Sommer gering ist. Das trifft für Gebiete mit stark ozeanischem Klima zu, und so überrascht es nicht, daß der Efeublättrige Hahnenfuß nur im westlichsten Europa vorkommt.
Schon in unserer Gegend erreicht er die Ostgrenze seiner natürlichen Verbreitung. Nach alledem braucht es nicht zu verwundern, daß es in Rheinland-Pfalz nur eine Handvoll Stellen gibt, an denen diese wählerische Pflanze vorkommt. Offenbar gab es diese Handvoll Stellen durch die Jahrhunderte hindurch, denn auch in der älteren botanischen Literatur werden immer wieder vereinzelte Fundorte der Pflanze genannt. Im 19. Jahrhundert waren sie offenbar noch etwas zahlreicher als heute. Es dürften allerdings nicht permanent die gleichen Stellen gewesen sein, die dem Hahnenfuß die geeigneten Lebensbedingungen boten; denn langfristig gab es auch schon früher immer wieder Veränderungen in der Landschaft. Somit war es für sein Überleben entscheidend, daß seine Samen neu entstandene geeignete Biotope möglichst bald erreichten.
Der Efeublättrige Hahnenfuß hat dazu eine Strategie entwickelt, die man bei vielen Wasserpflanzen findet. Seine Früchte haften am Gefieder von Wasservögeln, z. B. Enten. Diese kommen ja weit herum und lassen sich gerne an seichten, schlammigen Gewässern nieder. So ist es zu erklären, daß der Efeublättrige Hahnenfuß wie viele Wasserpflanzen immer wieder einmal an neuen Orten ohne Zutun des Menschen auftaucht. Nachdem nun so viel über den Hahnenfuß gesagt wurde, ist es Zeit, mit seinem Aussehen bekannt zu machen. Er unterscheidet sich darin stark von den bekannten Hahnenfußarten unserer Wiesen, die ja im Volksmund auch Butterblumen heißen. Wie alle Wasser-Hahnenfußarten, die auch als Froschkraut bezeichnet werden, blüht er weiß. Seine Blüten sind nur wenige Millimeter groß und sitzen einzeln und unauffällig auf ziemlich langen Stielchen an verzweigten Stengeln. Diese wachsen flach auf dem Schlamm entlang und verankern sich immer wieder mit Büscheln von Wurzeln. Die Blätter sind rundlich bis nierenförmig und leicht gebuchtet. Dadurch erinnern sie entfernt an Efeublätter.
Im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wurde die Pflanze an mehreren Orten des Kreisgebietes gefunden: bei Ayl, Könen, zwischen Konz und Wiltingen, bei Irsch, Krettnach, Oberemmel, Obermennig, Oberzerf, Ollmuth, Reinsfeld, zwischen Ruwer und Grünhaus und bei Tawern. Auch im Randbereich der Stadt Trier (Ehrang, Grüneberg, Olewiger Tal) gab es Fundstellen. Danach hörte man von der Pflanze nichts mehr. Das bedeutet nicht unbedingt, daß sie verschwunden war. Es wird eher darauf zurückzuführen sein, daß in der Zeit der beiden Weltkriege botanische Heimatforschung nicht mehr so intensiv betrieben wurde wie zuvor. Erst 1978 gelang es dem Verfasser, die Pflanze im Kreisgebiet wieder nachzuweisen, und zwar an einem ganz neuen Fundort bei Schillingen im Hochwald.
Besondere Verhältnisse, die mit der Grünlandwirtschaft zusammenhängen, ermöglichen dort dem Efeublättrigen Hahnenfuß gutes Gedeihen. Um es kurz und bündig zu sagen: Er verdankt Kühen seine Existenz.
Der Flonterbach fließt dort als kleiner Quellbach durch Viehweiden. Der Bach bildet nicht, wie das meist der Fall ist, die Grundstücksgrenze; die Parzellen reichen vielmehr über den Bach hinweg. Dadurch haben die Kühe ungehinderten Zugang zum Bach, den sie als Tränke benutzen. Das wiederum hat zur Folge, daß das Bachufer zertrampelt wird. Dadurch kann nicht die hochwüchsige Staudenvegetation entstehen, die man sonst an Bachufern findet.
TMu
Vielmehr erzeugt der Viehtritt einen regelrechten Morast mit vielen offenen Schlammstellen und zahlreichen kleinen Tümpeln. Das sind ideale Biotope für den Efeublättrigen Hahnenfuß. Der Einfluß von Düngestoffen, den die intensive Beweidung mit sich bringt, stört den Hahnenfuß nicht. Die Angabe, er benötige reines, nährstoffarmes Wasser, die man in älterer Fachliteratur und selbst in einigen neueren Veröffentlichungen findet, wurde inzwischen durch zahlreiche Beobachtungen widerlegt.
Der Fortbestand des Vorkommens bei Schillingen ist demnach nur gewährleistet, wenn die Weidewirtschaft in der bisherigen Weise fortgeführt wird. Die für den Naturschutz zuständigen Behörden sollten also möglichst bald mit dem Eigentümer der Viehweiden Kontakt aufnehmen und klären, ob die Bewirtschaftung der Wiesen auch für die Zukunft gesichert ist. Auch muß ein wachsames Auge auf den Bach geworfen werden. Seine Wassermenge und -temperatur darf sich nicht verändern. Ersteres könnte geschehen, wenn in seinem Quellgebiet Trinkwasser gewonnen, letzteres, wenn sein Lauf durch Teiche unterbrochen wurde.
Im Sommer 1989 sah es beinahe so aus, als habe man dem Hahnenfuß den Garaus gemacht. Wohl wegen starker Vernässung der Ufer hatten die Eigentümer das Bachbett neu ausgehoben.
Das geschah jedoch behutsam und der sachkundige Botaniker sah sofort, daß die Maßnahme dem Hahnenfuß nicht geschadet hat – im Gegenteil: auf dem Schlammauswurf beiderseits des Baches waren im Spätsommer zahlreiche junge Sprossen zu sehen. Teilweise waren sie so winzig, daß man sie nur bei intensivem Absuchen finden konnte. In den kommenden Jahren dürfte deshalb mit einer guten Entwicklung des Vorkommens zu rechnen sein.
Der Verfasser hat inzwischen schon etliche schlammige Viehweiden mit kleinen Bächen vergeblich nach dem Efeublättrigen Hahnenfuß abgesucht. Dort waren die Wuchsbedingungen zum Teil genau so günstig wie in Schillingen. Was offenbar fehlte, war der Besuch von Enten, die zufällig Früchte des Hahnenfußes im Gefieder hängen hatten. Wann mag so ein Entenbesuch in Schillingen stattgefunden haben? Wie bei so vielen seltenen Zufallsereignissen in der Natur wird man dies nie erfahren.
Literatur:
Andres, H. (1920): Flora des mittelrheinischen Berglandes. - 396 S., Wittlich





























