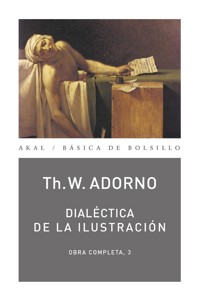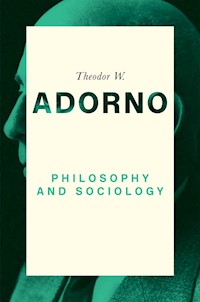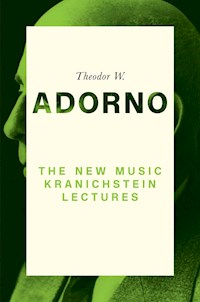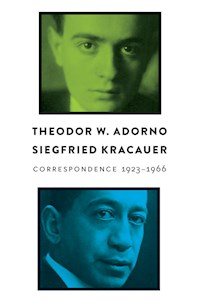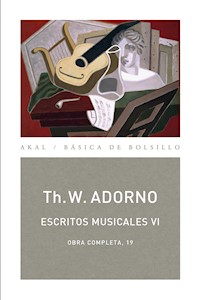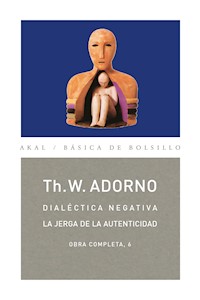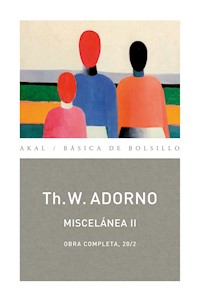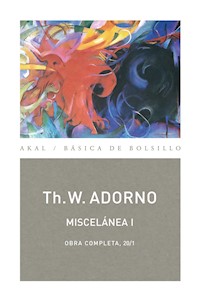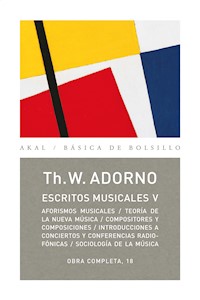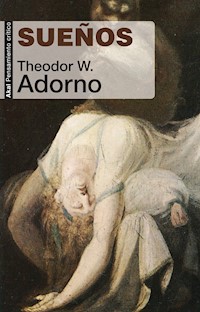23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ästhetische Theorie Paralipomena Frühe Einleitung Editorisches Nachwort Namenregister Übersicht
Das E-Book Gesammelte Schriften in 20 Bänden wird angeboten von Suhrkamp Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Adorno;Ästhetik;ästhetische Theorie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 982
Ähnliche
Theodor W. Adorno
Ästhetische Theorie
Suhrkamp
Inhalt
Ästhetische Theorie
Paralipomena
Frühe Einleitung
Editorisches Nachwort
Begriffsregister
Namenregister
Die aus dem Nachlaß herausgegebene »Ästhetische Theorie« wurde vom Autor nicht vollendet.
7Ästhetische Theorie
9Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Die Einbuße an reflexionslos oder unproblematisch zu Tuendem wird nicht kompensiert durch die offene Unendlichkeit des möglich Gewordenen, der die Reflexion sich gegenübersieht. Erweiterung zeigt in vielen Dimensionen sich als Schrumpfung. Das Meer des nie Geahnten, auf das die revolutionären Kunstbewegungen um 1910 sich hinauswagten, hat nicht das verhießene abenteuerliche Glück beschieden. Statt dessen hat der damals ausgelöste Prozeß die Kategorien angefressen, in deren Namen er begonnen wurde. Mehr stets wurde in den Strudel des neu Tabuierten hineingerissen; allerorten freuten die Künstler weniger sich des neu gewonnenen Reiches der Freiheit, als daß sie sogleich wieder nach vorgeblicher, kaum je tragfähiger Ordnung trachteten. Denn die absolute Freiheit in der Kunst, stets noch einem Partikularen, gerät in Widerspruch zum perennierenden Stande von Unfreiheit im Ganzen. In diesem ist der Ort der Kunst ungewiß geworden. Die Autonomie, die sie erlangte, nachdem sie ihre kultische Funktion und deren Nachbilder abschüttelte, zehrte von der Idee der Humanität. Sie wurde zerrüttet, je weniger Gesellschaft zur humanen wurde. In der Kunst verblaßten kraft ihres eigenen Bewegungsgesetzes die Konstituentien, die ihr aus dem Ideal der Humanität zugewachsen waren. Wohl bleibt ihre Autonomie irrevokabel. Alle Versuche, durch gesellschaftliche Funktion der Kunst zurückzuerstatten, woran sie zweifelt und woran zu zweifeln sie ausdrückt, sind gescheitert. Aber ihre Autonomie beginnt, ein Moment von Blindheit hervorzukehren. Es eignete der Kunst von je; im Zeitalter ihrer Emanzipation überschattet es jedes andere, trotz, wenn nicht wegen der Unnaivetät, der sie schon nach Hegels Einsicht nicht mehr sich entziehen darf. Jene 10verbindet sich mit Naivetät zweiter Potenz, der Ungewißheit über das ästhetische Wozu. Ungewiß, ob Kunst überhaupt noch möglich sei; ob sie, nach ihrer vollkommenen Emanzipation, nicht ihre Voraussetzungen sich abgegraben und verloren habe. Die Frage entzündet sich an dem, was sie einmal war. Kunstwerke begeben sich hinaus aus der empirischen Welt und bringen eine dieser entgegengesetzte eigenen Wesens hervor, so als ob auch diese ein Seiendes wäre. Damit tendieren sie a priori, mögen sie noch so tragisch sich aufführen, zur Affirmation. Die Clichés von dem versöhnenden Abglanz, der von der Kunst über die Realität sich verbreite, sind widerlich nicht nur, weil sie den emphatischen Begriff von Kunst durch deren bourgeoise Zurüstung parodieren und sie unter die trostspendenden Sonntagsveranstaltungen einreihen. Sie rühren an die Wunde der Kunst selber. Durch ihre unvermeidliche Lossage von der Theologie, vom ungeschmälerten Anspruch auf die Wahrheit der Erlösung, eine Säkularisierung, ohne welche Kunst nie sich entfaltet hätte, verdammt sie sich dazu, dem Seienden und Bestehenden einen Zuspruch zu spenden, der, bar der Hoffnung auf ein Anderes, den Bann dessen verstärkt, wovon die Autonomie der Kunst sich befreien möchte. Solchen Zuspruchs ist das Autonomieprinzip selbst verdächtig: indem es sich vermißt, Totalität aus sich zu setzen, ein Rundes, in sich Geschlossenes, überträgt dies Bild sich auf die Welt, in der Kunst sich befindet und die diese zeitigt. Vermöge ihrer Absage an die Empirie – und die ist in ihrem Begriff, kein bloßes escape, ist ein ihr immanentes Gesetz – sanktioniert sie deren Vormacht. Helmut Kuhn hat in einer Abhandlung, zum Ruhm der Kunst, dieser attestiert, ein jedes ihrer Werke sei Lobpreisung[1]. Seine These wäre wahr, wenn sie kritisch wäre. Angesichts dessen, wozu die Realität sich auswuchs, ist das affirmative Wesen der Kunst, ihr unausweichlich, zum Unerträglichen geworden. Sie muß gegen das sich wenden, was ihren eigenen Begriff ausmacht, und wird dadurch ungewiß bis in die innerste Fiber hinein. Nicht jedoch ist sie durch ihre abstrakte Negation abzufertigen. Indem sie angreift, was die gesamte Tradition hindurch als ihre Grundschicht garantiert dünkte, verändert sie sich 11qualitativ, wird ihrerseits zu einem Anderen. Sie vermag es, weil sie die Zeiten hindurch vermöge ihrer Form ebenso gegen das bloß Daseiende, Bestehende sich wendete, wie als Formung der Elemente des Bestehenden diesem zu Hilfe kam. So wenig ist sie auf die generelle Formel des Trostes zu bringen wie auf die von dessen Gegenteil.
Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich verändernden Konstellation von Momenten; er sperrt sich der Definition. Nicht ist ihr Wesen aus ihrem Ursprung deduzibel, so als wäre das Erste eine Grundschicht, auf der alles Folgende aufbaute und einstürzte, sobald sie erschüttert ist. Der Glaube, die ersten Kunstwerke seien die höchsten und reinsten, ist späteste Romantik; nicht mit minderem Recht ließe sich vertreten, die frühesten kunsthaften Gebilde, ungeschieden von magischen Praktiken, geschichtlicher Dokumentation, pragmatischen Zwecken wie dem, durch Rufe oder geblasene Töne über weite Strecken sich vernehmbar zu machen, seien trüb und unrein; die klassizistische Konzeption bediente sich gern solcher Argumente. Derb historisch verlaufen die Daten sich ins Vage[2]. Der Versuch, die historische Genese von Kunst unter ein supremes Motiv ontologisch zu subsumieren, verlöre notwendig sich in so Disparates, daß die Theorie nichts in Händen behielte als die freilich relevante Einsicht, daß die Künste in keiner bruchlosen Identität der Kunst sich einordnen lassen[3]. In Betrachtungen, die den ästhetischen ἀρχαί gewidmet sind, wuchern die positivistische Materialsammlung und die sonst den Wissenschaften verhaßte Spekulation wild nebeneinander; Bachofen wäre das größte Beispiel. Wollte man statt dessen nach philosophischem Brauch die sogenannte Ursprungsfrage als eine des Wesens von der genetischen nach der Urgeschichte kategorisch scheiden, so überführte man sich der Willkür dadurch, daß man dabei den Begriff des Ursprungs gegen seinen widerstrebenden Wortsinn verwendete. Die Definition dessen, was Kunst sei, ist allemal von dem vorgezeichnet, was sie einmal war, legitimiert sich aber nur an dem, wozu sie geworden 12ist, offen zu dem, was sie werden will und vielleicht werden kann. Während ihre Differenz von der bloßen Empirie festzuhalten ist, verändert sie sich doch qualitativ in sich; manches, kultische Gebilde etwa, verwandelt sich durch die Geschichte in Kunst, die es nicht gewesen ist; manches, was Kunst war, ist es nicht länger. Die von oben her gestellte Frage, ob ein Phänomen wie der Film noch Kunst sei oder nicht, führt nirgendwohin. Das Gewordensein von Kunst verweist ihren Begriff auf das, was sie nicht enthält. Die Spannung zwischen dem, wovon Kunst getrieben ward, zu ihrer Vergangenheit umschreibt die sogenannten ästhetischen Konstitutionsfragen. Deutbar ist Kunst nur an ihrem Bewegungsgesetz, nicht durch Invarianten. Sie bestimmt sich im Verhältnis zu dem, was sie nicht ist. Das spezifisch Kunsthafte an ihr ist aus ihrem Anderen: inhaltlich abzuleiten; das allein genügte irgend der Forderung einer materialistisch-dialektischen Ästhetik. Sie spezifiziert sich an dem, wodurch sie von dem sich scheidet, woraus sie wurde; ihr Bewegungsgesetz ist ihr eigenes Formgesetz. Sie ist nur im Verhältnis zu ihrem Anderen, ist der Prozeß damit. Axiomatisch ist für eine umorientierte Ästhetik die vom späten Nietzsche gegen die traditionelle Philosophie entwickelte Erkenntnis, daß auch das Gewordene wahr sein kann. Die traditionelle, von ihm demolierte Ansicht wäre auf den Kopf zu stellen: Wahrheit ist einzig als Gewordenes. Was am Kunstwerk als seine eigene Gesetzlichkeit auftritt, ist spätes Produkt der innertechnischen Evolution sowohl wie der Stellung von Kunst mitten in fortschreitender Säkularisation; fraglos indessen sind die Kunstwerke nur, indem sie ihren Ursprung negierten, zu Kunstwerken geworden. Nicht ist ihnen die Schmach ihrer alten Abhängigkeit von faulem Zauber, Herrendienst und Divertissement als Erbsünde vorzuhalten, nachdem sie einmal rückwirkend vernichtet haben, woraus sie hervorgingen. Weder ist die Tafelmusik der befreiten unentrinnbar, noch war die Tafelmusik ehrwürdiger Dienst am Menschen, dem autonome Kunst frevelnd sich entzöge. Ihr verächtliches Klappern wird darum nicht besser, weil der überwältigende Teil alles dessen, was heute die Menschen als Kunst erreicht, das Echo jenes Geklappers auswalzt. Die Hegelsche Perspektive eines möglichen Absterbens der Kunst 13ist ihrem Gewordensein gemäß. Daß er sie als vergänglich dachte und gleichwohl dem absoluten Geist zurechnete, harmoniert mit dem Doppelcharakter seines Systems, veranlaßt aber zu einer Konsequenz, die er nie würde gezogen haben: der Gehalt der Kunst, nach seiner Konzeption ihr Absolutes, geht nicht auf in der Dimension ihres Lebens und Todes. Sie könnte ihren Gehalt in ihrer eigenen Vergänglichkeit haben. Vorstellbar und keine bloß abstrakte Möglichkeit, daß große Musik – ein Spätes – nur in einer beschränkten Periode der Menschheit möglich war. Die Revolte der Kunst, teleologisch gesetzt in ihrer ›Stellung zur Objektivität‹, der geschichtlichen Welt, ist zu ihrer Revolte gegen die Kunst geworden; müßig zu prophezeien, ob sie das überdauert. Worüber einmal reaktionärer Kulturpessimismus zeterte, ist von der Kritik an der Kultur nicht zu unterdrücken: daß, wie Hegel vor hundertundfünfzig Jahren erwog, Kunst ins Zeitalter ihres Untergangs könnte eingetreten sein. Wie Rimbauds ungeheures Wort vor hundert Jahren die Geschichte der neuen Kunst antezipierend bis zum äußersten in sich vollzog, antezipierte sein Verstummen, seine Einordnung als Angestellter, die Tendenz. Ästhetik heute hat keine Macht darüber, ob sie zum Nekrolog für die Kunst wird; nicht aber darf sie den Leichenredner spielen; generell das Ende konstatieren, am Vergangenen sich laben und, gleichgültig unter welchem Titel, zur Barbarei überlaufen, die nicht besser ist als die Kultur, die Barbarei als Vergeltung für ihr barbarisches Unwesen sich verdient hat. Der Gehalt der vergangenen Kunst, mag Kunst nun selbst abgeschafft werden, sich abschaffen, vergehen oder verzweifelt sich fortsetzen, muß aber nicht selber notwendig hinab. Er vermöchte die Kunst zu überleben in einer Gesellschaft, die der Barbarei ihrer Kultur ledig geworden wäre. Nicht Formen bloß sondern ungezählte Stoffe sind jetzt schon abgestorben: die Literatur über Ehebruch, die den Viktorianischen Teil des neunzehnten und früheren zwanzigsten Jahrhunderts ausfüllt, ist nach der Auflösung der hochbürgerlichen Kleinfamilie und der Lockerung der Monogamie kaum mehr unmittelbar nachvollziehbar; nur in der Vulgärliteratur der Illustrierten lebt sie dürftig und verkehrt nach. Ebenso jedoch hat längst schon das Authentische der Madame Bovary, einst ihrem Sachgehalt eingesenkt, diesen und sei14nen Niedergang überflügelt. Das freilich darf nicht zum geschichtsphilosophischen Optimismus des Glaubens an den unbesieglichen Geist verleiten. Der Stoffgehalt mag auch, was mehr ist, in seinen Sturz hinabreißen. Hinfällig aber sind Kunst und Kunstwerke, weil sie, nicht bloß als heteronom abhängige, sondern bis in die Bildung ihrer Autonomie hinein, welche die gesellschaftliche Setzung arbeitsteiligen und abgespaltenen Geistes ratifiziert, nicht nur Kunst sondern auch ein dieser Fremdes, Entgegengesetztes sind. Ihrem eigenen Begriff ist das Ferment beigemengt, das ihn aufhebt.
Unabdingbar bleibt der ästhetischen Brechung das, was gebrochen wird; der Imagination das, was sie vorstellt. Das gilt vorab für die immanente Zweckmäßigkeit. Im Verhältnis zur empirischen Realität sublimiert Kunst das dort waltende Prinzip des sese conservare zum Ideal des Selbstseins ihrer Erzeugnisse; man malt, nach Schönbergs Wort, ein Bild, nicht, was es darstellt. Von sich aus will jedes Kunstwerk die Identität mit sich selbst, die in der empirischen Wirklichkeit gewalttätig allen Gegenständen als die mit dem Subjekt aufgezwungen und dadurch versäumt wird. Ästhetische Identität soll dem Nichtidentischen beistehen, das der Identitätszwang in der Realität unterdrückt. Nur vermöge der Trennung von der empirischen Realität, die der Kunst gestattet, nach ihrem Bedürfnis das Verhältnis von Ganzem und Teilen zu modeln, wird das Kunstwerk zum Sein zweiter Potenz. Kunstwerke sind Nachbilder des empirisch Lebendigen, soweit sie diesem zukommen lassen, was ihnen draußen verweigert wird, und dadurch von dem befreien, wozu ihre dinghaft-auswendige Erfahrung sie zurichtet. Während die Demarkationslinie zwischen der Kunst und der Empirie nicht und am letzten durch Heroisierung des Künstlers verwischt werden darf, haben gleichwohl die Kunstwerke Leben sui generis. Es ist nicht bloß ihr auswendiges Schicksal. Die bedeutenden kehren stets neue Schichten hervor, altern, erkalten, sterben. Daß sie als Artefakte, menschliche Hervorbringungen nicht unmittelbar leben wie Menschen, ist eine Tautologie. Aber der Akzent auf dem Moment des Artefakts in der Kunst gilt weniger ihrem Hervorgebrachtsein als ihrer eigenen Beschaffenheit, gleichgültig, wie sie zustande kam. Lebendig sind sie als sprechende, auf eine Weise, 15wie sie den natürlichen Objekten, und den Subjekten, die sie machten, versagt ist. Sie sprechen vermöge der Kommunikation alles Einzelnen in ihnen. Dadurch treten sie in Kontrast zur Zerstreutheit des bloß Seienden. Gerade als Artefakte aber, Produkte gesellschaftlicher Arbeit, kommunizieren sie auch mit der Empirie, der sie absagen, und aus ihr ziehen sie ihren Inhalt. Kunst negiert die der Empirie kategorial aufgeprägten Bestimmungen und birgt doch empirisch Seiendes in der eigenen Substanz. Opponiert sie der Empirie durchs Moment der Form – und die Vermittlung von Form und Inhalt ist nicht zu fassen ohne deren Unterscheidung –, so ist die Vermittlung einigermaßen allgemein darin zu suchen, daß ästhetische Form sedimentierter Inhalt sei. Die dem Anschein nach reinsten Formen, die traditionell musikalischen, datieren bis in alle idiomatischen Details hinein auf Inhaltliches wie den Tanz zurück. Ornamente waren vielfach einst kultische Symbole.
Eine Rückbeziehung ästhetischer Formen auf Inhalte, wie sie am spezifischen Gegenstand des Nachlebens der Antike die Schule des Warburginstituts durchführte, wäre umfassender zu leisten. Die Kommunikation der Kunstwerke mit dem Auswendigen jedoch, mit der Welt, vor der sie selig oder unselig sich verschließen, geschieht durch Nicht-Kommunikation; darin eben erweisen sie sich als gebrochen. Leicht ließe sich denken, daß ihr autonomes Reich mit der auswendigen Welt nicht mehr gemein hat als entlehnte Elemente, die in einen gänzlich veränderten Zusammenhang treten. Trotzdem ist die geistesgeschichtliche Trivialität unbestreitbar, daß die Entwicklung der künstlerischen Verfahrungsweisen, wie sie meist unter dem Begriff des Stils zusammengefaßt wird, der gesellschaftlichen korrespondiert. Noch das sublimste Kunstwerk bezieht bestimmte Stellung zur empirischen Realität, indem es aus deren Bann heraustritt, nicht ein für allemal, sondern stets wieder konkret, bewußtlos polemisch gegen dessen Stand zur geschichtlichen Stunde. Daß die Kunstwerke als fensterlose Monaden das ›vorstellen‹, was sie nicht selbst sind, ist kaum anders zu begreifen als dadurch, daß ihre eigene Dynamik, ihre immanente Historizität als Dialektik von Natur und Naturbeherrschung nicht nur desselben Wesens ist wie die auswendige, sondern in sich jener ähnelt, ohne sie zu imitieren. Die ästhetische Produktiv16kraft ist die gleiche wie die der nützlichen Arbeit und hat in sich dieselbe Teleologie; und was ästhetisches Produktionsverhältnis heißen darf, alles worin die Produktivkraft sich eingebettet findet und woran sie sich betätigt, sind Sedimente oder Abdrücke der gesellschaftlichen. Der Doppelcharakter der Kunst als autonom und als fait social teilt ohne Unterlaß der Zone ihrer Autonomie sich mit. In solcher Relation zur Empirie erretten sie, neutralisiert, was einmal die Menschen buchstäblich und ungeschieden am Dasein erfuhren, und was aus diesem der Geist vertrieb. An Aufklärung partizipieren sie, weil sie nicht lügen: die Buchstäblichkeit dessen, was aus ihnen spricht, nicht vortäuschen. Real aber sind sie als Antworten auf die Fragegestalt des von außen ihnen Zukommenden. Ihre eigene Spannung ist triftig im Verhältnis zu der draußen. Die Grundschichten der Erfahrung, welche die Kunst motivieren, sind der gegenständlichen Welt, vor der sie zurückzucken, verwandt. Die ungelösten Antagonismen der Realität kehren wieder in den Kunstwerken als die immanenten Probleme ihrer Form. Das, nicht der Einschuß gegenständlicher Momente, definiert das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft. Die Spannungsverhältnisse in den Kunstwerken kristallisieren sich rein in diesen und treffen durch ihre Emanzipation von der faktischen Fassade des Auswendigen das reale Wesen. Kunst, χωρίς vom empirisch Daseienden, bezieht dazu Position gemäß dem Hegelschen Argument wider Kant, sobald man eine Schranke setze, überschreite man durch diese Setzung sie bereits und nehme in sich hinein, wogegen sie errichtet war. Das allein, kein Moralisieren, ist die Kritik am Prinzip l’art pour l’art, das in abstrakter Negation den χωρισμός der Kunst zu ihrem Ein und Allen macht. Die Freiheit der Kunstwerke, deren ihr Selbstbewußtsein sich rühmt und ohne die sie nicht wären, ist die List ihrer eigenen Vernunft. All ihre Elemente ketten sie an das, was zu überfliegen ihr Glück ausmacht und worein sie in jedem Augenblick abermals zu versinken drohen. Im Verhältnis zur empirischen Realität erinnern sie an das Theologumenon, daß im Stand der Erlösung alles sei, wie es ist und gleichwohl alles ganz anders. Unverkennbar die Analogie zur Tendenz der Profanität, den sakralen Bereich zu säkularisieren, bis dieser allein noch säkularisiert sich erhält; der Sakralbereich wird gleichsam 17vergegenständlicht, von Pfählen eingegrenzt, weil sein eigenes Moment von Unwahrheit auf die Säkularisation ebenso wartet, wie beschwörend sie abwehrt. Danach wäre der reine Begriff von Kunst nicht der Umfang eines ein für allemal gesicherten Bereichs, sondern stellte jeweils erst sich her, in augenblicklicher und zerbrechlicher Balance, der psychologischen von Ich und Es mehr als nur zu vergleichen. Der Prozeß des sich Abstoßens muß immerwährend sich erneuern. Jedes Kunstwerk ist ein Augenblick; jedes gelungene ein Einstand, momentanes Innehalten des Prozesses, als der es dem beharrlichen Auge sich offenbart. Sind die Kunstwerke Antworten auf ihre eigene Frage, so werden sie dadurch selber erst recht zu Fragen. Der bis heute von der allerdings ihrerseits mißlungenen Bildung nicht beeinträchtigte Hang, Kunst außer- oder vorästhetisch wahrzunehmen, ist nicht nur barbarischer Rückstand oder Not des Bewußtseins Regredierender.
Etwas in der Kunst kommt ihm entgegen. Wird sie strikt ästhetisch wahrgenommen, so wird sie ästhetisch nicht recht wahrgenommen. Einzig wo das Andere der Kunst mitgefühlt wird als eine der ersten Schichten der Erfahrung von ihr, ist diese zu sublimieren, die stoffliche Befangenheit zu lösen, ohne daß das Fürsichsein der Kunst zu einem Gleichgültigen würde. Sie ist für sich und ist es nicht, verfehlt ihre Autonomie ohne das ihr Heterogene. Die großen Epen, die noch ihr Vergessenwerden überstanden, waren zu ihrer Zeit vermengt mit historischem und geographischem Bericht; der Artist Valéry hat sich vorgehalten, wie vieles nicht in die Formgesetzlichkeit Umgeschmolzene in den Homerischen wie den heidnisch-germanischen und christlichen Epen sich behauptet, ohne daß das, gegenüber den schlackenlosen Gebilden, ihren Rang minderte. Ähnlich war die Tragödie, von der die Idee ästhetischer Autonomie abgezogen sein dürfte, Nachbild von als realer Wirkungszusammenhang gemeinten Kulthandlungen. Die Geschichte der Kunst als die des Fortschritts ihrer Autonomie hat jenes Moment nicht exstirpieren können, und nicht bloß ihrer Fesseln wegen. Der realistische Roman hatte auf seiner Höhe als Form im neunzehnten Jahrhundert etwas von dem, wozu ihn die Theorie des sogenannten sozialistischen Realismus planvoll erniedrigte, von Reportage, der Vorwegnahme dessen, was dann die Sozialwissenschaft ermitteln sollte. 18Der Fanatismus sprachlicher Durchbildung in der Madame Bovary ist wahrscheinlich Funktion eben jenes ihm konträren Moments; die Einheit von beiden ist ihre unverwelkte Aktualität. Das Kriterium der Kunstwerke ist doppelschlächtig: ob es ihnen glückt, ihre Stoffschichten und Details dem ihnen immanenten Formgesetz zu integrieren und in solcher Integration das ihr Widerstrebende, sei’s auch mit Brüchen, zu erhalten. Integration als solche schützt nicht die Qualität; in der Geschichte der Kunstwerke trennen sich vielfach beide Momente. Denn keine einzelne auserwählte Kategorie, auch nicht die ästhetisch zentrale des Formgesetzes, nennt das Wesen der Kunst und reicht hin zum Urteil über ihre Produkte. Ihr gehören essentiell Bestimmungen zu, die ihrem festen kunstphilosophischen Begriff widersprechen. Hegels Inhaltsästhetik hat jenes der Kunst immanente Moment ihrer Andersheit erkannt und die Formalästhetik überflügelt, die scheinbar mit einem soviel reineren Begriff von Kunst operiert, allerdings auch geschichtliche Entwicklungen freiläßt, die von der Hegelschen und Kierkegaardschen Inhaltsästhetik blockiert sind, wie die zur ungegenständlichen Malerei. Zugleich jedoch regrediert die idealistische Dialektik Hegels, die Form als Inhalt denkt, auf eine vorästhetisch krude. Sie verwechselt die abbildende oder diskursive Behandlung von Stoffen mit jener für Kunst konstitutiven Andersheit. Hegel vergeht sich gleichsam gegen die eigene dialektische Konzeption von Ästhetik, mit für ihn unabsehbaren Folgen; er hat der banausischen Überführung von Kunst in Herrschaftsideologie Vorschub geleistet.
Umgekehrt ist das Moment des Unwirklichen, Nichtseienden in Kunst dem Seienden gegenüber nicht frei. Es wird nicht willkürlich gesetzt, nicht, wie das Convenu es möchte, erfunden, sondern strukturiert sich aus Proportionen zwischen Seiendem, die ihrerseits von diesem, seiner Unvollkommenheit, Not und Widersprüchlichkeit und seinen Potentialitäten gefordert werden, und noch in den Proportionen zittern reale Zusammenhänge nach. Kunst verhält sich zu ihrem Anderen wie ein Magnet zu einem Feld von Eisenfeilspänen. Nicht bloß ihre Elemente sondern auch deren Konstellation, jenes spezifisch Ästhetische, das man gemeinhin ihrem Geist zuschlägt, deutet aufs Andere zurück. Die Identität des Kunstwerks mit der seienden Realität ist auch die seiner zentrie19renden Kraft, die dessen membra disiecta, Spuren des Seienden, um sich versammelt, verwandt mit der Welt ist es durch das Prinzip, das es jener kontrastiert und durch welches der Geist die Welt selbst zugerüstet hat. Und die Synthesis durchs Kunstwerk ist seinen Elementen nicht bloß angetan; sie wiederholt, worin sie miteinander kommunizieren, insofern ihrerseits ein Stück Andersheit. Auch Synthesis hat ihr Fundament in der geistfernen, materialen Seite der Werke, in dem, woran sie sich betätigt, nicht bloß in sich. Das verbindet das ästhetische Moment der Form mit Gewaltlosigkeit. In seiner Differenz vom Seienden konstituiert das Kunstwerk notwendig sich relativ auf das, was es als Kunstwerk nicht ist und was es erst zum Kunstwerk macht. Die Insistenz auf dem Intentionslosen der Kunst, die, als Sympathie mit deren unteren Manifestationen, von einem Augenblick der Geschichte an zu beobachten ist – bei Wedekind, der über die ›Kunst-Künstler‹ spottete, bei Apollinaire, wohl auch im Ursprung des Kubismus –, verrät unbewußtes Selbstbewußtsein der Kunst von ihrer Teilhabe an dem ihr Konträren; jenes Selbstbewußtsein motivierte die kulturkritische Wendung der Kunst, die sich der Illusion ihres rein geistigen Seins entschlug.
Kunst ist die gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft, nicht unmittelbar aus dieser zu deduzieren. Die Konstitution ihres Bezirks korrespondiert der eines inwendigen der Menschen als des Raums ihrer Vorstellung: vorweg hat sie teil an der Sublimierung. Plausibel daher, die Bestimmung dessen, was sie ist, aus einer Theorie des Seelenlebens herauszuspinnen. Skepsis gegen anthropologische Invariantenlehren empfiehlt die psychoanalytische. Aber sie ist psychologisch ergiebiger als ästhetisch. Ihr gelten die Kunstwerke wesentlich als Projektionen des Unbewußten derer, die sie hervorgebracht haben, und sie vergißt die Formkategorien über der Hermeneutik der Stoffe, überträgt gleichsam die Banausie feinsinniger Ärzte auf das untauglichste Objekt, auf Lionardo oder Baudelaire. Das trotz aller Betonung des Sexus Spießbürgerliche ist daran zu demaskieren, daß durch die einschlägigen Arbeiten, vielfach Ableger der biographischen Mode, Künstler, deren œuvre die Negativität des Daseienden ohne Zensur objektiviert, als Neurotiker abgekanzelt werden. Das Buch von Laforgue rechnet Baudelaire allen Ernstes vor, daß 20er an einem Mutterkomplex litt. Nicht einmal am Horizont regt sich die Frage, ob er als psychisch Gesunder die Fleurs du mal hätte schreiben können, geschweige denn, ob durch die Neurose die Gedichte schlechter wurden. Normales Seelenleben wird schmählich zum Kriterium auch dort erhoben, wo so kraß wie bei Baudelaire der ästhetische Rang sich als mitbedingt erweist durch die Abwesenheit der mens sana. Dem Tenor der psychoanalytischen Monographien zufolge sollte Kunst affirmativ mit der Negativität der Erfahrung fertig werden. Das negative Moment ist ihnen nicht mehr denn das Mal jenes Verdrängungsprozesses, der freilich ins Kunstwerk eingeht. Kunstwerke sind der Psychoanalyse Tagträume; sie verwechselt sie mit Dokumenten, verlegt sie dabei in die Träumenden, während sie sie andererseits, zur Entschädigung für die ausgespart extramentale Sphäre, auf krud stoffliche Elemente reduziert, sonderbar zurückbleibend übrigens hinter Freuds eigener Lehre von der ›Traumarbeit‹.
Das Moment der Fiktion an den Kunstwerken wird, wie von allen Positivisten, durch die supponierte Analogie zu den Träumen maßlos überschätzt. Das Projektive im Produktionsprozeß der Künstler ist im Verhältnis zum Gebilde nur ein Moment und schwerlich das entscheidende; Idiom, Material haben ein Eigengewicht, vor allem das Produkt selbst, von dem die Analytiker wenig sich träumen lassen. Die psychoanalytische These etwa, Musik sei Abwehr drohender Paranoia, trifft klinisch wohl weithin zu, sagt aber nichts über Rang und Gehalt einer einzigen gestalteten Komposition. Die psychoanalytische Kunsttheorie hat vor der idealistischen voraus, daß sie ins Licht rückt, was im Inwendigen der Kunst nicht selbst kunsthaft ist. Sie hilft, Kunst aus dem Bann des absoluten Geistes herauszuholen. Dem vulgären Idealismus, der Kunst mit Rancune gegen ihre Erkenntnis, vollends die ihrer Verflechtung mit dem Trieb, in einer vorgeblich höheren Sphäre unter Quarantäneschutz nehmen möchte, arbeitet sie im Geist von Aufklärung entgegen. Wo sie den Sozialcharakter entziffert, der aus einem Werk spricht und in dem der seines Urhebers vielfach sich manifestiert, liefert sie Glieder konkreter Vermittlung zwischen der Struktur von Gebilden und der gesellschaftlichen. Aber sie verbreitet selbst einen dem Idealismus verwandten Bann, den eines absolut subjektiven 21Zeichensystems für subjektive Triebregungen. Sie entschlüsselt Phänomene, aber reicht nicht an das Phänomen Kunst heran. Kunstwerke sind ihr nichts als Tatsachen, aber darüber versäumt sie deren eigene Objektivität, ihre Stimmigkeit, ihr Formniveau, ihre kritischen Impulse, ihr Verhältnis zur nicht-psychischen Realität, schließlich ihre Idee von Wahrheit. Der Malerin, die, unter dem Pakt voller Aufrichtigkeit zwischen Analysanden und Analytiker, über die schlechten Gravuren von Wien sich mokierte, mit denen er seine Wände verunzierte, erklärte dieser, das sei nichts als Aggression von ihrer Seite. Kunstwerke sind unvergleichlich viel weniger Abbild und Eigentum des Künstlers, als ein Doktor sich vorstellt, der Künstler einzig von der Couch her kennt. Nur Dilettanten stellen alles in der Kunst aufs Unbewußte ab. Ihr reines Gefühl repetiert heruntergekommene Clichés. Im künstlerischen Produktionsvorgang sind unbewußte Regungen Impuls und Material unter vielem anderen. Sie gehen ins Kunstwerk vermittelt durchs Formgesetz ein; das buchstäbliche Subjekt, welches das Werk verfertigte, wäre darin nicht mehr als ein abgemaltes Pferd. Kunstwerke sind kein thematic apperception test ihres Urhebers. Mitschuldig an solcher Amusie ist der Kultus, den die Psychoanalyse mit dem Realitätsprinzip treibt: was diesem nicht gehorcht, sei immer nur ›Flucht‹, Anpassung an die Realität wird zum summum bonum. Die Realität liefert zu vielen realen Grund, sie zu fliehen, als daß eine Entrüstung über Flucht anstände, die von harmonistischer Ideologie getragen wird; selbst psychologisch wäre Kunst besser legitimiert, als Psychologie ihr zuerkennt. Wohl ist Imagination auch Flucht, aber nicht durchaus: was das Realitätsprinzip auf ein Superiores hin transzendiert, ist immer auch darunter; den Finger darauf zu legen hämisch. Verzerrt ist die imago des Künstlers als des tolerierten: in die arbeitsteilige Gesellschaft eingegliederten Neurotikers. In Künstlern höchsten Ranges wie Beethoven oder Rembrandt verband schärfstes Realitätsbewußtsein sich mit Realitätsentfremdung; das erst wäre ein würdiger Gegenstand der Psychologie von Kunst. Sie hätte das Kunstwerk nicht nur als das dem Künstler Gleiche zu dechiffrieren, sondern als Ungleiches, als Arbeit an einem Widerstehenden. Hat Kunst psychoanalytische Wurzeln, dann die der Phantasie in der von Allmacht. In 22ihr ist aber auch der Wunsch am Werk, eine bessere Welt herzustellen. Das entbindet die gesamte Dialektik, während die Ansicht vom Kunstwerk als einer bloß subjektiven Sprache des Unbewußten sie gar nicht erst erreicht.
Zur Freudschen Kunsttheorie als einer von Wunscherfüllung ist die Kantische die Antithesis. Das erste Moment des Geschmacksurteils aus der Analytik des Schönen sei das interesselose Wohlgefallen[4]. Interesse wird dabei »das Wohlgefallen genannt, was wir mit der Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden«[5]. Nicht ist eindeutig, ob mit der »Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes« der in einem Kunstwerk, als dessen Stoff, behandelte Gegenstand gemeint wird oder das Kunstwerk selbst; das hübsche Aktmodell oder der süße Wohllaut musikalischer Klänge, der Kitsch sein kann, aber auch integrales Moment künstlerischer Qualität. Der Akzent auf ›Vorstellung‹ folgt aus dem im prägnanten Sinn subjektivistischen Ansatz Kants, der die ästhetische Qualität stillschweigend, in Übereinstimmung mit der rationalistischen Tradition insbesondere Moses Mendelssohns, in der Wirkung des Kunstwerks auf seinen Betrachter sucht. Revolutionär ist an der Kritik der Urteilskraft, daß sie, ohne den Umkreis der älteren Wirkungsästhetik zu verlassen, diese gleichzeitig durch immanente Kritik einschränkt, so wie insgesamt der Kantische Subjektivismus sein spezifisches Gewicht hat an seiner objektiven Intention, dem Versuch der Rettung von Objektivität vermöge der Analyse subjektiver Momente. Interesselosigkeit entfernt sich von der unmittelbaren Wirkung, die das Wohlgefallen konservieren will, und das bereitet die Brechung von dessen Suprematie vor. Denn bar dessen, was bei Kant Interesse heißt, wird Wohlgefallen zu einem so Unbestimmten, daß es zu keiner Bestimmung des Schönen mehr taugt. Die Doktrin vom interesselosen Wohlgefallen ist arm angesichts des ästhetischen Phänomens; sie reduzierte es auf das in seiner Isolierung höchst fragwürdige Formal-Schöne oder auf sogenannte erhabene Naturgegenstände.
Die Sublimierung zur 23absoluten Form versäumte an den Kunstwerken den Geist, in dessen Zeichen sublimiert wird. Die forcierte Fußnote Kants[6], ein Urteil über einen Gegenstand des Wohlgefallens könne zwar uninteressiert, aber doch interessant sein, also ein Interesse hervorbringen, auch wenn es auf keinem sich gründe, bezeugt redlich und unfreiwillig diesen Sachverhalt. Kant trennt das ästhetische Gefühl – und damit, seiner Konzeption gemäß, virtuell die Kunst selbst – vom Begehrungsvermögen, auf das die »Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes« zielte; das Wohlgefallen an einer solchen Vorstellung habe »immer zugleich Beziehung auf das Begehrungsvermögen«[7]. Kant als erster hat die seitdem unverlorene Erkenntnis erreicht, daß ästhetisches Verhalten von unmittelbarem Begehren frei sei; hat Kunst der gierigen Banausie entrissen, die sie stets wieder abtastet und abschmeckt. Gleichwohl ist das Kantische Motiv der psychologischen Kunsttheorie nicht durchaus fremd: auch für Freud sind Kunstwerke nicht Wunscherfüllungen unmittelbar, sondern verwandeln primär unbefriedigte Libido in gesellschaftlich produktive Leistung, wobei freilich der gesellschaftliche Wert der Kunst, in kritiklosem Respekt vor ihrer öffentlichen Geltung, unbefragt vorausgesetzt bleibt. Daß Kant die Differenz der Kunst vom Begehrungsvermögen und damit von der empirischen Realität weit energischer hervorhob als Freud, idealisiert sie nicht bloß: die Aussonderung der ästhetischen Sphäre aus der Empirie konstituiert die Kunst. Kant hat jedoch diese Konstitution, ihrerseits ein Historisches, transzendental stillgestellt und in simpler Logik dem Wesen des Künstlerischen gleichgesetzt, unbekümmert darum, daß die subjektiv triebmäßigen Komponenten der Kunst noch in ihrer reifsten Gestalt, die jene negiert, verwandelt wiederkehren. Des dynamischen Charakters des Kunsthaften ist Freuds Sublimierungstheorie weit unbefangener innegeworden. Dafür hat er freilich keinen geringeren Preis zu zahlen als Kant. Springt bei diesem das geistige Wesen des Kunstwerks, trotz aller Präferenz für die sinnliche Anschauung, aus der Unterscheidung des ästhetischen vom praktischen und vom begehrenden Verhalten 24heraus, so scheint die Freudsche Adaptation der Ästhetik an die Trieblehre dagegen sich zu sperren; die Kunstwerke sind auch als sublimierte wenig anderes als Stellvertreter der sinnlichen Regungen, die sie allenfalls durch eine Art von Traumarbeit unkenntlich machen. Die Konfrontation der beiden heterogenen Denker – Kant hat nicht nur den philosophischen Psychologismus sondern im Alter zunehmend alle Psychologie abgelehnt – wird indessen erlaubt von einer Gemeinsamkeit, die schwerer wiegt als die Differenz zwischen der Konstruktion des transzendentalen Subjekts hier, dem Rekurs auf ein empirisch psychologisches dort. Beide sind prinzipiell subjektiv orientiert zwischen dem negativen oder positiven Ansatz des Begehrungsvermögens. Für beide ist das Kunstwerk eigentlich nur in Beziehung auf den, der es betrachtet oder der es hervorbringt. Auch Kant wird, durch einen Mechanismus, dem ebenso seine Moralphilosophie unterliegt, genötigt, das seiende Individuum, Ontisches zu bedenken, mehr als mit der Idee des transzendentalen Subjekts vereinbar ist. Kein Wohlgefallen ohne Lebendige, denen das Objekt gefiele; der Schauplatz der gesamten Kritik der Urteilskraft sind, ohne daß davon gehandelt würde, Konstituta, und darum ist, was als Brücke zwischen theoretischer und praktischer reiner Vernunft geplant war, beidem gegenüber ein ἄλλο γένος. Wohl verbietet das Tabu von Kunst – und soweit sie definiert ist, gehorcht sie einem Tabu, Definitionen sind rationale Tabus –, daß man zum Objekt animalisch sich stellt, seiner leibhaft sich bemächtigen will.
Aber der Macht des Tabus entspricht die des von ihm betroffenen Sachverhalts. Keine Kunst, die nicht negiert als Moment in sich enthält, wovon sie sich abstößt. Dem Interesselosen muß der Schatten des wildesten Interesses gesellt sein, wenn es mehr sein soll als nur gleichgültig, und manches spricht dafür, daß die Dignität der Kunstwerke abhängt von der Größe des Interesses, dem sie abgezwungen sind. Kant verleugnet das einem Freiheitsbegriff zuliebe, der, was immer nicht subjekteigen ist, als heteronom ahndet. Seine Kunsttheorie wird entstellt von der Unzulänglichkeit der Lehre von der praktischen Vernunft. Der Gedanke an ein Schönes, das dem souveränen Ich gegenüber etwas von Selbständigkeit besäße oder sich erworben hätte, erscheint nach dem Tenor seiner Philosophie 25als Ausschweifen in intelligible Welten. Samt dem jedoch, woraus sie antithetisch entsprang, wird der Kunst jeglicher Inhalt abgeschnitten und statt dessen ein so Formales wie Wohlgefälligkeit supponiert. Ihm wird Ästhetik, paradox genug, zum kastrierten Hedonismus, zu Lust ohne Lust, gleich ungerecht gegen die künstlerische Erfahrung, in der Wohlgefallen beiher spielt, keinesfalls das Ganze ist, und gegen das leibhafte Interesse, die unterdrückten und unbefriedigten Bedürfnisse, die in ihrer ästhetischen Negation mitvibrieren und die Gebilde zu mehr machen als leeren Mustern. Ästhetische Interesselosigkeit hat das Interesse erweitert, über seine Partikularität hinaus. Das Interesse an der ästhetischen Totalität wollte, objektiv, das an einer richtigen Einrichtung des Ganzen sein. Es zielte nicht auf die einzelne Erfüllung sondern auf die fessellose Möglichkeit, die doch nicht ohne die einzelne Erfüllung wäre. Korrelativ zur Schwäche der Kantischen ist die Freudsche Kunsttheorie weit idealistischer, als sie ahnt. Indem sie die Kunstwerke rein in die psychische Immanenz versetzt, werden sie der Antithetik zum Nichtich entäußert. Es bleibt unangefochten von den Stacheln der Kunstwerke; diese erschöpfen sich in der psychischen Leistung der Bewältigung des Triebverzichts, schließlich der Anpassung. Der Psychologismus ästhetischer Interpretation versteht sich nicht schlecht mit der philiströsen Ansicht vom Kunstwerk als einem harmonisch die Gegensätze Beschwichtigenden, dem Traumbild eines besseren Lebens, ungedenk des Schlechten, dem es abgerungen ward. Der konformistischen Übernahme der gängigen Ansicht vom Kunstwerk als wohltätigem Kulturgut durch die Psychoanalyse korrespondiert ein ästhetischer Hedonismus, der alle Negativität aus der Kunst in die Triebkonflikte ihrer Genese verbannt und am Resultat unterschlägt. Wird erlangte Sublimierung und Integration zum Ein und Allen des Kunstwerks gemacht, so verliert es die Kraft, durch die es das Dasein übersteigt, von dem es durch seine bloße Existenz sich lossagt. Sobald aber das Verhalten des Kunstwerks die Negativität der Realität festhält und zu ihr Stellung bezieht, modifiziert sich auch der Begriff der Interesselosigkeit. Kunstwerke implizieren an sich selbst ein Verhältnis zwischen dem Interesse und der Absage daran, wider ihre Kantische sowohl wie Freudische Interpretation. Noch das kontemplative Verhalten zu 26den Kunstwerken, den Aktionsobjekten abgezwungen, fühlt sich als Kündigung unmittelbarer Praxis und insofern ein selbst Praktisches, als Widerstand gegen das Mitspielen. Nur Kunstwerke, die als Verhaltensweise zu spüren sind, haben ihre raison d’être. Kunst ist nicht nur der Statthalter einer besseren Praxis als der bis heute herrschenden, sondern ebenso Kritik von Praxis als der Herrschaft brutaler Selbsterhaltung inmitten des Bestehenden und um seinetwillen. Sie straft Produktion um ihrer selbst willen Lügen, optiert für einen Stand der Praxis jenseits des Banns von Arbeit. Promesse du bonheur heißt mehr als daß die bisherige Praxis das Glück verstellt: Glück wäre über der Praxis. Den Abgrund zwischen der Praxis und dem Glück mißt die Kraft der Negativität im Kunstwerk aus. Sicherlich erweckt Kafka nicht das Begehrungsvermögen. Aber die Realangst, die auf Prosastücke wie die Verwandlung oder die Strafkolonie antwortet, der Schock des Zurückzuckens, Ekel, der die Physis schüttelt, hat als Abwehr mehr mit dem Begehren zu tun als mit der alten Interesselosigkeit, die er und was auf ihn folgt kassiert. Sie wäre seinen Schriften grob inadäquat. Nachgerade erniedrigte sie Kunst zu dem, was Hegel verspottet, zum angenehmen oder nützlichen Spielwerk der Horazischen Ars Poetica. Von ihr hat die Ästhetik des idealistischen Zeitalters, synchron mit der Kunst selbst, sich befreit. Autonom ist künstlerische Erfahrung einzig, wo sie den genießenden Geschmack abwirft. Die Bahn zu ihr führt durch Interesselosigkeit hindurch; die Emanzipation der Kunst von den Erzeugnissen der Küche oder der Pornographie ist irrevokabel. Aber sie kommt in der Interesselosigkeit nicht zur Ruhe. Interesselosigkeit reproduziert immanent, verändert, das Interesse. In der falschen Welt ist alle ήδονή falsch. Um des Glücks willen wird dem Glück abgesagt. So überlebt Begehren in der Kunst.
Unkenntlich geworden, vermummt sich Genuß in der Kantischen Interesselosigkeit. Was das allgemeine Bewußtsein und eine willfährige Ästhetik unter Kunstgenuß nach dem Modell realen Genießens sich vorstellt, existiert wahrscheinlich überhaupt nicht. An der künstlerischen Erfahrung tel quel hat das empirische Subjekt nur beschränkten und modifizierten Anteil; er dürfte sich verringern, je höher das Gebilde rangiert. Wer Kunstwerke kon27kretistisch genießt, ist ein Banause; Worte wie Ohrenschmaus überführen ihn. Wäre aber die letzte Spur von Genuß exstirpiert, so bereitete die Frage, wozu überhaupt Kunstwerke da sind, Verlegenheit. Tatsächlich werden Kunstwerke desto weniger genossen, je mehr einer davon versteht. Eher war sogar die traditionelle Verhaltensweise zum Kunstwerk, soll sie denn durchaus für es relevant sein, eine von Bewunderung: daß sie an sich so sind, nicht für den Betrachter. Was ihm an ihnen aufging und ihn hinriß, war ihre Wahrheit, wie sie in Gebilden des Kafkaschen Typus jedes andere Moment überwiegt. Sie waren keine Genußmittel höherer Ordnung. Das Verhältnis zur Kunst war keines von Einverleibung, sondern umgekehrt verschwand der Betrachter in der Sache; erst recht ist das der Fall in modernen Gebilden, die auf jenen zufahren wie zuweilen Lokomotiven im Film. Fragt man einen Musiker, ob ihm die Musik Freude bereite, so wird er eher, wie in dem amerikanischen Witz vom grimassierenden Cellisten unter Toscanini: I just hate music, sagen. Wer jene genuine Beziehung zur Kunst hat, in der er selber erlischt, dem ist sie nicht Objekt; unerträglich wäre ihm der Entzug von Kunst, nicht sind ihm deren einzelne Äußerungen eine Lustquelle. Daß keiner mit Kunst sich abgäbe, der, wie die Bürger sagen, gar nichts davon hätte, ist nicht zu bestreiten, aber doch wieder nicht so wahr, daß eine Bilanz zu ziehen wäre: heute abend Neunte Symphonie gehört, soundso viel Vergnügen gehabt; und solcher Schwachsinn hat mittlerweile als gesunder Menschenverstand sich eingerichtet. Der Bürger wünscht die Kunst üppig und das Leben asketisch; umgekehrt wäre es besser. Verdinglichtes Bewußtsein ruft als Ersatz dessen, was es den Menschen an sinnlich Unmittelbarem vorenthält, in dessen Sphäre zurück, was dort seine Stätte nicht hat. Während scheinbar das Kunstwerk durch sinnliche Attraktion dem Konsumenten in Leibnähe rückt, wird es ihm entfremdet: zur Ware, die ihm gehört und die er ohne Unterlaß zu verlieren fürchtet. Das falsche Verhältnis zur Kunst ist der Angst ums Eigentum verschwistert. Der fetischistischen Vorstellung vom Kunstwerk als einem Besitz, der sich haben läßt und durch Reflexion zerstört werden könne, entspricht streng die von dem im psychologischen Haushalt verwertbaren Gut. Ist Kunst ihrem eigenen Begriff nach ein Gewor28denes, dann nicht minder ihre Einordnung als Genußmittel; wohl waren die magischen und animistischen Vorformen der Kunstwerke als Bestandstücke ritualer Praxis diesseits von deren Autonomie; ließen aber, eben als sakrale, gewiß nicht sich genießen. Die Vergeistigung der Kunst hat die Rancune der von der Kultur Ausgeschlossenen aufgestachelt und die Gattung der Konsumentenkunst initiiert, während umgekehrt der Widerwille gegen diese die Künstler zu immer rücksichtsloserer Spiritualisierung drängte. Keine nackte griechische Plastik war ein pin-up. Nicht anders wäre die Sympathie der Moderne für längst Vergangenes, auch Exotisches erklärbar: auf die Abstraktion von Naturobjekten als Begehrbarem sprechen die Künstler an; übrigens hat Hegel in der Konstruktion der ›symbolischen Kunst‹ das unsinnliche Moment der Archaik nicht übersehen. Das Lustmoment an der Kunst, Einspruch gegen den universal vermittelten Warencharakter, ist auf seine Weise vermittelbar: wer im Kunstwerk verschwindet, wird dadurch dispensiert von der Armseligkeit eines Lebens, das immer zu wenig ist. Solche Lust vermag sich zu steigern zum Rausch; an ihn wiederum reicht der dürftige Begriff des Genusses nicht heran, der überhaupt geeignet wäre, Genießen einem abzugewöhnen. Merkwürdig übrigens, daß eine Ästhetik, die immer wieder auf der subjektiven Empfindung als dem Grund alles Schönen insistierte, jene Empfindung nie ernsthaft analysierte. Ihre Deskriptionen waren unweigerlich fast banausisch; darum vielleicht, weil der subjektive Ansatz vorweg dagegen verblendet, daß über künstlerische Erfahrung nur im Verhältnis zur Sache etwas Triftiges sich ausmachen läßt, nicht am Gaudium des Liebhabers. Der Begriff des Kunstgenusses war ein schlechter Kompromiß zwischen dem gesellschaftlichen und dem zur Gesellschaft antithetischen Wesen des Kunstwerks. Ist schon die Kunst für den Betrieb der Selbsterhaltung unnütz – ganz verzeiht ihr die bürgerliche Gesellschaft das niemals –, soll sie sich wenigstens durch eine Art von Gebrauchswert bewähren, der der sensuellen Lust nachgebildet ward. Verfälscht wird damit gleich ihr auch jene eine leibhafte Erfüllung, die ihre ästhetischen Repräsentanten nicht spenden. Daß, wer unfähig ist zur sensuellen Differenzierung, wer nicht einen schönen Klang von einem stumpfen, leuchtende Farben von matten unterscheiden kann, 29schwerlich künstlerischer Erfahrung fähig ist, wird hypostasiert. Diese jedoch empfängt zwar gesteigert die sensuelle Differenziertheit als Medium des Gestaltens in sich, läßt aber die Lust daran einzig als durchbrochene durch. Ihr Gewicht in der Kunst variierte; in Perioden, die asketischen folgen, wie die Renaissance, war es Organ der Befreiung und lebhaft, ähnlich im Impressionismus als einem Antiviktorianischen; zuzeiten bekundete kreatürliche Trauer als metaphysischer Gehalt sich, indem der erotische Reiz die Formen durchdrang. So stark jedoch wie die Kraft jenes Moments zur Rückkunft, es behält, wo es in Kunst buchstäblich, ungebrochen auftritt, etwas Infantiles. Nur in Erinnerung und Sehnsucht, nicht abgebildet und als unmittelbarer Effekt wird es von ihr absorbiert. Allergie gegen das Grobsinnliche entfremdet schließlich auch solche Perioden, in denen das Lustbesetzte und die Form noch unmittelbarer kommunizieren mochten; das nicht zuletzt dürfte die Abwendung vom Impressionismus bewirkt haben.
Das Wahrheitsmoment am ästhetischen Hedonismus wird dadurch gestützt, daß in der Kunst die Mittel nicht rein im Zweck aufgehen. In der Dialektik von beidem behaupten jene stets auch einige Selbständigkeit, und zwar vermittelt. Durch das sinnlich Wohlgefällige schließt die Erscheinung, die dem Kunstwerk wesentlich ist, sich zusammen. Nach dem Wort von Alban Berg ist es ein Stück Sachlichkeit, daß aus dem Geformten nicht die Nägel herausstechen und nicht der Leim stinkt; und die Süße des Ausdrucks vieler Gebilde von Mozart zitiert die Süße der Stimme herbei. In bedeutenden Werken wird das Sinnliche seinerseits, aufleuchtend von ihrer Kunst, zum Geistigen, so wie umgekehrt vom Geist des Werks die abstrakte Einzelheit, wie immer auch gleichgültig gegen die Erscheinung, sinnlichen Glanz gewinnt. Manchmal spielen in sich durchgebildete und artikulierte Kunstwerke vermöge ihrer gegliederten Formsprache sekundär ins sinnlich Wohlgefällige hinüber. Die Dissonanz, Signum aller Moderne, gewährt, auch in ihren optischen Äquivalenten, dem lockend Sinnlichen Einlaß, indem sie es in seine Antithese, den Schmerz transfiguriert: ästhetisches Urphänomen von Ambivalenz. Die unabsehbare Tragweite alles Dissonanten für die neue Kunst seit Baudelaire und dem Tristan – wahrhaft eine Art In30variante der Moderne – rührt daher, daß darin das immanente Kräftespiel des Kunstwerks mit der parallel zu seiner Autonomie an Macht über das Subjekt ansteigenden auswendigen Realität konvergiert. Die Dissonanz bringt von innen her dem Kunstwerk zu, was die Vulgärsoziologie dessen gesellschaftliche Entfremdung nennt. Mittlerweile freilich tabuieren die Kunstwerke noch die geistig vermittelte Suavität als der vulgären zu ähnlich. Die Entwicklung dürfte zur Verschärfung des sensuellen Tabus fortschreiten, obwohl es manchmal schwerfällt zu unterscheiden, wie weit dies Tabu im Formgesetz gründet und wie weit bloß in Mängeln des Metiers; eine Frage übrigens, derengleichen viele in ästhetischen Kontroversen aufkommen, ohne daß sie viel fruchteten. Das sensuelle Tabu greift am Ende noch auf das Gegenteil des Wohlgefälligen über, weil es, sei es auch aus äußerster Ferne, in seiner spezifischen Negation mitgefühlt wird. Für eine solche Reaktionsform drängt die Dissonanz allzunahe an ihr Widerspiel, Versöhnung, sich heran; sie macht sich spröd gegen einen Schein des Menschlichen, der Ideologie der Unmenschlichkeit ist, und schlägt sich lieber auf die Seite verdinglichten Bewußtseins. Dissonanz erkaltet zum indifferenten Material; zwar einer neuen Gestalt von Unmittelbarkeit, ohne Erinnerungsspur dessen, woraus sie wurde, dafür aber taub und qualitätslos. Einer Gesellschaft dann, in der die Kunst keinen Ort mehr hat und die in jeglicher Reaktion auf jene verstört ist, spaltet sie sich auf in dinghaft geronnenen Kulturbesitz und den Lustgewinn, den der Kunde einheimst und der meist mit dem Objekt wenig zu tun hat. Subjektive Lust am Kunstwerk würde dem Zustand des aus der Empirie als der Totalität des Füranderesseins Entlassenen sich nähern, nicht der Empirie. Schopenhauer dürfte das zuerst gewahrt haben. Das Glück an den Kunstwerken ist jähes Entronnensein, nicht ein Brocken dessen, woraus Kunst entrann; stets nur akzidentell, unwesentlicher für die Kunst als das Glück ihrer Erkenntnis; der Begriff des Kunstgenusses als konstitutiver ist abzuschaffen. Haftet allem Gefühl vom ästhetischen Objekt, nach Hegels Einsicht, ein Zufälliges an, meist die psychologische Projektion, so fordert es vom Betrachter Erkenntnis, und zwar eine von Gerechtigkeit: es will, daß man seiner Wahrheit und Unwahrheit innewerde. Dem ästhetischen Hedonismus wäre ent31gegenzuhalten jene Stelle aus der Kantischen Lehre vom Erhabenen, das er, befangen, von der Kunst eximiert: Glück an den Kunstwerken wäre allenfalls das Gefühl des Standhaltens, das sie vermitteln. Es gilt dem ästhetischen Bereich als ganzem eher als dem einzelnen Werk.
Mit den Kategorien haben auch Materialien ihre apriorische Selbstverständlichkeit verloren, so die Worte der Dichtung. Der Zerfall der Materialien ist der Triumph ihres Füranderesseins. Als erstes und eindringliches Zeugnis ist Hofmannsthals Chandosbrief berühmt geworden. Man mag die neuromantische Dichtung insgesamt als Versuch betrachten, dem sich entgegenzustemmen und der Sprache wie anderen Materialien etwas von ihrer Substantialität wiederzugewinnen. Die Idiosynkrasie gegen den Jugendstil aber heftet sich daran, daß jener Versuch mißlang. Dem Rückblick erscheint er, mit Kafkas Wort, als leere fröhliche Fahrt. George mußte im Einleitungsgedicht eines Zyklus aus dem Siebenten Ring, in der Anrufung eines Waldes nur die Worte Gold, Karneol nebeneinanderstellen, um nach seinem Stilisationsprinzip hoffen zu dürfen, die Wahl der Worte leuchte dichterisch[8]. Nach sechs Dezennien wurde die Wortwahl als dekoratives Arrangement erkennbar, nicht länger überlegen der stofflich rohen Anhäufung aller möglichen edlen Materialien in Wildes Dorian Gray, welche die Interieurs des piekfeinen Ästhetizismus Antiquitätenhandlungen und Versteigerungsstätten anähneln und damit eben dem verhaßten Kommerz. Analog bemerkte Schönberg: Chopin habe es gut gehabt, er habe bloß die damals unabgegriffene Tonart Fis-Dur zu greifen brauchen, und schon sei es schön gewesen; übrigens mit der geschichtsphilosophischen Differenz, daß in der früheren musikalischen Romantik tatsächlich Materialien wie Chopins aparte Tonarten etwas von der Kraft des Unbetretenen ausstrahlten, die in der Sprache um 1900 bereits zum Erlesenen depraviert waren. Was aber ihren Worten und ihrer Juxtaposition oder Tonarten widerfuhr, befiel un32aufhaltsam den traditionellen Begriff des Dichterischen als eines Höheren, Geweihten überhaupt. Dichtung hat in das sich zurückgezogen, was dem Prozeß der Desillusionierung ohne Reservat sich überläßt, welcher den Begriff des Dichterischen verzehrt; das macht die Unwiderstehlichkeit von Becketts Werk aus.
Auf den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit reagiert Kunst nicht bloß durch konkrete Änderungen ihrer Verhaltens- und Verfahrungsweisen, sondern indem sie an ihrem eigenen Begriff zerrt wie an einer Kette: der, daß sie Kunst ist. In der niederen Kunst oder Unterhaltung von einst, die heute von der Kulturindustrie verwaltet, integriert, qualitativ umgemodelt wird, läßt das am sinnfälligsten sich konstatieren. Denn jene Sphäre gehorchte nie dem selbst erst gewordenen und späten Begriff reiner Kunst. Stets ragte sie als Zeugnis des Mißlingens von Kultur in diese hinein, machte es zu ihrem eigenen Willen, daß sie mißlinge, so wie es aller Humor besorgt, in seliger Harmonie seiner traditionellen und seiner gegenwärtigen Gestalt. Die von der Kulturindustrie Überlisteten und nach ihren Waren Dürstenden befinden sich diesseits der Kunst: darum nehmen sie ihre Inadäquanz an den gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensprozeß – nicht dessen eigene Unwahrheit – unverschleierter wahr als die, welche noch daran sich erinnern, was einmal ein Kunstwerk war. Sie drängen auf Entkunstung der Kunst[9]. Die Leidenschaft zum Antasten, dazu, kein Werk sein zu lassen, was es ist, ein jegliches herzurichten, seine Distanz vom Betrachter zu verkleinern, ist unmißverständliches Symptom jener Tendenz. Die beschämende Differenz zwischen der Kunst und dem Leben, das sie leben und in dem sie nicht gestört werden wollen, weil sie den Ekel sonst nicht ertrügen, soll verschwinden: das ist die subjektive Basis für die Einreihung der Kunst unter die Konsumgüter durch die vested interests. Wird sie trotz allem nicht einfach konsumierbar, so kann das Verhältnis zu ihr wenigstens sich anlehnen an das zu den eigentlichen Konsumgütern. Erleichtert wird das dadurch, daß deren Gebrauchswert im Zeitalter der Überproduktion seinerseits fragwürdig wurde und dem sekundären Genuß von Prestige, 33Mit-dabei-Sein, schließlich des Warencharakters selbst weicht: Parodie ästhetischen Scheins. Von der Autonomie der Kunstwerke, welche die Kulturkunden zur Empörung darüber aufreizt, daß man sie für etwas Besseres hält, als was sie zu sein glauben, ist nichts übrig als der Fetischcharakter der Ware, Regression auf den archaischen Fetischismus im Ursprung der Kunst: insofern ist das zeitgemäße Verhalten zur Kunst regressiv. Konsumiert wird an den Kulturwaren ihr abstraktes Füranderessein, ohne daß sie wahrhaft für die anderen wären; indem sie diesen zu Willen sind, betrügen sie sie. Die alte Affinität von Betrachter und Betrachtetem wird auf den Kopf gestellt. Indem vom heute typischen Verhalten das Kunstwerk zum bloßen Faktum gemacht wird, wird auch das mimetische, allem dinghaften Wesen unvereinbare Moment als Ware verschachert. Der Konsument darf nach Belieben seine Regungen, mimetische Restbestände, auf das projizieren, was ihm vorgesetzt wird. Bis zur Phase totaler Verwaltung sollte das Subjekt, das ein Gebilde betrachtete, hörte, las, sich vergessen, sich gleichgültig werden, darin erlöschen. Die Identifikation, die es vollzog, war dem Ideal nach nicht die, daß es das Kunstwerk sich, sondern daß es sich dem Kunstwerk gleichmachte. Darin bestand ästhetische Sublimierung; Hegel nannte solche Verhaltensweise generell die Freiheit zum Objekt. Damit gerade erwies er dem Subjekt Ehre, das in geistiger Erfahrung Subjekt wird durch seine Entäußerung, dem Gegenteil des spießbürgerlichen Verlangens, daß das Kunstwerk ihm etwas gebe. Als tabula rasa subjektiver Projektionen jedoch wird das Kunstwerk entqualifiziert. Die Pole seiner Entkunstung sind, daß es sowohl zum Ding unter Dingen wird wie zum Vehikel der Psychologie des Betrachters. Was die verdinglichten Kunstwerke nicht mehr sagen, ersetzt der Betrachter durch das standardisierte Echo seiner selbst, das er aus ihnen vernimmt. Diesen Mechanismus setzt die Kulturindustrie in Gang und exploitiert ihn. Sie läßt eben das als den Menschen Nahes, ihnen Gehörendes erscheinen, was ihnen entfremdet ward und worüber in der Rückerstattung heteronom verfügt wird. Noch die unmittelbar gesellschaftliche Argumentation gegen die Kulturindustrie jedoch hat ihre ideologische Komponente. Von der autoritären Schmach der Kulturindustrie war die autonome Kunst nicht 34durchaus frei. Ihre Autonomie ist ein Gewordenes, das ihren Begriff konstituiert; aber nicht a priori. In den authentischesten Gebilden ist die Autorität, welche einst kultische Werke über die gentes ausüben sollten, immanentes Formgesetz geworden. Die Idee der Freiheit, ästhetischer Autonomie verschwistert, hat an Herrschaft sich geformt, die sie verallgemeinerte. So auch die Kunstwerke. Je freier von auswendigen Zwecken sie sich machten, desto vollständiger bestimmten sie sich als ihrerseits herrschaftlich organisierte. Weil aber die Kunstwerke immer ihre eine Seite der Gesellschaft zukehren, strahlte die in ihnen verinnerlichte Herrschaft auch nach außen. Unmöglich, im Bewußtsein dieses Zusammenhangs, Kritik an der Kulturindustrie zu üben, die vor der Kunst verstummte. Wer aber, mit Grund, in aller Kunst die Unfreiheit wittert, ist in Versuchung, zu erschlaffen, vor der heraufziehenden Verwaltung zu resignieren, weil das in Wahrheit immer so gewesen sei, während doch im Schein eines Anderen auch dessen Möglichkeit aufging. Daß inmitten der bilderlosen Welt das Bedürfnis nach Kunst, auch das der Massen, ansteigt, die durch die mechanischen Mittel der Reproduktion erstmals mit ihr konfrontiert wurden, weckt eher Zweifel, langt jedenfalls, als ein der Kunst Auswendiges, nicht zu, deren Fortbestand zu verteidigen. Der komplementäre Charakter jenes Bedürfnisses, Nachbild des Zaubers als Trost über die Entzauberung, erniedrigt die Kunst zum Exempel des mundus vult decipi und deformiert sie. Zur Ontologie falschen Bewußtseins rechnen auch jene Züge, darin das Bürgertum, das den Geist ebenso befreite wie an die Kandare nahm, hämisch auch gegen sich selbst am Geist gerade das akzeptiert und genießt, was es ihm nicht ganz glauben kann. Soweit Kunst dem sozial vorhandenen Bedürfnis entspricht, ist sie in weitestem Maß ein vom Profit gesteuerter Betrieb geworden, der weiterläuft, solange er rentiert und durch Perfektion darüber hinweghilft, daß er schon tot ist. Blühende Kunstgattungen und Sparten der Kunstübung wie die traditionelle Oper sind nichtig geworden, ohne daß es in der offiziellen Kultur sichtbar würde; in den Schwierigkeiten jedoch, auch nur dem eigenen Perfektionsideal nachzukommen, wird ihre geistige Insuffizienz unmittelbar zur praktischen; ihr realer Untergang ist absehbar. Vertrauen auf die Bedürfnisse der Men35schen, die, mit der Steigerung der Produktivkräfte, das Ganze zu höherer Gestalt brächten, trägt nicht mehr, seitdem die Bedürfnisse von der falschen Gesellschaft integriert worden sind und zu falschen gemacht. Wohl finden die Bedürfnisse, wie es prognostiziert war, abermals ihre Befriedigung, aber diese ist ihrerseits falsch und betrügt die Menschen um ihr Menschenrecht.
Vielleicht steht es an, zu Kunst heute, kantisch, als zu einem Gegebenen sich zu verhalten; wer für sie plädierte, macht bereits Ideologien und sie selbst zu einer. Anzuknüpfen vermag allenfalls der Gedanke daran, daß etwas in der Realität jenseits des Schleiers, den das Zusammenspiel von Institutionen und falschem Bedürfnis webt, objektiv nach Kunst verlangt; nach einer, die für das spricht, was der Schleier zudeckt. Während diskursive Erkenntnis an die Realität heranreicht, auch an ihre Irrationalitäten, die ihrerseits ihrem Bewegungsgesetz entspringen, ist etwas an ihr spröde gegen rationale Erkenntnis. Dieser ist das Leiden fremd, sie kann es subsumierend bestimmen, Mittel zur Linderung beistellen; kaum durch seine Erfahrung ausdrücken: eben das hieße ihr irrational. Leiden, auf den Begriff gebracht, bleibt stumm und konsequenzlos: das läßt in Deutschland nach Hitler sich beobachten. Dem Hegelschen Satz, den Brecht als Devise sich erkor: die Wahrheit sei konkret, genügt vielleicht im Zeitalter des unbegreifbaren Grauens nur noch Kunst. Das Hegelsche Motiv von der Kunst als Bewußtsein von Nöten hat über alles von ihm Absehbare hinaus sich bestätigt. Dadurch wurde es zum Einspruch gegen sein eigenes Verdikt über die Kunst, einen Kulturpessimismus, der seinem kaum nur säkularisierten theologischen Optimismus, der Erwartung real verwirklichter Freiheit Relief gibt. Die Verdunklung der Welt macht die Irrationalität der Kunst rational: die radikal verdunkelte. Was die Feinde der neuen Kunst, mit besserem Instinkt als ihre ängstlichen Apologeten, deren Negativität nennen, ist der Inbegriff des von der etablierten Kultur Verdrängten. Dorthin lockt es. In der Lust am Verdrängten rezipiert Kunst zugleich das Unheil, das verdrängende Prinzip, anstatt bloß vergeblich dagegen zu protestieren. Daß sie das Unheil durch Identifikation ausspricht, antezipiert seine Entmächtigung; das, weder die Photographie des Unheils noch falsche Seligkeit, umschreibt die Stellung authentischer ge36genwärtiger Kunst zur verfinsterten Objektivität; jede andere überführt sich durch Süßlichkeit des eigenen Falschen.
Phantastische Kunst, die romantische wie Züge davon in Manierismus und Barock stellen ein Nichtseiendes als seiend vor. Die Erfindungen sind Modifikationen von empirisch Vorhandenem. Der Effekt ist die Präsentation eines Nichtempirischen, als wäre es empirisch. Er wird erleichtert durch die Herkunft aus der Empirie. Die neue Kunst nimmt diese, gebeugt unter ihrer unmäßigen Last, so schwer, daß ihr der Spaß an der Fiktion vergeht. Erst recht mag sie nicht die Fassade wiederholen. Indem sie die Kontamination mit dem verhindert, was bloß ist, drückt sie es desto unerbittlicher ab. Kafkas Kraft schon ist die eines negativen Realitätsgefühls; was an ihm dem Unverstand phantastisch dünkt, ist »Comment c’est«. Durch ἐποχή von der empirischen Welt hört die neue Kunst auf, phantastisch zu sein. Nur Literarhistoriker konnten Kafka und Meyrink, nur Kunsthistoriker Klee und Kubin unter dieselbe Kategorie bringen. Freilich spielte phantastische Kunst in ihren großartigsten Gebilden in das hinüber, was die Moderne, ledig des Bezugssystems des Normalen, zu sich selbst brachte: so Partien aus Poes Pymerzählung, aus Kürnbergers Amerikamüdem, bis zu Wedekinds Mine-Haha. Gleichwohl ist nichts der theoretischen Erkenntnis moderner Kunst so schädlich wie ihre Reduktion auf Ähnlichkeiten mit älterer. Durchs Schema ›Alles schon dagewesen‹ schlüpft ihr Spezifisches; sie wird auf eben das undialektische, sprunglose Kontinuum geruhiger Entwicklung nivelliert, das sie aufsprengt. Unleugbar die Fatalität, daß keine Deutung geistiger Phänomene möglich ist, ohne einige Übersetzung von Neuem in Älteres; auch sie hat etwas vom Verrat. An zweiter Reflexion wäre es, das zu korrigieren. Am Verhältnis der modernen Kunstwerke zu älteren, die ihnen ähneln, wäre die Differenz herauszuarbeiten. Versenkung in die geschichtliche Dimension müßte aufdecken, was einst ungelöst blieb; nicht anders ist das Gegenwärtige mit dem Vergangenen zu verknüpfen. Die gängige geistesgeschichtliche Haltung dagegen möchte virtuell Neues überhaupt aus der Welt beweisen. Dessen Kategorie jedoch ist seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts – seit dem Hochkapitalismus – zentral, allerdings in Korrespondenz zur Frage, ob ein Neues überhaupt 37schon war. Kein Kunstwerk ist seitdem mehr gelungen, das gegen den wie immer auch schwebenden Begriff von Moderne sich spröde machte. Was vor der Problematik sich zu salvieren gedachte, welche man der Moderne attestierte, seit es sie gab, ging desto schneller zugrunde.
Selbst einem des Modernismus so wenig verdächtigen Komponisten wie Anton Bruckner wären seine bedeutendsten Wirkungen versagt geblieben, hätte er nicht mit dem fortgeschrittensten Material seiner Periode, der Wagnerschen Harmonik, operiert, die er dann freilich paradox umfunktionierte. Seine Symphonien fragen, wie ein Altes doch noch, als Neues nämlich, möglich sei; die Frage bezeugt die Unwiderstehlichkeit von Moderne, das Doch noch bereits ein Unwahres, auf welches gerade die Konservativen seiner Tage als auf ein Unstimmiges hämisch deuten konnten. Daß die Kategorie des Neuen nicht als kunstfremdes Sensationsbedürfnis sich abtun läßt, ist zu erkennen an seiner Unwiderstehlichkeit. Als, vor dem Ersten Krieg, der konservative, doch überaus sensible englische Musikkritiker Ernest Newman Schönbergs Orchesterstücke op. 16 hörte, warnte er, man solle diesen Schönberg nicht unterschätzen, er gehe aufs Ganze; dies Moment wird vom Haß als das Destruktive des Neuen registriert, mit besserem Instinkt als von der Apologetik. Schon der alte Saint-Saëns spürte etwas davon, als er, den Eindruck Debussys abwehrend, erklärte, es müsse doch auch andere Musik geben als solche. Was den Veränderungen im Material, die bedeutende Neuerungen mit sich führen, ausweicht, und was ihnen sich entzieht, stellt sogleich als ausgehöhlt, unkräftig sich dar. Newman muß bemerkt haben, daß die Klänge, die Schönberg in den Orchesterstücken freigesetzt hatte, nicht mehr aus der Welt fortzudenken sind, und daß sie, einmal existent, Implikationen für das gesamte Komponieren haben, die schließlich die traditionelle Sprache beseitigen. Das währt fort; man muß nur nach einem Stück von Beckett ein gemäßigteres zeitgenössisches gesehen haben, um dessen innezuwerden, wie sehr das Neue urteilsloses Urteil ist. Noch der ultra-restaurative Rudolf Borchardt hat bestätigt, daß ein Künstler über den einmal erreichten Standard seiner Periode verfügen müsse. Die Abstraktheit des Neuen ist notwendig, man kennt es so wenig wie das furchtbarste Geheimnis von Poes Grube. In der Abstraktheit des 38Neuen aber verkapselt sich ein inhaltlich Entscheidendes. Der alte Victor Hugo hat es in dem Wort über Rimbaud getroffen, er habe der Dichtung einen frisson nouveau geschenkt. Der Schauer reagiert auf die kryptische Verschlossenheit, die Funktion jenes Moments des Unbestimmten ist. Er ist aber zugleich die mimetische Verhaltensweise, die auf Abstraktheit als Mimesis reagiert. Nur im Neuen vermählt sich Mimesis der Rationalität ohne Rückfall: ratio selbst wird im Schauer des Neuen mimetisch: mit unerreichter Gewalt bei Edgar Allan Poe, wahrhaft einem der Leuchttürme Baudelaires und aller Moderne. Das Neue ist ein blinder Fleck, leer wie das vollkommene Dies da. Tradition ist, wie jegliche geschichtsphilosophische Kategorie, nicht derart zu fassen, als ob in ewigen Stafettenläufen eine Generation, ein Stil, ein Meister dem nächsten die eigene Kunst in die Hand gäbe. Soziologisch und ökonomisch wird, seit Max Weber und Sombart, zwischen traditionalistischen und nicht-traditionalistischen Perioden unterschieden; Tradition als Medium geschichtlicher Bewegung hängt in ihrer eigenen Beschaffenheit von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen ab und verändert mit ihnen sich qualitativ. Die Stellung der gegenwärtigen Kunst zur Tradition, die ihr vielfach als Traditionsverlust angekreidet wird, ist von der Veränderung innerhalb der Kategorie Tradition selbst bedingt. In einer wesentlich nicht-traditionalistischen Gesellschaft ist ästhetische Tradition a priori dubios. Die Autorität des Neuen ist die des geschichtlich Unausweichlichen. Insofern impliziert es objektiv Kritik am Individuum, seinem Vehikel: ästhetisch schürzt im Neuen sich der Knoten von Individuum und Gesellschaft. Die Erfahrung von Moderne sagt mehr, obwohl ihr Begriff, wie immer auch qualitativ, an seiner Abstraktheit laboriert. Er ist privativ, von Anbeginn mehr Negation dessen, was nun nicht mehr sein soll, als positive Parole. Er negiert aber nicht, wie von je die Stile, vorhergehende Kunstübungen sondern Tradition als solche; insofern ratifiziert er erst das bürgerliche Prinzip in der Kunst. Seine Abstraktheit ist verkoppelt mit dem Warencharakter der Kunst. Darum hat Moderne, wo sie erstmals theoretisch sich artikuliert, bei Baudelaire, sogleich den Ton von Unheil. Das Neue ist dem Tod verschwistert. Was bei Baudelaire als Satanismus sich gebärdet, ist die sich selbst als negativ reflektie39rende Identifikation mit der realen Negativität des gesellschaftlichen Zustands. Weltschmerz läuft über zum Feind, der Welt.