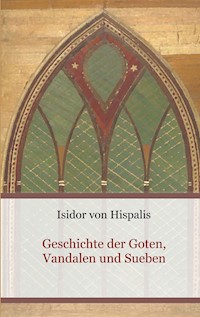
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriften des Mittelalters
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In der Buchreihe "Schriften des Mittelalters" erscheinen maßgebliche Werke von Autoren des 6. - 15. Jahrhunderts. Der erste Band enthält das Geschichtswerk des Bischofs Isidor von Hispalis, dem heutigen Sevilla, aus dem 7. Jh. über das Volk der Goten. Besonderen Wert hat sein Werk, da es für die Zeit von 590 an die vorzüglichste, zum Teil sogar ausschließliche Quelle für die Geschichte des Westgotenvolks ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriften des Mittelalters
Band 1
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Sankt Isidors, des Bischofs von Hispalis,Geschichte von den Königen der Goten, Vandalen und Sueben
Ebendesselben Isidor zusammenfassender Bericht zum Lob der Goten
Geschichte der Vandalen
Geschichte der Sueben
Aus der Geschichte des Beda Venerabilis
Erstes Buch
Zweites Buch
Einleitung.
ISIDOR, der Sohn des Severian, eines Provinzialen aus dem Distrikt von Cartagena, ist geboren um das Jahr 570. Er wurde ausgebildet durch seinen älteren Bruder Leander, Bischof von Sevilla (Hispalis), einen Freund des Papstes Gregor I., der in dessen Sinne viel dazu beigetragen hat, daß die Westgoten sich von der arianischen Lehre zum Katholizismus wandten. Im Anfang des 7. Jahrhunderts wurde Isidor der Nachfolger seines Bruders auf dem Bischofsstuhl von Sevilla, den er bis zu seinem Tode im Jahre 636 inne hatte. Wie sein Freund und Zeitgenosse, der Bischof Braulio von Zaragoza, sagt, hatte ihn Gott eigens gesandt, „um nach den schweren Zeiten, von denen Spanien heimgesucht worden war, die Denkmäler des Altertums wieder aufzurichten.“ Als erster Bischof der spanischen Kirche leitete er zwei Konzilien und galt bei seinen Zeitgenossen als eine Stütze der Kirche, sowie als ein Mann von umfassender Gelehrsamkeit und hinreißender Beredsamkeit. Während des ganzen Mittelalters war er eine Hauptquelle aller Wissenschaft, hauptsächlich wegen seines großen Werkes, der 20 Bücher Etymologiarum (oder Originum), einer Enzyklopädie der gesamten Wissenschaft, die er auf Anregung seines oben erwähnten Freundes Braulio verfaßte, der auch nach des Autors Tode die Einteilung in Bücher besorgte. Die Fülle des hier zusammengetragenen Materials ist geradezu staunenswert, und mit Recht nennt Ebert1 den Isidor „den größten Exzerpisten und Kompilator, den es vielleicht gegeben hat.“ Seine Bedeutung für das Mittelalter liegt darin, daß bei stets zunehmender Seltenheit der Handschrift sein Werk bald als Hauptquelle aller Kenntnis vom Altertum galt. Auch wir bewundern den außerordentlichen Fleiß des Mannes, wenngleich wir die oft rein äußerliche Einteilung und Behandlung der Materie und einen großen Teil seiner sogenannten Etymologien nicht billigen können. Auch Isidors andere Schriften, grammatisch-etymologischer und theologischer Art, erfreuten sich im Mittelalter großen Ansehens. An geschichtlichen Werken haben wir von ihm erstens das Chronicon, eine Weltchronik, gezählt von der Erschaffung der Welt und bis zum Jahre 615 n. Chr. reichend, im Anschluß an andere ähnliche Werke, wie die des Julius Africanus, Eusebius-Hieronymus und Victor Tunnunensis, von Isidor selbst eingeteilt nach den sechs Augustinischen Weltaltern2; eine trockene Aufzählung geschichtlicher Tatsachen nach Jahreszahlen, die im sechsten Weltalter nach den römischen Kaisern geordnet sind. Sein zweites geschichtliches Werk ist die in Folgendem übersetzte Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, eine chronologisch angelegte Geschichte der Westgoten, von ihrem Anfang (253 n. Chr.) bis zum Jahre 625 mit einem Anhang, der die Geschichte der Vandalen und Sueben behandelt. – Abgesehen von Einzelheiten hat Isidor für die ältere Zeit die Fortsetzung der Chronik des Eusebius von Hieronymus (bis 378) und die Historiæ des Orosius (417 vollendet) benutzt, für die spanischen Verhältnisse die Chronik des Idacius (die Jahre 379–469 umfassend), für die afrikanischen die des Victor von Tunnuna (für die Jahre 444–566), gegen Ende auch seinen Zeitgenossen Johannes von Biclaro (für die Jahre 565– 590) – Werke, die uns sämtlich erhalten sind; außerdem hat Isidor noch benutzt ein verlorengegangenes Chronicon des Bischofs Maximus von Zaragoza, eines älteren Zeitgenossen. Eigenen Wert hat Isidors Werk von Eurichs Regierung an (466); wir sind auf ihn besonders angewiesen für die Jahre 531–568; von 590 an ist er unsere vorzüglichste, zum Teil sogar ausschließliche Quelle für die Geschichte des Westgotenvolks. – Hervorzuheben ist endlich noch, daß Isidor, obgleich Romane von Geburt, nicht nur sein Vaterland Spanien mit Begeisterung preist, sondern auch ganz entschieden die Westgoten für das erste Volk der Welt erklärt3; wir sehen also, daß sich zu seiner Zeit die Verschmelzung der Westgoten und der von ihnen unterworfenen Romanen, gefördert durch die kirchliche Vereinigung, bereits vollzogen und sich gewissermaßen ein spanisches Nationalgefühl gebildet hat. –
Beda, den die bewundernde Nachwelt schon seit dem 9. Jahrhundert Venerabilis, den Verehrungswürdigen, nannte, ist im Jahre 672 geboren auf dem Gebiet des 674 gegründeten Klosters Warmouth in Northumberland. Dem Abt jenes Klosters, Benedict, wurde er schon als siebenjähriger Knabe zur Erziehung übergeben, dann vom Abt des Tochterklosters Jarrow, Ceolfrid, weiter ausgebildet. Schon im 19. Lebensjahr ward er zum Diakon, im 30. zum Presbyter geweiht. Sein ganzes Leben fast hat er in den Mauern jener beiden Klöster zugebracht; in dem letzteren starb er auch und wurde dort begraben (735). Jene beiden Äbte, besonders Benedict, hatten von ihren Romfahrten große Mengen von Büchern mitgebracht und so, außer ihrer persönlichen Anregung, den anglischen Mönchen die Möglichkeit eines umfassenden Studiums geboten. Ihr eifrigster Schüler aber war Beda, der sein reiches Wissen auf den Gebieten der Grammatik und Rhetorik, Mathematik und Poetik, der exegetischen und dogmatischen Theologie, der kirchlichen und profanen Geschichte in zahlreichen Werken niederlegte. Weitaus das bedeutendste ist die Historia ecclesiastica gentis Anglorum in fünf Büchern, die er in den letzten Jahren seines Lebens vollendete (731). Diese Geschichte der englischen Kirche ist, abgesehen von der Einleitung, welche die ersten 22 Kapitel des ersten Buches umfaßt, ganz das eigene Werk Bedas, nach umfangreichem Material und mit wörtlicher Mitteilung der wichtigsten Aktenstücke sorgfältig gearbeitet; die Wahrheit ist ihm, wie er selbst im Vorwort sagt, „das Grundgesetz der Geschichte“. Auch ist die Sprache ruhig und leidenschaftslos, der Ausdruck klar und gewandt, das Latein für jene Zeit von großer Reinheit, so daß er als Schriftsteller hoch über seinem Vorgänger Isidor steht, dessen Werk ihm übrigens wohlbekannt war.
Berlin, 19. Juni 1887 D. Coste.
1 A. Ebert, Geschichte der christlich-lateinischen Litteratur bis zum Zeitalter Karls d. Gr. Leipzig 1874, S. 556.
2 S. Aug. de Civitate Dei. XVI. 43. XXII. 30.
3 Das darf man behaupten, selbst wenn man das Elogium Hispaniæ, welches in den besten Handschriften fehlt, für einen späteren Zusatz hält. Vergl. Hertzberg, a. a. O. S. 18.
Sankt Isidors, des Bischofs von Hispalis, Geschichte von den Königen der Goten, Vandalen und Sueben.
1. Die Goten sind sicherlich ein sehr altes Volk; manche Leute nehmen an, daß sie von Magog, Japhets Sohn, abstammen, und berufen sich dafür auf die Ähnlichkeit der letzten Silbe dieses Wortes, noch mehr aber auf den Propheten Ezechiel.4 Doch haben früher die Gelehrten sie vielmehr Geten als Gog und Magog genannt. Sie werden als ein sehr tapferes Volk geschildert, das auch Judäa zu verheeren versucht hat.
2. Ihr Name bedeutet in unserer Sprache die Bedeckten (Geschützten), womit ihre Tapferkeit bezeichnet wird; und wahrlich, kein Volk in der ganzen Welt hat dem römischen Reich so viel zu schaffen gemacht wie dies. Vor ihnen warnte Alexander, fürchtete sich Pyrrhus, zog sich Cæsar zurück.5 Viele Jahrhunderte hindurch standen sie früher unter Herzögen, dann unter Königen. Diese Regierungszeiten will ich der Reihe nach aufführen und nach alten Quellen zusammenstellen, wie sie geheißen und was für Taten sie verrichtet haben.
3. Im Jahre 12 vor unserer Ära6 als Cn. Pompejus und C. Julius Cæsar um die Weltherrschaft im Bürgerkrieg kämpften, kamen die Goten nach Thessalien, um dem Pompejus Hilfe zu leisten und gegen Cæsar zu kämpfen. Während im Heer des Pompejus Äthiopier, Inder, Perser, Meder, Griechen, Armenier, Skythen und die anderen Völker des Orients, gegen Julius aufgerufen, kämpften, leisteten jene vor allen übrigen dem Cæsar tapferen Widerstand. Cæsar soll sogar im Schrecken über ihre Zahl und Tapferkeit haben fliehen wollen, wenn nicht die Nacht dem Kampf ein Ende gemacht hätte. Da sagte Cæsar, Pompejus verstehe nicht zu siegen, Cæsar aber sei unbesieglich; denn wenn jener zu siegen verstände, hätte er an diesem Tag mit so furchtbaren Kräften den Cæsar besiegen müssen.
4. Im ersten Jahr der Regierung des Valerian (253–260) und Gallienus (253-265) stiegen die Goten von den hohen Bergen, auf denen sie wohnten, herab und verwüsteten Griechenland, Makedonien, Pontus, Kleinasien und Illyrien. Letzteres sowie Makedonien hielten sie fünfzehn Jahre lang besetzt. Dann wurden sie vom Kaiser Claudius (268-70) besiegt7 und kehrten in ihre Stammsitze zurück. Die Römer aber rechneten es dem Claudius Augustus zu hohem Ruhm, daß er ein so tapferes Volk von den Grenzen des Reiches zurückgetrieben habe, und stellten für ihn auf dem Forum einen goldenen Schild, auf dem Kapitol eine goldene Bildsäule auf.
5. Im 26. Jahre der Herrschaft Konstantins überschwemmten die Goten das Gebiet der Sarmaten und fielen dann in zahllosen Schwärmen über die Römer her, in ungestümer Tapferkeit alles mit Feuer und Schwert verwüstend. Gegen sie zog Konstantin aus, trieb sie nach heftigem Widerstand über die Donau zurück und erhöhte durch diesen Sieg über die Goten den Ruhm, den er durch Niederwerfung anderer Völkerschaften bereits erworben hatte. Die Römer belobten ihn unter Beistimmung des Senats öffentlich dafür, daß er ein so großes Volk besiegt und die alten Grenzen des Reiches wieder hergestellt hatte.
6. Im 5. Jahre der Herrschaft des Valens gelangte zuerst zur Königsherrschaft über die Goten Athanarich. Er regierte dreizehn Jahre. In grausamer Glaubensverfolgung wandte er sich gegen diejenigen seiner eigenen Untertanen, welche für Christen galten, und machte sehr viele, die den Götzenbildern zu opfern sich weigerten, zu Märtyrern. Die übrigen verfolgte er zwar auch auf mancherlei Weise; ihre große Zahl hielt ihn aber davon zurück, sie umzubringen. So schenkte er ihnen zwar das Leben, zwang sie dagegen aus seinem Reich zu weichen und in die Provinzen des römischen Reiches auszuwandern.8





























