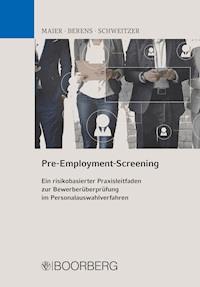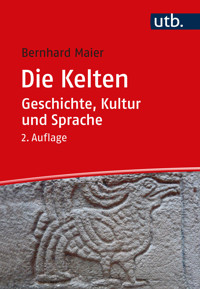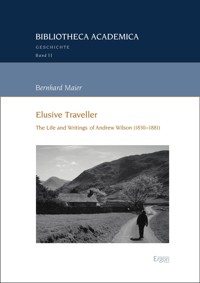9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schottland hat seit 1997 immer größere Autonomie innerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien erlangt. Das Streben danach lässt sich nur aus der schottischen Geschichte verstehen, welche die längste Zeit in anderen Bahnen verlief als die englische. Bernhard Maiers glänzende Einführung erläutert die politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen, die Schottlandgeprägt haben und den Reiz des Landes bis heute bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Bernhard Maier
GESCHICHTE SCHOTTLANDS
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Karte
Einleitung
1. Von der Steinzeit bis zu den frühen Kelten
Frühe Jäger und Sammler
Erste Siedler
Die Bronze- und Eisenzeit
2. Von der Ankunft der Römer bis zur Christianisierung
Die Feldzüge der Römer in Schottland
Frühe Fürstentümer und Königreiche der nachrömischen Zeit
Die ersten Christen
3. Vom Auftreten der Wikinger bis zum Ende des Hauses Dunkeld
Die Anfänge des Königreichs Schottland
Religion und Kirche
Geschichte im Spiegel der Dichtung
4. Von der Invasion Eduards I. bis zur Schlacht von Flodden Field
Schottland und England im Spätmittelalter
Wirtschaft, Gesellschaft und Herrschaft
Religiöses Leben
5. Von der Krönung Jakobs V. bis zur Union mit England
Die Reformation und ihre Folgen
Kunst, Architektur und Musik in der Frühen Neuzeit
Bildung, Wissenschaft und Literatur
6. Das 18. Jahrhundert
Politische und wirtschaftliche Entwicklungen
Die Schottische Aufklärung und ihr Erbe
«Ossian» Macpherson und seine europäische Wirkung
7. Das 19. Jahrhundert
Schottland im Kontext des Britischen Weltreichs
Industrialisierung, Urbanisierung und Nationalbewusstsein
Religiosität im Zeitalter der Kirchenspaltung
8. Vom Ersten Weltkrieg bis zum Erfolg der Autonomiebewegung
Gesellschaft und Wirtschaft im Umbruch
Politische Entwicklungen
Literatur und Kunst in der Moderne
9. Vom Beginn der Dezentralisierung bis zur Gegenwart
Politik im Zeichen der Dezentralisierung
Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung
Kultur zwischen Regionalismus und europäischem Bewusstsein
Rückblick und Ausblick
Weiterführende Literatur
Register
Karte 2
Zum Buch
Vita
Impressum
Karte
Schottland: Naturräumliche Gliederung
Schottland: Verwaltungsgliederung in Regionen und Inselbezirke1975–1996 (seit April 1996 besteht eine zum Teil sehr kleinräumigeVerwaltungsgliederung in 32 Council Areas)
Einleitung
Eine Geschichte Schottlands – und nicht etwa Großbritanniens – vorzulegen, bedarf kaum einer Rechtfertigung: Nicht nur in Schottland selbst, auch auf dem europäischen Festland ist man sich weithin dessen bewusst, dass das nördliche Drittel der Britischen Hauptinsel eine eigenständige Größe darstellt. Was diese Eigenständigkeit ausmacht, wird jedoch vom Beobachter aus der Ferne und vom Reisenden aus der Nähe mit unterschiedlicher Intensität wahrgenommen. Eigenheiten der Landschaft und der Sprache kennt fast jeder, aber solche des Rechts, der Religion und des Bildungswesens sind im deutschsprachigen Raum schon weniger geläufig. Wie sich die Unterschiede zum südlichen Nachbarn England historisch erklären, ist hierzulande oft völlig unbekannt. Das vorliegende Buch will Abhilfe schaffen, indem es dem Leser die Geschichte Schottlands von den Anfängen bis zur Gegenwart sowohl in der Abgrenzung zu England als auch in ihren internationalen Bezügen und Verflechtungen knapp und übersichtlich, doch zugleich anschaulich vor Augen führt.
«Schottland» in der heute geläufigen Bedeutung des Wortes gibt es erst seit dem Mittelalter, doch versteht man die Geschichte seit jener Zeit bis hin zur Gegenwart nur, wenn man auch die vorausgehenden Epochen ins Auge fasst. Das vorliegende Buch erzählt daher nicht die Geschichte eines Staates oder einer mehr oder weniger autonomen Region, sondern die Geschichte der Menschen, die seit vielen Tausend Jahren in dem Land leben, das man heute unter dem Namen Schottland kennt. Diese Geschichte besitzt viele Aspekte, darunter Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Sprache und Literatur, Religion und Recht, Alltagsleben und Mentalität. Dabei ist neben dem Wandel all dieser Aspekte im Lauf der Jahrhunderte auch eine ausgeprägte regionale Vielfalt zu verzeichnen, in der sich unterschiedliche äußere Bedingungen und wechselnde kulturelle Einflüsse widerspiegeln. Dies verleiht der schottischen Geschichte ihre besondere Eigenart und ihren eigentümlichen Reiz. Ein Schwerpunkt des Buchs liegt dementsprechend auf der Beschreibung der vielfältigen äußeren Einflüsse aus ganz Europa, welche die Bewohner Schottlands im Laufe ihrer Geschichte aufgegriffen und verarbeitet haben, und in der Darstellung des – gemessen an Größe und Einwohnerzahl des Landes erstaunlichen – Beitrags, den sie selbst gerade auf den Gebieten der Wissenschaft, Philosophie und Literatur zur Geschichte Europas und der Welt geleistet haben. Richten wir den Blick jedoch zunächst auf einige für die Geschichte wesentliche geographische Daten.
Mit einer Fläche von ca.79.000km2 ist Schottland fast viermal so groß wie Wales (ca.21.000km2), umfasst aber nur etwa drei Fünftel der Fläche Englands (ca.130.000km2) oder etwas mehr als ein Fünftel der Fläche Deutschlands (ca.357.000km2). Während die Landgrenze zu England kaum 100 km lang ist, beträgt die Länge der Küstenlinie insgesamt knapp 3700 km, denn Schottland zählt außer dem Festland noch fast 800 Inseln, von denen jedoch nur jede zehnte bewohnt ist. Historisch bedeutsam sind insbesondere die beiden Inselgruppen der Inneren und der Äußeren Hebriden im Westen (rund 500 Inseln mit ca.7300km2) sowie die Orkney-Inseln (rund 100 Inseln mit ca.1000km2) und die Shetland-Inseln (rund 100 Inseln mit ca.1400km2) im Norden. Auf dem Festland unterscheidet man üblicherweise das Hochland (Highlands), das Mittlere Tiefland (Central Lowlands) und das Südliche Hügelland (Southern Uplands). Die Grenze zwischen dem Südlichen Hügelland und dem Mittleren Tiefland verläuft entlang einer Linie von Girvan im Südwesten bis Dunbar im Nordosten, die zwischen dem Mittleren Tiefland und dem Hochland entlang der sogenannten Highland Line, die von der Insel Arran im Südwesten nach Stonehaven im Nordosten führt. Das Hochland wiederum besteht zum einen aus dem Nordwestlichen Hochland (Northwest Highlands), zum anderen aus den heute so genannten Grampian Mountains. Diese sind voneinander geschieden durch die tektonische Verwerfung des «Großen Tals» (Great Glen) mit dem von 1803 bis 1822 angelegten «Kaledonischen Kanal» zwischen Fort William im Südwesten und Inverness im Nordosten.
Gemessen an seiner relativ geringen Größe bietet Schottland eine ausgeprägte geologische Vielfalt, die fast drei Milliarden Jahre Erdgeschichte widerspiegelt. Daher wurde Schottland nicht von ungefähr im 18. und 19. Jahrhundert zur Heimat einiger der bedeutendsten Geologen. Zu den ältesten Schichten des Präkambrium und Kambrium zählt ein Großteil der Gesteinsformationen des Hochlands, der Hebriden sowie der Orkney- und Shetland-Inseln. Etwas jünger, aus dem Silur, sind dagegen die Sedimentgesteine des Südlichen Hügellands. Zu den jüngsten Schichten zählen die Gesteinsformationen des Mittleren Tieflands, die mit ihren Kohle- und Eisenerzvorkommen im 19. Jahrhundert maßgeblich zur Industrialisierung und Urbanisierung Schottlands beitrugen. Die geologisch ältesten Teile Schottlands und der Britischen Inseln überhaupt sind die drei Milliarden Jahre alten Gneisformationen der Insel Lewis. Mit England erdgeschichtlich verbunden ist Schottland seit ca.400 Millionen Jahren, und die endgültige Ablösung von dem ursprünglich benachbarten Teil Nordamerikas (mitsamt der Entstehung vulkanischer Inseln wie Skye und Mull) erfolgte vor 60 Millionen Jahren. Ihr heutiges Aussehen verdankt die schottische Landschaft weitgehend dem Wechsel von Warm- und Kaltzeiten im letzten Eiszeitalter (Pleistozän), das in Schottland vor 1,8 Millionen Jahren begann und vor rund 12.000 Jahren mit dem Abschmelzen der letzten Gletscher endete. Mit dem Auftreten der ersten Jäger und Sammler am Ende der letzten Eiszeit beginnt die Geschichte, die im Folgenden erzählt werden soll.
1. Von der Steinzeit bis zu den frühen Kelten
Die geschichtliche Epoche beginnt in Schottland mit dem Einsetzen der schriftlichen Überlieferung im Gefolge der römischen Eroberungen des 1. Jahrhunderts n. Chr. Davor liegt die ungefähr fünfmal so lange Epoche der Vorgeschichte, über die nur archäologische Funde und Denkmäler Auskunft geben. Sie erstreckt sich vom ersten Auftreten altsteinzeitlicher Jäger und Sammler am Ende der letzten Eiszeit um 10.000 v. Chr. über die Einführung des Ackerbaus und der Viehzucht zu Beginn der Jungsteinzeit um 4000 v. Chr. und die Anfänge der Bronzeverarbeitung um 2000 v. Chr. bis zur unmittelbar vorrömischen Eisenzeit, deren Anfänge in die Zeit um 700 v. Chr. zu datieren sind.
Frühe Jäger und Sammler
Die derzeit frühesten Hinweise auf die Anwesenheit von Menschen in Schottland geben einige Flintwerkzeuge, die 2005 auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Elsrickle in South Lanarkshire gefunden wurden. Sie stammen noch aus dem Jungpaläolithikum, der letzten Phase der Altsteinzeit, während man die ältesten bis dahin bekannten vorgeschichtlichen Funde Schottlands in das darauf folgende Mesolithikum datiert. Zu dieser Zeit war immer noch so viel Eis gebunden, dass der Meeresspiegel sehr viel niedriger war als in der daran anschließenden Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Infolgedessen waren nicht nur die spätere Insel Britannien und Kontinentaleuropa miteinander verbunden, man konnte auch trockenen Fußes vom schottischen Festland zu den Orkney-Inseln und auf die Inneren Hebriden gelangen. Zu den ältesten mesolithischen Funden in Schottland gehören mehrere Hundert Steinwerkzeuge sowie einige Pfostenlöcher, die man als Überreste eines Lagers steinzeitlicher Jäger und Sammler interpretiert. Man entdeckte sie in dem Ort Cramond an der Mündung des Flusses Almond in den Firth of Forth, ca.8 km nordwestlich des Stadtzentrums von Edinburgh. Anhand der ebenfalls aufgefundenen Schalen von Haselnüssen konnte man diese Funde mit Hilfe der Radiokarbon-Methode in die Zeit um 8500 v. Chr. datieren. Nicht weit davon entfernt, in Echline (South Queensferry), entdeckte man 2012 bei Bauarbeiten neben zahlreichen Flintwerkzeugen die Spuren einer ovalen, ca.7 m langen Behausung mit mehreren Feuerstellen, die vielleicht nur während der kalten Jahreszeit genutzt wurde. Nach Ausweis der Radiokarbon-Datierungen wurde sie in der zweiten Hälfte des 9. Jahrtausends v. Chr. angelegt. Aus der Zeit um 8000 v. Chr. stammt eine Reihe von zwölf Pfostenlöchern, die 2004–2006 bei Ausgrabungen in Warren Field unweit von Crathes Castle in Aberdeenshire untersucht wurden. Den daran beteiligten Archäologen zufolge handelt es sich dabei um die Überreste eines am Aufgang der Sonne zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende orientierten Kalenders, in dem sich die Beobachtung der unterschiedlichen Mondphasen und die Wahrnehmung der Abweichung zwischen Mond- und Sonnenjahr widerspiegeln. Trifft diese Deutung zu, ist dies die mit Abstand älteste derzeit bekannte Anlage dieser Art weltweit.
Mehrere mesolithische Fundstätten aus der Zeit zwischen dem 7. und dem 5. Jahrtausend v. Chr. sind im Hochland und auf den Hebriden gelegen, was sich zum Teil wohl aus den günstigeren Erhaltungsbedingungen aufgrund der sehr viel geringeren Bevölkerungsdichte erklärt. Zu den ältesten Spuren der Anwesenheit von Menschen in dieser Region zählen Hinweise auf den Gebrauch von Steinwerkzeugen und die verkohlten Schalen von Haselnüssen in der Nähe des Ortes Kinloch auf der Hebrideninsel Rùm. Am nahe gelegenen Strand von Loch Scresort fand man noch die Spuren eines Lagers von Menschen, die dort im 7. Jahrtausend v. Chr. den auf der Insel vorkommenden Heliotrop (englisch bloodstone) abbauten. Eine wichtige Quelle unserer Kenntnis der menschlichen Aktivitäten in jener Zeit sind die oft in Strandnähe angelegten Küchenabfallhaufen, die im europäischen Raum von Portugal über Irland und Schottland bis nach Dänemark verbreitet sind und seit der Mitte des 19. Jahrhunderts systematisch erforscht werden; im Dänischen nennt man sie køkkenmøddinger, im Englischen shell middens und im Portugiesischen concheiros. Solche Abfallhaufen, die vor allem aus den Schalen von Austern, Miesmuscheln und Napfschnecken bestehen, mitunter aber auch Werkzeugreste und menschliche Knochen enthalten, kennt man in Schottland unter anderem aus Sand auf der Halbinsel Applecross in Wester Ross, aus Staffin auf der gegenüberliegenden Insel Skye und von der weiter südlich gelegenen Insel Oronsay, wo man dem Inhalt der Abfallhaufen zufolge nicht nur Napfschnecken sammelte, sondern auch Seehunde jagte und Fischerei betrieb. Die fünf Abfallhaufen in Oronsay, die man ins 6. und 5. Jahrtausend datiert, gehören zu den bedeutendsten mesolithischen Fundstätten der Britischen Inseln. Vereinzelte Funde menschlicher Finger- und Zehenknochen lassen vermuten, dass die Abfallhaufen auch eine rituelle oder religiöse Bedeutung besaßen. Überreste regelrechter Bestattungen aus dem Mesolithikum wurden in Schottland bislang jedoch nicht gefunden.
Um 6100 v. Chr. machten die Menschen in Schottland erstmals die Erfahrung einer größeren Naturkatastrophe. Nach dem Abrutschen einer gewaltigen Menge Gerölls an der «Großen Kante» (norwegisch Storegga), dem Kontinentalabhang vor der Westküste Norwegens, bildete sich ein wohl über 20 m hoher Tsunami, der vor allem die Nordostküste Schottlands, aber auch die weiter südlich gelegenen Küstenlandstriche in England und auf dem europäischen Festland in Mitleidenschaft zog. Anhand entsprechender Ablagerungen besonders in der Bucht von Montrose und im Firth of Forth ist die Wucht dieser Katastrophe bis heute nachweisbar. Durch den weiteren Anstieg des Meeresspiegels versank nun auch die als Doggerland bekannte vorgeschichtliche Landmasse zwischen Nordengland und Dänemark, die sich vermutlich durch reiche Fisch- und Jagdgründe ausgezeichnet und bis dahin die mesolithischen Kulturen der Britischen Inseln und des Festlands miteinander verbunden hatte.
Erste Siedler
Die ältesten Spuren ortsfester Siedlungen in Schottland stammen aus der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. Bereits 1976 entdeckte man anhand von Luftbildern in Balbridie bei Banchory in Aberdeenshire die Spuren eines 26x13 m großen neolithischen Holzhauses, bei dessen archäologischer Untersuchung auch Reste von Keramik und kleine Mengen verbrannter Knochen nachgewiesen wurden. Das älteste noch erhaltene Steinhaus in Nordeuropa findet man in Knap of Howar auf Papa Westray, einer der Orkney-Inseln. Um 3700 v. Chr. erbaut und ca.900 Jahre lang bewohnt, besteht das Gehöft aus zwei benachbarten und durch einen Gang miteinander verbundenen annähernd rechteckigen Gebäuden ohne Fenster. Archäologischen Untersuchungen des Siedlungsabfalls zufolge hielten die Bewohner Rinder, Schafe und Schweine, bauten Gerste und Weizen an, sammelten Muscheln und betrieben Fischerei. Das am besten erhaltene und zugleich bekannteste jungsteinzeitliche Dorf ist Skara Brae an der Westküste der Orkney-Hauptinsel Mainland. 1850 nach Unwetterschäden infolge eines heftigen Wintersturms entdeckt, ist Skara Brae seit 1927 Gegenstand systematischer Ausgrabungen. Zwischen 3200 und 2500 v. Chr. lebten im Durchschnitt vielleicht um die 50 Menschen in dem kleinen Ort, dessen mit steinernen Möbeln ausgestattete Steinhäuser eine durchschnittliche Grundfläche von 40m2 aufweisen. Die Bewohner lebten von der Viehzucht, bauten aber wohl auch Getreide an. Die steinernen Überreste einer ähnlichen neolithischen Siedlung mit mindestens 15 Häusern aus der Zeit um 3000 v. Chr., das sogenannte Barnhouse settlement, entdeckte man 1984 am Ufer des Loch of Harray auf Mainland.
Außer einigen Häusern und Siedlungen der jungsteinzeitlichen Bewohner Schottlands kennt man auch zahlreiche gemeinschaftliche Kammergräber, bei denen man mehrere Typen mit charakteristischer regionaler Verbreitung und Nutzungsdauer unterscheiden kann. Als älteste Anlagen dieser Art gelten die von Irland bis nach Südwestschottland verbreiteten Hof- oder Galeriegräber (court cairns) mit einer unmittelbar von einem äußeren Vorhof zugänglichen rechteckigen Grabkammer. Zu den bekanntesten und am besten erhaltenen schottischen Beispielen dieses Typs zählen die beiden benachbarten Gräber von Cairnholy I und Cairnholy II auf einem Hügel bei dem Ort Newton Stewart oberhalb der Bucht von Wigtown in Galloway. Von den Orkney-Inseln bis nach Ross and Cromarty und den Hebriden verbreitet waren hingegen die sogenannten stalled cairns, bei denen die langgezogene rechteckige Grabkammer durch beidseitig aufgestellte Reihen von Steinplatten gleichsam in einzelne Abteile oder Boxen (englisch stalls) unterteilt ist. Die bekannteste und zugleich größte Anlage dieser Art ist mit über 23 m Länge das Kammergrab von Midhowe im Süden der Orkney-Insel Rousay, das ursprünglich von einem ovalen, 33 m langen und 13 m breiten Hügel überwölbt war und in dem man die sterblichen Überreste von mindestens 25 Personen fand. Ähnlich gestaltet ist das Kammergrab von Isbister an der Südostspitze der Orkney-Insel South Ronaldsay, das ab ca.3000 v. Chr. über einen Zeitraum von mehreren Generationen hinweg erbaut und 1958 durch einen Zufall entdeckt wurde. Dort fand man über 16.000 Knochen von insgesamt mindestens 300 Personen, aber auch Knochen von Kälbern, Lämmern und verschiedenen Vogelarten. Wegen der zahlreichen Knochen und Krallen von Seeadlern wurde die Anlage als «Adlergrab» (Tomb of the Eagles) bekannt, doch wurden die Vögel nach Ausweis der 2006 veröffentlichten Radiokarbon-Datierung interessanterweise erst etliche Generationen nach dem Bau des Grabes dort eingebracht. Den jüngsten und zugleich aufwändigsten Typ neolithischer Kammergräber, dessen Verbreitung sich auf die Orkney-Inseln beschränkt, repräsentiert das auch in seiner handwerklichen Perfektion herausragende Grab von Maeshowe südöstlich des Loch of Harray auf Mainland. Erbaut um 2800 v. Chr., besteht die Anlage aus einem 11 m langen Gang, der sich am Untergang der Sonne zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende orientiert und zu einer annähernd quadratischen, von einem Kragsteingewölbe überdeckten zentralen Grabkammer mit drei Seitenkammern führt. Darüber wölbt sich ein über 7 m hoher Hügel mit einem Durchmesser von 35 m, der von einem bis zu 14 m breiten Graben umgeben ist.