
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Geschwister Nicole und Kevin sind in einer verzweifelten Lage. Der Vater mißhandelt und mißbraucht sie, die Mutter weiß es und schweigt. Von anderen werden sie gemobbt und geschlagen, Freunde haben sie nicht, sie sind gänzlich auf sich allein angewiesen. Eines Tages wird Stephan Zeuge, wie Kevin wieder einmal von Jugendlichen bedrängt wird. Kevin kommt ins Krankenhaus, und seine Schwester erzählt Stephan, wie es soweit gekommen ist. Sie ist niedergeschlagen und hoffnungslos. Stephan erfährt, unter welchen Umständen die beiden Geschwister leben müssen und entscheidet spontan, sich fortan um die beiden zu kümmern. Langsam gewinnt er ihr Vertrauen. Mit Hilfe seiner Freundin Patrizia sorgt er dafür, daß sie bei ihm auf Dauer wohnen, weiter die Schule besuchen und sogar die Prozesse durchstehen können, die geführt werden müssen, nachdem der Mißbrauch der Kinder bekannt geworden ist. Trotzdem es ihnen immer besser geht, lassen die Geschwister nicht voneinander. Sie kennen es nicht anders und wollen es auch nicht anders. Sie vertrauen einander rückhaltlos, in jeder Beziehung. Kann man dieses Verhältnis zweier Teenager-Geschwister zueinander eigentlich noch normal finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlef Wolf
Geschwisterliebe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch
Ein Wort zuvor
Prolog
1. Kämpfe
2. Einzug
3. Neue Freunde
4. Reisen
5. Zwangsmaßnahmen
6. Verfahren
7. Neuanfang
8. Kontakte
9. Veränderungen
Epilog
Der Autor
Impressum neobooks
Das Buch
Die Geschwister Nicole und Kevin sind in einer verzweifelten Lage. Der Vater mißhandelt und mißbraucht sie, die Mutter weiß es und schweigt. Von anderen werden sie gemobbt und geschlagen, Freunde haben sie nicht, sie sind gänzlich auf sich allein angewiesen.
Eines Tages wird Stephan Zeuge, wie Kevin wieder einmal von Jugendlichen bedrängt wird. Kevin kommt ins Krankenhaus, und seine Schwester erzählt Stephan, wie es soweit gekommen ist. Sie ist niedergeschlagen und hoffnungslos. Stephan erfährt, unter welchen Umständen die beiden Geschwister leben müssen und entscheidet spontan, sich fortan um die beiden zu kümmern.
Langsam gewinnt er ihr Vertrauen. Mit Hilfe seiner Freundin Patrizia sorgt er dafür, daß sie bei ihm auf Dauer wohnen, weiter die Schule besuchen und sogar die Prozesse durchstehen können, die geführt werden müssen, nachdem der Mißbrauch der Kinder bekannt geworden ist.
Trotzdem es ihnen immer besser geht, lassen die Geschwister nicht voneinander. Sie kennen es nicht anders und wollen es auch nicht anders. Sie vertrauen einander rückhaltlos, in jeder Beziehung.
Kann man dieses Verhältnis zweier Teenager-Geschwister zueinander eigentlich noch normal finden?
Ein Wort zuvor
Diese Geschichte ist meiner Phantasie entsprungen. Es gibt keinen Zusammenhang mit Personen und tatsächlichen Begebenheiten, und falls jemand doch einen solchen konstruieren kann, so habe ich das nicht beabsichtigt. Das wäre dann ein Zufall.
Das gilt auch für die Namen der Personen in dieser Geschichte. Ich habe sie gewählt, weil sie mir gefallen haben oder weil ich sie für zum Charakter der Person passend hielt. Falls jemand tatsächlich so heißt, wie eine Person aus dieser Geschichte oder sich in einer solchen zu erkennen glaubt, so ist er nicht gemeint. Ganz sicher nicht.
Raesfeld-Erle im November 2014
Detlef Wolf
Prolog
Der Keller war groß, etwa sechs mal sechs Meter. Die Wände weiß gekalkt, die beiden Kellerfenster zugemauert. Der einzige Eingang mit einer Stahltür verschlossen. Von der Decke hingen einige nackte Glühbirnen, die den Raum in ein trübes Dämmerlicht tauchten. Der Zigarettenrauch, der wie ein feiner Nebelschleier im Raum hing, machte die Lichtverhältnisse nicht besser. Die Zwangsbelüftung arbeitete nur unzureichend. Aber das alles störte die drei Männer nicht, die sich auf einer abgenutzten Polstergarnitur lümmelten und eine Schnapsflasche kreisen ließen, während sie warteten. Gesprochen wurde nichts. Sie rauchten und tranken.
Irgendwann wurde die Tür aufgestoßen. Zwei Kinder stolperten herein, ein Junge und ein Mädchen, dreizehn und fünfzehn Jahre alt, Geschwister möglicherweise, obwohl sie sich nicht besonders ähnlich sahen. Beide waren für die Jahreszeit ungewöhnlich leicht bekleidet, Jeans, T-Shirts, Flip-Flops an den nackten Füßen. Sie froren, das war nicht zu übersehen und auch nicht ihre Angst, mit der sie die drei wartenden Männer betrachteten. Mitten im Raum blieben sie stehen.
Nach ihnen betrat ein großer, schwerer Mann den Raum, einen Meter neunzig groß, weit mehr als zwei Zentner schwer. Er wirkte ungepflegt mit seinen langen, zotteligen, ungewaschenen Haaren, dem Drei-Tage-Bart, dem ehemals weißen und nunmehr vergilbten Unterhemd und der schlabbrigen Trainingshose. Seine nackten Füße steckten in abgewetzten Hausschlappen, deren Sohlen sich allmählich auflösten.
„Zieht Euch aus“, herrschte er die Kinder an.
Sie gehorchten wortlos. Unterdessen ging er zu den anderen Männern und streckte die Hand aus. Sie legten Geldscheine hinein. Mehr und immer mehr, bis der schwere Mann nickte. Wieselflink ließ er das Geld in der Tasche seiner Trainingshose verschwinden. Dann sah er zu den Kindern hinüber, die sich inzwischen ihrer Kleider entledigt hatten und nun nackt und frierend in der Mitte des Raumes standen.
Es kam Bewegung in die Gruppe. Die Männer befingerten die nackten Körper der Kinder. Einer nach dem anderen zog seine Hosen aus.
Die Schreie der Kinder drangen nicht durch die dicken Wände und die schwere Stahltür.
Nach einer Ewigkeit ließen die Kerle von den Kindern ab. Sie brachten ihre Kleidung in Ordnung und ließen sich in die Sessel und auf die Couch fallen. Zigaretten wurden angezündet, erneut machte die Schnapsflasche die Runde. Geredet wurde noch immer nichts, während der lederne Gürtel des Riesen wieder und immer wieder auf Rücken und Beine der Kinder niedersauste. Die Schreie wurden leiser, verstummten schließlich ganz. Mit schmerzverzerrten Gesichtern ließen sie die Züchtigung über sich ergehen. Lediglich ein qualvolles Stöhnen war gelegentlich zu hören, wenn die Gürtelschnalle die Haut aufriß. Die Männer lachten.
„Verschwindet“, bellte der Riese und machte eine Bewegung, als wolle er eine Fliege verscheuchen.
Hastig rafften die beiden ihre Kleidung zusammen und liefen hinaus. Mit dem Zuschlagen der schweren Stahltür verstummte das Lachen der Männer. Wortlos zogen die beiden sich an. Der Junge half seiner Schwester die Treppe hinauf in die Wohnung. Das Mädchen konnte vor Schmerzen kaum laufen. Tränen liefen über sein Gesicht, während der Junge die Lippen zusammengepreßt hatte und wütend vor sich hin starrte. Auch er hatte große Schmerzen, aber die Wut auf den Riesen, seinen Vater, war um vieles größer. Wieder einmal hatte er seine Kinder an irgendwelche geilen Kerle verkauft, um sich das nötige Geld für seinen enormen Schnaps- und Zigarettenkonsum zu beschaffen, den er sich von seiner mageren Arbeitslosenhilfe niemals hätte leisten können.
Hastig zogen sie sich im Badezimmer wieder aus. Die Zeit drängte. Es war nicht ratsam, sich von dem Alten noch einmal sehen zu lassen, wenn er zurück in die Wohnung kam. Der Junge half seiner Schwester. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten. Ihr Höschen war voller Blutflecken im Schritt. Sie hatten ihr übel mitgespielt. Wieder einmal. Vorsichtig löste er den Stoff von der verletzten Haut. Sie stöhnte vor Schmerzen. Tränen schossen in ihre Augen, als er das Blut mit einem feuchten Waschlappen wegtupfte. Wortlos ließ sie die Prozedur über sich ergehen. Schweigend kümmerte sich der Junge um die Verletzungen seiner Schwester. Er wusch sie und trocknete sie ab und preßte ein Papiertaschentuch auf die blutenden Stellen zwischen ihren Beinen, so lange, bis das Bluten aufhörte. Flüchtig betrachtete er ihren Oberkörper. Sie hatte Glück gehabt. Die Gürtelschnalle hatte sie nicht allzu oft getroffen. Drei, vier blutige Schrammen nur auf dem Rücken und zwei am rechten Oberschenkel. Nicht allzu tief. Es hatten sich bereits Krusten gebildet. Striemen hatte sie allerdings reichlich davongetragen. An mehreren Stellen war die Haut aufgeplatzt. Wenigstens blutete es nicht mehr.
Während das Mädchen still auf dem Badewannenrand sitzen blieb, versuchte er, die Blutflecken so gut es ging aus ihrem Höschen und dem Waschlappen auszuwaschen. Dabei spürte er ihre Hand auf seinem Rücken. Sie wollte nachsehen, ob er irgendwelche Verletzungen davongetragen hatte. Natürlich am Po, aber es war nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Ihn hatte die Gürtelschnalle öfter getroffen. Er hatte einige tiefe Schürfwunden auf dem Rücken und den Pobacken. Und natürlich Striemen. Weil er sich bemüht hatte, seine Schwester abzuschirmen, hatte er den Großteil der Schläge abbekommen. Zärtlich strich sie mit den Fingerspitzen über seinen Rücken. Er verstand ihre Geste, drehte sich zu ihr um und lächelte sie an. Sie lächelte zurück, obwohl ihr noch immer die Tränen über die Wangen rannen.
Er drückte das Wasser aus den beiden Wäschestücken und legte sie zum Trocknen über den Rand der Badewanne. Dann schob er noch einmal sanft ihre Beine auseinander. Blut war jetzt keines mehr zu sehen, nur noch die zerschundene, rote Haut. Er hoffte, daß sich nichts entzündete, denn dann würden ihre Schmerzen beim nächsten mal um so fürchterlicher sein. Und es würde mit Sicherheit ein nächstes Mal geben. Auf eine mögliche Entzündung würde der Alte keine Rücksicht nehmen.
Er sammelte die Kleidungsstücke auf und half seiner Schwester hinüber in ihr gemeinsames Zimmer. Achtlos ließ er die Sachen auf den Boden fallen. Aus dem Kleiderschrank nahm er ein frisches Höschen und ein T-Shirt. Beides zog er ihr an, bevor er sie behutsam hinlegte und zudeckte. Er zog ebenfalls ein T-Shirt und eine Unterhose über. Schlafanzüge besaßen sie beide nicht. Ebensowenig wie ordentliche Betten. Schlafen mußten sie auf Matratzen, die auf dem Fußboden lagen. Er schob seine Matratze neben die seiner Schwester, schaltete das Licht im Zimmer aus und legte sich hin. Sie hatte wieder angefangen zu weinen. Ob aus Wut oder Verzweiflung oder wegen der Schmerzen, er wußte es nicht. Es war auch gleichgültig. Er schob sich dicht an sie heran und nahm sie tröstend in die Arme. Noch immer hatten sie kein Wort miteinander gesprochen.
1. Kämpfe
Der Junge war ganz offensichtlich in Schwierigkeiten. Zwar war er genauso groß wie die anderen drei, aber wesentlich schmächtiger. Gegen diese Übermacht hatte er keine Chance. Sie droschen mit aller Macht auf ihn ein, gleichgültig wohin, wo immer sie ihn trafen. Lange hielt er das Trommelfeuer aus Schlägen und Tritten nicht aus bevor er zu Boden ging. Er krümmte sich zusammen, hielt die Arme schützend vor das Gesicht. Doch das stoppte die drei anderen nicht, ihn weiter zu treten. Mit voller Wucht, in den Leib, vor den Kopf. Der Junge ächzte und stöhnte.
Stephan beschleunigte seinen Schritt. Er konnte nicht glauben, was er dort sah, mitten auf dem Bahnhofsvorplatz. Passanten machten einen weiten Bogen um die vier Jugendlichen. Niemand griff ein, niemand kümmerte sich um die vier. Er ging geradewegs auf sie zu.
„Hey, was soll das denn?“ rief er über den Platz. „Hört sofort auf!“
Sie beachteten ihn nicht. Ungerührt traten sie weiter auf den wehrlosen Jungen ein. Sekunden später war er bei ihnen, riß zwei von ihnen auseinander und schleuderte sie so heftig zur Seite, daß sie zu Boden stürzten. Den dritten setzte er mit einem gezielten Tritt zwischen die Beine außer Gefecht. Er schrie laut auf, knickte zusammen wie ein Klappmesser und fiel auf die Knie. Einen Moment lang sah er Stephan entsetzt ungläubig an, dann beugte er sich zur Seite und erbrach sich heftig. Stephan gab ihm einen Stoß mit dem Fuß, so daß er umkippte und zusammengekrümmt liegen blieb. Dann wandte er sich dem verletzten Jungen zu. Er war bei Bewußtsein, blutete aus der Nase und aus einer Platzwunde über der rechten Augenbraue. Andere Verletzungen konnte Stephan nicht ausmachen.
Stephan faßte ihn vorsichtig an der Schulter. „Kannst Du aufstehen?“
Der Junge nickte. Mühsam versuchte er, sich aufzurichten. Stephan half ihm auf die Beine. Allein stehen konnte er nicht. Er mußte sich auf Stephans Schulter stützen.
Stephan hielt ihn fest. „Geht’s?“
Der Junge nickte. „Einigermaßen, danke.“
Aus den Augenwinkeln sah Stephan die zwei Angreifer kommen, die er zur Seite gestoßen hatte. Sie hatten sich aufgerappelt und wollten nun gemeinsam auf ihn losgehen. Er drehte sich um, wollte den verletzten Jungen hinter sich schieben, Aber der fiel gleich wieder hin, sobald Stephan ihn losließ.
„Habt Ihr noch nicht genug?“ fauchte er die beiden an. „Braucht Ihr noch eine Abreibung?“
Einer der beiden zog ein Messer und ließ es aufschnappen. Das war jetzt nicht mehr ganz so harmlos. Stephans Augen wurden zu Schlitzen, als er den Jungen mit dem Messer taxierte. Langsam kam er näher, wobei er drohend mit seinem Messer herumfuchtelte. Nein, er fuchtelte nicht, er wußte offensichtlich mit dem Messer umzugehen. Der Kerl war gefährlich. Stephan blieb ruhig stehen und ließ den anderen näherkommen. Aufmerksam verfolgte er jede Bewegung. Der Angreifer hatte das Messer in der Faust, die Klinge nach oben gerichtet, als wolle er Stephan den Leib aufschlitzen.
Stephan wartete, bis der andere kurz vor ihm stand, bereit, mit dem Messer zuzustoßen. Dann ging alles blitzschnell. Stephan wirbelte um die eigene Achse, sein Fuß fuhr in die Höhe und traf den Arm des Angreifers, mit dem dieser das Messer hielt. Deutlich war zu hören, wie die Knochen brachen. In hohem Bogen flog das Messer davon und landete scheppernd auf dem Pflaster. Dann kam der gellende Schmerzensschrei.
Stephan kümmerte sich nicht darum. Er sah, daß der andere Schläger sich nach dem Messer bückte. „Denk nicht mal dran!“ rief er dem Kerl zu.
Der zögerte einen Moment, riß dann aber doch das Messer vom Boden hoch und schleuderte es in Stephans Richtung. Es flog knapp an seinem Kopf vorbei. Stephan rührte sich nicht. Er fixierte seinen Gegenüber, der völlig überrascht war, daß sein Messerwurf danebengegangen war. Eine Sekunde später ging der Junge zu Boden, während Stephan scheinbar immer noch auf dem selben Fleck stand, als wenn nichts geschehen wäre. Einzig ein lautes Knacken und ein weiterer Schmerzensschrei kündeten davon, daß Stephen ihm den Unterschenkel gebrochen hatte. Laut wimmernd wälzte sich der Angreifer auf dem Pflaster. Stephan sah sich nach den beiden anderen um. Beide waren außer Gefecht gesetzt. Einer stand da und hielt sich stöhnend seinen gebrochenen Arm, der andere saß mit glasigen Augen auf dem Boden. Der verletzte Junge war ein Stück weggekrochen und blickte ungläubig in die Runde. Einige Passanten waren stehengeblieben und sahen dem Schauspiel zu ohne einzugreifen. Andere gingen kopfschüttelnd vorbei.
Stephan wandte sich an den Jungen. Panisch vor Angst und unfähig, sich zu bewegen, saß er da und starrte Stephan an. Der legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter.
„Keine Angst, Junge, ich tu Dir nichts“, sagte er, zog sein Handy aus der Jackentasche und wählte den Notruf der Polizei. „Ich habe hier einen mit einem gebrochenen Arm, einen mit einem gebrochenen Bein, einen, der für längere Zeit mit Mädchen nichts mehr anzufangen weiß und einen, der blutet wie verrückt und von dem ich nicht weiß, was er sonst noch hat. Es wäre gut, wenn Sie einen Krankenwagen schicken könnten und einen Arzt, und es wäre auch nicht schlecht, wenn Sie selbst ebenfalls vorbeischauen könnten.“
Stephan sprach mit vollkommen ruhiger Stimme. Er beantwortete die Frage nach seinem Namen und dem Ort, an dem er sich befand und versicherte, er werde selbstverständlich dort bleiben und warten. Dann schaltete er das Handy wieder aus und steckte es in die Jackentasche zurück. Er hockte sich neben den Jungen, zog eine Packung Papiertaschentücher heraus, nahm eines davon und tupfte damit vorsichtig auf die blutende Stelle an der Stirn. Gleichzeitig gab er ihm die Packung.
„Hier, nimm eins raus und halt es gegen Deine Nase“, forderte er ihn auf.
Der Junge nahm ihm die Taschentücher aus der Hand. Sofort legte Stephan die nun freigewordene Hand auf den Hinterkopf, damit er mit der anderen Hand das Taschentuch kräftiger auf die Wunde drücken konnte, die noch immer stark blutete.
„Sie haben Dir ganz schön zugesetzt“, sagte er.
Der Junge nickte.
„Nicht!“ forderte Stephan ihn auf. „Halt still, Mensch, Du tust Dir doch nur weh.“
Mit einer Sanftheit, die der Junge ihm kaum zugetraut hatte, hielt Stephan ihm den Kopf fest. Langsam begann er, sich zu entspannen.
„So ist gut“, sagte Stephan. „Ganz ruhig. Der Krankenwagen sollte gleich da sein. Die helfen Dir dann richtig. Wahrscheinlich nehmen sie Dich mit, damit sie feststellen können, was Dir sonst noch fehlt. Gebrochen scheint nichts zu sein, sonst hättest Du nicht stehen können. Eine Gehirnerschütterung dürftest Du aber schon haben, schätz’ ich mal. Naja, das werden sie im Krankenhaus schon feststellen.“
Er merkte, wie der Junge wieder erstarrte.
„Keine Angst, Junge, die tun Dir nun wirklich nichts. Notfalls bin ich ja dabei.“
Ein Mädchen kam langsam über die Straße auf sie zu. Es machte einen ängstlichen Eindruck und sah immer wieder zu den drei Burschen, die sich in Schmerzen auf dem Boden wanden. Drei Schritte von ihnen entfernt blieb es stehen.
„Wer ist das denn?“ fragte Stephan. „Kennst Du die?“
„Das ist meine Schwester. Auf die hatten sie’s eigentlich abgesehen.“
Weil er keine Hand frei hatte, winkte er sie mit dem Kopf heran. Zögernd kam das Mädchen näher, immer noch die drei auf dem Boden im Blick.
„Komm ruhig her“, sagte Stephan. „Von den Dreien hast Du vorerst mal gar nichts zu befürchten. Wie heißt Du denn?“
„Nicole Zervatzky“, antwortete das Mädchen. „Das ist mein Bruder Kevin.“
Stephan dachte sich seinen Teil, als er die Namen hörte, sagte aber nichts, sondern nickte nur. „Ich hab die Polizei gerufen und einen Krankenwagen“, informierte er sie. „Die müssen jeden Moment hier sein.“
Er merkte, wie das Mädchen erschrak, als er die Polizei erwähnte. „Polizei?“ sagte sie leise. „Die wollen sicher unsere Namen wissen.“
„Na klar“, antwortete Stephan leichthin. „Warum auch nicht, Ihr habt ja nichts gemacht. Hast Du Angst?“
Sie nickte. Panik stieg in ihr auf. Im Hintergrund war die Sirene eines Polizeiautos zu hören. Der Lärm kam schnell näher.
„Verdrück Dich“, rief Stephan ihr zu. „Aber lauf nicht zu weit weg, damit ich Dich später wiederfinden kann.“
Das Mädchen rannte davon. Stephan sah ihr nach.
Das Polizeiauto kam auf den Platz gefahren und stoppte unmittelbar vor Stephan und dem Jungen. Zwei Beamte stiegen aus.
„Gut, daß Sie kommen“, begrüßte Stephan sie. Er deutete mit dem Kopf in Richtung der drei anderen, die sich immer noch stöhnend auf dem Boden wälzten. „Die drei da haben den hier so zugerichtet. Ich hab ihm ein bißchen aus der Bredouille geholfen.“
Er hielt immer noch den Kopf des Jungen zwischen seinen Händen. Das Papiertaschentuch, das er nach wie vor auf die Platzwunde auf seiner Stirn preßte, war inzwischen blutdurchtränkt. Einer der Beamten warf einen flüchtigen Blick darauf, bevor er sich wieder abwandte.
„Der Krankenwagen müßte gleich hier sein.“
Eine weitere Sirene war zu hören. Ein Rettungswagen und ein Notarztwagen rasten auf den Platz und hielten mit quietschenden Reifen. Der Arzt sprang aus dem Auto heraus und wollte sich gleich um die drei am Boden liegenden Schlägertypen kümmern.
„Nehmen Sie den hier zuerst“, rief Stephan ihm zu. „den anderen fehlt nicht viel. Der eine hat ein gebrochenes Bein, der andere einen gebrochenen Arm und der dritte ist nicht mehr ganz fit im Schritt.“
Der Arzt sah ihn überrascht an. „Woher wissen Sie das?“
„Ganz einfach, ich hab ihnen die Knochen gebrochen, nachdem sie den hier so zugerichtet haben.“
„Lassen Sie mal sehen.“
Stephan ließ den Kopf des Jungen los, so daß der Arzt sich um ihn kümmern konnte. Er stand auf und wandte sich an die Polizisten.
„So, meine Herren. Sie haben sicherlich ein paar Fragen. Also, die Sache war so. Ich kam gerade aus dem Bahnhof, da sah ich, wie die drei da gemeinsam auf den Jungen einschlugen. Ich bin hin und hab sie auseinandergebracht. Der Junge lag schon am Boden als ich hinkam. Der da trat ihm mit voller Wucht an den Kopf. Dafür hab ich ihm hier mit voller Wucht in die Eier getreten. Die beiden anderen hab ich weggeschubst. Einer von ihnen zog ein Messer und ging auf mich los. Da hab ich ihm den Arm gebrochen. Er hat das Messer fallen lassen. Der andere nahm es auf und warf es nach mir. Allerdings hat er mich nicht getroffen. Da hinten liegt das Ding. Damit er’s nicht wieder aufsammeln konnte, hab ich ihm das Bein gebrochen. Dann hab ich sie angerufen und mich um den hier gekümmert. Der hat ja geblutet wie ein Schwein.“ Er zog sein Portemonnaie aus der Tasche und zog daraus den Personalausweis. „Bevor Sie fragen“, sagte er und reichte ihn dem Beamten.
Der bedankte sich und fing an, Stephans Daten zu notieren. Währenddessen fragte der andere: „Und der Junge, wie heißt der?“
„Keine Ahnung“, antwortete Stephan. „Ich kenne den nicht.“
„Na, dann werden wir ihn mal fragen“, meinte der Polizist und machte einen Schritt auf den Jungen zu, den die Sanitäter inzwischen auf die Trage des Krankenwagens gelegt hatten. Der Arzt, der neben der Trage kniete und dabei war, die Kopfwunde des Jungen zu verbinden, sah auf.
„Den fragen Sie erst mal gar nichts. Der hat ’ne saftige Gehirnerschütterung, der ist gar nicht ganz klar.“
„Aber seinen Namen wird er doch wohl noch wissen“, protestierte der Beamte.
„Mag sein, aber Sie werden ihn jetzt nicht danach fragen“, antwortete der Arzt scharf. „Haben Sie das verstanden?“
Mißmutig wandte sich der Polizist ab und ging zu den drei anderen Jugendlichen hinüber. Stephan folgte ihm.
„Warum hilft uns denn keiner?“ jammerte der mit dem gebrochenen Bein. „Wir liegen hier schwer verletzt und keine Sau kümmert sich um uns, verdammte Scheiße!“
„Paß auf, was Du sagst, Du Pfeife.“ Stephan stieß mit seinem Fuß gegen das gebrochene Bein. Er schrie vor Schmerzen laut auf. Der Arzt, der gerade dabei war, dem auf der Trage liegenden Jungen eine Infusion anzulegen, schnalzte mißbilligend mit der Zunge. Aber er grinste dabei.
Ein zweiter Krankenwagen fuhr auf den Platz. Er war ohne Blaulicht und ohne Sirene gekommen. Anscheinend hatte der Arzt irgendwie Entwarnung gegeben. So dringend war es nicht mehr. Während Kevin in den Krankenwagen verfrachtet wurde, machte sich der Arzt daran, die drei anderen zu untersuchen. Er ging nicht gerade sanft dabei vor. Schmerzensschreie hallten über den Platz.
„Die zwei nehmen wir mit“, sagte er danach, „der andere kann seine geprellten Eier zu Hause auskurieren.“
„Wohin bringen Sie den Jungen?“ fragte Stephan und wies auf den Rettungswagen, der gerade davonfuhr.
„Ins Elisabethkrankenhaus. Aber geben Sie uns zwei Stunden, bevor Sie da aufkreuzen. Ich nehme an, das wollen Sie?“
Stephan nickte.
„Wir müssen den Jungen zuerst untersuchen, röntgen und ordentlich zusammenflicken. Er wird Ihnen nicht weglaufen. Heute lassen wir ihn bestimmt noch nicht wieder gehen. Was ist denn mit den Eltern?“
„Ich kümmer mich drum“, sagte Stephan.
Der Arzt nickte. „Ich nehme an, der Junge hat ‘n Problem, oder? Sie waren eben so kurz ab mit den Bullen.“
„Das weiß ich noch nicht“, antwortete Stephan. „Seine Schwester versteckt sich hier irgendwo. Die werd ich fragen, bevor ich ins Krankenhaus komme.“
Der Arzt hob die Hand, setzte sich in sein Auto und fuhr davon. Die Polizisten hatten sich inzwischen den Kerl vorgenommen, den Stephan zwischen die Beine getreten hatte. Die anderen beiden wurden gerade von den Sanitätern ziemlich grob in den zweiten Krankenwagen verfrachtet. Sie konnten keine Fragen beantworten, da sie ständig vor Schmerzen schrieen. Stephan stellte sich zu den Beamten. Der eine gab ihm seinen Personalausweis zurück.
„Ich nehme an, Sie brauchen mich nicht mehr?“ fragte er.
Der Polizist schüttelte den Kopf. „Nicht im Moment. Aber wir müssen noch Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Auf dem Revier. Wann können Sie kommen?“
„Morgen um diese Zeit, ist das okay?“
„Ja, das paßt gut. Dann haben wir wieder Dienst, und Sie können uns die ganze Sache ausführlich erzählen.“
Stephan nickte und hob seine Hand. Zum Gruß und zum Zeichen, daß er jetzt gehen würde. Der Beamte winkte ebenfalls.
***
Er traf das Mädchen eine Straßenecke weiter. Es hatte sich in einer Hofeinfahrt verborgen und kam heraus, als es ihn kommen sah. Er faßte es am Ärmel und zog es in die Hofeinfahrt zurück.
„Die Polizei ist noch immer in der Nähe“, erklärte er. „Wenn sie zufällig gleich hier durchfahren, brauchen sie uns nicht unbedingt zu sehen.“
Das Mädchen warf ihm einen scheuen Blick zu. Dann sah es wieder zu Boden.
„Deinen Bruder haben sie mitgenommen ins Krankenhaus. In zwei Stunden können wir ihn besuchen. Er legte ihr die Hand auf den Oberarm. Sie zuckte zurück.
„Was ist mit ihm?“ fragte sie leise.
„Wahrscheinlich hat er eine Gehirnerschütterung. Der Rest ist nur äußerlich. Gebrochen haben sie ihm jedenfalls nichts.“
Er griff wieder nach ihrem Arm. Diesmal hielt er ihn fest.
„Aber jetzt mal raus mit der Sprache. Warum hattest Du Angst vor der Polizei?“
Sie zuckte die Achseln. „Nur so.“
Stephan wurde ärgerlich. „Nur so. Erzähl mir doch keinen Scheiß, Mädchen. Keiner hat Angst vor der Polizei ’nur so’. Also was ist los? Habt Ihr was angestellt?“
Sie schüttelte den Kopf. Eine Weile schwieg sie. Stephan wartete auf ihre Antwort.
„Wenn unser Vater mitkriegt, daß wir mit der Polizei zu tun hatten, schlägt er uns windelweich“, brach es schließlich aus ihr hervor.
Stephan war schockiert. „Wie bitte? Aber Ihr habt doch gar nichts gemacht.“
„Das ist dem doch egal. Außerdem, wenn er besoffen ist, kriegt er das ohnehin nicht mit. Und meistens ist er besoffen.“
„Und Eure Mutter?“
„Die sagt nichts. Die sagt nie was, weil sie die erste ist, die was abkriegt. Meistens merkt sie aber nichts davon, weil sie selber besoffen ist.“
Sie fing leise an zu weinen. Stephan wußte nicht, was er machen sollte. Als sie nicht aufhörte, wollte er sie einfach in den Arm nehmen. Mit einem leisen Schrei wich sie zurück.
Er hob beide Hände hoch. „Um Gottes Willen, ich will Dir doch nichts tun“, rief er erschrocken. Er wartete, bis sie sich wieder etwas beruhigt hatte. Dann fragte er sie: „Wie alt seid Ihr beide eigentlich?“
„Ich bin fünfzehn, Kevin ist dreizehn.“
Stephan sah sie erstaunt an. Damit hatte er nicht gerechnet. Schmächtig wie sie war, hätte er sie für wesentlich jünger gehalten. Ihre viel zu weite Kleidung tat ein übriges dazu. Sie sah ziemlich abgerissen aus, obwohl ihre Sachen sauber zu sein schienen. Trotz allem machte sie einen gepflegten Eindruck. Ihre Haare glänzten und waren ordentlich gekämmt. Sie hatte ein bildhübsches Gesicht. Allerdings lag eine Trostlosigkeit in ihren Augen, die ihn erschreckte.
„Ich bin übrigens der Stephan“, stellte er sich vor. „Ich bin einundzwanzig.“
Scheu reichte sie ihm die schmale, feingliedrige Hand. „Danke, daß Du Kevin geholfen hast“, sagte sie. Kaum daß Stephan sie berührt hatte, zog sie die Hand wieder zurück.
„Keine Ursache“, antwortete Stephan. „Warum sind die drei eigentlich auf Deinen Bruder losgegangen?“
„Ach, eigentlich wollten sie gar nichts von ihm. Hinter mir waren sie her. Das haben sie schon öfter gemacht. Einmal haben sie mich erwischt. Sie wollten, daß ich mich ausziehe. Aber ich hab das nicht gemacht. Ich konnte abhauen. Da haben sie alle meine Schulsachen kaputtgemacht, Bücher und Hefte zerrissen und in den Matsch geworfen. Den Rucksack haben sie mitgenommen. Der Haustürschlüssel war weg, mein Portemonnaie mit der Fahrkarte für den Bus, alles eben. Der Alte hat mich so verdroschen, daß ich eine ganze Woche nicht in die Schule gehen konnte. Heute hat Kevin sich ihnen in den Weg gestellt, damit ich wieder weglaufen konnte. Naja, was dann passiert ist, hast Du ja gesehen. Und jetzt ist er im Krankenhaus, und ich werde dafür die Prügel kriegen.“ Sie fing wieder an zu weinen.
„Keiner wird Dich verprügeln, das verspreche ich Dir. Gleich gehen wir erst mal ins Krankenhaus und sehen, wie’s Kevin geht. Dann kommst Du mit zu mir, und dann sehen wir weiter.“
„Muß Kevin denn im Krankenhaus bleiben?“
„Wahrscheinlich. Sie werden ihn ein paar Tage dabehalten wollen. Mit so ‘ner Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. Da kann leicht was zurückbleiben. Selbst wenn er aus dem Krankenhaus rauskommt, muß er sich verdammt vorsehen. Viel liegen, kein Sport, und er darf sich den Kopf nirgendwo anknallen.“
Sie lachte bitter. „Das hat sich spätestens dann erledigt, wenn mein Vater ihm die erste Ohrfeige verpaßt hat. Also spätestens, wenn er die Wohnungstür hinter sich zugemacht hat.“
„Das werden wir ja sehen“, antwortete Stephan.
Er sah das Mädchen an. „Du bist wirklich sehr hübsch, kein Wunder, daß die Kerle auf Dich abfahren.“
Sie zuckte mit den Schultern. „Das gibt sich, wenn mein Vater mich in der Mache hatte.“
„Wo ist er jetzt?“
Sie sah auf ihre Armbanduhr. Ein billiges Modell aus dem Kaufhaus. „Halb drei, da wird er mit seiner zweiten Flasche Schnaps angefangen haben und eine neue Packung Fluppen aufreißen. Auf der Couch, vor der Glotze.“
„Er arbeitet nicht?“
Nicole lachte bitter. „Der? Arbeiten? Wie kommst Du denn auf sowas?“
„Und Deine Mutter?“
„Die schon. Die putzt. Schwarz. Nachmittags und nachts. Zum Abendessen saufen sie zusammen. Wenn er sie nicht gerade verprügelt oder fickt. Meistens macht er das, nachdem er sie geprügelt hat.“ Ihre Stimme klang völlig verbittert. „Wir machen uns dann immer unsichtbar, damit er uns ja nicht erwischt. Erst wenn sie zu ihrer Arbeit verschwunden und er vom Schnaps eingeschlafen ist, machen wir uns schnell was zu essen, bevor wir ins Bett gehen. Meistens haben wir Glück, und er merkt nichts. Wenn doch, gibt’s statt Abendessen eine Tracht Prügel. Kevin kriegt dann immer das meiste ab, weil er versucht, mich da rauszuhalten.“
„Ihr versteht Euch gut, Du und Dein Bruder?“ fragte Stephan.
„Was bleibt uns übrig? Wir haben ja sonst niemanden.“
Stephan überlegte einen Moment. Dann sagte er: „Paß auf. Wir gehen jetzt zu Euch, Du packst ein paar Sachen ein für Dich und Deinen Bruder, dann gehen wir ins Krankenhaus , sehen, wie’s ihm geht und danach nehm ich Dich mit zu mir. Wenn Du willst.“
Sie sah ihn erschrocken an. „Bist Du verrückt geworden? Es ist doch noch heller Nachmittag. Wenn ich jetzt nach Hause komme, ist der Alte gereizt wie ein Kettenhund. Da hat er doch erst eine Flasche weg. Da ist er doch noch total nüchtern. Der schlägt mich glatt tot.“
„Das wird er nicht tun. Das verspreche ich Dir.“ Er nahm sie am Arm und zog sie mit sich. „Los, komm. Wo wohnt Ihr denn?“
Das Mädchen nannte die Adresse. Stephan kannte die Gegend. Vom Wegsehen. Schnell hochgezogene, billige Mietskasernen, heruntergekommen. Die Bewohner waren oft arbeitslos, viele Zugewanderte unter ihnen. Die Polizei war ständig dort im Einsatz. Schlägereien, Randale, das Übliche eben, wenn Menschen zuviel Zeit haben und zuviel Alkohol im Spiel ist. Keine Gegend jedenfalls, in der man gerne wohnte.
Nicole ging stumm neben ihm her. Sie hatte Angst, das konnte er spüren. Er dachte nach über das, was sie gesagt hatte. Nicht nur Verbitterung, auch vollkommene Hoffnungslosigkeit hatten aus ihren Worten geklungen. Offensichtlich machte sie sich mit ihren fünfzehn Jahren keine Illusionen mehr. Sie tat ihm leid.
Wie er vermutet hatte, steuerte sie auf eine der Mietskasernen zu. Vor dem Haus stand eine Gruppe Jugendlicher. Sie rauchten und tranken Bier aus Dosen. Einer warf die leere Bierdose Stephan vor die Füße. Stephan kickte sie wortlos zur Seite.
„Hey, Nicole“, brüllte ein anderer. „Ist das Dein neuer Stecher?“
Nicole gab ihm keine Antwort. Sie senkte den Kopf und ging mit schnellen Schritten auf das Haus zu. Der Kerl lief ihr nach und riß sie an der Schulter herum.
„Ich hab Dich was gefragt, Du blöde Fotze“, schrie er sie an.
Im Nu war Stephan bei ihr. Er packt den Schreihals am Kragen und riß ihn von dem Mädchen weg. Dann gab er ihm eine schallende Ohrfeige.
„Noch so ‘n Spruch, und Dir fehlen ein paar Zähne“, drohte er.
Der andere grunzte und ging auf Stephan los. Stephan ließ ihn herankommen, dann wich er blitzschnell aus und ließ ihn ins Leere laufen. Schäumend vor Wut drehte der andere sich um und griff erneut an. Stephan rührte sich nicht von der Stelle. Siegesgewiß holte der andere zum Schlag aus. Stephan wirbelte herum, riß den Fuß hoch und trat dem Angreifer mit Wucht gegen das Brustbein. Der Tritt war wohldosiert. Der Kerl blieb unverletzt, aber es trieb ihm sämtliche Luft aus den Lungen. Er taumelte rückwärts und knallte auf den Boden.
Stephan drehte sich zu den anderen um. „Noch jemand?“ fragte er provozierend.
Die Krakeeler verzogen sich murrend.
Stephan faßte Nicole am Arm und zog sie mit sich auf das Haus zu. „Sieht nicht so aus“, murmelte er.
***
Nicole zögerte einen Moment, bevor sie die Wohnungstür aufschloß. So leise wie möglich öffnete sie die Tür, schlich in den Flur und winkte Stephan, ihr zu folgen. Gerade wollte sie in ihrem Zimmer verschwinden, da wurde die Wohnzimmertür aufgerissen. Ein Schwall abgestandener Luft schlug Stephan entgegen. In der Tür stand ein Koloß von einem Mann. Strubbelige Haare, Dreitagebart, verschwitztes, fleckiges Unterhemd, eine ebenso dreckige, völlig versiffte Trainingshose. Der Mann stierte sie aus blutunterlaufenen Augen an.
„Was willst Du hier?“ brüllte er das Mädchen an. „Ich denke, Du bist in der Schule? Statt dessen schleppst Du mir Deine Stecher ins Haus, Du Flittchen. Na warte, Dir werd ich’s zeigen.“
Stephan rührte sich nicht vom Fleck. Während er den Mann ansah, schob er das verängstigte Mädchen hinter sich. „Guten Tag, Herr Zervatzky. Wir sind nur gekommen, um ein paar Sachen für Nicole zu holen. Dann sind wir schon wieder weg, und Sie können in Ruhe weitersaufen.“
Zervatzky stieß einen unartikulierten Grunzlaut aus und wollte sich auf Stephan stürzen. Der wich ihm geschickt aus. Zervatzky verlor das Gleichgewicht und knallte gegen die Garderobe. Einer der hölzernen Haken brach ab.
„Hoppala, sind Sie vorsichtig, Herr Zervatzky, sonst verletzen Sie sich noch“, sagte Stephan mit gespielter Freundlichkeit.
Der Koloß rappelte sich auf und drehte sich langsam um. Er bebte vor Wut am ganzen Körper. Stephan sah, daß er sich wieder auf ihn stürzen wollte. Gefährlich leise sagte er: „Ich würde das lassen, Herr Zervatzky. Sonst kann es passieren, daß sie ein paar Wochen lang weder Schnapsflasche noch Zigarette halten können.“
Doch der wutschnaubende Mann hörte nicht auf ihn. Im Nu war er heran.
„Ich hab Sie gewarnt“, sagte Stephan noch.
Dann machte er ein paar schnelle Bewegungen Zervatzky fiel zu Boden und brüllte wie ein Stier. Stephan hatte ihm beide Schultern ausgekugelt und beide Unterarme gebrochen. „Sie wollten ja nicht hören“, sagte er ruhig.
Dann drehte er sich zu Nicole um. „Pack ein paar Sachen zusammen. Für Dich und Deinen Bruder. Ich kümmere mich derweil um den hier.“
Er wartete, bis Nicole in ihrem Zimmer verschwunden war, dann setzte er den immer noch brüllenden Mann mit einem gezielten Handkantenschlag gegen den Hals außer Gefecht. Das Brüllen verstummte augenblicklich. Stephan zerrte Zervatzky zurecht, setzte ihn aufrecht in eine Ecke gegenüber der Wohnungstür damit er nicht umfallen konnte. So konnte er nicht an seiner eigenen Kotze ersticken. Und kotzen würde er, spätestens wenn er wieder zu sich kam, dessen war Stephan sich sicher. Dann ging er zu Nicole in ihr Zimmer.
Was er sah, versetzte ihm einen Schock. Zwei Matratzen lagen auf dem nackten Fußboden, bezogen mit Bettlaken, die seit Monaten nicht gewechselt waren. Decken und Kissen darauf waren ebenfalls schmutzig und lagen zusammengeknüllt in einer Ecke. Am Fenster stand ein alter Küchentisch mit zwei Stühlen. Darauf stapelten sich Schulbücher und Hefte. Nicole stand vor einem baufälligen Sperrholzkleiderschrank, dem eine der beiden Türen abhanden gekommen waren und stopfte wahllos Unterwäsche, T-Shirts, Jeans und Pullover in eine große Sporttasche. Ansonsten war der Raum leer. Die Tapete war teilweise heruntergerissen, die Gardinen vor den Fenstern fehlten. Statt dessen stand davor eine große Papptafel, offensichtlich um das Fenster nachts abzudunkeln. Es gab kein einziges Bild oder Poster oder Plakat an den Wänden, von der Decke baumelte eine nackte Glühbirne.
„Hier wohnt ihr?“ fragte Stephan entsetzt.
Nicole nickte und zog den Reißverschluß ihrer Sporttasche zu.
„Ich fasse es ja nicht“, murmelte Stephan.
„So, fertig“, sagte das Mädchen.
„Dann laß uns gehen.“
Als sie auf den Flur hinaustraten, sah Nicole ihren Vater bewußtlos in der Flurecke auf dem Boden sitzen.
„Wir können den doch hier nicht einfach so liegenlassen.“
„Doch, können wir“, entgegnete Stephan. „Dem kann nichts passieren. Soll sich Deine Mutter um ihn kümmern, wenn sie nach Hause kommt.“
***
Als sie aus dem Haus kamen, standen die Jugendlichen wieder zusammen. Zwei stützten ihren angeschlagenen Kumpel. Wütend blickten sie zu Stephan hinüber und schüttelten die Fäuste. Stephan beachtete sie nicht. Er trug die Sporttasche mit Nicoles und Kevins Sachen darin.
„Gibt’s hier ’ne Bushaltestelle?“ fragte er Nicole.
Sie nickte. „Da vorn an der Ecke.“
Der Bus war fast leer. Nicole saß schweigend neben Stephan. Er hielt die Sporttasche auf seinen Oberschenkeln. Immer wieder sah sie ihn verstohlen von der Seite an. Offensichtlich hatte sie immer noch Angst.
„Was ist los mit Dir?“ erkundigte er sich.
„Du bist ziemlich stark“, sagte sie leise.
Stephan schüttelte den Kopf. „Nein, bin ich nicht. Aber ich kenne ein paar Tricks, wie man solche wie die von eben los wird.“
„Was hast Du mit dem Alten gemacht?“
„Ich hab ihm die Arme gebrochen. Der schlägt so schnell niemanden mehr. Für die nächsten Wochen ist er auf Deine Mutter angewiesen. Ich hoffe, er lernt seine Lektion.“
„Vergiß es“, erwiderte Nicole bitter. „Der lernt nichts. Der hat noch nie was kapiert.“
Stephan zuckte die Achseln. „Sein Problem.“
Nicole sah ihn an. „Warum tust Du das?“
„Was? Deinem Vater die Knochen brechen? Er wollte mir an die Wäsche, das hast Du doch gesehen. Und weil ich sowas nicht mag, hab ich ihm eins mitgegeben.“
„Das mein ich nicht. Warum hilfst Du uns?“
„Was soll ich denn machen? Dich hier stehenlassen und sagen: ‚So, Mädchen, das war’s, nun sieh mal zu, wie Du klarkommst’, oder was?“
„Zum Beispiel.“
„Das kann ich nicht“, antwortete er schlicht.
„Und warum nicht?“
„Keine Ahnung.“
„Was willst Du von uns? Was hast Du mit uns zu tun?
„Gar nichts. Ich will Euch einfach nur helfen.“
Sie sah ihn skeptisch an. Sie glaubte ihm nicht. Ihre Erfahrung war, niemand machte irgend etwas ohne dafür etwas zu wollen. Und jetzt hatte sie Angst vor dem, was Stephan wohl im Sinn haben mochte. Allein die Sorge um ihren Bruder ließ sie nicht weglaufen.
Der Bus hielt, sie mußten aussteigen. Den Rest des Weges gingen sie zu Fuß. Es hatte angefangen zu regnen. Nicht sehr fest, ein feiner Nieselregen eher, wie er im Frühjahr oft fällt. Schweigend gingen sie nebeneinander her.
Im Krankenhaus erkundigte Stephan sich nach Kevin. Sie fuhren mit dem Aufzug zu der angegebenen Station. Immer noch hatte Nicole kein Wort gesagt. Das Krankenzimmer war für drei Personen vorgesehen, aber im Moment war Kevin der einzige Patient. Er sah winzig aus in dem großen Bett. An einem Metallständer neben dem Bett hingen zwei Infusionsbeutel, die mit einem dünnen Plastikschlauch verbunden waren. Die Infusionsnadel steckte in seiner linken Hand. Sein Gesicht war blaß, fast wächsern. Ein großes Pflaster klebte über der Platzwunde an seiner Augenbraue. Ein kurzes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er seine Schwester sah. Nicole stellte sich neben sein Bett und nickte ihm zur Begrüßung zu. Er hob kurz die Hand, auch um Stephan zu begrüßen.
„Na, wie geht’s Dir, Du Held?“ fragte Stephan.
„Die Bullen waren noch nicht hier“, antwortete Kevin.
„Die kommen auch nicht. Ich hab Deinen Namen rausgehalten.“
Die Erleichterung war ihm deutlich anzumerken. Er atmete tief durch und schloß die Augen.
„Morgen gehe ich hin und mache meine Aussage“, fuhr Stephan fort. „Ich werde ihnen die ganze Geschichte erzählen.“
Sofort war die Angst wieder da. Kevin riß die Augen auf und starrte Stephan an.
„Keine Sorge“, beruhigte Stephan ihn. „Dein Alter wird Dir deshalb nichts tun. Der ist vorläufig außer Gefecht gesetzt.“
„Er hat ihm die Arme gebrochen“, sagte Nicole mit einer Kopfbewegung zu Stephan hin. „Beide.“
Kevin starrte Stephan weiterhin an. Ungläubig jetzt. Dann grinste er. „Wirklich?“
Stephan nickte.
Kevin lächelte zufrieden. Seine Augen gingen wieder zu. Stephan zog zwei Stühle heran und setzte sich. Nicole blieb unbeweglich neben dem Bett stehen und sah ihren Bruder an. Man merkte ihr an, daß sie sich Sorgen um ihn machte.
„Was ist denn nun?“ fragte sie.
Kevin schlug die Augen auf. „Gehirnerschütterung. Ist wohl ziemlich übel. Jedenfalls wollen sie mich vorerst hierbehalten.“
Stephan sah, daß man ihm eines dieser Krankenhaushemdchen angezogen hatte, die auf dem Rücken offen waren und mit Bändchen um den Hals festgebunden wurden.
„Hast Du ihm einen Schlafanzug mitgebracht?“ fragte er das Mädchen.
Nicole schüttelte den Kopf. „Sowas haben wir nicht.“
„Dann gib ihm ein T-Shirt und eine Unterhose“, forderte er sie auf.
Sie wühlte in der Sporttasche herum, zog schließlich die Sachen daraus hervor.
„Hier“, sagte sie und legte die beiden Kleidungsstücke auf Kevins Bett.
„Kannst Du das alleine?“
Kevin zuckte die Achseln. „Weiß nicht. Ich soll nicht aufstehen.“
Stephan nickte. „Ich hol eine Schwester. Die kann Dir helfen. Auch mit der Infusion.“
Als er wenig später mit einer Krankenschwester zurückkam, hatte Kevin den Slip bereits angezogen. Nicole hatte ihm offenbar dabei geholfen. Gerade breitete sie die Decke wieder über ihm aus. Das Krankenhaushemdchen hatte er ausgezogen. Stephan sah den schmächtigen, nackten Oberkörper des Jungen und die blutunterlaufenen Striemen, die sich über seine Brust zogen. Die Schwester zog den Infusionsschlauch ab, damit er das T-Shirt anziehen konnte. Sie schloß den Schlauch wieder an.
Stephan lächelte ihr zu. „Danke Schwester.“
Sie nickte. „Kann ich Sie nachher mal kurz sprechen?“ fragte sie.
Stephan sah sie an. Er hatte sofort verstanden, was sie wollte. „Natürlich“, sagte er.
Sie ging hinaus.
Stephan wandte sich an den Jungen. „Besser so, oder?“
Kevin nickte dankbar. „Viel.“
Nicole stand immer noch neben dem Bett. Stephan faßte sie am Arm und zog sie auf den leeren Stuhl. „Setz Dich, Mädchen“, sagte er.
Sie rutschte ganz nach vorn auf die Stuhlkante.
„Was ist mit den anderen?“ erkundigte Kevin sich.
„Zwei sind ebenfalls hier gelandet, den dritten hatten die Bullen dazwischen als ich ging“, antwortete Stephan.
„Und Nicci?“
Stephan sah ihn verständnislos an.
„Na Nicole“, erklärte Kevin und deutete mit einer knappen Handbewegung auf seine Schwester.
„Der ist nix passiert. Siehst Du ja.“
„Ich soll mit zu ihm kommen“, sagte Nicole.
„Zumindest mal heute Nacht“, ergänzte Stephan. „Bei Euch wird heute Abend der Teufel los sein, wenn Deine Mutter Deinen Vater findet. Da dachte ich, es ist besser, ich nehm sie erstmal mit.“
Kevin nickte. Aber er schien beunruhigt. „Wo wohnst Du denn?“
„Keine Angst, bei mir ist Platz genug“, sagte Stephan, statt seine Frage zu beantworten.
Kevin sah ihn an. „Warum hast Du mir geholfen?“
„Ist das nicht selbstverständlich?“ fragte Stephan zurück. „Die drei hätten Dich richtig aufgemischt. Du bist ja so schon übel genug dran. Wer weiß, was passiert wäre.“
„Wenn nicht diesmal, dann eben beim nächsten Mal.“ Kevins Stimme klang resigniert. „Sie werden’s wieder versuchen. Schließlich sind sie mal in Nicols Klasse gewesen.“
„Das wollen wir erst mal abwarten“, versuchte Stephan, ihn zu beruhigen. „In welche Schule geht Ihr denn?“
„Willy Brand Hauptschule“, antwortete Kevin knapp. „Sie ist nächstes Jahr fertig. Ich muß noch ein Jahr länger.“
„Und dann?“
„Keine Ahnung“, sagte Nicole. „Ich hab schon mal angefangen, mich zu bewerben. Bis jetzt nur Absagen. Wer will schon eine mit Hauptschulabschluß?“
„Aber die Schule machst Du auf jeden Fall fertig?“
„Was hast Du denn gedacht?“ rief Kevin. „Wir haben doch sonst nichts.“
Stephan sah ihn eine Weile durchdringend an. Dann stand er auf. „Ich muß mal“, erklärte er.
Draußen auf dem Flur sah er sich nach der Krankenschwester um. Sie saß in einem kleinen Glaskasten in der Mitte des langen Flurs hinter einem Schreibtisch.
„Sie wollten mit mir sprechen“, sagte er.
Sie sah ihn an. „Haben Sie den Jungen gesehen?“
„Sie meinen die Striemen auf seinem Oberkörper. Ja, die hab ich gesehen.“
„Kennen Sie die beiden?“
„Nein. Jedenfalls bis heute Mittag hab ich sie nicht gekannt. Der Junge wurde gerade von ein paar anderen zusammengeschlagen als ich dazukam. Ich hab ihm geholfen. Das Mädchen ist seine Schwester. Die Striemen hat er wohl von seinem Vater. Als sie den Jungen hierhergebracht haben, bin ich mit ihr zu ihr nach Hause gegangen. Der Alte war da und wollte auf sie los. Ich hab ihn daran gehindert. Sie werden ihn wohl bald hier haben. Tun Sie mir nur einen Gefallen und legen Sie ihn nicht zu seinem Sohn aufs Zimmer.“
„Und das Mädchen?“
„Das nehm ich erst mal mit zu mir.“
Sie sah ihn prüfend an. „Aber Sie werden ihr nichts tun?“
Er hielt ihrem Blick stand. „Nein, ich werde ihr nichts tun. Ich will nur nicht, daß sie in das Dreckloch zurückkehrt, in dem sie hausen muß.“
„Wie lange wollen sie sie denn bei sich behalten?“
„Keine Ahnung. Das muß sich ergeben. Morgen gehe ich erstmal zur Polizei und mache meine Aussage. Danach werde ich wahrscheinlich mit dem Jugendamt reden. Vielleicht können die ja was machen.“
„Sie meinen’s ernst, oder?“
„Die beiden tun mir leid“, antwortete Stephan nur.
„Kommen Sie morgen wieder?“
„Ja, sicher. Wie lange muß der Junge denn hierbleiben?“
„Der Doktor meinte, ein, zwei Tage. Aber dann…“
„Ich weiß. Dann muß er viel liegen, darf sich nicht anstrengen und so weiter. Er hat eine Gehirnerschütterung. Ich weiß nicht, ob er die bei sich zu Hause auskurieren kann. Jetzt, wo der Alte weg ist, vielleicht. Wir werden sehen.“
„Ich rede mit dem Arzt. Mal sehen, was sich machen läßt. Sprechen Sie mich auf jeden Fall morgen nochmal an. Und jetzt wäre es besser, wenn Sie ihn allein ließen. Er braucht Ruhe.“
Stephan nickte. Er ging zurück in das Krankenzimmer. Nicole saß noch immer auf der Stuhlkante. Sie und ihr Bruder sahen sich schweigend an.
„Wir sollten jetzt gehen“, sagte Stephan. „Die Schwester meint, Kevin braucht Ruhe.“
Sofort stand das Mädchen auf, hob die Hand zum Abschied und wandte sich von ihrem Bruder ab.
„Wir kommen auf jeden Fall morgen wieder“, versprach Stephan und legte seine Hand auf die des Jungen. Kevin zog seine Hand weg, als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen.
„Mach’s gut, Kevin“, sagte Stephan, nahm die Sporttasche auf und ging hinter Nicole her, die bereits in der Tür stand. Schweigend verließen sie das Krankenhaus. Es regnete noch immer. Die Luft war zwar warm, aber Stephan sah, daß das Mädchen in seinem dünnen T-Shirt fröstelte. An der Bushaltestelle mußten sie ewig auf den Bus warten. Als er endlich kam, waren sie beide völlig durchnäßt.
***
Sie fuhren bis zur Endhaltestelle vor der Stadt. Stephan ging mit ihr auf einem geteerten Feldweg zwischen Getreidefeldern hindurch. Nicole fühlte sich unbehaglich, um so mehr, je weiter sie sich von der Stadt entfernten. Aber sie stellte keine Fragen. Sie lief einfach stumm neben Stephan her. Zehn Minuten später kamen sie an ein eingezäuntes Grundstück. Eine übermannshohe, dichte Hecke hinter dem Zaun versperrte den Blick darauf. Ein großes, schmiedeeisernes Tor schloß die Einfahrt gegen die Straße ab. Stephan hob den Deckel eines kleinen Metallkästchens an, das am linken Torpfeiler montiert war. Er tippte einen fünfstelligen Code in das Zahlenfeld, das sich in dem Kästchen befand. Das Tor öffnete sich langsam.
Der gepflasterte Weg dahinter schlängelte sich durch eine Wiese, zwischen gepflegten Beeten und sorgsam gestutzten Büschen hindurch zu einer Gruppe von Häusern, die ursprünglich ein Bauernhof gewesen sein mochten. Der gepflasterte Platz vor dem Eingang war von hohen, alten Bäumen gesäumt. Das Wohnhaus, die Scheune und ein weiteres, kleineres Gebäude, ursprünglich vermutlich ein Geräteschuppen, die um den Vorplatz herum in einem Halbkreis zueinander standen, waren behutsam renoviert worden, ohne den ursprünglichen Charakter des Hofes zu zerstören. Beide Nebengebäude waren mit dem Wohnhaus durch gläserne, überdachte Gänge verbunden.
Neben der schweren, hölzernen Haustür befand sich wiederum ein Metallkästchen mit einer Tastatur darin. Stephan gab den Code ein, die Haustür öffnete sich. Er winkte Nicole, einzutreten. Überrascht blieb das Mädchen an der Tür stehen, als es die riesige Eingangshalle sah, die sich bis ins Dach hinauf erstreckte. Der Fußboden war mit schwarzem Marmor ausgelegt, in der Mitte der Halle plätscherte ein Marmorbrunnen, dessen Rand einen umlaufenden Blumenkasten bildete. Die Blumen darin blühten in kräftigen Farben. Rechts vorne gab es eine großzügige Garderobe, an der Stephan seine Jacke aufhing. Links, gegenüber ein kleiner Raum, offenbar eine Gästetoilette. Dahinter eine offenstehende Tür zu einem großen Arbeitszimmer. Die ebenfalls offene Tür gegenüber führte in die Küche. Dazwischen mündeten die gläsernen Gänge zu den anderen Gebäuden. Sie waren mit Glastüren abgeschlossen. Weiter hinten gelangte man über eine geschwungene Holztreppe mit geschnitztem Geländer nach oben auf eine Art Empore, die nach vorne hin und zu beiden Seiten mit dem gleichen Holzgeländer abgeschlossen wurde. Von der Empore gingen mehrere Türen ab, die allesamt geschlossen waren. Hinter der Treppe befand sich eine große Flügeltür, durch die offensichtlich ins Wohnzimmer kam. Mehrere riesige Topfpflanzen standen in der Eingangshalle und nahmen dem Raum die Kälte und die Unpersönlichkeit. Sie wurden von weichem Licht aus mehreren Strahlern angeleuchtet. Ansonsten war die Halle durch indirekte Beleuchtung in ein angenehmes Licht getaucht.
Eine graugetigerte Katze tauchte auf und strich Stephan um die Beine.
„Das ist Napoleon, genannt Polo“, stellte Stephan das Tier vor. „Seine Frau heißt Katharina die Große, genannt Katie. Die ist ein bißchen scheu und versteckt sich wohl.“ Er bückte sich und kraulte den Kater. Das Tier hob den Kopf und maunzte.
„Ja, ich weiß, Du hast Hunger“, sagte Stephan.
Er ging in die Küche. Der Kater lief hinter ihm her. Nicole blieb bewegungslos in der Eingangshalle stehen.
„Kommst Du?“ rief Stephan aus der Küche.
Zaghaft ging sie hinein.
Auch die Küche war ungewöhnlich groß, beinahe geeignet, ein kleines Restaurant daraus zu versorgen. Eine Kochinsel in der Mitte des Raumes unter einer großen Dunstabzugshaube barg einen Sechs-Flammen Induktionsherd und gegenüber ein Waschbecken. Zu beiden Seiten gab es großzügige Arbeits- und Ablageflächen. Die Stirnwand war mit Geräteschränken bestückt. Ein großer Gefrierschrank reihte sich neben einen ebenso großen Kühlschrank, es gab einen Mikrowellenherd, zwei Backöfen, Spülmaschine, eine Eiswürfelmaschine und einen kleinen Dampfgarer. Über die Länge der Seitenwand neben der Eingangstür zog sich eine Arbeitsplatte hin, in die zwei Spülbecken und das Ablaufblech eingebaut waren. Darüber Hängeschränke, deren Türen nach oben aufgefaltet wurden. Die gegenüberliegende Seitenwand war die Fensterwand mit einer Glastür in den Garten. Vor dem Fenster stand ein großer, runder Eßtisch mit vier Stühlen. Unter dem Fenster, neben der Tür gab es ein Loch in der Wand mit einer Holzklappe darin, durch das die Katzen schlüpfen konnten Die vierte Wand bestand vollständig aus Einbauschränken, darin in der Mitte die Tür zum Eßzimmer.
Die Küche war tipp-topp aufgeräumt und blitzte vor Sauberkeit.
„Sag mal, wieviele Leute wohnen denn hier?“ fragte Nicole fassungslos. „Das ist ja riesig.“
Stephan lachte. Er gab der Katze zu fressen. „Komm, ich zeig Dir das Eßzimmer“, sagte er.
Der Raum war lang und schmal, ausreichend groß für einen Eßtisch mit zwölf Stühlen und eingebaute Büffetschränke an beiden Längsseiten. Darüber an der einen Längswand große Fenster zum Garten, in den man durch eine Flügeltür an der schmalen Seite des Raumes gelangte. Eine ebensolche Tür an der anderen Längswand führte ins Wohnzimmer, das zweifellos der größte Raum im Haus war. Es war von zwei Seiten zum Garten hin vollkommen verglast. In den Glaswänden befanden sich mehrere Schiebetüren, die einen ungehinderten Zugang zum Garten ermöglichten. Der Raum war im wesentlichen in drei Bereiche aufgeteilt. Der eine wurde beherrscht von einem großen Konzertflügel, ein weiterer von einer großen, sehr gemütlich aussehenden Sitzgruppe, in der leicht ein Dutzend Personen Platz finden konnten und der dritte schließlich diente der Unterhaltung mit einer weiteren, bequemen Sitzgruppe vor einem riesigen, versenkbaren Flachbildfernseher samt allen möglichen Geräten zur Bild und Tonwiedergabe, inklusive einer ausgesucht wertvollen Musikanlage, die alle so dezent in eine Schrankwand eingebaut waren, daß sie bei Nichtbenutzung gar nicht weiter auffielen.
Eine in diese Schrankwand eingebaute Tür führte schließlich ins Arbeitszimmer, das ungefähr die gleiche Größe wie die Küche hatte und das mit seinen raumhoch eingebauten Bücherregalen, die sich über geschlossenen Unterschränken über drei der vier Wände hinzogen, eher einer Bibliothek als einem Büro glich. Der Schreibtisch mit einem hypermodernen Schreibtischstuhl war in der Ecke vor dem Fenster aufgestellt, darauf zwei reichlich dimensionierte Computerbildschirme, davor zwei bequeme Drehsessel. Zwischen den Regalen, in der Mitte des Raumes gab es eine Sitzgruppe mit schweren, englischen Ledersesseln und einem niedrigen Glastisch in der Mitte. Das helle Kirschbaumholz, in dem alle Möbel gehalten waren, nahm dem Raum die Schwere. Ein weiteres dazu trug eine raffiniert angebrachte Beleuchtung bei, wie sie auch in den anderen Räumen zu finden war.
Das Arbeitszimmer war der einzige Raum, den Nicole bis dahin gesehen hatte, welcher etwas unaufgeräumt aussah. Zeitungen lagen verteilt auf dem Glastisch und zwei der drei Sessel der Sitzgruppe, auf dem Schreibtisch stapelten sich Papiere und Zeitschriften. Mehrere Aktenordner lagen auf dem Fußboden neben dem Schreibtisch.
Stephan ging wieder in die Eingangshalle hinaus. „Laß uns nach oben gehen“, sagte er zu Nicole, die, immer noch stumm, hinter ihm hergekommen war. „Dort kannst Du duschen und Dich umziehen.“
Er nahm Nicols Sporttasche, die er auf der Garderobe abgestellt hatte und ging die Treppe hinauf. Nicole folgte ihm zögernd. Von der Empore im ersten Stock des Hauses zog sich ein breiter Gang nach hinten, von dem rechts und links Türen zu den einzelnen Zimmern abgingen. Nicole zählte sechs Türen zu beiden Seiten und eine geradeaus am Ende des Flurs.
Stephan öffnete die mittlere Tür auf der linken Seite. Sie führte in ein großzügig ausgestattetes Badezimmer mit einer großen Dusche, einer überdimensionierten Eckbadewanne an der einen Wand und zwei in einem Waschtisch eingebauten Waschbecken, über dessen gesamte Länge sich ein Spiegelschrank hinzog. Die Toilette befand sich in der hinteren Ecke und war durch eine halbhohe Maurer abgetrennt. Neben dem Waschtisch und zwischen Dusche und Badewanne auf der gegenüberliegenden Seite führten zwei Türen, die zur Gänze mit einem Spiegel bedeckt waren, in die beiden Nachbarzimmer.
Stephan stellte die Sporttasche auf den Waschtisch. „So, hier kannst Du duschen oder auch baden, wenn Du willst. Handtücher und Badetücher findest Du hier.“ Er öffnete den Schrank neben einer der Türen, gegenüber der Dusche. „alles was Du sonst noch brauchst, ist in dem Spiegelschrank.
Nicole sah ihn an und nickte.
Er ging zur Tür. „Ich laß Dich dann mal allein.“
Leise zog er die Tür hinter sich ins Schloß. Nicole wartete einen Moment, dann drehte sie die Schlüssel in allen drei Türen um. Erst danach zog sie sich aus.
***
Stephan ging hinunter in die Küche. Er war auf Besuch nicht vorbereitet und hatte dementsprechend nichts Besonderes zum Essen anzubieten. Allerdings war genug Wurst, Käse und Brot da, daß es allemal für zwei Personen reichte. Er richtete alles appetitlich auf Platten an, stellte ein Schälchen mit kleinen Tomaten dazu und einen Teller mit Gurken. Er war gerade dabei den Tisch in der Küche zu decken, als Nicole hereinkam. Sie war splitternackt.
„So, ich wär dann soweit“, sagte sie.
Stephan wich einen Schritt zurück und sah sie an. Der Kopf mit dem bildhübschen Gesicht und den traurigen Augen saß auf einem mageren, ausgemergelten Körper, der von Striemen übersät war. Unter der wächsernen Haut des Brustkorbs zeichneten sich die Rippen ab, die kleinen Brüste entsprachen keineswegs dem Entwicklungsstadium einer Fünfzehnjährigen. Die Hüftknochen standen deutlich heraus, Ihr Bauch war flach, fast konkav. Das Geschlecht war mit dünnem, dunkelblondem Schamhaar bedeckt, trotzdem war die gerötete, entzündete Haut deutlich zu erkennen. Die Muskulatur der endlos langen Beine war unterentwickelt, ebenso wie auch an die der Arme. Großflächige Hämatome hatten sich an den Innenseiten der Oberschenkel und den Oberarmen gebildet. Das Mädchen sah wirklich erbarmungswürdig aus.
Stephan erschrak. „Bist Du verrückt geworden?“ fragte er. „Was soll das denn?“
„Na, das wolltest Du doch, oder? Deshalb hast Du mich doch hierhergebracht.“
„Was wollte ich?“ fragte er ungläubig. „Gar nichts wollte ich. Jetzt lauf nach oben und zieh Dir was an, Du erkältest Dich ja. Und dann komm wieder runter. Das Essen ist fertig.“
Sie machte auf dem Absatz kehrt und lief sie hinaus. Als sie kurz darauf wieder zurückkam, trug sie Jeans, ein T-Shirt und Sandalen.
„Ist Dir nicht zu kalt in dem dünnen Shirt?“ fragte er.
Völlig eingeschüchtert schüttelte sie den Kopf.
„Setz Dich“, forderte er sie auf. „Was möchtest Du trinken? Ich trink Milch.“
„Kann ich auch ein Glas davon haben?“ fragte sie leise.
„Ja, sicher, deshalb frag ich ja.“
Er schüttete ihr ein Glas Milch ein. „Greif zu, Du hast doch sicher Hunger.“
Langsam und sorgfältig machte sie sich eine Scheibe Brot zurecht. Stephan hielt sein Glas in beiden Händen und sah ihr zu.
„Hast Du wirklich geglaubt, ich hab Dich nur hierhergebracht, um mit Dir…?“
Sie sah ihn an und nickte.
„Du bist schon oft dazu gezwungen worden?“ Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Wieder nickte sie nur. Tränen stiegen ihr in die Augen.
Er wollte ihre Hand nehmen, aber sie zog sie blitzschnell weg. „Du brauchst keine Angst zu haben“, versicherte er. „Ich tu Dir bestimmt nichts.“
Sie gab ihm keine Antwort.
Schweigend aßen sie ihr Abendbrot.
„Setz Dich ins Wohnzimmer“, sagte er, als sie mit dem Essen fertig waren. „Ich räum nur noch schnell hier auf, dann komm ich auch.“
Aber statt seiner Aufforderung nachzukommen, machte sie sich daran, den Tisch abzuräumen. Er lächelte sie an und nahm ihr die Wurstplatte aus der Hand. „Ich mach das schon, setz Du Dich schon mal rüber.“
Zögernd ging sie hinaus. Nachdem er die Reste des Abendessens weggeräumt hatte, setzte er sich zu ihr. Mit Bedacht wählte er einen entfernt von ihr stehenden Sessel. Er wollte deutlich machen, daß er ihr nicht zu nahe kommen würde.
„Hast Du schon mal in die Nachbarzimmer geguckt, rechts und links neben dem Badezimmer?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Eins von den Zimmern kannst Du Dir aussuchen. Eigentlich sehen sie genau gleich aus. Nur spiegelverkehrt. Früher haben sie mal mir und meiner Schwester gehört. Jetzt stehen sie leer. Aber sie sind in Ordnung.“
„Wo ist denn Deine Familie?“ fragte sie zaghaft.
„Die gibt’s nicht mehr“, antwortete er beiläufig, fast schroff. „Ich wohne alleine hier.“
Nicole ahnte eine Geschichte hinter seiner knappen Antwort, aber sie wagte es nicht, ihn danach zu fragen.
Stephan sah das Mädchen an. „Du hast Angst, stimmt’s?“
Sie nickte.
„Vor mir?“
Sie sah ihn stumm an.
„Mußt Du nicht. Ich will Euch nur helfen, Dir und Deinem Bruder. Ihr steckt so in der Scheiße, da muß man doch einfach was tun.“
„Pah“, machte sie. „Und was willst Du da tun?“ Es klang aggressiv.
„Weiß ich noch nicht“, gab er zu. „Jedenfalls bist Du jetzt erstmal hier, Dein Bruder ist im Krankenhaus gut aufgehoben und Dein Alter vorerst aus dem Verkehr gezogen. Was dann kommt, müssen wir sehen.“
„Ich muß morgen in die Schule.“
„Du mußt gar nichts. Morgen bleibst Du erstmal hier und schläfst Dich aus. Übermorgen kannst Du dann wieder hingehen. Wann hast Du das letzte Mal richtig geschlafen?“
Sie zog die Schultern hoch. „Weiß nicht.“
„Sie holen Dich oft, nicht wahr?“
Sie fing wieder an zu weinen. Er widerstand der Versuchung, sie in den Arm zu nehmen. Statt dessen holte er ihr nur ein Papiertaschentuch. Sie schneuzte sich laut und kräftig.
„Einmal hat Kevin sie daran hindern wollen. Sie haben ihn fast totgeschlagen. Seitdem macht er nichts mehr.“
„Du liebst Deinen Bruder?“
Sie zuckte die Achseln. „Weiß nicht. Ich hab niemanden sonst. Er versucht, mich zu beschützen. Und er ist der einzige, mit dem ich reden kann.“
„Hast Du keinen Freund?“
Sie schüttelte den Kopf. „Wie denn? Wenn ich einen Freund hätte, wollte der auch irgendwann, daß ich mich ausziehe. Und Du hast ja gesehen, wie ich aussehe.“
„Dein Bruder weiß es auch?“
„Na klar. Wir wohnen ja zusammen in einem Zimmer. Da läßt sich das nicht vermeiden. Außerdem sieht er genauso aus.“
„Sie machen’s mit ihm auch?“
Nicole nickte. „Schon lange. Aber mittlerweile ist es ihm egal. Genau wie mir. Wenn Du stillhältst, ist es schnell vorbei. Dann lassen sie Dich wieder gehen.“
Stephan war fassungslos über das, was er da hörte. Auf ihrem Gesicht stand tiefste Verzweiflung. Hoffnungslosigkeit. Sie schien ziemlich am Ende zu sein.
„Möchtest Du was trinken? Oder möchtest Du lieber schlafen gehen?“ fragte er.
Sie zuckte mit den Schultern.
Er stand auf, ging in die Küche und kam mit zwei Gläsern Rotwein zurück. Er gab ihr eins davon in die Hand.
„Hier. Eigentlich solltest Du sowas noch gar nicht trinken, aber, ich denke, heute wird es Dir guttun. Man schläft gut danach. Und das sollst Du.“
Sie nippte an ihrem Glas.
„Schmeckt er Dir?“
Sie nickte.
„Das ist ein Cabernet-Sauvignon von Stellenbosch aus Südafrika“, klärte er sie auf, nur um etwas Belangloses zu sagen. „Ich mag den ganz gern.“
Es half nicht. Sie saßen sich gegenüber und schwiegen sich an. Nach einer Weile stand sie auf. „Ich glaub, ich geh jetzt schlafen.“
Stephan blieb sitzen. Er sah sie an und nickte. „Mach das.“
Leise zog sie die Tür hinter sich ins Schloß. Er blieb noch eine Weile sitzen und trank seinen Wein aus. Sie hatte von ihrem kaum genippt. Er überlegte einen Moment, ob er ihr Glas ausschütten sollte. Dann entschied er sich dagegen. Es wäre einfach zu schade drum. Er setzte sich wieder und nahm einen Schluck. Nachdenklich betrachtete er die dunkelrote Flüssigkeit in dem bauchigen Glas.
Was sollte er jetzt tun. Plötzlich waren die zwei in sein wohlsortiertes Leben eingebrochen und hatten ein heilloses Durcheinander angerichtet. Es war offensichtlich, daß sie dringend Hilfe brauchten. Halbe Kinder noch, die von einem gewalttätigen Vater gezwungen wurden, sich mißbrauchen zu lassen, während die Mutter dabeistand und nichts unternahm. Sie taten ihm leid. Aber was sollte er machen? Er könnte sie zu sich nehmen. Das Haus war allemal groß genug für drei Personen. Aber würde das geduldet werden? Auf jeden Fall wollte er sie nicht wieder in das Dreckloch zurückschicken, in dem sie jetzt hausten. Wohin aber sonst? Er wußte sich keinen Rat. Frustriert leerte er das Glas, brachte es in die Küche und ging nach oben in sein Schlafzimmer.
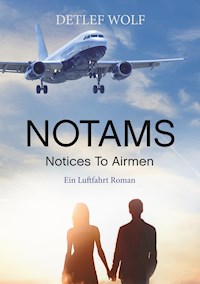


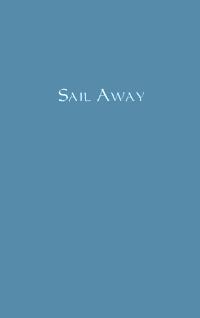














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










