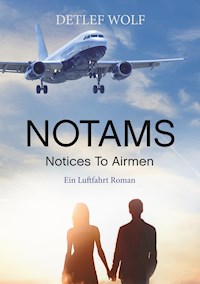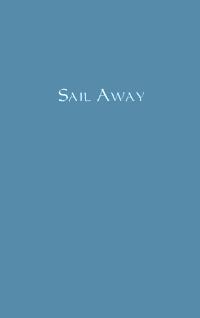Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Lastwagen mit Plutonium ist verschwunden. Mehr zufällig als absichtlich wird der russische Junge, Mikhail Dobrin, darin verwickelt, dessen Familie, die vor mehr als vier Generationen nach Rußland ausgewandert ist, kurz vor ihrer Rückkehr nach Deutschland steht. Mikhail wird vorausgeschickt und soll in Deutschland ein Internat besuchen, bis die Familie folgt. Doch dazu kommt es nicht mehr. Sie werden ein versehentliches Opfer bei der Jagd nach dem gestohlenen Plutonium. Er bleibt in dem Internat, einsam und allein, denn niemand will mit ihm etwas zu tun haben, bis auf Lara, ein Mädchen aus seiner Klasse, das buchstäblich in ihn hineinstolpert. Ohne daß Mikhail weiß, um wen es sich handelt, nimmt sich einer der Urheber dieses dreisten Diebstahls, der als reicher Deutsch-Russe in Deutschland lebt, seiner an. Doch dann wird auch der Junge in die Affäre um das gestohlene Plutonium verwickelt und deckt nach und nach die Umstände dieses Verbrechens auf. Dabei läßt er sich auf ein gefährliches Spiel ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlef Wolf
Lara's Theme
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch
Ein Wort zuvor
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Quellennachweis:
Der Autor
Impressum neobooks
Das Buch
Ein Lastwagen mit Plutonium ist verschwunden. Mehr zufällig als absichtlich wird der russische Junge, Mikhail Dobrin, darin verwickelt, dessen Familie, die vor mehr als vier Generationen nach Rußland ausgewandert ist, kurz vor ihrer Rückkehr nach Deutschland steht.
Mikhail wird vorausgeschickt und soll in Deutschland ein Internat besuchen, bis die Familie folgt. Doch dazu kommt es nicht mehr. Sie werden ein versehentliches Opfer bei der Jagd nach dem gestohlenen Plutonium. Er bleibt in dem Internat, einsam und allein, denn niemand will mit ihm etwas zu tun haben, bis auf Lara, ein Mädchen aus seiner Klasse, das buchstäblich in ihn hineinstolpert.
Ohne daß Mikhail weiß, um wen es sich handelt, nimmt sich einer der Urheber dieses dreisten Diebstahls, der als reicher Deutsch-Russe in Deutschland lebt, seiner an. Doch dann wird auch der Junge in die Affäre um das gestohlene Plutonium verwickelt und deckt nach und nach die Umstände dieses Verbrechens auf. Dabei läßt er sich auf ein gefährliches Spiel ein.
Ein Wort zuvor
Geneigter Leser, verehrte Leserin,
wie immer, ist diese Geschichte frei erfunden. Es gibt keine Zusammenhänge mit lebenden oder verstorbenen Personen. Es sollte sie zumindest nicht geben. Und wenn doch, dann ist das ein Zufall. Garantiert. Auf jeden Fall ist es nicht beabsichtigt. Wenn Sie sich also wiedererkennen, dann mögen Sie sich darüber freuen, wenn Sie in der Geschichte gut weggekommen sind oder meine Bitte um Entschuldigung annehmen, wenn Sie meinen, als ein mieser Typ dargestellt worden zu sein, der Sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Ich kann das nämlich nicht beurteilen, ich kenne Sie ja gar nicht. Auch nicht, wenn ich Sie zufällig mit Ihrem Namen angesprochen habe. Denn auch den habe ich mir bloß ausgedacht.
So ähnlich ist das mit den Örtlichkeiten. Manche gibt es tatsächlich, manche habe ich mir auch zurechtgebastelt. Und wenn das eine oder andere nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, dann sehen Sie es mir bitte nach. Ich fand eben, daß es, so wie es beschrieben wurde, ganz gut zu meiner Geschichte paßt.
So, das mußte vorab vielleicht mal gesagt werden.
Und jetzt viel Spaß beim Lesen (hoffe ich zumindest).
Raesfeld-Erle, im Dezember 2014
Detlef Wolf
Prolog
Mikhail starrte aus dem Fenster. Schier endlose Birkenwälder zogen draußen vorbei. Die Sonne stand bereits tief im Westen. Einer dieser traumhaft schönen Sommertage, wie man sie so oft in Sibirien erleben kann, ging langsam zu Ende. Die Sonnenstrahlen brachen sich in den Baumkronen und tauchten das Eisenbahnabteil, in dem er saß, in ein seltsames Licht, das der verrückt gewordenen Lichtorgel einer Diskothek zu entstammen schien. Was keineswegs zu der Melodie paßte, die ihm in diesem Moment durch den Kopf ging, die aber sehr wohl im Einklang mit dem stand, was es draußen zu sehen gab, wenn man den Lichtorgeleffekt im Inneren ausblendete.
Leise summte er die Melodie mit und war versucht, nach seiner Klarinette zu greifen, um sie darauf zu spielen. ‚Lara’s Theme‘, die Titelmelodie aus dem Film ‚Doktor Schiwago‘. Doch dann fiel ihm ein, daß sein Instrument tief unten in einem der Koffer vergraben war, die er dabei hatte. Seufzend lehnte er sich in die Polster seines Sitzes zurück. Die Melodie in seinem Kopf verklang leise und machte wieder dem eintönigen Rattern der eisernen Räder des Zuges auf den Gleisen Platz.
Ohne sich dessen bewußt zu werden, begann er zu zählen. Das heißt, zählen konnte man es nicht einmal nennen. Er nahm die Zahl der Bäume zwischen den einzelnen Masten der Oberleitung in sich auf, als ob er sie gezählt hätte; zwanzig waren es wohl. Bei einem geschätzten Abstand der Masten von etwa fünfzig Metern, ergaben sich daraus vierhundert Bäume pro Kilometer. Wenn man bedachte, daß der Zug seit ungefähr zwanzig Minuten mit einer Geschwindigkeit von vielleicht einhundertundzwanzig Kilometern pro Stunde durch diesen Wald fuhr und das wohl auch noch weitere zwanzig Minuten tun würde, bevor der Zug in die Nähe der nächsten Siedlung kam, würde er um einige mehr als dreißigtausend Bäume passiert haben. Auf jeder Seite des Bahndamms, an dem sich der Wald fünf, sechs oder sieben Kilometer weit ausbreiten würde. Was ihn dann einhundertzwanzig bis knapp einhundertsiebzig Millionen Bäume mächtig machte. Bewertete man nun den Wert eines jeden Baumes mit zehn Rubel, machte das Eins-komma-zwei bis Eins-komma-sieben Milliarden Rubel oder, ausgedrückt in der neuen Währung, an die er sich von nun an würde gewöhnen müssen, dreißig bis zweiundvierzigeinhalb Millionen Euro.
Das alles war ihm in weniger als drei Sekunden durch den Kopf gegangen, und er lächelte bei dem Gedanken, daß ihm dieser Wald mit all diesen Millionen Bäumen darin gehört haben mochte und er ihn, zum Auffüllen der Reisekasse, verkauft haben würde. Irgendetwas zwischen dreißig und vierzig Millionen Euro als Polster für den Neustart in Europa. Nicht schlecht. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.
Dafür, daß er mutterseelenallein in ein ihm völlig fremdes Land reiste, fühlte er sich erstaunlich gut. Wahrscheinlich war es die Abenteuerlust, die ihm mit seinen knapp sechzehn Jahren innewohnte. Obwohl es ihm alles andere als leicht gefallen war, sich von seinen Freunden und Klassenkameraden zu verabschieden. Wohl wissend, daß dies nicht nur ein Abschied auf Zeit war. Nein, es war ein Abschied für immer. Vermutlich jedenfalls, denn er wußte nicht, ob er jemals wieder in die Stadt in Westsibirien, in der er geboren war, zurückkehren würde.
Seine Eltern hatten sich entschlossen, nach mehr als einhundertundfünfzig Jahren, die die ehemals deutsche Familie jetzt in Rußland wohnte, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Das Leben dort war einfach besser. Vermuteten sie jedenfalls.
An den Verhältnissen in seiner Heimat gemessen, ging es der Familie nicht schlecht. Man mochte sie sogar als wohlhabend bezeichnen. Ob die Verhältnisse in Deutschland so waren, wie sie sich das im fernen Sibirien ausmalten, würde sich zeigen. Mikhail hatte keine Vorstellung davon, was ihn dort erwartete und wie es weitergehen würde.
Er kannte niemanden in Deutschland. Wenn es dort überhaupt Verwandte seiner Familie gab, hatte er nie von ihnen gehört, nie jemanden von ihnen getroffen, und er wußte auch nicht, wo einer von ihnen wohnen konnte. Er war völlig auf sich allein gestellt.
Immerhin war er nicht mittellos. Seine Eltern hatten die Ausreise nach Deutschland lange geplant, ein kleines Reihenhaus gekauft und ein Bankkonto eingerichtet, auf dem sich bereits ein ansehnlicher Betrag befand. Ihn selbst hatten sie in einem Internat angemeldet, in dem er leben und zur Schule gehen sollte, bis die Familie nachkommen konnte. Wann das sein würde, wußte er nicht so genau. Es hing davon ab, wann der Vater den passenden Zeitpunkt für gekommen hielt. Irgendwann im nächsten halben Jahr sollte es sein.
Er, Mikhail, sollte darauf jedoch nicht warten müssen. Im kommenden Schuljahr würde er in die erste Oberstufenklasse kommen, und es wäre sicherlich gut, wenn er diese gleich in der Schule besuchen könnte, auf der er auch das Abitur ablegen würde. Also hatten sich seine Eltern entschieden, ihn vorauszuschicken und in einem Internat anzumelden.
Und nun war es eben soweit. Das Schuljahr in seiner alten Schule war zu Ende gegangen, und er war unterwegs nach Deutschland.
***
Die Räder des Zuges schlugen unaufhörlich, wenn sie die Spalten überfuhren, an denen die Schienenstücke aneinanderstießen. ‚Klack-klack‘, ‚klack-klack‘, ‚klack-klack‘. Längst hätten Gleise und Gleisbett der Transsibirischen Eisenbahn erneuert werden müssen. Angekündigt war es seit Jahren, Dazu gekommen war es bisher nicht. Also mußten die Züge darauf ihr Tempo drosseln. Hundertzwanzig Kilometer in der Stunde war das Äußerste. Mehr war nicht drin, wollte man nicht riskieren, daß die Wagen entgleisten. In der Regel ging es langsamer voran. Um Viertel nach drei am Nachmittag hatte er den Zug in Tyumen bestiegen. Jetzt wurde es langsam dunkel; einundzwanzig Uhr mochte es sein, vielleicht etwas später, und noch immer waren sie nicht in Ekaterinburg angekommen. Nizhny Novgorod, das frühere Gorki, die verbotene Stadt, Ort der Verbannung des Physikers Andrej Sakharov, morgen, kurz vor der Abendbrotzeit und Moskau-Belorusskaja in der darauffolgenden Nacht gegen zwei Uhr.
‚Klack-klack‘, ‚klack-klack‘, ‚klack-klack‘, weiter und weiter und weiter würde es gehen, bis die Wagen des Zuges in zwei Tagen, von jetzt an gerechnet, im weißrussischen Brest neue Drehgestelle erhalten würden, damit sie auf der schmäleren Spur der europäischen Gleise weiterfahren konnten. Von Brest nach Terespol, Lukov, Warszawa, Poznan, Rzepin, bis zur Ankunft in Berlin-Lichtenberg am Samstag Morgen, nach mehr als dreieinhalbtägiger Fahrt. „Klack-klack“, „klack-klack“, „klack-klack“ und mit jedem „klack-klack“ versank das alte Leben tiefer hinter dem Horizont.
***
Tyumen, die reiche Stadt in West-Sibirien, Zentrum der russischen Petroliumindustrie, wo er geboren war und bis jetzt gelebt hatte, in einer schönen Wohnung unten am Fluß Tura, der in jedem der eiskalten Winter zugefroren war und im Sommer, wenn es heiß war, noch bis vor einigen Jahren so erbärmlich gestunken hatte.
Jetzt tat er das nicht mehr. Viel war getan worden, den Fluß sauber zu machen, ebenso wie die Stadt selbst, mit Bäumen an den Straßenseiten der Bürgersteige und vor den endlos langen, endlos hohen, endlos grauen und endlos häßlichen Mietskasernen, um diese wenigstens ein bißchen freundlicher aussehen zu lassen. Blumenrabatten zwischen den Fahrbahnen der großen Hauptstraßen der Stadt mit ihren zwei oder drei Fahrspuren in beiden Richtungen, die den Autofahrern den Verkehrsstau, der sich am frühen Morgen bildete und erst am Abend wieder auflöste, erträglicher machen sollten. Dieser Stau und die Vielzahl der Baukräne im Zentrum, in dem immerfort neue und prächtigere Gebäude entstanden, waren die Zeichen des zunehmenden Wohlstands der Stadt mit ihren knapp sechshunderttausend Einwohnern, der auch die eisigsten Winter mit Temperaturen von minus dreißig Grad nichts von ihrer quirligen Lebendigkeit nehmen konnte.
Wer Beschaulichkeit suchte, mußte hinaus aus der Stadt. Nach Osten, zum Beispiel, ein Stück auf der Hauptstraße Richtung Omsk, nach Bogandynski, dem kleinen Ort, in dem die Großeltern gewohnt hatten. In einem Holzhaus mit Holzschindeln auf dem Dach, in dem ein Ofen in jedem Zimmer mit Holz zu stochen war, um es im Winter warm und behaglich zu haben.
Doch auch hier hatte die Beschaulichkeit ihre Grenzen. Ruhig war es nicht, denn vor dem Dorf lärmten die Lastwagen über die Straße in Richtung Omsk oder von dort, nach Tyumen hinein, und auf der gegenüberliegenden Seite, hinter den sumpfigen Wiesen, auf deren trockengelegten Stücken reiche Menschen aus Tyumen ihre Datschas gebaut hatten, verliefen die Gleise der Transsibirischen Eisenbahn, über die unaufhörlich die Züge ratterten. Endlos lange Güterzüge zumeist, aber auch die bekannten Expreßzüge, die vom Jaroslavler Bahnhof in Moskau abfuhren mit dem Ziel Vladivostok oder Beijing oder in der umgekehrten Richtung unterwegs waren.
Wie oft hatte Mikhail an diesem Bahndamm, jenseits der sumpfigen Wiesen gestanden? Immer, wenn sie die Großeltern besucht hatten, am Wochenende oder an den Feiertagen, zusammen mit seiner kleinen Schwester, die ihn immer begleiten wollte und die dann ganz still neben ihm stand und seine Hand festhielt, ein wenig furchtsam, weil die vorbeifahrenden Züge so schrecklich laut waren.
Das würde es nie mehr geben, weil es das gemütliche, heimelige Holzhaus in Bogandynski nicht mehr gab. Ein schreckliches Feuer hatte es im Winter dahingerafft und mit ihm die Großeltern, die darin zu Tode gekommen waren.
Wenige Wochen später lagen die weinroten Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland neben den purpurfarbenen der russischen Föderation auf dem Küchentisch. Pavel Ruslanowitsch Dobrin, Ur-ur-urenkel des Heinrich-Joseph Düber aus Langendreer bei Bochum, der seinem Land vor mehr als einhundertundfünfzig Jahren den Rücken gekehrt hatte, wollte nun den umgekehrten Weg einschlagen.
***
Längst war es Nacht geworden. Der Zug hatte die Stadt Perwouralsk am westlichen Ende des Ural passiert und war nun unterwegs nach Kungur und Perm. In dem dunklen Abteil lag Mikhail in seiner Koje und lauschte dem Schlagen der Räder auf den Schienen. Er konnte nicht schlafen.
Wieder erklang ‚Lara’s Theme‘ in seinem Kopf: ‚Somewhere my Love … ‘
1
Nikolaj Petrovich Visnijakov saß auf einer der Bänke, die im Park am Weg rund um den kleinen See aufgestellt waren und blinzelte in die Sonne. Er trug einen dicken Wintermantel und einen Hut, denn es war kalt an diesem sonnigen Herbsttag. Der Winter schien ungewöhnlich früh zu kommen in diesem Jahr.
Visnijakov mochte Anfang sechzig sein, wenn auch das schlohweiße Haar, das unter der Krempe seines Hutes hervorschaute, ihn älter aussehen ließ, und er konnte die Kälte mit den Jahren immer schlechter ertragen. Früher hatten ihm die kalten, sibirischen Winter mit ihren arktischen Temperaturen von mehr als minus dreißig Grad nichts ausgemacht, aber seit ein paar Jahren machte ihm bereits das vergleichsweise milde, europäische Winterklima zu schaffen.
Gedankenverloren erhob er sich von der Parkbank und schlenderte gemächlich zum Eingang des Parks. Dort wartete sein Chauffeur, der die rechte, hintere Tür der gewaltigen, nachtblau lackierten Maybach-Limousine aufhielt. Ein wenig mühsam glitt Visnijakov in die weichen Polster der Rückbank und überließ es dem Chauffeur, die Tür zu schließen.
„Nach Hause?“ fragte der junge Mann, der etwa dreißig Jahre alt sein mochte. Er war von kräftiger Statur, hatte einen rot-braunen Bürstenhaarschnitt und ein grobes Bauerngesicht.
„Da“, antwortete Visnijakov knapp in russischer Sprache, denn der Chauffeur war, ebenso wie er selbst, russischer Abstammung.
Visnijakov lehnte sich zurück, öffnete die Knöpfe seines Mantels und zog den eleganten, weißen Schal, den er um den Hals gewickelt hatte, heraus. Den Hut behielt er auf. Während der Fahrt hielt er die Augen geschlossen. Sie dauerte eine gute Viertelstunde, dann bog der Wagen von der Straße ab auf ein parkähnliches Grundstück, das von einer mehr als drei Meter hohen Mauer begrenzt wurde. Über eine etwa einhundertfünfzig Meter lange Allee gelangte man zum Wohnhaus, das sich mehr wie ein kleines Schloß ausnahm. Der Wagen hielt vor einer großen Freitreppe. Der Chauffeur sprang heraus und riß den Schlag auf.
Visnijakov stieg aus, nickte dem Mann kurz zu und stieg langsam die Stufen zu der gewaltigen, zweiflügligen Eingangstür hinauf. Die Tür stand offen, und die Haushälterin, ganz traditionell in ein schwarzes Kleid mit weißer Schürze gekleidet, eine elegante Erscheinung von etwa Mitte vierzig, erwartete ihn. Er ging an ihr vorbei in die Eingangshalle. Sie schloß die Tür hinter ihm.
Drinnen nahm sie ihm Mantel, Schal und Hut ab und brachte alles zur Garderobe. Er ging weiter in sein Arbeitszimmer. Es lag auf der rechten Seite des Hauses, hatte riesige Ausmaße und war doch nur spärlich möbliert. Die Wände waren mit Kirschbaumholz getäfelt, die Stuckdecke etwa drei Meter hoch. In der Mitte des Raumes lag ein etwa drei mal fünf Meter großer, blaugrundiger Afghan. Darumherum befanden sich eine Sitzgruppe, bestehend aus einem Dreiersofa und zwei Sesseln, die mit senfgelbem Leder bezogen waren, dazwischen ein niedriger, rechteckiger Tisch mit einem goldfarbenen Metallgestell und einer Rauchglasplatte. Weiter gab es einen Konferenztisch mit sechs Stühlen, ebenfalls aus Kirschholz wie die Wandvertäfelung. Die Stühle waren ledergepolstert und mit Armlehnen versehen. Der Schreibtisch mit einer etwa zwei Quadratmeter großen Tischplatte stand schräg im Raum. Dahinter ein hypermoderner Schreibtischstuhl mit einer hohen Rückenlehne, davor zwei Drehsessel gleicher Machart. Im Alkoven an der rechten Längswand standen zwei schwere, ledergepolsterte, englische Ohrensessel, zwischen den Sesseln ein runder Tisch aus poliertem Wurzelholz.
Auf jedem der Tische stand eine Vase aus geschliffenem Kristall mit frischen Schnittblumen darin und ein ebenso geschliffener Aschenbecher. Ansonsten waren die Tische leer, mit Ausnahme des Schreibtisches, auf dem sich neben einer ledernen Schreibunterlage mit passender Stiftschale ein Computermonitor, die zugehörige Tastatur und ein Telephon befanden.
Eine zweiflügelige Schiebetür auf der linken Längsseite des Raumes führte hinüber ins Wohnzimmer. Daneben stand ein großes Sideboard, ebenfalls aus Kirschbaumholz, dessen Oberseite mit einer Rauchglasplatte belegt war, darauf verteilt mehrere Glaskaraffen mit alkoholischen Getränken nebst den dazugehörigen Gläsern. Auf der hinteren Schmalseite des Raumes gelangte man durch eine gläserne Flügeltür hinaus auf die Terrasse, die sich über die gesamte Rückseite des Hauses und etwa sechs Meter in den Garten hinein erstreckte.
Durch zwei weitere, gläserne Flügeltüren kam man von der Terrasse aus ins Wohnzimmer, das zweifellos den größten Raum des Hauses bildete. Mit Ausnahme der gläsernen Rückwand waren alle anderen Wände mit Bücherschränken bestellt, die sich vom Boden bis zur Decke erstreckten und in die auch die Schiebetüren zum Arbeitszimmer, zum Eßzimmer und zur Eingangshalle eingebaut waren. Mehrere Postergarnituren waren über den Raum verteilt, auf unterschiedlich gemusterten Teppichen aus verschiedenen Ländern des Orients. Auch hier, wie schon im Arbeitszimmer, Kristallaschenbecher und Vasen mit frischen Schnittblumen auf jedem der Beistelltische zwischen den Sesseln und vor den Couchen.
Den Raum dominierte ein Konzertflügel, der in der Mitte aufgestellt war und über dem ein ausladender, mit Swarovski-Kristallen bestückter Leuchter von der Decke herab hing.
Das Eßzimmer war etwas kleiner als das Arbeitszimmer, bot jedoch reichlich Platz genug für eine altflämische Eßgruppe mit zwölf Stühlen samt den dazugehörigen Buffets, in denen Geschirr, Besteck und Gläser verwahrt wurden. Die überbreite Schiebetür zwischen Wohn- und Eßzimmer gestattete es in geöffnetem Zustand, beide Räume als Einheit zu nutzen, so daß leicht eine Gesellschaft von mehreren Dutzend Personen darin Platz fand.
Den Rest des Erdgeschosses nahm, neben mehreren Gästetoiletten hinter dem Arbeitszimmer, die großzügig dimensionierte Küche ein, deren Ausstattung es problemlos ermöglichte, mehrgängige Menues für eine den Plätzen im Eßzimmer entsprechende Gesellschaft von zwölf Personen zuzubereiten.
Eine geschwungene Holztreppe and der Wand zu Küche und Eßzimmer führte hinauf in den ersten Stock. Oben gab es acht Gästezimmer, von denen sich jeweils zwei ein Bad teilten und das große Schlafzimmer mit einem eigenen Bad. Unter dem Dach, im zweiten Stock, befanden sich weitere sechs Zimmer und zwei Bäder für das Personal.
Von der weitläufigen Rasenfläche hinter dem Haus hatte man einen direkten Zugang zu dem unter der Terrasse gelegenen Schwimmbad, dessen Glaswand sich vollständig öffnen ließ. Rechts und links daneben führten zwei breite Steintreppen hinauf auf die Terrasse, auf der sich im Sommer mehrere Sitzgruppen befanden, die zu dieser Jahreszeit allerdings bereits abgeräumt war.
***
Nikolaj Petrovich Visnijakov begab sich in sein Arbeitszimmer und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Unaufgefordert servierte die Haushälterin Tee, den er aus feinstem Meißener Porzellan zu sich nahm, süß, mit viel Zucker und einem Tropfen Sahne. Einem silbernen Etui, das er in der rechten Tasche seiner Anzugjacke zu tragen pflegte, entnahm er eine Zigarette, die er mit einem goldenen Dunhill-Feuerzeug, das er stets in der linken Jackentasche verwahrte, anzündete.
Kaum hatte er die Tasse zur Hälfte ausgetrunken und die Zigarette im Aschenbecher ausgedrückt, als die Tür zum Arbeitszimmer erneut geöffnet wurde. Die Haushälterin blieb darin stehen. An ihr vorbei trat ein Mann unbestimmten Alters herein. Er war mittelgroß, untersetzt, mit Glatze, Doppelkinn, einem fleischigen Gesicht und kleinen Schweinsäuglein darin, mit denen er mißtrauisch in die Welt sah. Er trug einen dunkelbraunen Maßanzug feinster Machart, dazu ein beigefarbenes Hemd und eine grüngrundige Krawatte. Die ebenfalls braunen Schuhe waren blank poliert und handgefertigt.
Visnijakov erhob sich hinter seinem Schreibtisch, als der Besucher hereinkam. Er ging ihm entgegen und streckte die Hand aus.
„Herr Staatssekretär, welch eine Überraschung“, begrüßte er den Mann.
Der offensichtlich unangemeldete Besucher machte keine Umstände. Er schüttelte Visnijakovs Hand und sagte dabei: „Ich muß Sie dringend sprechen, Nikolaj Petrovich. Es geht um eine äußerst heikle Angelegenheit.“
„Aber doch bestimmt nicht so heikel, daß Sie nicht eine Tasse Tee mit mir trinken wollen“, antwortete Visnijakov jovial und deutete auf die beiden Ohrensessel im Alkoven. „Setzen wir uns doch, mein Freund.“
Sie setzten sich und schwiegen, bis die Haushälterin jedem eine Tasse Tee serviert und das Zimmer wieder verlassen hatte. Visnijakov nahm sein Zigarettenetui aus der Tasche und hielt es seinem Gast hin. Doch der winkte ab.
„Nicht doch, Nikolaj Petrovich, Sie wissen doch, daß ich’s mir abgewöhnt habe.“
Visnijakov schüttelte bedauernd den Kopf. „Ihr Deutschen wißt einfach nicht die kleinen Freuden des Lebens zu genießen“, meinte er.
„Wenn ich nicht irre, sind Sie auch einer von uns Deutschen“, erwiderte der Besucher.
„Sagen wir, ich bin es mit der einen Hälfte meiner Seele“, gab Visnijakov zu. „Mit der anderen Hälfte bin ich immer ein Russe geblieben. Insbesondere was solche Dinge angeht“, fügte er lächelnd hinzu und betrachtete beinahe liebevoll die brennende Zigarette.
Sie nahmen einen Schluck aus den Teetassen. Eine Weile schwiegen sie beide und widmeten sich weiter dem Tee. Visnijakov zündete sich eine weitere Zigarette an und stieß den Rauch langsam durch die Nase aus.
„Was also führt Sie zu mir, werter Herr Staatssekretär?“ fragte er schließlich. „Ich nehme an, es ist sowohl äußerst heikel, wie Sie andeuteten, als auch streng geheim?“
Der Beamte nickte. „In der Tat, das ist es beides.“
„Mir werden Sie jedoch trotzdem erzählen, worum es sich handelt“, stellte der Andere fest, immer noch lächelnd.
Der Staatssekretär blieb ernst. „Natürlich, sonst hätte ich Sie nicht aufgesucht“, gab er zurück.
Visnijakov lehnte sich in seinem Sessel zurück und nahm einen Zug aus seiner Zigarette. „Also?“
„Plutonium“, sagte der Andere. „Was wissen Sie darüber?“
„Plutonium ist das schwerste in der Natur vorkommende Element“, referierte Visnijakov. „Es trägt die Ordnungszahl vierundneunzig, ein Transuran aus der Gruppe der Actinoide. Ein hochgiftiger Alfastrahler, dessen Gefährlichkeit allerdings von den hysterischen, grünen Weltverbesserern weit überschätzt wird. Jedenfalls solange man es sich aus dem Körper heraushält. Dann ist die Strahlung vernachlässigbar. Die Giftigkeit wird ohnehin von vielen anderen Stoffen weit übertroffen.
Man findet natürliches Plutonium in kleinsten Mengen in sehr altem Gestein. Darüberhinaus entsteht es als Spaltprodukt bei der Kernspaltung des Urans. Es läßt sich sowohl als Brennstoff in Kernkraftwerken als auch in Kernwaffen verwenden. Heutzutage ist es in vielen Ländern verbreitet, in allen solchen nämlich, in denen elektrische Energie aus der Kernspaltung gewonnen wird … “
„Und von solchen, die daraus Waffen anfertigen, angefertigt haben oder aber sich darum bemühen, es zu tun“, unterbrach ihn der Staatssekretär.
„So ist es in der Tat“, stimmte Visnijakov zu, um dann mit seinem Referat fortzufahren: „Selbstverständlich ist der Handel streng reglementiert. Am freien Markt ist Plutonium nicht zu erwerben. Wie das freilich auf dem schwarzen Markt aussieht … “ Visnijakov zog die Schultern nach oben und die Mundwinkel nach unten.
Der Staatssekretär richtete sich in seinem Sessel auf. „Und genau darum geht es. Angeblich ist in Kasachstan eine gewisse Menge waffenfähiges Plutonium verschwunden, das wenig später in Russland aufgetaucht sein soll. In einer Wiederaufbereitungsanlage in der Nähe von Chelyabinsk. Dort ist es aber anscheinend nicht mehr. Ein Transport radioaktiver Materialien hat vor fünf Tagen diese Wiederaufbereitungsanlage verlassen und ist seitdem verschwunden.“
Visnijakov hatte sich den Bericht des Staatssekretärs mit unbeteiligtem Gesicht angehört. Wieder zog er an seiner Zigarette. „Eine interessante Geschichte“, sagte er jetzt. „Warum erzählen Sie sie mir?“
Der Beamte seufzte laut und lehnte sich wieder in seinem Sessel zurück. „Es gibt Informationen, die darauf hindeuten, daß dieses Material nach Deutschland geschafft werden soll. Allerdings wissen wir nicht wie und wann und durch wen.“
Visnijakov breitete die Hände aus. „Ich weiß es auch nicht, Herr Staatssekretär. Ich weiß nur, daß ich es nicht bestellt habe.“ Er lächelte den Politiker an. „Ich habe keinen Bedarf an Plutonium. Meinen Strom beziehe ich vom örtlichen Stromversorger und meine Konflikte pflege ich nicht mit Plutoniumbomben zu lösen.“
„Oh, das weiß ich“, wehrte der Staatssekretär ab. „Aber einem Nikolaj Petrovich Visnijakov würde eine derartige Transaktion sicher nicht entgehen, wenn er sie denn sehen wollte.“
Eine geraume Weile blieb Visnijakov schweigend in seinem Sessel sitzen. Er nahm einen Schluck von seinem Tee und rauchte seine Zigarette zu Ende. Dann erhob er sich.
„Ich werde sehen, was ich herausfinde“, sagte er, drehte sich zu seinem Gast um und sah ihn an. „Ich begleite Sie hinaus.“
Am Fuß der Treppe vor dem Eingang wartete ein Taxi. Der Fahrer machte sich nicht die Mühe, auszusteigen und seinem Fahrgast die Tür zu öffnen. Visnijakov tat es stattdessen.
„Hat das Bundesinnenministerium Dienstwagen und Chauffeure abgeschafft?“ fragte er den Staatssekretär.
„Nein, bis jetzt nicht“, antwortete der Beamte. „Aber ich habe es vorgezogen, bei diesem Besuch so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Ich bin mit dem Zug gekommen und werde auch für die Rückfahrt die Bahn benutzen.“
„Es schickt sich für einen renommierten Politiker nicht, mit einem Nikolaj Petrovich Visnijakov gesehen zu werden“, stellte der Russe lächelnd fest.
Der Staatssekretär hob die Hände und zog die Schultern hoch. „Sie kennen die öffentliche Meinung, Nikolaj Petrovich.“
„Nein“, widersprach der Andere, „die öffentliche Meinung kenne ich nicht. Ich interessiere mich nicht dafür. Allerdings weiß ich, wie die Medien dazu stehen. Das tangiert mich zwar auch in keiner Weise, aber es ist schwer, das Geschrei der Journallie nicht zu hören.“
Die beiden Männer schüttelten sich die Hand.
„Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, Herr Staatssekretär“, sagte Visnijakov.
„Vielen Dank. Sie halten mich auf dem laufenden?“
„Natürlich. Ich melde mich.“
Visnijakov blieb neben dem Auto stehen, bis der Staatssekretär eingestiegen und das Taxi hinter den Büschen verschwunden war. Dann ging er nachdenklich wieder ins Haus zurück. In seinem Arbeitszimmer setzte er sich hinter seinen Schreibtisch und begann zu telephonieren.
***
Der ‚Gulfstream G450‘ Business Jet gab ein etwas seltsames Bild ab auf dem kleinen Flugplatz zwischen den einmotorigen Motorflugzeugen und den Segelflugzeugen, die vor dem barackenähnlichen Gebäude geparkt waren, das zwischen mehreren Wellblechhangars erbaut war und aus dessen Dach sich ein kleiner Kontrollturm erhob. Aber der Flugplatz verfügte über eine Betonpiste, die gerade lang genug war, um einer G450 Start und Landung zu erlauben. Ohne viel Aufsehen zu erregen, denn an Werktagen war der Platz, mit Ausnahme der Abendstunden, an denen die Hobbypiloten und Segelflieger ihre Freizeit hier verbrachten, so gut wie verwaist. Und er lag ganz in der Nähe von Nikolaj Visnijakovs Wohnsitz.
Am frühen Vormittag war der Jet gelandet. Man hatte eigens einen Fluglotsen auftreiben müssen, der Anflug und Landung und später auch den Abflug überwachen sollte, denn normalerweise war der Kontrollturm nur an den Wochenenden besetzt, wenn reger Flugverkehr herrschte. Ansonsten wurde nur bei schönem Wetter und nach Sichtflugregeln geflogen.
Das alles interessierte Visnijakov nicht im geringsten, dessen Maybach Limousine am späteren Vormittag auf der betonierten Fläche vor dem Flugplatzgebäude vorfuhr und unmittelbar vor dem Einstieg der Gulfstream zum Stehen kam. Er wartete, bis sein Chauffeur die Tür der Limousine geöffnet hatte und begab sich dann, ohne nach rechts oder links zu schauen sofort an Bord des Flugzeuges. Kaum fünf Minuten später war der Jet in der Luft.
Visnijakov war nicht der einzige Passagier an Bord. Im hinteren Teil der Maschine warteten drei Männer und eine Frau auf ihn. Jedoch beachtete er sie vorerst nicht, sondern er nahm vorne an einem kleinen Tisch Platz, wo ihm die Stewardess ein Mittagessen servierte, gleich nachdem sie die Reiseflughöhe erreicht hatten. Danach kümmerte sie sich um die vier anderen Passagiere. Alle schwiegen während sie aßen.
Nachdem Visnijakov seine Mahlzeit beendet und die Stewardess den Tisch abgeräumt hatte, rief er: „Kalinin, daweij!“
Der Angesprochene erhob sich von seinem Sitz und ging nach vorne. Er hatte Mühe, sich in dem kleinen Flugzeug zu bewegen, denn er war außergewöhnlich groß, ein hagerer, schwarzhaariger Mann mit buschigen Augenbrauen und finsteren Gesichtszügen, dem das Lachen oder Lächeln ganz offensichtlich schon in der Kindheit verlorengegangen war. Immerhin trug er einen dunkelgrauen Maßanzug mit weißem Hemd und einer bordeauxroten Krawatte.
Visnijakov deutete mit der Hand auf den Platz ihm gegenüber und wartete, bis der andere Platz genommen hatte, bevor er ihn auf russisch ansprach: „Was haben Sie zu berichten?“
„Das Material ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden. Als meine Leute in Russland den Fahrer des Transportes befragen wollten, war er zunächst nicht auffindbar. Stunden später entdeckte man ihn dennoch. Tot. In der Spedition, der der Lastwagen gehörte, gab man sich ahnungslos. Von einem verschwundenen Lastwagen wisse man nichts, alle Fahrzeuge seien ordnungsgemäß unterwegs, der betreffende derzeit in Kasachstan. Allerdings habe man momentan keine Verbindung zum Fahrer. Das sei normal und eine Sache des schlecht ausgebauten Mobilfunknetzes. Man erwarte ihn jedoch in einigen Tagen zurück.“
„Und damit haben Sie sich abspeisen lassen?“
„Vorerst ja. Wir hielten es für besser, daß Sie sich selbst ein Bild machen, bevor wir andere Maßnahmen ergreifen.“
Visnijakov nickte zustimmend. Er wußte, worin diese ‚anderen Maßnahmen‘ bestehen würden, und er war mit deren Anwendung keineswegs einverstanden. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt.
„Gut. Tun Sie vorerst nichts weiter. Wir werden sehen, was die Leute zu sagen haben. Was ist mit denen aus der Fabrik?“
Kalinin schüttelte den Kopf. „Keine Chance, freiwillig sagt da keiner was.“
„Dann lassen Sie sie. Bis auf weiteres. Wir wollen keinen Staub aufwirbeln.“
Wieder nickte Visnijakov und machte eine Handbewegung, die andeuten sollte, daß der andere entlassen war.
„Schicken Sie mir die Frau“, sagte er noch.
Kalinin verschwand wieder im hinteren Teil der Kabine. Augenblicke später tauchte die Frau auf. Sie mochte Anfang dreißig sein, keine Schönheit im eigentlichen Sinne, aber doch eine attraktive Erscheinung, mit kurz geschnittenen, rotblonden Haaren und einer außergewöhnlich hellen Haut. Sie trug einen Hosenanzug, weiße Bluse, schwarze Pumps, dezent geschminkt, keinen Schmuck. Ihr Gesichtsausdruck hatte etwas Hochmütiges.
„Tanja Müller, Bundesinnenministerium“, stellte sie sich vor. „Ich komme auf Weisung des Herrn Staatssekretärs.“
„Lassen Sie diesen Blödsinn“, antwortete Visnijakov schroff. „Der Staatssekretär kann Ihnen gar keine Anweisungen geben. Er kann Sie allenfalls bei Ihren Vorgesetzten anfordern. Mit Hilfe von deren Vorgesetzten. Ich kenne mich aus, was die Beziehungen zwischen dem Innenministerium und dem Bundesnachrichtendienst angeht. Und ich gehe davon aus, daß Sie zu dieser Organisation gehören. Ihr ungewöhnlicher Hausname deutet darauf hin.“
Die Frau wollte etwas erwidern, aber Visnijakov ließ sie nicht zu Wort kommen.
„Sparen Sie sich Ihre Erklärungsversuche. Sie sind unnötig. Ihre Dienstverhältnisse spielen hier keine Rolle. Wichtiger ist mir, zu erfahren, was Sie wissen.“ Wieder deutete er auf den Sessel ihm gegenüber. „Setzen Sie sich.“
***
Etwa fünf Stunden nach dem Abflug landete die Gulfstream auf dem Flughafen Roschtschino der Stadt Tyumen. Hier war es bereits dunkel, denn der Zeitunterschied zu Deutschland betrug vier Stunden.
Eine Regierungslimousine des Tyumen Oblast, des Bezirks Tyumen, wartete auf dem Rollfeld. Visnijakov und Tanja Müller ließen sich damit zum Spasskaja Hotel fahren, das etwas außerhalb des Zentrums in der Nähes des Flusses Tura lag und in dem Visnijakov regelmäßig abstieg, wenn er sich in der Stadt aufhielt.
Der Gouverneur des Bezirks Tyumen wartete auf ihn in einem Nebenzimmer des Restaurants. Die beiden Männer waren alte Bekannte, noch aus Sovjetzeiten, und sie begrüßten sich entsprechend. Natürlich in russischer Sprache. So wurde auch die Unterhaltung fortgeführt, nachdem sie und Tanja Müller am Tisch Platz genommen hatten.
Wesentliches wurde nicht beprochen. Man frischte alte Erinnerungen auf und plauderte über die allgemeine politische Lage, die Konjunktur, das Wetter und die Kunst. Beide Männer waren sich sehr wohl bewußt, daß die Frau am Tisch ihrer Unterhaltung folgen konnte, obwohl sie bis dahin noch kein Wort gesagt hatte. Der BND hätte kaum einen Agenten nach Russland geschickt, der die Landessprache nicht beherrschte.
Was Müller jedoch nicht beherrschte, war die Körpersprache der beiden Russen. Und in dieser tauschten sie sich aus. So erfuhr Visnijakov, daß auch die Administration des Tyumen Oblast keinen Hinweis über den Verbleib des Plutoniums hatte und im Moment auch keine brauchbare Spur verfolgte. Was sowohl Visnijakov als auch den Gouverneur außerordentlich zornig machte.
Ungewöhnlich war das nicht, denn das Geheimnis der beiden Männer war, daß sie beide in den Plutoniumdeal verwickelt waren. Der Gouverneur hatte das Material beschafft und war für den Transport innerhalb des Landes zuständig, Visnijakov sollte den Stoff übernehmen, sobald es die Grenze der Russischen Föderation passiert hatte. Außerdem war es seine Aufgabe, einen Käufer dafür zu finden.
Tanja Müller ahnte davon nichts. Am Ende des Abends, nachdem sie gegessen und eine Menge getrunken hatten, war sie genauso schlau wie vorher. Und das, obwohl sie sich beim Genuß der hochprozentigen, alkoholischen Getränke sehr zurückgehalten hatte.
Frustriert verschwand sie in ihrem Zimmer, zu dessen Tür Visnijakov sie galant begleitete. Und keinerlei Anstalten gemacht hatte, ihr dort hinein zu folgen. Das war nicht sein Stil. Nicht, daß er einem gelegentlichen, sexuellen Abenteuer abholt gewesen wäre, das nicht. Aber er ließ sich niemals mit Frauen ein, mit denen er sich im Nachhinein erpreßbar gemacht hätte. Und eine solche war Tanja Müller ganz gewiß. Bestimmt würde sie eine Liaison zu ihrem Vorteil zu nutzen wissen. Nicht zu ihrem persönlichen, möglicherweise, aber sicherlich zu dem ihres Dienstherren. Und darauf würde es Visnijakov auf keinen Fall ankommen lassen.
Also wünschte er ihr eine Gute Nacht und begab sich danach in seine Suite. Am folgenden Tag würde er den Gouverneur alleine treffen. Dann konnte man Tacheles reden.
***
Die Reise nach Tyumen war ein Schlag ins Wasser gewesen. Tanja Müller konnte weder ihren Vorgesetzten noch den Beamten im Innenministerium mit neuen Erkenntnissen dienen. Der Verbleib des Plutoniums war nach wie vor nicht bekannt, noch wußte sie zu berichten, wer hinter der Affäre steckte.
Nikolaj Petrovich Visnijakov hätte einiges zum Erhellen der Angelegenheit beitragen können, aber er schwieg. Im Hintergrund allerdings zog er seine Fäden. Die Arbeit freilich überließ er anderen. Regelmäßig sprachen sie bei ihm vor, um ihm Bericht zu erstatten und ihm ihre Erkenntnisse vorzutragen. Wie sie an ihre Informationen gekommen waren, erwähnten sie nicht. Visnijakov wollte es auch gar nicht wissen. Es interessierte ihn nicht.
So entging es ihm zunächst auch, daß ein gewisser Pavel Ruslanowitsch Dobrin, seine Frau Irina und die achtjährige Tochter Svetlana der Skrupellosigkeit, die Visnijakovs Leute bei der Jagd nach Informationen um den Verbleib des prekären Materials an den Tag legten, zum Opfer gefallen waren.
Dobrin arbeitete an dem Institut, aus dem das Plutonium verschwunden war, und das war sein Pech. In der Annahme, in ihm einen Mitwisser entdeckt zu haben, sprengten sie sein Auto in die Luft. Die kleine Svetlana und ihre Eltern hatten keine Chance.
2
Mikhail Dobrin erfuhr vom Tod seiner Eltern und seiner kleinen Schwester eine gute Woche später. So lange hatte es gedauert, bis Nikolaj Petrovich Visnijakov die Mitteilung erhalten hatte, was da in seinem Namen angerichtet worden war und die Leute, die er damit beauftragt hatte, die näheren Umstände dieses, wie er es ausdrückte, ‚Unglücks‘ aufzuklären. So kam auch die Identität und der Aufenthaltsort des einzigen Überlebenden dieses Familiendramas ans Licht, Mikhail Pavlovitsch Dobrin, sechzehn Jahre alt, Schüler des Wildenburg-Internats am Rande des Ruhrgebietes.
Das Schicksal des Jungen war Visnijakov nicht gleichgültig. Soviel Verantwortungsbewußtsein hatte er immerhin, daß er es für seine Pflicht hielt, sich um ihn zu kümmern, nachdem was dessen Familie in seinem Namen angetan worden war. Er wollte ihm die schreckliche Nachricht selbst überbringen und danach schließlich mit ihm zusammen überlegen, wie es weitergehen sollte.
Hier, in seinem Haus, wollte er mit dem Jungen reden. Damit er sich wappnen konnte gegen das, was möglicherweise passieren mochte. Vorsorglich hatte er sogar einen Arzt und eine Krankenschwester beauftragt, sich zur Verfügung zu halten und sich notfalls um einen Patienten zu kümmern, der einen seelischen Schock erlitten hatte.
Eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, wie sich herausstellte. Mikhail Dobrin nahm die Nachricht vom Tod seiner Eltern und seiner kleinen Schwester erstaunlicherweise recht gefaßt entgegen. Scheinbar jedenfalls. Solange er bei Visnijakov zu Besuch war, ließ er sich nichts anmerken.
Später jedoch, nachdem ihn Visnijakovs Fahrer mit der schweren Maybach-Limousine wieder zum Internat zurückgebracht hatte, sah die Sache anders aus. Sobald er in seinem Zimmer allein war, brach der Junge vollkommen zusammen. Er schrie und weinte hemmungslos, stundenlang, tagelang, denn es war Wochenende, und niemand hörte ihn, und kümmerte sich um ihn. Er war sich selbst überlassen in seinem Schmerz. Nirgendwo gab es einen Menschen, zu dem er hätte gehen können.
***
Hier, im Internat war er mehr geduldet als gelitten, und Verwandte hatte er jetzt keine mehr. Abgesehen von ein paar entfernten Onkeln und Tanten, die irgendwo in Kasachstan lebten und die er nicht kannte. Und Nikolaj Petrovich Visnijakov hielt er instinktiv nicht für jemanden, dem er sich anvertrauen wollte.
Obwohl der sehr freundlich und mitfühlend gewesen war. Natürlich hatte er dem Jungen verschwiegen, wie seine Familie zu Tode gekommen war und welche Mitschuld er, Visnijakov, daran hatte. Von einem tragischen ‚Unfall‘ hatte er geredet, für den niemand etwas gekonnt habe. Und Mikhail hatte oberflächlich keinen Grund, an Visnijakovs Geschichte zu zweifeln. Trotzdem war er mißtrauisch geblieben und hatte das großzügige Angebot des reichen Mannes, vorerst bei ihm zu wohnen, abgelehnt.
Visnijakov hatte Verständnis dafür gehabt, ihm jedoch versichert, daß er sich von nun an um ihn kümmern würde. Und das war auch geschehen. Visnijakov hatte den Nachlaß der Dobrints geregelt und erwirkt, daß er die Vormundschaft über Mikhail bekam, was diesem jedoch vorläufig verborgen geblieben war. Anfangs hatte er für diese Dinge keinen Sinn gehabt und danach waren sie ihm gleichgültig gewesen. Zumal sich in seinem Leben nichts änderte.
Er war nach wie vor allein. So war es vor dem Tod seiner Eltern gewesen, und so war es auch jetzt. Ob seine Eltern nun in Tyumen, viertausend Kilometer weit entfernt, lebten oder ob sie dort begraben waren, was machte das für einen Unterschied? Dachte er jedenfalls. Manchmal. Aber immer wieder wurde es ihm auch bewußt, daß es sehr wohl einen Unterschied machte. Bislang hatte er die Zeit im Internat bis zur Ankunft seiner Eltern als Überbrückung angesehen. Nun waren die Verhältnisse endgültig.
***
Im Internat ließ er nichts darüber verlauten. Nicht dem Direktor gegenüber, nicht zu den Lehrern und schon gar nicht mit seinen Mitschülern sprach er über sein Schicksal. Letzteres fiel ihm besonders leicht. Sie wollten ja ohnehin nichts von ihm wissen. Sie nannten ihn ‚Den Ruski‘ und sahen ihn an wie ein exotisches Tier, das wie zufällig in ihrer Umgebung lebte.
Anfangs war es ihm nicht leicht gefallen, sich damit abzufinden, aber inzwischen hatte er sich daran gewöhnt. Er war als Außenseiter im Internat empfangen worden, man hatte ihn stets als solchen behandelt und so war es nur folgerichtig, daß er dazu geworden war.
Nicht der einzige, aber doch ein gewaltiger Unterschied zu dem, wie er in Tyumen angesehen gewesen war. Dort hatte er viele Freunde gehabt, er war beliebt, ein toller Kumpel. Sogar seine Lehrer hatten ihn gemocht. Der Direktor seiner Schule hatte ihn am letzten Schultag vor seiner Abreise eigens zu sich kommen lassen, um sich von ihm zu verabschieden und ihm alles erdenklich Gute zu wünschen.
„Wenn Du alt genug wärst, würde ich jetzt gerne eine Karaffe Wodka mit Dir leeren“, hatte er gesagt und Mikhail ein paarmal feste auf die Schultern geklopft. „Auf eine glückliche Zukunft in Deutschland und daß Du uns und Deine Heimat nicht ganz vergißt. Do swidanja“
Der neue Direktor hatte es nicht einmal für nötig gehalten, ihn mit einem Handschlag zu begrüßen. Drei unpersönliche Minuten hatte Mikhail in seinem Büro verbracht, dann hatte der Direktor ihn in die Verantwortung des Sekretariats abgeschoben, wo man ihm sein Zimmer anwies und ihn für den Rest des Tages nicht mehr behelligte, damit er sich dort einrichten könne. Am nächsten Tag erwarte man ihn dann pünktlich um acht Uhr im Klassenraum der Klasse zehn zum Unterricht.
Dort hatte ihn der Klassenlehrer mit einem Kopfnicken begrüßt, ihn der Klasse vorgestellt und ihm seinen Platz angewiesen. Etwas mehr als eine Minute hatte das gedauert, dann begann der normale Unterricht, wie gewöhnlich.
Um die näheren Umstände und Gepflogenheiten im Internat mußte er sich selbst kümmern. Im Sekretariat hatte man ihm die Schul- und Hausordnung gegeben und eine Liste mit Büchern, die für den Unterricht benötigt wurden und die er sich in der Stadt besorgen sollte. Von seinen Mitschülern hatte sich keiner um ihn gekümmert.
Mikhail war das alles sehr seltsam vorgekommen. Aber er hatte es akzeptiert. Notgedrungen. Trotzdem fragte er sich, woher diese übertrieben ablehnende Haltung ihm gegenüber kam. Er konnte es sich nicht erklären.
Erst Wochen später begann er, den Grund dafür zu ahnen. In der Stadt, in deren Nähe das Internat lag, gab es eine relativ große Gruppe russischer Einwanderer, die ‚Spätaussiedler‘ genannt wurden, meist nur sehr schlecht Deutsch sprachen und normalerweise unter sich blieben, weil sie die Gepflogenheiten ihrer russischen Heimat nicht ablegen mochten, mit denen man in Deutschland wenig anfangen konnte und die man daher ablehnte.
Unnötig zu sagen, daß auch der Alkohol dabei eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Zusammen mit der dazu noch weithin grassierenden Arbeitslosigkeit vieler dieser ‚Spätaussiedler‘ und dem ihnen eigenen, russischen Temperament ergab sich dadurch eine höchst ungute Gemengelage, die nicht selten zu Polizeieinsätzen führte und schließlich ganz und gar nicht dazu angetan war, die russische Gemeinde in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Kein Wunder also, daß man ihm, Mikhail Dobrin, dem Russen, den man für ein Mitglied dieser Gemeinde hielt, mit erheblichem Mißtrauen, ja sogar mit totaler Ablehnung begegnete.
Mikhail gab sich seinerseits allerdings auch wenig Mühe, seinen Lehrern und Mitschülern ihre Vorurteile abzugewöhnen. Zu sehr war er anfangs damit beschäftigt, sich zurechtzufinden und sich sein neues Leben in Deutschland einzurichten. Dann erreichte ihn die Nachricht vom Tod seiner Eltern, und danach war es ihm ohnehin völlig gleichgültig, was die anderen von ihm hielten. Danach war eigentlich gar nichts mehr wichtig.
Er lebte vor sich hin, meistens allein in seinem Turmzimmer und von den anderen unbeachtet. Mehr aus Langeweile als aus Interesse begann er, sich mit seinem Computer zu beschäftigen, den sein vermeintlicher väterlicher Freund und Gönner Nikolaj Visnijakov ihm zur Verfügung gestellt hatte.
Es dauerte nicht lange, bis er feststellte, daß ihm der Umgang mit Bits und Bytes nicht nur Spaß machte, sondern daß er auch ein beträchtliches Talent besaß, vorhandene Programme nach seinen Vorstellungen umzubauen und neue zu schreiben. Zuerst machte er es zum Spaß und zum Zeitvertreib, aber dann fand er heraus, daß sich damit nicht wenig Geld verdienen ließ.
Also fing er an, sich sein Talent vergolden zu lassen. Mit überraschend großem Erfolg. Allerdings freute ihn dabei mehr der Umstand, daß überhaupt Leute bereit waren, für seine Dienste Geld zu bezahlen, als die Summen, die sie ihm auf sein Konto überwiesen. Denn er war ja auf das Geld nicht angewiesen. Nikolaj Visnijakov sorgte dafür, daß es ihm an nichts mangelte.
Trotzdem verkaufte er das, was er sich ausdachte oder worum er gebeten wurde, es sich auszudenken. Blitzschnell beherrschte er die gängigen Programmiersprachen und codierte seine Programme ebenso mühelos wie andere Leute ihren Einkaufszettel schrieben. Er war ein Genie.
In seiner unmittelbaren Umgebung, im Internat, fiel das allerdings niemandem auf. Wie auch, es gab sich ja keiner mit ihm ab. Lehrer und Mitschüler mußten lediglich zur Kenntnis nehmen, daß er ein höchst schlaues Bürschchen zu sein schien, denn er lieferte seine Arbeiten auf einem Niveau ab, das andere vor Neid erblassen ließ. Lediglich seine mündliche Mitarbeit ließ ein wenig zu wünschen übrig. Er hatte zwar immer die richtigen Antworten auf die Fragen, die ihm von den Lehrern gestellt wurden, aber von selbst meldete er sich im Unterricht nie zu Wort. Er war wie eine Maschine, die zuverlässig das Richtige ausspuckte, wenn man auf den entsprechenden Knopf drückte.
„Die Gruppe der Edelgase.“ Der Chemielehrer sah ihn an und machte eine auffordernde Bewegung mit dem Kopf. Die meisten Lehrer taten das, wenn sie ihn aufforderten, eine Antwort zu geben. Mit seinem Namen sprachen sie ihn selten an.
„Helium, Neon, Krypton Xenon, Radon und Ununoctium“, antwortete Mikhail prompt.
„Ununoctium?“
„Es ist ein künstliches erzeugtes, radioaktives Edelgas, Ordnungszahl 118, erstmals hergestellt in 2006, bekannt auch unter dem Namen Eka-Radon. Ob es tatsächlich ein Edelgas ist, weiß man noch nicht. Es gibt zu wenig davon, um das eindeutig nachweisen zu können.“
„Klugscheißer“, meinte einer aus der Klasse. Er hatte es zwar leise gesagt, aber alle hatten es gehört und lachten. Der Lehrer ging nicht darauf ein, sondern fragte weiter:
„Radon?“
Mikhail hatte den Einwurf seines Klassenkameraden ebenfalls gehört, aber auch er beachtete ihn nicht. Er blieb weiterhin unbewegt sitzen, sah den Chemielehrer an und sprach mit ruhiger, gleichtönender Stimme. „Ordnungszahl 86, als Alphastrahler ebenfalls radioaktiv, aber natürlichen Ursprungs. Es kommt im Grundwasser vor und hat eine Halbwertszeit von drei Komma acht Tagen.“
Den Kommentar des Lehrers, er habe seine Hausaufgaben offensichtlich gemacht, nahm Mikhail mit unbewegtem Gesicht zur Kenntnis. Natürlich hatte er das. Sie waren ihm ja aufgetragen worden.
Und so wie in diesem Fall, war es immer, in diesem, ebenso wie in den anderen Fächern. Irgendjemand stellte eine Frage, und er antwortete. Schnell, präzise emotionslos. Auch in seinen schriftlichen Arbeiten spiegelten sich diese Eigenschaften wider.
Über seine Aussprache machte sich inzwischen niemand mehr lustig. Er redete eben so. Und vor dem, was er sagte, wenn er denn etwas sagte, bekamen sie mehr und mehr Respekt. Die bloße, unbegründete Abneigung, die ihm anfangs entgegengeschlagen war, nahm deutlich ab. Stattdessen begann Mikhail, seinen Mitschülern und Lehrern unheimlich zu werden. Der Effekt war allerdings der gleiche. So oder so, niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Für ihn änderte sich also nichts. Er blieb allein. Ständig.
Ob ihm das etwas ausmachte oder nicht, wußte niemand zu sagen. Falls es das tat, so ließ er das die anderen nicht merken. Manchmal fuhr er nachmittags in die Stadt, wenn ihm in seinem einsamen Turmzimmer die Decke auf den Kopf fiel. Dann streifte er durch den Stadtpark oder die Straßen und Gassen der Fußgängerzone. Meistens ohne etwas zu kaufen. Allenfalls das eine oder andere Kleidungsstück, das dann zwar unauffällig aber von erlesener Qualität sein mußte. Darauf legte er Wert, egal ob es sich um Hemden, Hosen, Strümpfe oder Unterwäsche handelte. Das Geld dazu hatte er ja.
Und er machte es sich zur Gewohnheit, niemals nachlässig gekleidet zum Unterricht zu erscheinen. Stets erschien er in Stoffhosen, sorgfältig gebügelten, einfarbig weißen, grauen oder hellblauen Oberhemden und blank geputzten Lederschuhen. Ein weiterer Grund für seine Mitschüler, die zumeist die übliche Uniform aus Jeans, Sweat oder T-Shirts und Sneakers trugen, sich über ‚den Ruski‘ lustig zu machen.
Gelegentlich traf er bei seinen Ausflügen auf Mitschüler aus dem Internat, die einzeln oder auch in Gruppen unterwegs waren. Anfangs wartete er darauf, daß jemand ihn ansprach, wenn er auf sie zuging. Aber das taten sie nicht. Einige deuteten mit einem Kopfnicken an, daß sie ihn erkannt hatten, die meisten aber drehten sich einfach weg. Nachdem er das wiederholt erfahren hatte, gewöhnte er sich an, ebenfalls achtlos an ihnen vorüberzugehen.
Hin und wieder erkundigte sich Nikolaj Visnijakov nach seinem Befinden. Er antwortete stets prompt und höflich. Doch seine Einladungen nahm er nicht an. Aus Gründen, die er sich nicht erklären konnte, widerstrebte es ihm, den Mann zu besuchen. Und Visnijakov bedrängte ihn nie. Wahrscheinlich sprach er die Einladungen nur aus Höflichkeit aus, und es war ihm ganz recht, daß Mikhail sie jedesmal ausschlug.
***
Mit Schularbeit und dem Schreiben von Computerprogrammen gelang es ihm halbwegs, seine Einsamkeit zu überwinden und seinen Schmerz zu betäuben, den ihm der Verlust seiner Familie noch immer bereitete. Nur die Nächte waren furchtbar, wenn er in seinem Bett lag und die Bilder seiner Eltern und der kleinen Svetlana, die er so sehr geliebt hatte, vor sich sah und nicht einschlafen konnte. Oft mußte er weinen, weil er es kaum zu ertragen vermochte.
So auch eines Sonntags früh, als er es nicht mehr aushielt, mit den quälenden Gedanken an seine Familie im Bett zu liegen. Panikartig sprang er aus dem Bett, flüchtete aus seinem Zimmer, dem Internat und sah per Zufall den wartenden Bus an der Haltestelle unterhalb der Burg stehen. Er fuhr damit in die Stadt und stieg an der Probsteikirche aus, weil deren Glocken gerade zur Frühmesse riefen. Sie erinnerten ihn an die Gottesdienste in der Snamenski-Kathedrale in Tyumen, die er mit seiner Familie regelmäßig besucht hatte.
Ohne daß er es eigentlich vorgehabt hatte, ging er in die Kirche hinein, kniete sich im Schatten eines Pfeilers hin und feierte die Frühmesse mit. Erstaunlicherweise kam er dabei vollkommen zur Ruhe, auf eine Art und Weise, die ihn dazu brachte, von diesem Sonntag an stets zur Frühmesse in die Stadt zu fahren.
Und obwohl er dort ein regelmäßiger Besucher unter nur wenigen wurde, die ihren Weg zu dieser frühen Morgenstunde in die Kirche fanden, bemerkte niemand den schmächtigen Jungen mit der Igelfrisur.
Auch am ersten Adventssonntag kniete Mikhail wieder auf seinem Platz neben dem Pfeiler. Und wie immer waren außer ihm nur ein paar Leute zur Frühmesse in die Kirche gekommen, meistens ältere. Das große Kirchenschiff der neugotischen Probsteikirche war fast leer. Das kalte Winterwetter mit dem frischen Neeschnee, der über Nacht gefallen war, tat sein übriges dazu.
Ihn konnte das nicht vom Besuch des Gottesdienstes abhalten. Er war anderes Wetter gewohnt. Die minus vier Grad erschienen ihm geradezu milde im Vergleich zu den minus zwanzig, die um diese Jahres- und Tageszeit in seiner Heimat herrschten. Andächtig folgte er der Liturgie, die hier eine ganz andere Form hatte als in der Heimat. Schwermütiger die Gesänge dort und viel ausladender. Doppelt so lange dauerte der Gottesdienst daheim. Hier war alles in einer Dreiviertelstunde erledigt. Trotzdem tat es ihm gut.
Eine Weile blieb er noch knien auf seinem Platz, nachdem die Meßfeier zu Ende war und die Kirche sich langsam leerte, bis er allein zurückblieb. Einmal mehr wurde ihm bewußt, daß die Zeit in Deutschland, das halbe Jahr, das er jetzt hier war, und der Verlust seiner Familie ihn zum Einzelgänger gemacht hatten. Er war ‚Der Ruski‘, ein sonderbarer Typ mit einem komischen Akzent, mit dem keiner so recht etwas anzufangen vermochte.
Er bemerkte den Priester, der die Meßfeier zelebriert hatte, erst, als er unmittelbar vor ihm stand.
„Kann ich Dir helfen?“ fragte der Mann. „Geht’s Dir nicht gut?“
Mikhail sah ihn von unten herauf an und schüttelte den Kopf. Als er sah, daß der Priester ihn anlächelte, lächelte er zurück.
„Nein, danke. Mir geht es ausgezeichnet.“
Das stimmte zwar nicht ganz, denn gerade hatte er wieder einmal an Svetlana gedacht, aber das brauchte er dem unbekannten Priester ja nicht unbedingt zu erzählen.
Obwohl ihm der Mann auf Anhieb sympathisch war. Er war noch ziemlich jung, Mitte dreißig vielleicht, eine hoch aufgeschossene Gestalt mit freundlich blickenden, grau-grünen Augen, hinter einer goldfarben geränderten Brille und dichtem, schwarzen Haar, das bis an den Kragen reichte.
„Du kommst jeden Sonntag zum Gottesdienst“, stellte der Geistliche fest. „Ich beobachte das jetzt schon eine ganze Weile. Und Du bist immer allein.“
Mikhail nickte, sagte aber nichts.
„Für die anderen aus der Familie ist es wohl noch zu früh?“ fragte der Priester weiter.
„Kaum“, antwortete Mikhail. „Ich lebe allein.“
Der Andere war erstaunt. „Du lebst allein? Wie alt bist Du denn, daß Du schon eine eigene Wohnung hast?“
„Ich bin sechzehn, und ich habe keine eigene Wohnung. Ich lebe im Internat auf der Burg“, gab Mikhail in seinem üblichen, emotionslosen und gleichförmigen Tonfall zurück, mit dem er stets die Fragen der Lehrer zu beantworten pflegte.
„Und dann kommst Du den weiten Weg hierher zur Frühmesse? Alle Achtung.“
„Das ist nicht besonders mühsam. Es fährt ein Bus. Und der kommt genau zur richtigen Zeit vor der Kirche an.“
„Das mag ja sein, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, daß jemand in Deinem Alter jeden Sonntag so etwas auf sich nimmt.“
Mikhail zuckte dazu nur mit den Achseln. Er war inzwischen aufgestanden und sah den Priester geradeheraus an.
„Du bist nicht von hier.“ Es war mehr eine Frage als eine Feststellung.
„Nein. Ich komme aus Rußland.“
„Und Du bist Katholik?“
„Nein, russisch-orthodox. Aber eine russisch-orthodoxe Kirche gibt es hier nicht. Jedenfalls kenne ich keine. Davon abgesehen hält der Bus ja, wie gesagt, gleich vor der Tür dieser Kirche, und der Liebe Gott ist ja auch derselbe.“
Mikhail gestattete sich ein kleines Lächeln.
Der Priester hingegen lachte, daß es in dem leeren Kirchenschiff widerhallte.
„Nicht schlecht, diese Begründung. Demnach führen uns also die städtischen Verkehrsbetriebe einen weiteren Gottesdienstbesucher zu. Und noch dazu einen, der die Frühmesse besucht. Ich sollte dem Oberstadtdirektor einen Dankesbrief schreiben.“
Jetzt lachte auch Mikhail. Der Priester war ihm sympathisch. Auf jeden Fall war er der erste, der sich auf ein längeres Gespräch mit ihm einließ. Und er schien es auch noch weiterführen zu wollen, denn er ließ sich auf der Gesangbuchablage der Bank nieder.
„Seit wann bist Du denn im Internat?“
„Seit dem Beginn des Schuljahres.“
„Und, gefällt’s Dir dort?“
Wieder zuckte Mikhail mit den Achseln. „Die Schule ist gut. Sie sorgen dafür, daß man eine Menge lernt.“
Das war nicht ganz die Antwort, die der Geistliche erwartet hatte, weil sie weder Zustimmung noch Ablehnung ausdrückte.
„Heimweh?“ fragte er deshalb.
„Kaum“, antwortete Mikhail.
An der Art, wie der Junge diese knappe Antwort hervorpreßte, merkte der Pfarrer, daß er anscheinend einen wunden Punkt berührt hatte.
„Willst Du darüber reden?“ fragte er deshalb.
Mikhail zögerte einen Moment. Doch dann schüttelte er den Kopf. Beide schwiegen sie daraufhin. Eine unbehagliche Situation. Schließlich erhob sich der Priester von der Bank, auf der er gesessen hatte.
„Wenn Du es Dir anders überlegst, Du findest mich im Pfarrhaus, gleich neben der Kirche.“ Dann nickte er Mikhail zu, drehte sich um und schritt langsam zum Eingang der Sakristei. Mikhail blieb so lange sitzen, bis der Mann darin verschwunden war, dann ging er ebenfalls hinaus.
***
Er wartete eine gefühlte Ewigkeit auf den Bus, der ihn zurück zum Internat brachte. Es lag einen kleinen Fußweg entfernt von der Endhaltestelle der Buslinie, auf einem nicht allzu hohen Hügel. Eine alte Burg, die man vor Jahren restauriert und zu einer Internatsschule umgebaut hatte.
Eine Straße führte dort hinauf, die sich einmal um den Hügel herumwand und ein kleiner Fußweg, über den man in direktem Anstieg nach oben gelangte. Der Fußweg war nicht geräumt und tief verschneit, aber Mikhail nahm ihn trotzdem, denn er war wesentlich kürzer als die Straße.
Fast oben angelangt, kamen ihm zwei Mädchen entgegen. Er kannte sie beide. Kerstin und Lara. Sie gingen in seine Klasse. Gesprochen hatte er noch nie mit ihnen. Auch an diesem Morgen rechnete er nicht damit, daß es dazu kommen würde. Sie würden ihn vermutlich nicht einmal ansehen.
Plöztlich rutschte eine von ihnen auf dem glatten, steil abschüssigen Weg aus und fiel vornüber, geradewegs in seine Arme. Der Aufprall war stark genug, auch ihn von den Füßen zu holen. Hinterrücks stürzte er in den tiefen Schnee neben dem schmalen Pfad. Das Mädchen, es war Lara, stürzte auf ihn. Instinktiv hatte er sie festgehalten. Nun lagen sie am Boden, ihre Gesichter dicht voreinander.
„Choppla“, machte er mit seinem rauen, russichen Akzent und lächelte sie an.
Einen Moment lang war sie zutiefst erschrocken, aber dann entspannten sich ihre Gesichtszüge.
„Chast Du Dir wehgetan?“ fragte er besorgt.
Sie schüttelte den Kopf und wollte sich aufrichten, obwohl er sie immer noch festhielt, was schließlich dazu führte, daß sie beide auf die Seite rollten. Als er es merkte, ließ er sie los, sprang auf und hielt ihr die Hand hin. Sie griff danach und ließ sich von ihm hochziehen. Wieder lächelte er sie an und hielt dabei ihre Hand fest, ein wenig länger als nötig.
„Alles in Ordnung?“
Seine Stimme war sanft, klang fast liebevoll. Sie sah ihm direkt in die Augen. Ihr Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. „Tut mir leid.“
„Nicht schlimm. Ist ja nichts passiert“, antwortete er. „Wo wollt Ihr denn hin, so eilig?“
„In die Stadt“, antwortete Kerstin, die inzwischen dazugekommen war. Sie faßte ihre Freundin am Ärmel. „Komm, Lara, wir müssen uns beeilen, sonst ist der Bus weg“, drängte sie.
„Ist er schon“, sagte Mikhail. „Vor zehn Minuten. Ich bin damit aus der Stadt gekommen.“
„So ein Mist“, schimpfte Kerstin und stampfte mit dem Fuß auf. „Der nächste fährt erst wieder in zwei Stunden. Was sollen wir denn jetzt machen?“
„Ich würde sagen, zurückgehen“, schlug Mikhail vor. „Oder wollt Ihr bei der Kälte zwei Stunden lang an der Haltestelle stehen?“
„Nee, ganz sicher nicht“, schnappte das Mädchen, drehte sich um und begann, den Weg wieder hinaufzusteigen.
Mikhail und Lara folgten ihr. Der Weg war gerade breit genug, daß sie nebeneinander hergehen konnten. Sie schwiegen und vermieden es, sich anzusehen.
Sie ist hübsch, dachte Mikhail, soweit man das bei der dicken Kleidung erkennen kann. Vorher war ihm das noch nie aufgefallen. Allerdings war er ihr auch noch nie so nahe gekommen wie vorhin, als sie gefallen war. Da hätte sie ihn beinahe geküßt. Unfreiwillig natürlich. Bei dem Gedanken daran mußte er unwillkürlich lachen.
„Warum lachst Du? Was ist denn so komisch“ fragte sie ihn.
„Ich mußte gerade daran denken, daß Du mir vorhin fast einen Kuß gegeben hättest.“
Sie sah ihn an, nickte und lachte ebenfalls. „Viel hat nicht gefehlt.“
Er sah sie an. „Eigentlich schade. Mir hätt’s gefallen.“
„Kaum“, widersprach sie. „Mit so viel Schwung, wie ich auf Dich draufgeknallt bin, hätt ich Dir dabei wahrscheinlich ein paar Zähne ausgeschlagen.“
„Stimmt auch wieder“, gab er zu. „Trotzdem schade.“
Sie schüttelte lachend den Kopf und wandte sich wieder von ihm ab. Den Rest des Weges legten sie wiederum schweigend zurück.
In der Halle des Internatsgebäudes gingen sie auseinander, ohne sich zu verabschieden. Die Mädchen stiegen die breite Holztreppe hinauf, und Mikhail verschwand hinter einer Tür, durch die man zur Wendeltreppe des Burgturms gelangte. Dort hinauf mußte er, denn sein Zimmer lag ganz oben in diesem Turm.
Es war eines der wenigen Einzelzimmer, über die das Internat verfügte, aber es war nicht besonders beliebt. Es war zwar recht groß und aus den Fenstern bot sich eine phantastische Aussicht, aber man mußte eben die Wendeltreppe fünf Etagen hochsteigen, um hineinzugelangen. Das war auf die Dauer recht mühsam. Außerdem hatte man keine Nachbarn, die man schnell mal treffen konnte.
Mikhail machte das nichts. Das Treppensteigen betrachtete er als Teil der Körperertüchtigung, und mit Nachbarn hätte er ohnehin nichts anfangen können. Es wollte ja niemand etwas von ihm wissen. Gerade wieder war ihm das bewußt geworden, als die beiden Mädchen einfach grußlos davongelaufen waren. Eigentlich hatte er auch nichts anderes erwartet. Aber einen kleinen Stich hatte es ihm dennoch gegeben.
Während er beim Treppensteigen darüber nachdachte, zog er die Handschuhe aus, setzte seine Mütze ab und öffnete seinen dicken Wintermantel. Ein Segen, daß seine Mutter ihm die Sachen eingepackt hatte, als er im Sommer nach Deutschland gefahren war. Damals hatte er sich darüber lustig gemacht, jetzt war er froh, daß er sie hatte. Sie waren zwar nicht besonders modern, und schick waren sie schon gar nicht, aber sie hielten ihn gut warm. Sollten andere sich darüber lustig machen. Ihn störte das nicht. Er brauchte jedenfalls nicht zu frieren.
Oben in seinem Zimmer, zog er den Mantel vollends aus und verstaute die warmen Sachen im Kleiderschrank. Dann stellte er sich vor eines der Fenster und sah hinaus. Blickte über die schneebedeckten Wälder unter ihm und in den grauen Winterhimmel. Richtung Osten. Dorthin, wo seine Heimat lag und wo seine Lieben begraben waren. Auf einmal hatte er wieder furchtbares Heimweh. Er vermißte sie so sehr. Seine Heimat, Mama und Papa und die kleine, geliebte Svetlana. Tränen strömten über sein Gesicht.
Vielleicht hätte er doch mit dem Pfarrer reden sollen. Der hätte ihm sicherlich zugehört. Andererseits, was wäre damit schon gewonnen? Ändern hätte der auch nichts können. Trotzdem, es wäre eine Gelegenheit gewesen, nach einem halben Jahr Schweigen, wieder mit einem Menschen zu reden. Ganz unverbindlich, außerhalb des Schulunterrichts, einfach so. Vielleicht würde er ihn doch gelegentlich mal ansprechen.
***
„Eigentlich ist er ja ganz nett, ‘der Ruski‘, meinte Lara, als sie und Kerstin sich in ihrem gemeinsamen Zimmer ebenfalls ihrer dicken Wintersachen entledigten.
Kerstin zuckte die Achseln. „Ich kann mit dem nix anfangen. Ein komischer Kerl ist das. Hast Du die altmodischen Klamotten gesehen, die er anhatte? So läuft doch heutzutage keiner mehr rum.“
„Aber garantiert hat er darin nicht gefroren“, hielt Lara dagegen. „Und anlächeln kann er einen trotzdem.“
Kerstin sah ihre Freundin eindringlich an. „Was soll das denn heißen? Hast Du Dich etwa in den verknallt?“
„Blödsinn!“ wehrte Lara sofort ab. „Verknallt doch nicht. Aber ich fand ihn irgendwie nett.“
Obwohl, so ganz sicher war sie sich doch nicht, ob sie ihn einfach nur ‚nett‘ fand, oder ob da nicht noch ein ganz klein bißchen mehr war. Sie hatte so ein komisches Gefühl gehabt, als er sie so angelächelt hatte und dann wieder, als er das mit dem Kuß sagte, den sie ihm beinahe gegeben hätte. Aber das wollte sie Kerstin gegenüber nicht zugeben.
„Soll ich Dir die Haare machen?“ fragte sie die Freundin stattdessen. „Jetzt, wo wir nicht in die Stadt können, haben wir ja Zeit dazu.“
Kerstin nickte und zog ihren Pullover aus. Sie gingen hinüber in das kleine Bad, das zu ihrem Zimmer gehörte.
„Was ist jetzt eigentlich mit Achim?“ fragte Lara, während sie sich mit Kerstins Haaren beschäftigte.
Kerstin zuckte mit den Achseln. „Was soll mit ihm sein? Garnix is mit ihm. Aus isses. Der war vielleicht ganz okay, aber letztlich war er doch nur darauf aus, mich ins Bett zu kriegen. Und als ich das nicht wollte, hat er Schluß gemacht.“
„Schade eigentlich. Ich fand, Ihr paßtet ganz gut zusammen.“
„Na ja, wie man’s nimmt. Soviel hatten wir uns auch wieder nicht zu sagen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, er wollte nix anderes als mich flachzulegen. Und da hatte ich echt keinen Bock drauf. Jedenfalls nicht so schnell, wie er das wollte.“