
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1345. Vor einem heftigen Gewitter suchen der Fackelträger Konrad und die Kaufmannstochter Elisabeth Zuflucht in einer Höhle nahe ihrer Heimatstadt Koblenz, obwohl deren Betreten aufgrund eines Befehls des Schultheißen von Koblenz streng verboten ist. Den Grund dafür kennen sie nicht, aber sie sollen ihn erfahren, nachdem sie bald darauf aus dem Dunkel der Höhle wieder herausfinden. Denn mit einem Mal ist nichts mehr wie es war. Sie erkennen die Gegend nicht wieder und treffen auf Menschen, deren Sprache sie nicht verstehen, die sich aber dennoch ihrer annehmen. Bald wird ihnen bewusst, dass sie in einer anderen Zeit gelandet sind. Der unerlaubte Aufenthalt in der Höhle hat sie mehr als sechshundert Jahre in die Zukunft geschleudert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ein Wort zuvor
Kapitel 1 – A. D. 1345
Kapitel 2 – A. D. 2013
Kapitel 3 – A. D. 1345
Kapitel 4 – A. D. 2013
Kapitel 5 – A. D. 1345
Kapitel 6 – A. D. 2013
Kapitel 7 – A.D. 1345
Kapitel 8 – A.D. 2013
Kapitel 9 – A.D. 2007
Kapitel 10 – A.D. 2013
Kapitel 11 – A.D. 1351
Kapitel 12 – A.D. 2013
Kapitel 13 – A.D. 1353
Kapitel 14 – A.D. 2013
Kapitel 15 – A.D. 1354
Kapitel 16 – A.D. 2013
Kapitel 17 – A.D. 1355
Kapitel 18 – A.D. 2013
Kapitel 19 – A.D. 2014
Detlef Wolf
Ein Wort zuvor
Wie immer, so ist auch diese Geschichte meiner Phantasie entsprungen.
Es gibt keinen Zusammenhang mit Personen und tatsächlichen Begebenheiten, und falls jemand doch einen solchen konstruieren kann, so habe ich das nicht beabsichtigt. Das wäre dann ein Zufall.
Das gilt auch für die Namen der Personen in dieser Geschichte. Ich habe sie gewählt, weil sie mir gefallen haben oder weil ich sie, entsprechend der Charaktere der Protagonisten, für passend hielt. Falls jemand tatsächlich so heißt, wie eine Person aus dieser Geschichte oder sich in einer solchen zu erkennen glaubt, so ist er nicht gemeint. Ganz sicher nicht.
Raesfeld-Erle, im September 2015
Detlef Wolf
Kapitel 1 – A. D. 1345
„Hab Dank für Dein Geleit.“
Giselher von Raesfeld, Ratsherr der Stadt Koblenz und Gewürzhändler, nahm ein paar Münzen aus seinem Beutel und drückte sie dem Jungen in die Hand, der ihn mit seiner Fackel den Weg vom Rathaus zu seinem prächtigen Haus in der Löhrstraße unweit des Löhrtors begleitet hatte.
Der Junge steckte hurtig die Münzen ein und bedankte sich. „Vergelt’s Gott, edler Herr.“
Er verbeugte sich vor dem Ratsherrn und machte sich auf den Rückweg. Vielleicht gab es ja noch mehr Leute, die einen Fackelträger wie ihn brauchten, um in dieser tiefschwarzen Nacht, die kein Stern erhellte, nach Hause zu finden.
Konrad, der Fackelträger, hingegen fand den Weg auch im Dunkeln, so gut kannte er sich aus in den Gassen seiner Heimatstadt Koblenz.
Lange genug versah er diesen Dienst schließlich schon, sechs Jahre immerhin, seit dem Tag, an dem seine Mutter verschwunden war.
Sie hatte als Kleidermacherin den Löwenanteil zum Einkommen der Familie beigetragen, denn der Vater war ein fauler, grobschlächtiger Nichtsnutz, der sich nur gelegentlich als Tagelöhner im Hafen verdingte und danach vielfach das wenige Geld, das er für seine Arbeit erhielt, in der nächstbesten Schenke durchbrachte.
Dann war die Mutter plötzlich nicht mehr da, sie war verschwunden, von einem Tag auf den anderen. Niemand wusste, wohin sie gegangen war. Warum sie fort war, das konnte man sich in der Nachbarschaft schon vorstellen. Jeder hier kannte Ruprecht Merseburger und wusste, wie gewalttätig er gegen seine Frau und seine drei Kinder werden konnte, wenn er getrunken hatte. Und betrunken war er oft.
Kein Wunder also, dass sie es irgendwann nicht mehr ausgehalten hatte und einfach davongelaufen war. Obwohl man eigentlich niemals von ihr gedacht hätte, dass sie es fertigbringen würde, ihre drei Kinder, von denen das Jüngste noch ein Säugling war, im Stich zu lassen. Ruprecht musste ihr schon sehr zugesetzt haben, um sie so weit zu treiben.
Zum Glück für Ruprecht, vor allem aber seine drei Kinder, gab es Sieglinde, seine ältere Schwester, die verwitwete Frau des Bäckermeisters Godebrecht. Die war zwar eine streitsüchtige, unleidliche Person, aber sie hatte ein großes Haus, in dem sie sechs Kinder großgezogen hatte.
Bis auf den Ältesten, Heinrich, der inzwischen das Geschäft seines Vaters weiterführte, waren sie allesamt ausgezogen und lebten mit ihren Familien im weiten Umkreis von Koblenz verstreut.
Sieglinde war alles andere als begeistert, ihren trunksüchtigen Tunichtgut von Bruder und seine Brut bei sich aufnehmen zum müssen, aber was blieb ihr anderes übrig? Die vermeintliche christliche Nächstenliebe und Barmherzigkeit den anderen gegenüber, allemal wenn sie aus derselben Familie stammten, gebot es nun einmal. Denn selbst versorgen konnte Ruprecht seine Kinder nicht. Konrad vielleicht, der war inzwischen neun Jahre alt, mit dem wäre er zurechtgekommen. Nicht aber mit der kleinen Gertrude, die schon immer etwas kränklich gewesen war, und mit Johann, dem Säugling.
Also zogen die vier Merseburgers wenige Tage nach dem Verschwinden der Mutter in das Haus der Bäckerin um.
Sieglinde allerdings war weit davon entfernt, ihrer Verwandtschaft ein kostenloses Obdach zu gewähren. Energisch trieb sie Ruprecht zum Arbeiten an, und auch der junge Konrad musste sich am Broterwerb beteiligen. Alsbald brachte sie ihren Sohn Heinrich dazu, sich das Haus der Merseburgers überschreiben zu lassen, damit es verkauft werden und sie den Erlös einkassieren konnte, als Kostgeld und Mietzins für die vier Merseburgers unter ihrem Dach.
Konrad folgte dem Gebot seiner Muhme und suchte sich eine Beschäftigung. Er wurde Fackelträger, denn keiner der Handwerker in Koblenz wollte ihn als Lehrling einstellen, schon gar nicht, wenn Vater oder Tante nicht bereit oder nicht in der Lage waren, das Lehrgeld zu bezahlen, das üblicherweise fällig war. Außerdem hielten sie Konrad für viel zu schmächtig. Der Junge musste ja erst einmal aufgepäppelt werden, bevor er zum Arbeiten taugte und sich somit sein Essen verdienen konnte.
Sieglinde kam es jedenfalls gerade recht, dass Konrad eine Tätigkeit gefunden hatte, die ihn in der Nacht beschäftigte. So konnte er tagsüber seine kleineren Geschwister hüten, in der Zeit, die sie selbst in der Bäckerei mithalf.
Das einzige Zugeständnis, das die Bäckerswitwe Konrad machte, war die Erlaubnis, die Lateinschule der Kartäuser auf dem Beatusberg zu besuchen. Auf die hatte ihn seine Mutter schon geschickt, seit er sechs Jahre alt geworden war. An drei Vormittagen in der Woche gestattete Sieglinde ihm nun, auf den Beatusberg zu den Kartäusern hinaufzusteigen. Ganz selbstlos war allerdings auch das nicht, bekam doch der Junge, der immer einen guten Appetit hatte, an den Schultagen auch gleich eine warme Mahlzeit im Kloster. Drei Mahlzeiten in der Woche, für die sie nicht aufkommen musste.
Oft war Konrad hundemüde, wenn er, nachdem er fast die ganze Nacht hindurch mit seiner Fackel die Leute durch das nächtlich dunkle Koblenz begleitet hatte, am frühen Morgen zur Frühmesse ins Kloster ging.
Denn der Besuch der Frühmesse war für die Schüler der Lateinschule obligatorisch. Zur Prim hatte man da zu sein und durfte danach mit den Mönchen das karge Frühstück im Refektorium einnehmen, bevor der Unterricht begann, der zur Sext, nach dem Angelusläuten mit dem Mittagsgebet endete. Danach gab es das Mittagessen.
Trotz der Mühe, die es machte, ging Konrad gerne zur Schule, und er war ein guter Schüler. Denn er war schlau, was nicht sein Verdienst war, und er war fleißig, wofür er sehr wohl etwas konnte. Es war nicht immer einfach, Papier und Tinte zu besorgen, wenn er etwas aufschreiben wollte, aber meistens schaffte er es irgendwie. Das meiste allerdings schrieb er auf sein Wachstäfelchen und wischte es wieder weg, wenn der Platz zu knapp wurde. Aber manches Geschriebene wollte er auch länger aufbewahren, und dafür brauchte man eben Papier, Federkiel und Tinte.
Die beschriebenen Blätter verwahrte er in der Truhe, die er von zu Hause mitgebracht und in der die Mutter einst ihre Nähsachen untergebracht hatte. Jetzt stand die Truhe in der kleinen, zugigen Kammer unter dem Dach, die ihm die Tante zugewiesen hatte. Diese und eine weitere Truhe, in der er seine Kleidung aufbewahrte, bildeten die einzigen Möbelstücke in dieser Kammer. Schlafen musste er auf einem Strohsack. Zum Schreiben setzte er sich auf die eine und legte das Papier auf die andere Truhe. Es war mühsam und unbequem, da die beiden Truhen beinahe die gleiche Höhe hatten. Allemal im Winter, weil die Kammer nicht beheizt werden konnte. Aber das machte ihm nichts aus. Wenn er nur überhaupt schreiben konnte.
Oft kam das allerdings nicht vor, denn viel Zeit hatte er nicht. Schließlich musste er sich tagsüber um seine kleinen Geschwister kümmern und, wann immer sich die Gelegenheit bot, auch einmal schlafen. Denn sobald es dunkel wurde, zog er mit seiner Fackel los, immer auf der Suche nach Leuten, denen er mit seinem Licht den Heimweg zeigen konnte.
***
Konrad machte sich auf den Weg zum Markt. Zu dieser Stunde würde es dort sicherlich noch einige geben, die auf seine Dienste angewiesen waren. Angesichts des morgigen Markttages waren viele Fremde in der Stadt, da würde er gut zu tun haben.
Aber wider Erwarten war es ruhig auf dem Marktplatz. Also ging er weiter zum Frauenhaus. Das tat er ungerne, denn die Besucher dieses Hauses waren in der Regel ziemlich ungehobelte Gesellen, geizig zumindest, die ihm nicht selten seinen Dienst mit ein paar Hieben statt mit klingender Münze vergolten, wenn sie nach dem Besuch der aufreizenden Weiber und dem Genuss von zu viel Branntwein wieder herauskamen.
Tatsächlich brauchte er nicht lange zu warten, bis jemand aus dem Haus kam. Konrad bemerkte sofort, dass der Mann angetrunken war, aber er konnte sich einigermaßen auf den Beinen halten und machte auch sonst einen eher friedfertigen Eindruck.
„Braucht Ihr ein Licht für den Heimweg, mein Herr?“, fragte er den Mann.
Der schien ihn bislang nicht bemerkt zu haben. Sein bisher eher finsterer Blick hellte sich auf.
„Kennst Du das Gasthaus am Rhein, in der Nähe von Sankt Kastor?“, fragte er.
Konrad nickte. „Ja, das ist mir bekannt, mein Herr.“
„Gut, dahin will ich.“
„Dann folgt mir, bitte.“
Konrad ging voraus und hielt sein Licht so, dass der Mann keine Mühe hatte, seinen Weg zu finden und Hindernissen auszuweichen.
„Morgen ist Gerichtstag“, meinte der Mann, nachdem sie ein paar Schritte gegangen waren. „Der Vogt des Erzbischofs ist in Koblenz.
Gestern ist er angekommen.“
„Ja, das ist mir bekannt“, antwortete Konrad.
„Ein Räuber und Mörder wird unter das Rad kommen. Ich werde hingehen. Einen Tag bin ich deshalb länger in Koblenz geblieben. Ein solches Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen. Du wirst doch sicher auch hingehen?“
Konrad schüttelte den Kopf. „Nein. Ich werde in der Schule sein, wenn es geschieht.“
„Das ist bedauerlich. Da entgeht Dir etwas.“
Unterdessen hatten sie das Wirtshaus erreicht. Das enthob Konrad einer weiteren Antwort. Er war froh darüber, denn es war ihm unbehaglich zumute bei diesem Thema. Aus einem guten Grund.
Der Mann gab Konrad ein paar kleine Münzen, die er lose in einer Tasche seines Beinkleides bei sich trug. Wie bei jedem bedankte sich Konrad mit einer kleinen Verbeugung und einem „Vergelt’s Gott“. Dann drehte er sich um und verschwand in der Nacht.
***
In der Frühmesse war Konrad nicht bei der Sache. Immerzu musste er an das denken, was sich am Mittag auf dem Richtplatz abspielen würde. Es nahm ihn so sehr mit, dass er nicht einmal sein Frühstück anrührte. Wenigstens würde es ihm erspart bleiben, das grausige Schauspiel mit ansehen zu müssen.
Aber er hatte sich getäuscht.
Die Kartäuser Mönchsbrüder hatten sich entschlossen, Pater Remigius, einen der ihren, der ausgewählt worden war, dem Verurteilten in seiner letzten Stunde beizustehen, zur Hinrichtungsstätte zu begleiten. Die Schüler der Lateinschule nahmen sie mit. Ausschließen durfte sich keiner.
Konrad war leichenblass, als er in dem kleinen Trupp seiner Mitschüler vom Kloster auf dem Beatusberg zum Richtplatz hinunterging. Eine große Menschenmenge hatte sich bereits versammelt und noch immer strömten die Leute in Scharen durch das weit geöffnete Stadttor hinaus.
Besonders viele waren es heute, denn es war Markttag, und viele von außerhalb hielten sich in der Stadt auf.
Ein Platz war freigehalten worden für Pater Remigius und die Kartäusermönche. Dorthin begaben sie sich. Konrad sah zu, in die letzte Reihe zu kommen, um möglichst weit weg vom Geschehen zu sein. Bereitwillig wurde ihm das gewährt, denn alle anderen drängten möglichst weit nach vorne, um ja nichts zu verpassen.
Man hatte ein Schafott aufgebaut, auf dem der Verurteilte zu Tode gebracht werden würde und auf dem auch der Vogt in seinem Richterstuhl Platz nehmen würde.
Da kam er auch schon. In seiner Kutsche, verziert mit dem Wappen des Erzbischofs und Kurfürsten von Trier, gezogen von zwei prächtigen Schimmeln. Die Kutsche hielt vor dem Schafott an, der Vogt, ein kleiner, rundlicher Mann, arbeitete sich mühsam heraus, stieg die Stufen empor und ließ sich ächzend in seinem Richterstuhl nieder.
Kurz darauf folgte ein weiteres Gefährt, ebenfalls von zwei Pferden gezogen. Darauf befand sich der Verurteilte, in Ketten gelegt, die am hölzernen Aufbau des Wagens befestigt waren, und vier Büttel, die benötigt wurden, um den kräftigen Mann zu bändigen.
Der Mann war Ruprecht Merseburger, Konrads Vater.
Muhme Sieglinde hatte Konrad gesagt, wessen der Vater sich schuldig gemacht hatte. Mit Abscheu in der Stimme hatte sie ihm berichtet, wie er eines Abends ins Frauenhaus gegangen war, um sich dort zu vergnügen. Als es ans Bezahlen ging, wollte er der Frau, der er beigewohnt hatte, den Lohn schuldig bleiben. Zu schlecht sei das gewesen, was sie geleistet habe. Statt sie zu bezahlen, hatte er ihr Gewalt angetan und sie dann erwürgt, nachdem er ein zweites Mal seinen Trieb befriedigt hatte.
Noch in derselben Nacht hatten sie ihn geholt.
Vier Mann waren nötig gewesen, ihn zu binden und abzuführen. Mit der Kraft eines Verzweifelten hatte er sich gewehrt. Denn er wusste, was ihn erwartete. Auf Räuberei, Notzucht und Mord stand der Tod durch das Rad.
Heute nun war es soweit. An diesem Tag sollte das Urteil vollstreckt werden.
Die Büttel lösten die Ketten vom Wagen und stießen Ruprecht hinunter. Wie ein Klotz fiel er zu Boden, denn seine Hände und Füße waren eng aneinander gekettet, so dass er den Sturz nicht abfangen konnte.
Dann schleiften sie ihn hoch auf das Schafott, warfen ihn auf den Boden und ketteten seine Hände und Füße an vier kräftige Holzpfähle, die aus dem Boden herausragten und so weit auseinanderstanden, dass Arme und Beine weit gespreizt waren. Unmöglich war es nun für ihn, sich noch zu rühren.
Während zwei der Büttel dem Todgeweihten die Kleider vom Leib rissen, holten die anderen beiden das große, eisenbeschlagene Rad mit den sechs Speichen, mit dem ihm die Knochen zerschlagen werden sollten.
Als er es sah, begann er vor Entsetzen zu schreien.
Der Vogt erhob sich und streckte die Hand aus. Der Lärm, den die Zuschauer machten, die inzwischen den weiten Platz zur Gänze gefüllt hatten, ebbte ab. Mit ein paar kräftigen Fußtritten stoppte einer der Büttel das Geschrei des Verurteilten.
Man reichte dem Vogt eine Papierrolle, die dieser langsam und feierlich entrollte.
„Ruprecht Merseburger“, begann der Vogt mit lauter Stimme, „Du bist angeklagt und für schuldig befunden worden der todeswürdigen Verbrechen der Notzucht, der Räuberei und des Mordes an der Dirne Irmtraut Kohlhas. Im Namen und Auftrag Balduins, des ehrwürdigsten Kurfürsten und Erzbischofs von Trier bist Du daher verurteilt zum Tode durch das Rad. So groß ist Deine Schuld, dass man mit der Prozedur von unten nach oben beginnen soll. Danach wirst Du auf das Rad geflochten, das, hoch aufgerichtet, an diesem Ort verbleiben möge, bis die Vögel des Himmels, der Wind und das Wetter, Deinen verdammten Leib vollends zunichtegemacht haben.“
Der Vogt rollte das Pergament wieder ein und setzte sich auf seinen Stuhl.
„Man möge beginnen“, sagte er, an die Büttel gewandt.
Auf dieses Wort hin stieg Pater Remigius die Stufen zum Schafott hinauf und nahm an der Seite des Richterstuhls Aufstellung.
Als zwei der Büttel nach dem Rad griffen, begann er zu beten: „Pater noster, tu es in Coelis …“
Aber sein Gebet ging im Gebrüll des Verurteilten unter, der wieder zu schreien begonnen hatte, sobald die Büttel das Rad anhoben, um es auf Ruprecht Merseburgers rechten Unterschenkel herabfallen zu lassen.
Der Schrei, den er ausstieß, als das schwere Rad die Knochen seines Unterschenkels zerbrach, schien aus keiner menschlichen Kehle zu kommen.
Konrad hatte sich hinter seinen Mitschülern verborgen, um nicht mitansehen zu müssen, was seinem Vater da widerfuhr. Den entsetzlichen Schmerzensschreien konnte er allerdings nicht entkommen.
Während die Büttel das Rad wieder aufnahmen, sank er zu Boden.
***
Am frühen Nachmittag war es vorbei.
Ruprecht Merseburger hatte seine gerechte Strafe erhalten. Bereits, als man seine gebrochenen Glieder durch die Speichen des Rades flocht, lebte er nicht mehr.
Nachdem die Büttel das Rad mit dem Leichnam darauf aufgerichtet hatten, zerstreute sich die Menge.
Konrad blieb allein zurück, unfähig, sich zu rühren.
Jetzt hatte er also auch keinen Vater mehr. Nicht, dass er ihn nötig gebraucht hätte, hatte sich dieser doch Zeit seines Lebens kaum um ihn und seine jüngeren Geschwister gekümmert. Aber es war ein Makel, ohne Eltern zu sein, umso mehr durch die Schande, die der Vater mit seinem abscheulichen Verbrechen über die Familie gebracht hatte.
„Konrad, der Sohn des Räubers und Mörders Ruprecht Merseburger, den sie aufs Rad geflochten hatten“, würde man ihn nennen. Und es war zweifelhaft, ob sich ein achtbarer Bürger noch von so einem des Nachts die Fackel tragen lassen wollte.
Als die Sonne bereits tief im Westen stand, gelang es ihm endlich, sich aufzurappeln und nach Hause zu gehen.
Seine Muhme würdigte ihn keines Blickes, als er das Haus betrat, noch richtete sie das Wort an ihn. Jetzt nicht und auch später nicht, als sich alle um den großen Tisch versammelt hatten, um das Nachtmahl einzunehmen. Wieder vermochte Konrad kaum etwas zu essen. Ebenso wenig wie die jüngeren Geschwister es konnten. Still saßen sie auf ihren Stühlen, Gertrude, die inzwischen elf Jahre alt war und die in der Bäckerei ihres Cousins und ihrer Muhme arbeitete und die immer noch etwas kränklich war, und der sechsjährige Johann, der Liebling der Schwiegertochter der Tante.
Zu gerne hätte sich Konrad an diesem Abend in seiner Kammer verkrochen. Er fühlte sich elend und wollte niemanden sehen und auch mit niemandem reden. Trotzdem ging er wieder hinaus, sobald es dunkel geworden war. Es half ja nichts, er musste sein Scherflein zum Unterhalt der Familie beitragen. Auch hätte es ihm die Muhme niemals gestattet, seiner Arbeit fernzubleiben.
Zum Glück bekam er reichlich zu tun. Noch immer waren ja viele Fremde in der Stadt, die ihn nicht kannten und die ihm daher nichts nachzusagen wussten. Morgen würde das anders sein, denn morgen waren sie alle wieder weg und die Koblenzer unter sich. Von denen wusste fast jeder, wer er war.
Sie kannten ihn und sie mochten ihn. Konrad Merseburger war eine ehrliche Haut, freundlich, höflich, anstellig und arbeitsam, auch wenn ihm die Mutter davongelaufen war und der Vater das genaue Gegenteil dieser Eigenschaften verkörperte.
Jetzt schien das nicht mehr zu zählen.
Konrads Befürchtungen bestätigten sich nur zu bald. Niemand von denen, die in der Stadt lebten, wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben.
Alle wandten sich von ihm ab. Nur Fremden konnte er sich noch andienen und das auch nur so lange, bis sie erfahren hatten, um wen es sich bei Konrad, dem Fackelträger, handelte.
Seine Verzweiflung wuchs von Tag zu Tag. Er brachte kaum noch Geld nach Hause, was seine Muhme Sieglinde gegen ihn aufbrachte, die ihm schon damit gedroht hatte, ihn auf die Straße zu setzen, sollte er nicht endlich seinen Beitrag leisten, wie sie das von ihm gewohnt war und was sie für das Mindeste hielt, um sich Kost und Obdach in ihrem Haus zu verdienen.
Noch schlimmer als das aber war die Verachtung, die ihm überall in der Stadt entgegenschlug.
Aus der Schule hatte man ihn hinausgeworfen, nachdem viele sich beschwert hatten, dass ihre Söhne mit ‚so einem‘ zusammen dem Unterricht folgen mussten. Überhaupt, wozu sollte ‚so einer’ sich im Lesen und Schreiben und den anderen Künsten üben? Pah, der Sohn eines Mörders, was sollte aus dem schon werden?
Auch mit dem fröhlichen, freundlichen Plausch der Fackelträger, wenn sie sich nächtens zwischen ihren Gängen auf dem Marktplatz trafen, war es vorbei. Für Konrad jedenfalls. Sobald die anderen ihn sahen, wandten sie sich ab und gingen davon. Ob sie sich stattdessen anderswo wiedertrafen, wusste er nicht. Und er suchte auch nicht nach ihnen, weil er wusste, dass es wieder so sein würde.
Zusehends verlor Konrad an Gewicht und Kraft. Denn die Mahlzeiten, die er bislang im Kloster der Kartäuser einnehmen konnte, wurden durch solche im Haus der Bäckerswitwe nicht ersetzt. Allemal, da er jetzt noch weniger Lohn nach Hause brachte als zuvor, hielt sie es für ihr gutes Recht, ihm dieses zusätzliche Essen zu verweigern.
Es stand schlimm um Konrad, den Fackelträger.
Kapitel 2 – A. D. 2013
Das Flugzeug war pünktlich gelandet. Beate und Lukas warteten geduldig, bis sie mit dem Aussteigen an der Reihe waren. Das hatte gedauert, aber jetzt war es endlich soweit. Mühsam quälten sie sich aus den engen Sitzen und nahmen das Handgepäck aus den Ablagefächern. Das war so umfangreich wie es gerade noch sein durfte. Sie hatten alles hineingestopft, was sie für ihren zweiwöchigen Campingurlaub an der kroatischen Küste brauchten. Viel war das nicht, denn der Wohnwagen, den sie dort gemietet hatten, war komplett ausgestattet, und zum Anziehen brauchten sie ebenfalls kaum etwas. Also konnten sie sich einen Koffer sparen, der nur zusätzliches Geld gekostet hätte, wollten sie ihn im Flugzeug mitnehmen.
Überhaupt waren sie einigermaßen billig davongekommen. Der Flug mit einer Billigairline, der Campingplatz und die Verpflegung, um die sie sich meistens selbst kümmerten, hatte ihre knapp bemessene Reisekasse nicht allzu sehr belastet. Klar, sie hätten’s auch wesentlich bequemer haben können. Wenn sie mit den Eltern in den Urlaub gefahren wären. Aber das wollten sie nicht. Erstens waren sie mit ihren achtzehn und neunzehn Jahren längst aus dem Alter heraus, gemeinsam mit den Eltern Ferien zu machen, und zum zweiten hätte das geheißen, den Urlaub getrennt voneinander zu verbringen.
Letzteres hatte schließlich den Ausschlag gegeben.
Es war ihr erster gemeinsamer Sommerurlaub, denn kennen gelernt hatten sie sich erst im letzten Herbst, zu Beginn des Wintersemesters.
Beide studierten sie in Aachen. Lukas Maschinenbau an der Technischen Hochschule und Beate Germanistik auf Lehramt. Bei einer Informationsveranstaltung für die Erstsemester waren sie sich zum ersten Mal begegnet. Zufällig. Im Hörsaal gab es zwei freie Plätze nebeneinander.
Weil die Einführungsveranstaltung langweilig war – das meiste, das dort erzählt wurde, kannten sie schon –, waren sie miteinander ins Gespräch gekommen. Und weil sie sehr schnell feststellten, dass sie sich allerhand zu erzählen hatten, entschlossen sie sich, nach der Veranstaltung ihr Gespräch in einer Pizzeria in der Innenstadt fortzusetzen. Und weil das immer noch nicht genug war, entschlossen sie sich nach dem Essen, sich erneut zu verabreden.
Wann? – Keine Ahnung. Sie tauschten ihre Handynummern aus und versprachen, sich irgendwie für irgendwo und irgendwann zusammenzutelefonieren.
Lange hatte das nicht gedauert, denn schon am nächsten Tag trafen sie sich wieder. Im ‚Café zum Mohren‘ diesmal, gleich in der Nähe des Doms. Ob der Kuchen dort gut war, vermochten sie hinterher nicht mehr zu sagen, der Kaffee war jedenfalls am Ende kalt geworden, so vieles gab es, über das sie auch diesmal reden konnten.
Das änderte sich auch nicht, nachdem sie sich noch viele Male getroffen und sich dabei viele Stunden miteinander unterhalten hatten. Wobei diese Treffen keineswegs immer in irgendwelchen Cafés oder Pizzerien stattfanden. Das gab ihr begrenztes Studentenbudget einfach nicht her.
Schließlich brauchte man zum Reden ja auch nicht unbedingt in einem Café oder einer Kneipe zu sitzen. Jedenfalls nicht immer. Oft tat es auch die Mensa oder der Stadtpark, der zudem den Vorteil hatte, dass man miteinander durch die frische Luft laufen konnte.
Anfangs taten sie das, locker nebeneinander her schlendernd, später dann Hand in Hand. Dass das Wetter, der Jahreszeit entsprechend, oftmals eher schmuddelig als gut war, störte sie nicht. Dafür gab es warme Kleidung. Und die wiederum hinderte sie nicht daran, sich nach einiger Zeit, die sie nun schon mit Reden verbracht hatten, zum ersten Mal zu küssen. Mitten auf der Wiese vor dem großen Springbrunnen, östlich des Kurhauses. Der war zwar jetzt abgestellt und konnte sie daher nicht mehr mit seinem Rauschen betören, aber das machte nichts. Das Rauschen in ihren Ohren, das sie empfanden, als sie sich umarmten und sich ihre Lippen das erste Mal fanden, genügte ihnen vollkommen.
Über Weihnachten hatten sie dann ihre Eltern überredet, ihnen statt der beiden einzelnen Zimmer in zwei verschiedenen und zu allem Überfluss auch noch weit auseinanderliegenden Studentenwohnheimen, eine gemeinsame Wohnung zu mieten. Die Kosten seien ja die gleichen, hatten sie argumentiert und so spare man sich aber die viele Zeit, die das lästige Hin- und Herfahren durch die Stadt koste, wenn man sich gelegentlich sehen wolle. Also gelegentlich, täglich, sollte das heißen. Denn es sei doch erstaunlich, wieviel man sich zu sagen habe.
Augenzwinkernd hatten beide Elternpaare zugestimmt, und schon zum Ende des Wintersemesters konnten sie umziehen. In eine sechsundsiebzig Quadratmeter große Wohnung in der Nähe der Frankenburg.
Das war nun nicht gerade sooo zentral, so dass die Aachener Verkehrsbetriebe durch das Unterbleiben der beiderseitigen Pendelei keine allzu großen Verluste hinnehmen mussten, aber dafür war es eine Neubauwohnung mit Balkon und Tiefgarage. Neben dem Wohnzimmer und der gut ausgestatteten Küche, die sie beide gemeinsam nutzen wollten, gab es für jeden noch ein weiteres Zimmer, in dem sie sich, ganz individuell, ihrem Studium und dem Schlafen widmen konnten. Gegenseitige Besuche nicht ausgeschlossen. Auch nicht nach zweiundzwanzig Uhr.
Allerdings, wie schon zuvor die zeitraubende Fahrerei durch die Stadt, wurde es ihnen alsbald auch mit den Besuchen in ihren jeweiligen Zimmern zu lästig, zumal es in einem Einzelbett ziemlich eng zuging, wenn man dort einen Übernachtungsgast beherbergen wollte. Selbst dann, wenn man sich mochte. Sogar, wenn man sich sehr mochte.
Also beschlossen Beate und Lukas, ihre individuellen Studier- und Schlaf-Kombizimmer aufzugeben und diese in ein gemeinsames Schlaf- und ein gemeinsames Studierzimmer umzufunktionieren. Seitdem besuchten sich die beiden nicht mehr. Das hielten sie nicht mehr für nötig, denn sie waren ja ohnehin immer zusammen.
Und weil sie das auch bleiben wollten, entschlossen sie sich weiterhin, in dem nun kommenden Sommer gemeinsam in den Urlaub zu fahren.
Nach Kroatien. Dort war es schön und sonnig und preiswert, und eine Badehose brauchte man dort auch nicht. Eigentlich überhaupt keine Kleidung, wenn man das denn so wollte.
Beate und Lukas wollten. In ihrer Wohnung brauchten sie ja auch keine.
Die meiste Zeit über jedenfalls nicht. Sie hatten sich das so angewöhnt.
Genauso wie die gegenseitige Besucherei wurde ihnen auch recht schnell die gegenseitige An- und Auszieherei zu lästig. Das kostete nur Zeit, die man anders besser nutzen konnte. Zum Studieren beispielsweise. Schließlich war das ja ihre vornehmste Aufgabe. Einschließlich des gegenseitigen Studierens. Das allerdings fand vornehmlich in der vorlesungsfreien Zeit statt. Aber auch in den Semesterferien. Und so wie die Dinge lagen, würde sich dieses Studium über viele Semester hinziehen.
Vorerst jedoch war es erst einmal Frühling geworden, und als die beiden bei einem Spaziergang auf der Wiese vor dem Springbrunnen, östlich des Kurhauses, ihren ersten Kuss wiederholten – aus einer romantischsentimentalen Anwandlung heraus – war ihnen, diesmal begleitet vom Rauschen der wieder eingeschalteten Wasserfontäne, die Idee mit dem Kroatienurlaub gekommen.
Der unmittelbar darauf vorgenommene Kassensturz betätigte ihnen, dass es bei dieser Idee nicht bleiben musste, sondern dass diese auch durchaus umsetzbar war. Herausgefunden, wohin sie wollten, hatten sie schnell. Ganz altmodisch buchten sie daraufhin ihren Mietcaravan in einem Reisebüro, nicht ohne der Chefin dieses Etablissements noch ein wunderbar kitschiges Kroatienposter abzuschwatzen, das sie dann zu Hause auf die Innenseite der Schlafzimmertür klebten. Dieserart wurden sie jedes Mal gleich nach dem Aufwachen daran erinnert, dass ihnen noch etwas Schönes bevorstand, was die Vorfreude darauf nicht unerheblich vergrößerte und immer wieder aufs Neue anstachelte.
***
Nun war der Urlaub allerdings vorbei, und sie standen beide wieder auf heimischem Boden. Gut gelaunt, gut erholt und nahtlos gebräunt. Und das Wetter, in das sie kamen, nachdem sie das Flugzeug verlassen hatten, sah ganz danach aus, als ob sich das auch nicht so schnell ändern würde. Jedenfalls war es jetzt, um Viertel nach neun am Vormittag, schon ganz schön muckelig warm, selbst auf den rauen Höhen des Hunsrücks.
Sie ignorierten das Gedränge rund um das Gepäckband und machten sich mit ihren Rucksäcken, die sie inzwischen aufgeschnallt hatten, auf den Weg zum Parkplatz für Langzeitparker, auf dem sie ihr Auto abgestellt hatten. Das war Lukas’ ganzer Stolz. Ein Golf TDI. Zwar nicht mehr so ganz taufrisch, aber dafür mit allerhand unter der Haube. Und mit seinen Initialen und seinem Geburtstag auf dem Nummernschild:
„LK 77“, Lukas Kramer, geboren am siebten Juli.
Den Tag hatten sie während ihrer Ferien gefeiert. Mit einer Riesen-Fete.
Zwar nahmen daran nur zwei Personen teil, aber auch so war es ein aufregendes Fest gewesen. Die ganze Nacht hatte es gedauert. Lukas grinste, als er daran dachte.
„Was ist, warum grinst Du so?“, fragte Beate dann auch sofort. Denn natürlich war ihr das nicht entgangen.
„Och, nur so“, meinte Lukas achselzuckend.
„Das glaub ich Dir nicht.“
Immer noch grinsend wies Lukas auf das Autokennzeichen. „Ich musste nur gerade an meinen Geburtstag denken. Und an Dein Geburtstagsgeschenk.“
„Wieso? Ich hab Dir doch gar nichts geschenkt.“ Beate sah ihn irritiert an.
Sein Grinsen verbreiterte sich. „Doch, Dich“, antwortete er.
Scheinbar empört knuffte sie ihn in die Seite. „Och, Du!“
Lachend brachte er sich vor ihr in Sicherheit.
„Jetzt komm, und schließ die Karre auf, damit wir endlich loskommen“, verlangte sie.
Lukas tat ihr den Gefallen.
Als er den Kofferraum öffnete, entdeckte er das kleine Zelt, das er seit ewigen Zeiten da drin liegen hatte und spazieren fuhr.
„Was hältst Du davon, wenn wir heute noch nicht gleich nach Hause fahren, sondern runter zum Rhein, da ein bisschen herumtrödeln, irgendwo über Nacht zelten und dann morgen erst zurückfahren? So als Urlaubsabschluss sozusagen.“ Er sah hinauf in den wolkenlos blauen Himmel. „So’n Wetter hier, das muss man doch ausnutzen, oder meinst Du nicht?“
„Hab nix dagegen“, stimmte Beate zu. „Aber zelten nicht nochmal auf’m Campingplatz. Davon hab ich erstmal die Nase voll“, schränkte sie ein.
„Müssen wir ja nicht. Meinetwegen schlagen wir uns irgendwo in die Pampa, wo uns keiner stört und hauen uns da in die Sonne.“
Jetzt war es an Beate, zu grinsen. „Hauen uns in die Sonne, wo uns keiner stört“, echote sie. „Ich hab so das Gefühl, Du willst nochmal Geburtstag feiern, was?“
Er stupste sie auf die Nasenspitze. „Wie hast Du das nur erraten, mein Schatz?“
Kopfschüttelnd warf sie ihren Rucksack in den Kofferraum und nahm auf dem Beifahrersitz Platz.
***
Aber dann nahmen sie doch die B327, die ‚Hunsrückhöhenstraße‘, die quer durch den Hunsrück bis hinunter nach Koblenz führt.
Ein Stück oberhalb von Koblenz bog Lukas nach links in einen Waldweg ein. Das war zwar offensichtlich nicht erlaubt, denn eine abgebrochene Schranke, die wohl eigentlich den Weg für Autofahrer hätte versperren sollen, lag gleich neben der Einmündung im Graben, aber Lukas störte sich nicht daran. Die hölzerne, ehemals rot-weiß angestrichene Schranke war schon so vermodert, dass er nicht daran glaubte, das gute Stück erneuert und wegversperrend angebracht vorzufinden, wenn er morgen wieder aus dem Wald hinausfahren wollte.
Nach einem guten Kilometer war der für Autos befahrbare Weg zu Ende. Lukas hielt an und stieg aus. Beate folgte ihm. Skeptisch sah sie sich um.
„Na, so richtig sonnig ist das aber nicht hier, mitten im Wald“, meinte sie.
„Nee, das ist es wirklich nicht“, gab Lukas zu, der sich ebenfalls umgesehen hatte. „Aber das macht nichts. Wir lassen die Karre hier steh’n und suchen uns irgendwo ‘ne sonnige Lichtung, wo wir unser Zelt aufbauen können.“
Eine gute halbe Stunde später war alles erledigt. Eine schöne, abgelegene Lichtung war gefunden, das Zelt aufgebaut und alles, was sie sonst noch benötigten, aus dem Auto herbeigeschafft. Dann taten sie, was sie sich vorgenommen hatten. Sie breiteten eine Decke aus, die Lukas ebenfalls noch im Kofferraum seines Autos entdeckt hatte, zogen sich aus, rieben sich gegenseitig den Sonnenschutz auf die nackte Haut und streckten sich auf der Decke aus.
Eine Weile dösten sie still vor sich hin, bis Lukas nach Beates Hand griff.
„Krieg ich jetzt mein Geburtstagsgeschenk?“, fragte er leise.
Beate sah ihn lächelnd an und nickte.
So verbrachten sie den Tag. Immer mal wieder unterbrachen sie ihr Sonnenbad, damit Lukas sich sein Geburtstagsgeschenk abholen konnte und regelmäßig gab er es seiner Freundin kurz darauf wieder zurück. Seinetwegen hätte das ewig so weitergehen können.
Dass es am Ende dann doch nicht dazu kam, lag allerdings nicht an Beate, sondern am Wetter, das nachmittags plötzlich nicht mehr mitspielte. Es war ihnen beim eifrigen Austauschen der Geburtstagsgeschenke nämlich völlig entgangen, dass der Himmel längst nicht mehr so blau war wie am Morgen, als sie vom Flugplatz in Hahn losgefahren waren. Erst als die Wolken so dick wurden, dass es sich um sie herum verdunkelte und der Himmel eine schwefelgelbe Farbe angenommen hatte, fiel es ihnen auf.
„Schätze, da braut sich ganz schön was zusammen“, meinte Lukas mit einem kritischen Blick nach oben.
Indem er das sagte, zuckte schon der erste Blitz nieder. Sekunden später folgte der Donner.
Beate erschrak. „Und was machen wir jetzt?“
Sie mochte Gewitter nicht sonderlich, und jetzt, völlig nackt auf einer abgelegenen Waldlichtung, hatte sie sogar richtig Angst davor.
„Gar nix“, antwortete Lukas gleichmütig. „Wir verkriechen uns in unser Zelt und warten ab, bis es sich ausgewittert hat. Zum Weglaufen ist es jetzt sowieso zu spät.“
Er hatte Recht, denn schon spürten sie die ersten Regentropfen auf ihrer Haut. Eilig rafften sie die Decke zusammen und verkrochen sich in dem kleinen Zelt. Zum Glück hielt es dem Unwetter stand, denn Lukas hatte es ordentlich festgezurrt, so dass der Wind es nicht davonblasen konnte. Obwohl es ziemlich hefig wehte und wie aus Kübeln goss. Die Blitze konnten sie nicht sehen, da das Zelt aus blickdichtem Material bestand, aber die Donnerschläge hörten sie in immer kürzeren Abständen. Die ganze Zeit hielt Lukas seine vor Angst und Kälte zitternde Freundin fest in seinen Armen. Und auch ihm war etwas mulmig zumute. Dass das Unwetter so heftig werden würde, hätte er nicht gedacht.
Mehr als eine Stunde dauerte es, bis das Donnern schließlich leiser wurde und der heftige Regen, der lautstark auf das Zelt niederprasselte, allmählich nachließ. Eine weitere halbe Stunde ließen sie vergehen, bevor sie es wagten, den Reißverschluss, mit dem das Zelt verschlossen war, vorsichtig zu öffnen und den Kopf hinauszustrecken.
Von dem anfangs so schönen Sommertag war nichts mehr übriggeblieben. Immer noch war der Himmel mit dunklen Wolken verhangen, und dichte Nebelschwaden lagen über der Lichtung. Kaum, dass man die Büsche und Bäume ausmachen konnte, die sie säumten.
Plötzlich kniff Beate die Augen zusammen. Angestrengt spähte sie nach rechts.
„Du, da vorne steht einer“, rief sie kurz darauf und rüttelte Lukas am Arm.
„Wo?“
„Na, da vorne“, antwortete Beate und wies mit dem ausgestreckten Arm in die Richtung. „Ein Junge, vielleicht zwölf oder dreizehn oder so.“
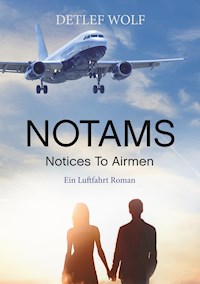

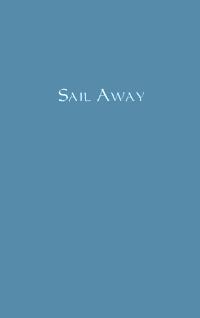















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










