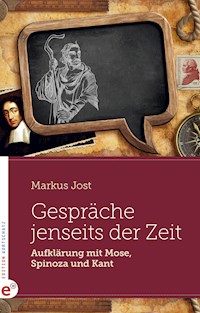
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neufeld Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwei Philosophen und ein Prophet: Kant, Spinoza und Mose. Ein ungewöhnliches Gespräch jenseits der Zeit, aber erstaunlich aktuell. Sie sind dabei und erfahren so einiges über Aufklärung, Philosophie und Religion. Meinungen prallen aufeinander, Mose ringt mit Humor um seine Existenz und Spinoza und Kant merken, dass sie sich näher sind, als sie dachten. Tauchen Sie ein in die Welt der Philosophie und der Bibel. Sie werden feststellen: Alles hat eine Geschichte, aber die Geschichte ist nicht alles. "Ein Buch, das komplexe Sachverhalte einfach und lesbar darstellt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Jost
Gespräche jenseits der Zeit
Aufklärung mit Mose, Spinoza und Kant
Markus Jost
Gespräche jenseits der Zeit
Aufklärung mit Mose, Spinoza und Kant
Dieses Buch in gedruckter Form: 978-3-943362-51-0
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf JohannsonUmschlagbilder: Andrey_Kuzmin, Suzanne Tucker/Shutterstock.comSatz und Herstellung: Edition Wortschatz, Cuxhaven
© 2019 Markus Jost
Edition Wortschatz, Sauerbruchstraße 16, 27478 CuxhavenISBN 978-3-943362-52-7
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Autors
www.edition-wortschatz.de
Der Weisheit gewidmet.
Inhalt
Ein einleitendes Gespräch mit dem Autor 8
Prolog 18
Der erste Philosoph 22
Der zweite Philosoph 51
Der Prophet 104
Mose, Spinoza und Kant: Gespräch jenseits der Zeit 180
Bibliographie 203
Ein einleitendes Gespräch mit dem Autor
Was war Ihre Motivation, dieses ungewöhnliche Buch zu schreiben?
Nach Abschluss meines ersten Buches über die Rolle der Bibel bei Ignatius von Loyola und Menno Simons wollte ich über etwas schreiben, das mich schon lange interessierte: den Pentateuch, die fünf Bücher Mose oder die Tora, wie die Juden sagen. Natürlich kannte ich die verschiedenen Theorien und Hypothesen zur Entstehung des Pentateuchs von meinem Theologiestudium her. Aber keine dieser Theorien konnte mich wirklich überzeugen. Zudem stellte ich erstaunt fest, wie wenig wir heute trotz aller Forschung über die Entstehung des Pentateuchs wirklich wissen und wie viel reine Spekulation bleibt. So wurde beispielsweise bis heute keine eigenständige Priesterschrift gefunden, welche aber vielen Theorien als Grundlage dient. Die sogenannte Krise der Pentateuch-Forschung bestärkte mich darin, einen anderen Weg zu suchen, um den Pentateuch begreifen zu können.
Als ich am Schreiben dieses Buches war, hatte ich unerwartet die Möglichkeit, an einer Reise ins Heilige Land teilzunehmen. Bei den Diskussionen mit unserem fachkundigen Reiseleiter konnte ich immer wieder feststellen, wie komplex und kompliziert die heutige Situation, aber auch die Geschichte des Landes und der darin lebenden Menschen war und ist. Mir wurde klar, dass die Vorstellung von Geschichte und Religion, wie sie bei uns verbreitet ist, in Israel, Palästina und vermutlich auch in vielen anderen Regionen der Welt mehrheitlich nicht geteilt wird. Diese Erfahrung bestärkte mich in meiner Idee, einen anderen Weg zum Verständnis des Pentateuchs zu suchen.
Wie sieht dieser andere Weg aus?
Beim Analysieren der an Universitäten gelehrten Erklärungsversuche stellte ich fest, dass diese sehr oft vom Heute in die Vergangenheit funktionieren. Das heisst, es wird häufig davon ausgegangen, dass der uns überlieferte Text das Resultat eines geschichtlichen Prozesses ist und nicht umgekehrt, dass der Text auch selber Geschichte schreiben kann. Es stellten sich mir zwei Fragen: Warum wird der biblische Text heute bei uns vor allem historisch verstanden? Und zweitens: Was würde geschehen, wenn die Autoren und Protagonisten der Bibel sich äussern könnten, also das Umgekehrte dessen, was wir heute machen: Nicht wir erklären die Texte, die Autoren und die Protagonisten, sondern die Autoren und Protagonisten erklären sich selber und klären uns über ihre Motive und Ideen auf. Es ging mir darum, eine Art kritische Würdigung der Personen hinter dem Text zu machen. Denn hinter jedem Text stehen Menschen. Diesen Menschen wollte ich die Möglichkeit geben, sich selber und ihre Texte zu erklären. Als Autoren des Pentateuchs wollte ich aber bewusst nicht – wie es oft gemacht wird – irgendwelche anonymen Priester- oder königlichen Beamtengruppen annehmen, die irgendwann irgendwo möglicherweise gelebt haben könnten, sondern ich sagte mir, ein solch starker Text wie der Pentateuch braucht starke Persönlichkeiten als Autoren oder wenigstens als erste Autorengeneration. So startete ich mein Experiment: Ich ging ganz einfach von der simplen Annahme aus, dass der Prophet Mose wirklich gelebt hat und dass er etwas mit den Mose-Büchern in der Bibel zu tun hatte. Es ging mir nicht darum, dies historisch zu beweisen, sondern ich wollte einfach mal schauen, was Mose uns heute sagen könnte. Damit das Gespräch nicht zu abgehoben werden würde, stellt eine kritische und theologisch ausgebildete Journalistin aus dem 21. Jahrhundert die Fragen. Ich möchte mit meinem Buch darauf hinweisen, dass durch zeitlose Gespräche spannende Erkenntnisse gewonnen werden können. Es ist manchmal besser, direkt mit den Leuten zu sprechen, statt nur mit anderen Menschen über sie.
Warum wählten Sie als zusätzliche Gesprächspartner zum Propheten Mose aus der Bibel noch die beiden Philosophen Immanuel Kant und Baruch de Spinoza aus?
Den niederländischen Philosophen Baruch oder Benedikt de Spinoza aus dem 17. Jahrhundert habe ich ausgewählt, weil sein „Theologisch-politischer Traktat“ aus dem Jahr 1670 als eigentliches Gründungsdokument der heute weit verbreiteten sogenannten „historisch-kritischen Methode“ gilt.1 Viele Ansichten, die Spinoza damals formulierte, werden auch heute noch von den Gelehrten vertreten. Spinoza selber hat nie an der Existenz des Propheten Mose gezweifelt. Auch ging er davon aus, dass Mose der Nachwelt Schriften hinterlassen hatte. Spinoza bezweifelte aber, dass der uns überlieferte Pentateuch so von Mose verfasst wurde. Heute wird dem Propheten Mose von historisch-kritischen Forschern oft jegliche Mitwirkung am Pentateuch abgesprochen und er wird nicht selten sogar seiner Existenz beraubt. Im Gespräch mit der Journalistin wehrt er sich aber erfolgreich dagegen.
Den deutschen Philosophen Immanuel Kant habe ich ausgewählt, weil er unbestritten als der grosse Aufklärer im deutschen Sprachraum gilt. Ich denke, Kant kann am besten erklären, was Aufklärung eigentlich ist. Das Gespräch mit ihm zeigt, dass Aufklärung bedeutet, dass man und frau den Mut hat, selber zu denken – unabhängig von Autoritäten jeglicher Art. In diesem Sinne habe ich auch gewagt mit diesem Buch eigene Wege zu gehen.
Ihr Buch spielt in einer jenseitigen Welt. Ist es nicht anachronistisch in einer Welt, wo nur das Diesseitige zählt, über das Jenseitige zu schreiben? Wen könnte das schon interessieren?
Ja, mein Buch ist von Anfang bis Ende anachronistisch. Es passt absolut nicht in unsere Vorstellung von Zeit. Wir sind gewohnt, die Geschichte zu schreiben und zu definieren, was dazumal passiert ist. Der berühmte „garstige“ Graben zwischen uns und der Vergangenheit hält uns die Toten vom Leib, die uns eines Besseren belehren könnten. In meinem Buch versuche ich, diesen „garstigen“ Graben zu überwinden und den toten Protagonisten der Vergangenheit eine Bühne zu geben, um sich selber erklären zu können. Dadurch entsteht eine neue Perspektive auf das Leben: So wird die Vergangenheit vom historisierenden Zwang befreit, indem Mose schlicht und einfach mehr Raum zugestanden wird als allgemein üblich und durch die gewählte Form entstehen neue Möglichkeiten des Gesprächs, die über unsere irdische Existenz hinausgehen.
Das Jenseits hat auch mit Religion und religiösen Vorstellungen zu tun. Verstehen Sie Ihr Buch als ein religiöses Werk?
Die Vorstellung eines Jenseits ist nicht nur eine religiöse Vorstellung, sondern auch eine philosophische. Es kommen in meinem Buch auch zwei Philosophen zu Wort.
Sie bezeichnen Kant und Spinoza (und auch den im Gespräch erwähnten Descartes) ausdrücklich nicht als Atheisten. Wieso?
Beim Schreiben meines Buches war dies eines der Schlüsselerlebnisse, festzustellen, dass die beiden grossen Aufklärer Kant und Spinoza keineswegs als stramme Atheisten bezeichnet werden können – obwohl sie oft als Ikonen der Atheisten herhalten müssen. Die Sprache Spinozas ist interessanterweise sehr religiös geprägt2 und zudem sehr klar und direkt. Auch die Tatsache, dass er sich so intensiv mit der Bibel auseinandersetzte und der Gottfrage das ganze erste Kapitel seines Werks „Ethik in geometrischer Weise dargestellt und in fünf Teile geschieden“widmete, zeigt sehr deutlich, dass sein Denken ohne religiöse Vorstellungen schwer zu verstehen ist.
Ist es nicht vermessen, aus einem Philosophen wie Spinoza einen religiösen Menschen zu machen oder anders gesagt, ist es nicht unwissenschaftlich, Spinoza religiös zu vereinnahmen: Schliesslich wurde er von der jüdischen Gemeinde gebannt und seine Werke wurden auf Druck der damals in den Niederlanden herrschenden calvinistischen Kirche verboten und die katholische Kirche setzte sie auf die Liste der verbotenen Bücher?
Mein Ziel ist es nicht, Spinoza religiös zu vereinnahmen. Durch meine Recherchen konnte ich aber feststellen, dass Spinoza nicht ein wirklicher Gegner der Religion war. Für ihn gab es immer zwei Wege zum Heil: den philosophischen Weg und den religiösen Weg. Durch Denken und durch Gehorsam.3 Ich wollte ihm wie auch Kant die Möglichkeit geben, sich einmal anders zu präsentieren. Beide waren der institutionalisierten Religion gegenüber sehr kritisch eingestellt. Warum sich beide aber nicht als überzeugte Atheisten zeigen wollten, ist ihnen selbst zu überlassen. Der moderne und postmoderne Mensch tut sich sehr schwer mit Religion: Auf der einen Seite lehnt er Religion als überlebt ab und ist stets darum bemüht, ja nicht als religiös zu gelten. Er unterwirft sich sozusagen dem Primat des Rationalismus und der Areligion. Auf der anderen Seite ist er in der Not schnell bereit, irgendeinen Glauben anzunehmen und Menschen mit den unglaubwürdigsten Theorien und Vorstellungen blindlings zu vertrauen – Hauptsache es hilft.
In Ihrem Buch wird der Prophet Mose als real existierende Person dargestellt, die dazu noch einen Bezug zu den fünf Büchern Mose im Alten Testament hat. Darf man das heute noch machen?
Ich weiss: mit dieser Verbindung überschreite ich für viele Gelehrte eine rote Linie. Ich habe mein Buchmanuskript einem Orientalisten4 und einem Spezialisten der hebräischen Bibel5 zur Durchsicht gegeben. Der eine fand mein Projekt durchaus kühn und interessant, meinte aber, es sei zu Beginn schwierig gewesen, ständig zwischen der historisch-kritischen, der spekulativen und der naiv-fundamentalistischen Perspektive im Text zu wechseln. Der andere meinte, es sei mir gelungen komplexe Sachverhalte einfach und lesbar darzustellen.
Es ist Teil meines Projekts, verschiedene Sichtweisen des biblischen Texts zu kombinieren und dem biblischen Mose eine glaubwürdige Identität zu verschaffen, möglichst nahe am biblischen Text. Dies kann unzeitgemäss wirken und als naiv-fundamentalistisch verstanden werden, wird aber durch den historisch-kritischen, spekulativen Aspekt und die humorvolle Art und Weise der Protagonisten meines Erachtens mehr als ausgewogen. Humor gilt als eine der besten Waffen gegen Fanatismus.
Durch meine Recherchen für das Buch hatte ich Kontakt mit einer Rabbinerin6. Diese sagte mir, dass für sie – als Jüdin – Mose nicht so wichtig sei. Mose sei bloss der Empfänger der Tora gewesen. Es hätte geradeso ein anderer Mensch die Tora empfangen können. Das Wichtige sei, zu wissen, was in der Tora stehe und wie die Weisungen im Leben konkret umgesetzt werden können.
Ja, sagte ich, aber wenn Mose nie existiert haben soll, wer hätte dann die Tora empfangen und sie dem jüdischen Volk weitervermittelt? Sein Bruder Aaron? Nein, sagte sie entschieden, Aaron sei zwar der erste Cohen (Priester) gewesen, aber seit der Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels hätten die Priester keine Bedeutung mehr im Judentum. Es komme nicht drauf an, an wen die Tora übergeben wurde, Hauptsache sie sei nun da. Ich erwiderte, es gäbe Bibelwissenschaftler, die behaupten, dass der Pentateuch erst viel später in hellenistischer Zeit aufgeschrieben worden sei. Darauf meinte sie, das sei die wissenschaftliche Sicht der Dinge. Gemäss der jüdischen Tradition sei Mose aber selbstverständlich der Empfänger der Tora am Sinai gewesen. Ich war ein wenig erstaunt über ihre Antwort und kam zum Schluss: Vielleicht ist es besser, die Frage nach der Existenz Moses nicht ausschliesslich durch die moderne Geschichtswissenschaft beantworten zu lassen, sondern auch theologische, philosophische, religiöse und literarische Argumente einzubeziehen. Denn das Wissen über Mose und die Tora wurde nicht in Stein gemeisselt, sondern wurde von Menschen zu Menschen über Generationen hinweg weitergegeben und weiterentwickelt. Es ist für uns heute unmöglich, den realen Mose zu ermitteln. Um diesen wirklich erkennen zu können, müssten wir schon mit ihm sprechen können. Auch „historische Beweise“ würden die Existenz eines Moses nicht beweisen, sondern würden einzig davon zeugen, dass es Menschen gab, denen Mose so wichtig war, dass sie das Wissen über seine Person und seine Texte weitergaben. Schlussendlich muss dann jeder selber entscheiden, ob er oder sie diesem Wissen Glauben schenkt oder eben nicht.
Die Frage nach der Existenz Moses ist also eher eine philosophische Frage denn eine historische?
Ja und nein. Denn: Alles hat zwar eine Geschichte, aber die Geschichte ist nicht alles! Verstehen Sie mich richtig: Ich bin sehr an der Geschichtswissenschaft und ihren Resultaten interessiert. Ich finde es aber unklug, den Resultaten der Historiker blindlings zu vertrauen. Es braucht eine Art Kritik der Kritik oder einen kritischen Rationalismus, wie es der Philosoph Karl Popper nannte. Hinzu kommt, dass meines Erachtens die Wahrheit der Bibel viel grösser ist als die hypothetische historische Wahrheit hinter ihr. Ich denke, die Frage nach der Geschichte ist immer eine philosophische Frage: Was ist Geschichte, was ist Wirklichkeit? Man müsste sich eher die Frage stellen: Warum wurde aus der Person Mose der Mose der Bibel?
Und was ist Ihre Antwort?
Ich denke, Mose wurde zum Mose der Bibel, weil er den Auftrag hatte, die ihm folgenden Generationen für die Sache der Tora zu begeistern. Meines Erachtens sollte Geschichte immer dazu dienen, den Menschen im Hier und Jetzt Orientierung bei der Gestaltung ihres Lebens zu geben. Sehen Sie: Sie, ich, wir alle leben für eine gewisse Zeit auf dieser Erde. Während dieser Zeit werden wir uns ein Bild von der Zeit vor uns – also der Geschichte – machen. Dieses Bild wird immer eine Fiktion bleiben. Denn die Menschen nach uns werden unser Bild der Geschichte revidieren und ein neues, eigenes System zeichnen.
Es gibt aber Systeme, die Jahrtausende überdauert haben. Diese Systeme sind einerseits stabile aber gleichzeitig auch flexible Systeme. Ähnlich einer Hängebrücke: Sie ist stabil im Boden verankert, ist aber auch flexibel und passt sich dem Tempo und dem Gewicht der über sie gehenden Personen an. Mose ist Teil des sehr alten Systems der Bibel. Mose sollte deshalb aus der Perspektive dieses Systems verstanden werden: Die philosophisch-theologische Sicht ist somit der ausschliesslich historisch-kritischen Sicht vorzuziehen. Deswegen kommen in meinem Buch auch zwei Philosophen zu Wort. Da Mose eine uralte Figur ist, die vermutlich nie wirklich historisch erfasst werden kann, erlaube ich ihm in meinem Buch, sich gegen die historisch-kritischen Argumente, die gegen seine Existenz sprechen, erfolgreich zu verteidigen. Interessanterweise ist es für Mose gar nicht so schwierig, die gegen ihn hervorgebrachten Argumente zu entkräften – manchmal glaubwürdiger, manchmal unglaubwürdiger. Mein Vorgehen soll aber nicht missverstanden werden: Ich möchte mit meinem Buch nicht etwas beweisen, sondern schlicht und einfach die Leserin und den Leser dazu motivieren, selber zu denken (und zu glauben). Denn wie Spinoza so schön sagt: Gott ist ein denkendes Ding.7
Gasel/Köniz im Oktober 2018
„Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war unförmlich und vermischt, Finsternis auf der Fläche des Abgrundes, und der göttliche Geist wehend auf den Wassern.“
„Da bildete das ewige Wesen, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdreich und blies in seine Nase lebendigen Odem. Also wurde der Mensch ein beseeltes Tier.“ 8
Gott erschuf eine zeitlose Welt. Eine perfekte Welt. Doch diese paradiesische Welt verging und Gott liess eine neue Welt entstehen. Eine Welt in und aus der Zeit. Die Welt, wie wir sie heute kennen. Die Erinnerung an die ursprünglich zeitlose Welt blieb aber in der Phantasie und Imagination der Menschen weiterhin präsent. Und die Geschichte nahm ihren Lauf.
1 Rudolf Smend, Kritiker und Exegeten: Porträtskizzen zu vier Jahrhunderten alttestamentlicher Wissenschaft (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017), 59.
2 Elhanan Yakira bestätigt diesen Befund in: Elhanan Yakira, Spinoza and the case for philosophy (New York: Cambridge University Press, 2015), 15ff.
3 Vgl. Hélène Bouchilloux, Spinoza: les deux voies du salut, Ouverture philosophique (Paris: L’Harmattan, 2018).
4 Prof. em. Othmar Keel der theologischen Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz).
5 Prof. Thomas Römer der religionswissenschaftlichen und theologischen Fakultät der Universität Lausanne und des Collège de France in Paris.
6 Dr. theol. Annette M. Böckler, Fachleiterin Judentum und Dozentin am Zürcher Institut für interreligiösen Dialog.
7 Baruch de Spinoza und Carl Vogl, Die Ethik : Schriften und Briefe, 8., aktualisierte Aufl. / mit neuer Einl. von Daniel Schmicking, Kröners Taschenausgabe (Stuttgart: Kröner, 2010), 52.
8 Annette M. Böckler, Simon Bernfeld, und Moses Mendelssohn, Hrsg., Die Tora, Revision 2015 (Essex: JVFG, 2015).
Prolog
Stellen Sie sich vor: Sie sind ein typischer, (post)moderner Mensch und Sie sterben. Und entgegen aller Beteuerungen Ihres Nachbarn oder der netten Kollegin am Arbeitsplatz stellen Sie fest, dass der Tod nicht das endgültige Ende Ihrer Existenz ist: Sie erwachen nach Abschluss Ihres Sterbeprozesses in einer neuen Welt.
In einer Welt, von der Sie eigentlich schon immer vage ahnten, dass es sie geben könnte, aber woran Sie irgendwie nie wirklich zu glauben wagten, weil Ihnen seit Ihrer Kindheit vermittelt wurde, dass es nur die eine Welt, nur diese eine – sichtbare und messbare – Wirklichkeit gäbe. Nun müssen Sie feststellen, dass Sie sich in diesem Punkt getäuscht haben. Sie fragen sich: Warum habe ich nicht schon früher meiner Intuition vertraut und bin dieser inneren Idee gefolgt? Das hätte vermutlich bereits zu Ihren Lebzeiten eine spannende, erweiterte Lebensperspektive ermöglicht. Warum nur liessen Sie sich nicht auf dieses tief in Ihnen verankerte Wissen ein und sind Sie diesen interessanten Gedankengängen nicht gefolgt? Stattdessen verliessen Sie sich auf das „was man so glaubt und denkt“ und überall erzählt wird. Aber nun stellen Sie sonnenklar fest, dass niemand mehr da ist, der Ihnen sagt, was man so glaubt und denkt. Und Sie müssen beginnen, selber zu glauben und zu denken.
Sie ärgern sich, dass Sie nur selten gewagt haben, in Ihrem Leben eigene Wege zu gehen. Es nervt Sie, dass Sie all diesen Studien geglaubt haben, welche Ihnen die Wirklichkeit über Sie, Ihre Stadt, Ihr Land ja über die gesamte Welt mit Zahlen begreiflich machen wollten. Sie stellen nun fest, dass diese geschaffenen Wirklichkeiten nur Illusionen und Fiktionen waren. Denn Sie können nun zurückblicken oder besser gesagt: Sie können die Welt nun realistisch betrachten – denn Sie befinden sich ausserhalb von Raum und Zeit. Die Welt und ihre Geschichte scheint Ihnen aus dieser Perspektive so klar und verständlich zu sein – anders als all die Theorien, Hypothesen oder Studien, welche vorgaben, die Wirklichkeit zu erklären.
Sie stehen ganz alleine da und beginnen zu begreifen, dass diese neue Welt Ihnen gehören wird. „Sapere aude!“ (Wage es, weise zu sein!) ruft Ihnen eine Stimme entgegen und Sie wissen, dass diese Stimme die Wahrheit spricht. Kommt sie von diesem schon oft totgesagten Gott? Zum ersten Mal spüren Sie, was Freiheit wirklich sein könnte und wer Sie wirklich sind.
Bei jedem Schritt, den Sie tun, wächst Ihre Erkenntnis über die Vergangenheit: Sie merken plötzlich, dass Sie, obwohl Sie sich nie dazugehörig gefühlt haben, Teil der Menschheitsgeschichte sind. Der einen Geschichte aller Menschen. Egal, ob Sie nun 10, 20, 30, 50 oder gar 100 Jahre gelebt haben. Sie sind Teil der einmaligen Geschichte der Menschen. Sie beginnen zu begreifen was Geschichte wirklich ist: Sie erkennen, dass die Wahrheit der Geschichte weit mehr ist, als die Aneinanderreihung von Ereignissen und ausgegrabenen Gegenständen. Sie ist mehr als das Abbild von gesellschaftlichen Strukturen, die durchbrochen werden müssen. Sie ist mehr als in die Vergangenheit projizierte mythologische Visionen. Geschichte ist die Bühne, auf welcher sich das Drama der Natur und mit ihr das Drama der Menschheit und des einzelnen Menschen abspielt. Sie stellen fest: So lange Sie lebten, waren Sie Teil dieses Dramas und nun sind Sie Zuschauer – aber nicht nur. Auch wenn Sie schon zu Lebzeiten versuchten, Zuschauer und Kritiker zu sein: Nun sind Sie ein ganz anderer Zuschauer. Denn Sie beginnen zu begreifen, was Wahrheit ist und wer Gott sein könnte.
Sie wagen den ersten Schritt in die neue Welt. Und Sie stellen fest, dass Sie nicht alleine sind in der neuen Welt. Auf Ihrem Weg begegnen Sie verschiedenen Menschen aus der Geschichte. Zu Ihrer Verwunderung können Sie problemlos mit ihnen kommunizieren. Alle sprechen dieselbe Sprache oder besser gesagt, jeder versteht des anderen Sprache. Sie stellen auch fest, dass der in der Geschichtswissenschaft oft beschworene garstige breite Graben9 zwischen Ihnen und den Menschen vor Ihnen zugeschüttet ist und Sie problemlos mit Menschen aus älteren Epochen sprechen können. Ohne aneinander vorbei zu reden. Sie verstehen sie und Sie werden von ihnen verstanden. Durch die Gespräche erhalten Sie einen neuen Zugang zur Geschichte. Sie verstehen nun, dass Geschichte mehr ist als die Rückprojektion des Heute in die Vergangenheit. Als das „Richten“ der Vergangenheit mittels Befragung von Zeugen – seien es Manuskripte, Inschriften, Texte, Objekte, Gegenstände oder antike Bauten. Sie hören nun Geschichten von Menschen, wie Sie einer sind. Und all diese Personen, die Sie früher zu beurteilen oder zu richten versuchten oder die Ihnen unnahbar zu sein schienen, stehen Ihnen nun gegenüber. Von Angesicht zu Angesicht. In ihrer wahren Identität ohne geschichtlichen Graben. Sie treten in Dialog mit ihnen, mit Sympathie, ohne Vorurteile.
Als Sie so dahingehen, überlegen Sie sich, wer Ihr Denken und Ihren (Nicht-)Glauben in Ihrem Erdenleben stark beeinflusst haben könnte. Begriffe wie Aufklärung und Moderne kommen Ihnen in den Sinn. Ja, Sie waren ein aufgeklärter, moderner Mensch. Das gehörte sich damals so. Und Sie erinnern sich zurück, dass Sie vor langer, langer Zeit einmal begonnen hatten die Bibel zu lesen. Sehr schnell waren Sie fasziniert von diesen alten Geschichten, die Ihnen wie aus Ihrem persönlichen Leben gesprochen vorkamen. Die Ihnen den Horizont öffneten für eine Welt hinter der realen Welt, die Ihnen den Zugang verschafften in eine zeitlose Welt. Sie erhielten dadurch eine neue Perspektive auf Ihre Zeit. Doch mit der Zeit verloren Sie Ihre Begeisterung für die biblischen Geschichten. Denn die Wissenschaft habe doch eindeutig bewiesen, dass die biblischen Geschichten im Prinzip Märchen seien, die keine eigentliche Bedeutung für uns heute haben würden, wurde Ihnen gesagt. Sie zogen die Konsequenzen daraus und legten das Buch der Bücher – die Bibel – für immer weg. Sie wollten ja schliesslich nicht als naiv und unaufgeklärt gelten. Aber in dieser neuen Welt stellen Sie nun fest, dass es viel naiver und unaufgeklärter war, diesen Menschen blindlings zu glauben, statt sich selber auf den Weg zu machen. Sie sagen sich, wenn ich es schon zu Erdenzeiten verpasst habe, selber zu denken und zu glauben, dann werde ich es wenigstens jetzt in der neuen Welt tun.
9 Vermutlich war der deutsche Dichter und Philosoph Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) der Erste, der den Begriff „garstiger breiter Graben“ in seinem Werk Über den Beweis des Geistes und der Kraft (1777) verwendete.
Der erste Philosoph
Während Sie so dahin gehen, begegnen Sie einem Mann, dem Sie ansehen, dass er zu seiner Erdenzeit einen starken Willen und Disziplin hatte und dem Unabhängigkeit, Freiheit und Sparsamkeit ein zentrales Anliegen waren.10 Nach der Begrüssung fragen Sie ihn, was für ihn in seinem Erdenleben wichtig gewesen sei. Er antwortet: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“11 Beide Dinge dürften nicht im Überschwänglichen noch im Dunkeln oder ausserhalb des eigenen Blickfeldes gesucht oder vermutet werden. Er habe versucht den Sternenhimmel und seine „Welten über Welten“ und „Systeme von Systemen“ mit seinem unsichtbaren Selbst, seiner Persönlichkeit, zu verknüpfen, in einer Welt, die zwar unendlich sei, aber nur durch den Verstand wahrgenommen werden könne. Diese Verknüpfung sollte aber nicht bloss als zufällig verstanden werden, wie die Sterne am Sternenhimmel, sondern sie sollte als allgemeine und notwenige Verknüpfung erkannt werden.
Sie staunen ab solch erhabener Wortwahl und vermuten, auf einen Philosophen gestossen zu sein. Ein Philosoph der versucht, seine innere Welt mit der Erhabenheit des Universums zu verknüpfen und sich über das moralische Gesetz und die Naturbeobachtung definiert. Vielleicht kann er Ihnen Auskunft geben über den viel gehörten Begriff der Aufklärung. Sie fragen ihn, was er unter Aufklärung verstehe. Der Mann schaut Sie verlegen an, überlegt und sagt zögernd, Aufklärung sei das, was in dieser neuen Welt stattfände: das Erkennen, was wirklich ist. Früher – zu seiner Erdenzeit – hätte er so geantwortet: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“12 Er fügt bei, dass er rückblickend damals nur Teile der wahren Aufklärung begriffen habe.
Sie laden den Fremden ein, noch mehr von seinen Ideen und Vorstellungen zu erzählen. Und er ist so freundlich und versucht Ihnen seine Gedankengänge zu erklären. Er stellt aber zu Beginn klar, dass seine Schriften noch nie sofort verstanden worden seien. Die Klarheit der neuen Welt habe ihm zwar bereits geholfen seine Gedanken einfacher zu formulieren, doch er sei erst verhältnismässig kurze Zeit hier und deshalb könnte es sein, dass er sich immer noch kompliziert und umständlich ausdrücken werde. Er nehme sich aber gerne Zeit für Sie und Ihre Rückfragen – da Zeit ja in dieser neuen Welt keine Rolle spiele.
Vier Fragen hätten ihn zeitlebens umgetrieben: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Zuerst habe ihn interessiert, was eigentlich Wirklichkeit sei und wie die Realität erkannt werden könne. Es sei ihm um die sogenannte Metaphysik gegangen. Durch sein langes Nachdenken und Forschen sei er zum Schluss gekommen, dass wir Menschen die wahre Wirklichkeit der Welt nie wirklich erkennen könnten, weil unsere Erkenntnis immer von unserer Wahrnehmung und unserem Verstand abhängig sei. Alle menschliche Erkenntnis beginne immer mit Betrachtung und Anschauung, darauf würden Begriffe formuliert und schliesslich würden Ideen daraus gemacht. Das heisst, wir müssen erkennen, dass wir Menschen die Welt nicht rein objektiv betrachten können. Es sei eine „Revolution der Denkart“13 notwendig: Dass wir die Erkenntnis nicht mehr nach den Gegenständen richten, sondern umgekehrt die Gegenstände sich nach der Erkenntnis richten sollten. Diese neu erkannte menschliche Subjektivität müsse aber nicht zwingend negativ bewertet werden. Sie könne auch positiv verstanden werden: als schöpferischen Grund des kritischen Denkens. Diese „Revolution der Denkart“ erfordere aber eine „neue Geburt“ der Metaphysik, welche auf der Kritik der reinen Vernunft aufbaue. Wie dies zu geschehen habe, habe er Zeit seines Lebens nicht umfassend herausgefunden. Deswegen habe er später das Zentrum seines Schaffens von der theoretisch-spekulativen Philosophie (der reinen Vernunft) zur angewandten Philosophie (der praktischen Vernunft) verschoben. Er sei davon überzeugt gewesen, gerade im Gebiet des Praktischen das Unbedingte finden zu können, das er im Felde des Theoretischen vergebens gesucht habe.14 Die reine Vernunft allein könne spekulativ keine Gewissheiten begründen, deswegen könne ihr Wert nur im praktischen Gebrauch liegen. Womit wir bei der zweiten Frage angelangt seien: Was soll ich tun? Er habe die Antwort auf seine Frage im sogenannten kategorischen Imperativ zusammengefasst. Dieser hindere den Menschen daran, nach Willkür und Laune zu handeln. Er laute: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“15 Maximen seien subjektive Grundsätze, erklärt er. Man könne es auch anders formulieren: „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest.“16 Damit der Mensch gemäss dem kategorischen Imperativ handeln könne, benötige er Freiheit.
Womit wir bei der dritten Frage seien: Was darf ich hoffen? Diese Frage habe auch etwas mit Glauben zu tun. Sie wenden ein, dass ein Philosoph sich nicht mit Glauben beschäftigen solle – dafür gäbe es ja die Theologen. Ein Philosoph müsse sich ausschliesslich dem Denken und dem rationalen Argumentieren widmen, behaupten Sie. Er entgegnet, er habe den Eindruck, dass Ihre Vorstellung von Philosophie von der mathematischen Methode herkomme. Das sei äusserst gefährlich, denn die mathematische Methode neige zu Dogmatismus. Wahre Philosophie sei weder Dogmatismus noch pure Mathematik. Man könne Philosophie nicht so betreiben, wie man Mathematik betreibe, sonst werde Philosophie anmassend und zur reinen Spekulation. Die reine Vernunft benötige eine praktische Erweiterung, meint er. Erst der Glaube ermögliche es dem Menschen, zu erkennen, dass er obwohl der Endlichkeit verhaftet, gleichzeitig einer übersinnlichen Ordnung angehöre, welche ihm seine eigentümliche Würde gebe. Der Mensch sei somit Bürger zweier Welten.17 Diese übersinnliche Ordnung habe als Grundlage die drei sogenannten Postulate: Freiheit des Willens – damit sich der Mensch für das Gute entscheiden könne; die Unsterblichkeit der Seele – damit das Handeln des Menschen einen Sinn erhalte – und das Dasein Gottes – welches sich aus der Moral erschliesse. Der Sinn der Vernunft sei schlussendlich die Stützung des moralischen Glaubens. Der Moral wegen seien die drei Postulate wichtig: Sie weisen dem Menschen in seiner Suche nach dem, was zu tun sei, den Weg.
Und schliesslich zur vierten Frage: Was ist der Mensch? Die menschliche Natur habe einen Hang zum Bösen: „Er ist sich des moralischen Gesetzes bewusst, und hat doch die (gelegentliche) Abweichung von demselben in seine Maxime aufgenommen.“18 Der Mensch sei aber vernünftig bestimmt und könne deshalb durch eine gute Erziehung aufgeklärt werden. Diese sei äusserst wichtig und solle die Kinder zum selber Denken führen. Der Mensch sei fähig, gemäss dem auf der Vernunft basierenden moralischen Gesetz handeln zu wollen. Es ginge darum, nicht einfach moralisch zu handeln, weil einem eine Strafe angedroht werde, sondern weil man mittels Vernunft eingesehen habe, dass die Einhaltung des moralischen Gesetzes erstrebenswert sei.
Die Geschichte der Menschheit zeige: Durch die Weitergabe des Erreichten von Generation zu Generation habe eine Vervollkommnung stattgefunden. Dadurch vollziehe die Natur ihren verborgenen Plan, alle ihre Anlagen in der Menschheit zu entwickeln. Der Mensch erstrebe die Gesellschaft und lehne sich doch gegen sie auf. Die Errichtung der vollkommenen gerechten bürgerlichen Gesellschaft sei die „höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung, weil die Natur [nur so] ihre übrigen Absichten mit unserer Gattung erreichen kann“.19
Er erzählt Ihnen von seiner Idee eines ewigen Friedens zwischen den Menschen. Er habe darüber eigens eine Schrift verfasst.20 Für den Titel seiner Schrift habe er sich von einem holländischen Gastwirt inspirieren lassen. Der Wirt habe in seinem Gasthof ein Bild mit einem Friedhof und dem Spruch „zum ewigen Frieden“ aufgehängt gehabt. Er habe sich immer gefragt, ob die Aussage des Bildes, dass es ewigen Frieden nur auf einem Friedhof gebe, für alle Menschen gelte oder nur für die oft kriegsführenden Staatsoberhäupter oder nur für die vom Frieden träumenden Philosophen. Er habe die Schrift über den ewigen Frieden im Alter von 71 Jahren geschrieben. Er sei damals bereits vom Lehrverbot der preussischen Zensurbehörde betroffen gewesen und habe nicht mehr an der Universität Königsberg unterrichten dürfen. Der Grund für das Verbot sei sein Werk „Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft“21 gewesen. Er habe mit der Schrift über den ewigen Frieden etwas Neues wagen wollen: Er habe den Text in Form eines Friedensvertrages verfasst, damit seine Gedanken auch von einem breiteren Publikum verstanden würden – zumindest erhoffte er sich dies. Übrigens, meint er, hätten 18 Monate später22 Preussen und die Französische Republik einen Friedensvertrag abgeschlossen, der da hiess: Frieden von Basel.
Sie wollen nun wissen, ob und wie ein ewiger Frieden zwischen den Menschen möglich sei. Er beginnt zu erklären, dass Frieden kein natürlicher Zustand sei. Im Gegenteil, die Menschheit sei grundsätzlich immer von Krieg bedroht. Wenn gerade kein Krieg herrsche, bedeute dies noch lange nicht, dass Frieden sei. Um Frieden zu schaffen und zu erhalten, sei das gegenseitige Vertrauen zwischen den Staaten notwendig. So sei es sinnlos, über einen Friedensvertrag zu verhandeln, wenn die eine Seite bereits an den nächsten Krieg denke. Die Kriegsgefahr werde erhöht, wenn es zu grosse Berufsarmeen gäbe, die Staaten sich gegenseitig verschuldeten oder sich bestimmte Staaten in die Verfassung und Regierung anderer Staaten gewalttätig einmischten.
Zur Erhaltung des Friedens müsse ein Staat republikanisch organisiert sein. Das bedeute: Die Freiheiten der einzelnen Menschen müssen garantiert sein und die Bewohner müssen einer gemeinsamen Gesetzgebung verpflichtet werden. Jeder Bewohner eines Staates müsse seine persönliche (gesetzlose) totale Freiheit aufgeben und die vernünftige Freiheit vorziehen, sprich sich dem geltenden Recht verpflichten. Dies erhöhe die Sicherheit eines Staates. Zudem müssen alle Bewohner vor dem Gesetz gleich sein. Weiter müsse in einem solchen Staat die gesetzgebende Gewalt von der ausführenden Gewalt getrennt sein.
Jeder Staat sollte vom anderen fordern, eine eigene republikanische Verfassung einzuführen. Zwischen den einzelnen Staaten bräuchte es ein von den Staaten anerkanntes Recht: das internationale Recht oder Völkerrecht. Das Völkerrecht sollte auf einem Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Das Weltbürgerrecht beinhalte das Besuchsrecht (allgemeine Hospitalität), hingegen kein eigentliches Gastrecht. Der freie Handel zwischen den Staaten fördere den (ewigen) Frieden.
Die republikanische Verfassung sei die einzige Staatsform, die den Menschenrechten entspreche. Aber es sei auch die am schwierigsten einzuführende und die am schwierigsten zu erhaltende Form, fügt er an. Rein rational betrachtet, sei es am einfachsten, wenn alle Völker in einem Staat vereint seien. Aber die Natur habe es anders gewollt. Sie möchte scheinbar, dass die Völker getrennt seien: Denn es gäbe verschiedene Sprachen und verschiedene Religionen. Doch gleichzeitig vereinige die Natur auch die Völker durch ihren gegenseitigen Egoismus, der Ausdruck finde im Handelsgeist und in der Macht des Geldes. Der Handel aber könne nicht stattfinden, wenn Krieg zwischen den Nationen herrsche. Und so schaffe die Natur selbst die Grundlagen für den ewigen Frieden.
Sie sind beeindruckt von den vielen Überlegungen Ihres Gegenübers. Sie fragen Ihn, ob er zu seinen damaligen Ansichten heute in der neuen Welt noch stehen könne. Er sei damals viel zu kompliziert und viel zu abgehoben gewesen, bedauert er. Aber er sei sehr froh und dankbar, dass ihm bereits zu Lebzeiten die Erkenntnis geschenkt worden sei, dass mit dem Verstand nicht alles bewiesen werden könne. Gerade die Existenz oder Nichtexistenz von Dingen, die ausserhalb unserer Wahrnehmung liegen, könne nicht bewiesen werden. So sei er im Gegensatz zu anderen Philosophen davor bewahrt worden, die Existenz Gottes grundsätzlich zu verneinen. Denn in der neuen Welt sei es offensichtlich, dass Gott existiere.
Er habe die Idee gehabt, die sinnliche Wahrnehmung mit dem Verstandesdenken zu verbinden. Das bedeute, die Welt durch Beobachtung (empirische Methode) und rein denkerisch (spekulativ) zu begreifen. Seine Forschungen hätten ihm gezeigt, dass wir die wahre Wirklichkeit der Welt nie feststellen könnten, weil unsere Erkenntnis immer von unserer Wahrnehmung und unserem Verstand abhängig sei. Sie wollen von ihm wissen, an was man sich noch orientieren könne, wenn unsere Wahrnehmung scheinbar zutiefst subjektiv sei. Er antwortet, man solle sich am sogenannten Vernunftglauben im Denken orientieren.23 Man müsse das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.24





























