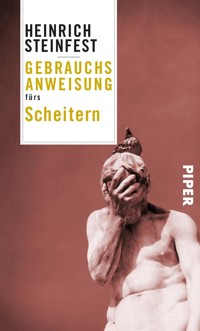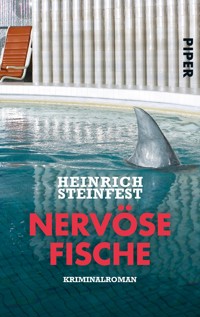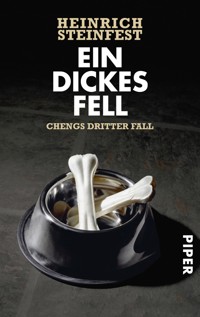9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Lorenz Mohn begreift im vierzigsten Jahr seines Lebens, dass er selbiges radikal ändern muss – und beendet seine Karriere als Porno-Darsteller. Inspiriert durch den Anblick einer Kollegin, die mit Vermeerscher Ruhe an einem Pullöverchen häkelt, eröffnet er einen Strickwarenladen. Geldgeberin ist die von Gerüchten umwehte Grande Dame der Wiener Unterwelt. Ihre einzige Bedingung für das zinslose Darlehen: es auf den Tag genau in sieben Jahren zurückzuzahlen oder aber an eben diesem 14. Juli 2015 ein Leben zu retten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage Dezember 2010
ISBN 978-3-492-95801-1
© 2009 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: plainpicture / fStop Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
I
– Wir begeben uns in die Welt von außergewöhnlich gefährlichen Abenteuern.
– Müssen es denn gefährliche Abenteuer sein?
– Selbstverfreilich. Wie sollen wir denn sonst wissen,daß wir richtig sind?
(Tigger und Ferkel in dem Disney-Film The Piglet Who Would Be King)
»Wir unternehmen eine Vergnügungsfahrt, um uns auf Gnade und Ungnade
giftigen Schlangen und Ameisen auszuliefern.
Wieviel Torheit steckt doch in den Menschen!«
(Vivean Gray als Mathematiklehrerin Miss McCraw
in Peter Weirs Film Picknick am Valentinstag)
1 | Der Fisch im Bett
Vier Uhr am Morgen.
Dann, wenn man nicht mehr schlafen kann, aber zu müde für einen Tag ist, der ja noch gar nicht begonnen hat. Vier Uhr morgens, das klingt nach: Zum Abnehmen zu spät, zum Fettwerden zu früh. Oder wie wenn jemand sagt: Kinder, ich würde gerne auswandern, nur leider kann ich meine Schuhe nicht finden. Man könnte somit meinen, das sei eine schlechte Zeit. Gleichwohl ist es eine gute Zeit. In der sich nämlich über die Dinge nachdenken läßt, ohne bereits mit einem Fuß und einem Magen und einem Hirn im neuen Tag zu stehen. Oder noch im alten festzustecken. Es ist mitunter besser, seine Schuhe nicht zu finden und also nicht auszuwandern und sich statt dessen dem zu stellen, was ist.
Genau das tat Lorenz. Während er in seinem Bett wie ein kranker Schwertfisch dahintrieb, sagte er sich: »Ich habe das alles unendlich satt.«
Und wie er es satt hatte, sich sein Leben mit…nun, man muß es so häßlich sagen: sich sein Leben mit Ficken zu verdienen, allerdings mit einem fiktiven Ficken, auch wenn Lorenz dabei seinen faktischen Körper zum Einsatz brachte. Aber halt bloß im Film. Als Schauspieler seinen Körper und sein Geschlecht und seine Potenz zur Schau stellend. Lorenz gehörte folglich zu denen, die einen sexuellen Akt vorspiegelten und ihn gleichzeitig erhöhten. Und dabei eine vereinfachte Form von Leben präsentierten. Denn das war es ja eigentlich, was die Pornographie so attraktiv machte, gar nicht so sehr die Verbildlichung eines an sich intimen Vorgangs, sondern die unkomplizierten Rahmenbedingungen. – Worüber so gerne gelacht wird, wie da ein Mann an irgendeine Tür klopft, sich als Versicherungsmakler vorstellt, die Zentralheizung repariert, die Post überreicht, so was in der Art eben, um nur wenig später einer entblößten Frau die Seele aus dem Leib…und so weiter.
Die Aufgeklärten und Emanzipierten mögen diese Rasanz der Entwicklung als grotesk empfinden, das ist sie sicher auch, aber wieviel besser erscheint sie im Vergleich zum umständlichen Theater der Wirklichkeit. Denn das, was im realen Leben geschieht, ist ja kein respektvolles und charmantes Werben, kein elegantes Vorspiel, kein kommunikatives Schaulaufen, sondern ein lächerlicher Eiertanz. Ein Eiertanz, der zur Folge hat, daß, wenn dann endlich etwas Konkretes geschieht, die ganze Kraft bereits verpufft ist. Eigentlich auch die Lust. Der sexuelle Akt verkümmert zur bloßen Pflichterfüllung. Er geschieht nur darum noch, um besagten Eiertanz zu rechtfertigen: das neue Kleid, die teure Unterwäsche, den Restaurantbesuch, die ganze aufwendige Angeberei, die Lügen, die Fettabsaugung, die seit Wochen umsonst mitgeschleppten Präservative, den Sport, die Vitamine, nicht zuletzt die aus der Pornographie bezogenen Illusionen. Denn allein die Pornographie schafft es, uns solche Illusionen zu vermitteln, Illusionen vom gelungenen Sex. Die Psychologie hingegen läßt keinen Zweifel darüber, daß die Sache zum Scheitern verurteilt ist, daß der Zweck der Sexualität sicher nicht darin besteht, daß alle ihren Spaß haben. Ganz im Gegenteil. Der Sinn der »echten« Sexualität reflektiert die Verhältnisse der Welt, den irdischen Hang zum Gefälle, zum Nord-Süd, zum Groß-Klein, zum Gescheit-Blöd, Arm-Reich, Glücklich-Unglücklich, Giftig-Ungiftig.
Lorenz Mohn war gewissermaßen ein Märchenonkel der Sexualität, indem er in den Filmen, in denen er auftrat, nicht nur ungewöhnlich ausdauernd und erfolgreich agierte, sondern die Sache eben ohne die bekannten Umständlichkeiten einfädelte. Seine gespielte Ausdauer, seine gespielte Potenz ergaben sich folgerichtig aus der Schnelligkeit der Anbahnung – so blieb nämlich genug Zeit für das Wesentliche –, während im wirklichen Leben die erschöpfende Länge solcher Anbahnungen wie auch die ewige Diskutiererei darüber, wer was wie möchte, für den eigentlichen Akt kaum noch Zeit und Kraft lassen. Der Mensch ermattet in der Diskussion. Man kann also nicht immer sagen, daß die Erfindung der Sprache ein großes Glück darstellt. Es besteht ein deprimierendes Ungleichgewicht. Während etwa im Krieg zuwenig gesprochen wird, wird im Sex zuviel gesprochen.
Er war jetzt beinahe vierzig. Ein im Grunde hohes Alter für einen Pornodarsteller. Allerdings war er körperlich gesehen topfit. Das gehörte dazu. Seit Jahr und Tag praktizierte er ein gelenkschonendes Krafttraining, ging zum Joggen und Schwimmen, hüllte sich in Schlammpackungen, duschte kalt, ließ sich maniküren, achtete auf seine Zähne, mied fettige Speisen, betrachtete Alkohol mit Mißtrauen und erkannte den Wert der einen oder anderen Zigarette in ihrer appetitmindernden Wirkung. An ihm war kein einziges Fettpölsterchen, die Haut glatt, das dunkelbraune Haar voll, die Augen frei von Ringen. Natürlich werden viele sagen, daß es in Pornos nicht auf die Augen ankommt. Aber so einfach war das nicht. Lorenz sah sich als Ganzes, auch im Film.
Die Frauen, mit denen er zusammenarbeitete, mochten ihn. Es war Verlaß auf ihn. Er war pünktlich, nie ungewaschen, selten launisch. Und er war kein Besserwisser, der seinen Kolleginnen mit Uraltgeschichten auf die Nerven ging. Während ja so mancher in die Jahre gekommene Akteur meinte, daß vor zwanzig Jahren alles besser gewesen sei, als Pornos noch von echten Künstlern gedreht worden waren. Lorenz Mohn konnte auf einen solchen Schmonzes verzichten. Er blieb sachlich und ruhig und konzentrierte sich auf seine Arbeit, die lange nicht so vergnüglich war, wie Laien sich das vorstellen. Selbstverständlich wurde auch hier, wie bei jedem anderen Filmgenre, mit vielen Unterbrechungen gearbeitet, wurden Pausen eingelegt, Tränen gestillt, Sensibilitäten gepflegt, aber es ging nun mal nicht an, ewig herumzujammern. Vor allem die männlichen Darsteller waren aus naheliegenden Gründen gezwungen, bei der Sache zu bleiben und einen Zustand wenigstens körperlicher Erregung zu erreichen. Ganz gleich, wie gelangweilt die Frauen schienen oder wie deppisch sich das Drehteam aufführte. Von der Häßlichkeit der Kulissen ganz zu schweigen.
Daß ein Mann wie Lorenz in seinem bisherigen Leben genügend Sex gehabt hatte, versteht sich. Und dabei ist nicht nur sein Beruf gemeint, sondern auch sein Privatleben. Einerseits. Andererseits war es ihm verwehrt geblieben, eine Frau fürs Leben zu finden. Gerade das Faktum seiner filmischen Tätigkeit – und er ließ dies nie unerwähnt, denn Täuschungen waren ihm zuwider – schien viele Frauen, vor allem die bürgerlichen, in höchstem Maße anzuziehen. Offensichtlich stellten sie sich Lorenz als einen Sexmeister vor, einen Zauberer, einen Fingerkünstler, wenigstens einen Trickkünstler. Falsche Magie war immer noch besser als das, was diese Frauen gewohnt waren, nämlich gar keine Magie. In einer Welt des Mangels entstanden Luftschlösser.
Doch ganz gleich, ob selbige Frauen nun genau das erlebten, was sie sich von diesem Spezialisten erhofft hatten, oder auch nicht, sie wären nie und nimmer auf die Idee gekommen, mit einem solchen Mann zusammenleben zu wollen. Selbst dann nicht, wenn er bereit gewesen wäre, seine Profession gänzlich aufzugeben. Nicht zuletzt jene Damen, die ständig die Toleranz im Munde führten und vor lauter Aufgeschlossenheit sogar überlegten, ob sie nicht zur Abwechslung einen kleinen Neonazi adoptieren sollten, waren überaus kurz angebunden, wenn Lorenz sich nach einer ersten Nacht um ein Wiedersehen bemühte und dabei Dinge wie einen Theaterbesuch oder eine gemeinsame Bergwanderung ins Spiel brachte. Man wich ihm aus, als hätte er eine Krankheit, die immer erst beim zweiten Mal übertragen wird. (Auf die Idee werden die Viren auch noch kommen.) So lief das ab. Und die Möglichkeit, sich vielleicht mit einer seiner Filmpartnerinnen zu liieren, schloß Lorenz sowieso aus. Das wäre unsinnig gewesen. Seine Kolleginnen waren gefallene Prinzessinnen, die davon träumten, eines Tages in einem Ferrari aufzuwachen. Einem Ferrari, den sie dann selbst bezahlt hatten, aus so einer Art wachgeküßtem Prinzessinnenbankkonto.
Der Umstand, ohne echte Partnerin zu sein, hatte Lorenz über viele Jahre mit Wehmut erfüllt. Er empfand dies als eine Ungerechtigkeit. Als wollte man ihn dafür strafen, sich im Alter von zwanzig Jahren für das Pornogeschäft und gegen die Physik entschieden zu haben. Wobei er anfangs gemeint hatte, er könnte beides vereinen, sich zur Hauptsache seinem Studium widmen und ein wenig nebenher pornographieren. Doch er war mit seinem jungen, damals sehr viel weniger athletischen, sondern auf eine anmutige Weise magersüchtig wirkenden Körper gut angekommen bei den Produzenten (was das Publikum von seiner Erscheinung und seinen Leistungen hielt, blieb natürlich stets ein Geheimnis; er war ein Mann, er würde es nie zu einem Pornostar bringen, zumindest nicht in der heterosexuellen Sphäre, die zu verlassen er in keinem Moment bereit gewesen war). Er bekam mehr Aufträge, als er brauchte. Und nahm sie alle an. In Augenblicken leichter Berauschtheit kam es ihm vor, als könnte ihm die Pornographie helfen, die Welt zu begreifen. Und zwar sehr viel besser als die Physik. Das war ein Irrtum gewesen. Nun, vielleicht hätte es sich ebenso als Irrtum herausgestellt, auf die Physik zu setzen. Aber eines wäre ihm dank ihrer wohl eher gelungen, nämlich eine Partnerin fürs Leben zu finden, die üblichen Kinder zu zeugen und das übliche Haus in die Landschaft zu stellen. Statt dessen: ein kranker Schwertfisch, der um vier morgens durch sein Bett treibt und sich darüber klar wird, es endgültig satt zu haben.
»Ich werde aufhören«, sagte Lorenz. Und weil er das so vollkommen ernst meinte, konnte er sich zur Seite drehen und in einen Schlaf zurückfallen, der noch gute drei Stunden andauern sollte.
Als er erwachte, war der Tag da, groß und finster. Wie diese Polizisten im Film, wenn sie ihre schwarzen Lederschuhe in den Türspalt stellen und erklären, sie würden einen Dreck darauf geben, was in irgendeinem Gesetzbuch steht. Von wegen Durchsuchungsbefehl.
Nachdem Lorenz in einem benachbarten Park eine dreiviertel Stunde gejoggt war, ging er unter die Dusche, wo er abwechselnd heißes und kaltes Wasser über seinen Körper laufen ließ. Er betrachtete die makellos gleichförmige Struktur seiner Bauchmuskeln, diese armeeartige Formation, die Reihen enggeschlossener, dumpf dahinmarschierender Soldaten. Die üblichen Römer. Und man weiß aus »Asterix und Obelix«,wie wenig solche Soldaten ausrichten können gegen ein bißchen Zauberkraft. Gegen einen einzigen dicken Mann. Lorenz war verbittert. Nicht wegen des Anblicks, sondern darüber, daß ihm dieser Anblick so wenig bedeutete. Ja, dies war ein Bauch für die anderen, für die neidvollen Blicke der Männer und die sehnsüchtigen der Frauen. Doch es war kein Bauch, der Lorenz selbst zur Freude verhalf.
Und als Lorenz sich nun an den Fenstertisch in der Küche setzte und damit begann, verschiedene getrocknete Früchte, Haferflocken, Nüsse sowie eine in präzise Scheiben zerteilte Banane mit einem fettarmen Joghurt zu vermengen, da beschloß er, daß er ab morgen mit dieser Müslischeiße aufhören würde. Nicht, daß er vorhatte, sich in Zukunft dank gebratenem Speck den Magen und vor allem die Haut zu verderben. Auch sehnte er sich in keiner Weise nach jenen Wampen und Bäuchen und Umrundungen, an denen seine Altersgenossen so erfolgreich modellierten, aber er wollte nicht weiter eine Norm verfolgen, die allein seinem Beruf diente. Einem Beruf, den er, entsprechend einer um vier Uhr morgens getroffenen Entscheidung, an den Nagel hängen würde. Und zwar noch heute, gleich nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren. – Es gibt Dinge, die kann man nicht aufschieben. Es gibt Bomben, die man sofort entschärfen muß. Es gibt Insekten, die man lieber töten sollte, bevor sie einen stechen. Und nicht erst zuschlagen, wenn das Viech schon auf der Haut sitzt und man mittels des Schlags sich dessen Mundwerkzeug nur noch tiefer ins eigene Fleisch stößt. Man sollte also beim Töten nicht bloß auf die Verhältnismäßigkeit, sondern ebenso auf die Rechtzeitigkeit achten.
Kurz nach zehn betrat Lorenz Mohn das Haus, in dem der Film zu Ende gedreht wurde. Der Plot war denkbar einfach. Lorenz spielte darin einen Hollywoodregisseur, der sich auf der Suche nach der Idealbesetzung für einen Thriller befindet, einen Thriller mit dem Titel »Krieg der Frauen«. Und darum also sitzt er da in seiner Hollywoodvilla und empfängt eine angehende Schauspielerin nach der anderen. Woraus sich in Null Komma nichts die obligaten Körpersaftvermengungen ergeben. Dabei spielt ein gigantisches Sofa eine Rolle, dem eine mirakulöse Kraft nachgesagt wird, sprich, die Ermöglichung eines geradezu überirdischen Geschlechtsverkehrs. Was dann natürlich ein jedes Mal der Fall ist.
»Warum Hollywood?« hatte Lorenz gleich zu Beginn der Dreharbeiten gefragt. »Ich meine, dieses Zimmer hier, diese sogenannte Villa…so sieht es in Hollywood nicht aus.«
Aber das schien nun mal nicht das Thema des Streifens zu sein, wie es in Hollywood aussieht. Und die fehlende Authentizität filmischer Lokalitäten ist ja auch sicher kein Privileg von Pornostreifen. Zudem war Lorenz zwar ein Pedant, doch kein Nörgler. Er fragte sich nur, wofür man eigentlich die Requisite bezahlte.
Nun, das alles würde bald vorbei sein. Dies sollte der letzte Tag sein, an dem er sich solche Fragen stellen mußte.
Der Regisseur, der tatsächliche Regisseur, erklärte, worum es heute ging. Er nahm sich allerdings ziemlich ernst dabei. Er gehörte wohl auch zu denen, die vor zwanzig Jahren Kunst gemacht hatten. Lorenz hörte nur halb zu, zog sich in der Zwischenzeit aus und legte seine Kleidung sehr ordentlich auf einen Sessel. Dabei dachte er, wie nett es wäre, genau diese Handlung zu filmen, dieses akkurate Zusammenlegen der Kleidung, dieses Bemühen, keine Falten entstehen zu lassen, zumindest keine ungeplanten Falten.
Entsprechend den Anweisungen des Regisseurs setzte sich Lorenz auf das mit einem hellrosafarbenen Satinstoff bezogene monumentale Sofa, streckte seine muskulösen Arme über eine Gruppe pinguinartig gedrängter Polster, bildete mit den Beinen ein geknicktes V, spannte seine Bauchmuskeln an und zwang einen herausfordernden Blick in sein Gesicht. In erster Linie freilich bemühte er sich, nicht zu lachen. Darüber zu lachen, wie nun der Regisseur einer Frau mit feuerrotem Kunsthaar akribisch beschrieb, was sie längst wußte. Sie stand da, nackt bis auf die Perücke, die Hände in die geraden Hüften gestützt und verdrehte die Augen.
»Hör auf, Schätzchen, die Augen zu verdrehen«, sagte der Regisseur.
»Ich weiß schon«, sagte das Schätzchen, »daß Sie einmal mit Polanski zusammengearbeitet haben. Na und? Soll ich dem Lorenz jetzt einen blasen oder nicht?«
Die Sache mit Polanski war eher ein Witz. Niemand glaubte dem Regisseur, daß er allen Ernstes mit der Superlegende Polanski auch nur auf derselben Party gewesen war. Polanski, das klang wie Andromeda oder Kreuz des Südens, als spreche man von einer sehr fremden, sehr fernen Welt. Was aber niemand hier ahnen konnte, war, daß der Regisseur von »Sexsofa« (unter diesem Titel sollte der Film in die einschlägigen Kinos kommen) tatsächlich einst für Polanski tätig gewesen war, nämlich in jener frühen Produktion mit dem Titel »Wenn Katelbach kommt«, einer von diesen Geschichten, deren Sinn darin besteht, daß jemand kommt. Das ist überhaupt der Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne. In der Moderne hatten wir noch das Glück, auf jemanden zu warten, der sich niemals würde blicken lassen, ob er jetzt Godot oder Katelbach hieß oder bloß ein Linienbus war. Heute aber geschieht alles, alle kommen, jede Vorhersage wird erfüllt, übererfüllt; wenn ein Katelbach sich ankündigt, kommen nachher drei Katelbachs, jeder mieser und brutaler als der andere. Oder gütiger.
Moderne ist also, wenn jemand ausbleibt. Leider ist die Moderne tot (von den Linienbussen einmal abgesehen). Eine Sache, an der auch der Regisseur von »Sexsofa« nicht unwesentlich litt.
Wofür seine Schauspieler wenig Verständnis hatten. Die Frau mit der Perücke ließ sich nicht weiter abhalten und gab dem Skriptgirl ein Zeichen. Eine elektronische Klappe wurde betätigt. Der Regisseur war gewissermaßen überstimmt. Die Kamera lief, die Scheinwerfer leuchteten, das Mikro hing in den Raum. Die Perükkenfrau bewegte sich auf Lorenz zu und fragte, ob sie die Rolle der Vanessa in »Krieg der Frauen« bekommen würde. Lorenz antwortete, das habe nicht er zu entscheiden, sondern er. Dabei zeigte er mit einem gewürzten Lächeln auf sein aufgerichtetes Glied. Sofort ging die Rothaarige in die Knie, schob sich mit den gespreizten Fingern das Haar hinters rechte Ohr, öffnete ihren Mund und ergab sich dem Unweigerlichen. (Eines ist die Pornographie ganz sicher nicht, ein Hort überraschender Wendungen.) Auch der Kameramann ging in die Knie und bemühte sich, ins Bild zu bekommen, was nun mal in dieses Bild hineinmußte.
Während Lorenz da saß und die üblichen geistreichen Kommentare von sich gab, wie gut sie es ihm besorge (wo er doch in Wirklichkeit gelernt hatte, sein Glied praktisch zu hypnotisieren, ja selbiges in eine lang anhaltende künstliche Steifheit zu versetzen, ganz in der Art einer zwischen zwei Sesseln gespannten Person im Varieté), währenddessen also fiel Lorenz’ Blick auf eine Frau, die im hinteren Teil des Raums in einem Fauteuil saß. Lorenz wußte, daß es sich um eine weitere Darstellerin handelte, mit der zusammen ein Dreier geplant war, eine aktionsreiche Verdeutlichung der Krieg-der-Frauen-Thematik. Eine recht üppige Blondine, deren schwere Brüste in einem fleischfarbenen Büstenhalter einsaßen. Das war jetzt nämlich wieder Mode, diese BHs aus Großmütterzeiten, die wie eine Form von Mimikry funktionierten – die Haut vortäuschend, die sie verbargen. Die Frau machte keine Anstalten, herüberzusehen, sondern hatte ihren Blick auf das Strickzeug zwischen ihren Händen gerichtet, auf das kirschrote Wollstück, an dem sie gerade arbeitete. Schwer zu sagen, was es war. Beziehungsweise was am Ende dieser Arbeit stehen sollte. Vielleicht ein Schal oder ein Pullover, wohl eher ein Pulloverchen, etwas für kleine Kinder oder kleine Hunde.
Seit diesem Moment um vier Uhr morgens, als sich Lorenz entschlossen hatte, sein Pornodarstellerdasein aufzugeben, war die Frage im Raum gestanden, was er statt dessen tun würde. Denn leider hatte er es zu keinem Vermögen gebracht, von dem er hätte zehren können. Abgesehen davon, daß er sich ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen konnte. Vielmehr war ihm vom Beginn seiner Entscheidung an klar gewesen, daß er einen Beruf ergreifen wollte, der seinem bisherigen diametral entgegenstand. Nicht jedoch aus moralischen Gründen, denn vorzuwerfen hatte er sich nichts. Er hatte in keiner Weise etwas Unanständiges getan, niemanden geschädigt oder betrogen, so wie es im modernen Geschäftsleben geradezu zum guten Ton gehörte. Die Filmproduktionen, an denen er beteiligt gewesen war, hatten niemals den Bereich des Legalen verlassen. Nein, wenn er sich etwas vollkommen Andersgeartetes wünschte, dann geschah dies im Sinn einer Evolution, wie bei einem Wesen, das nach einem Leben im Wasser ans Ufer kriecht, Füße ausbildet und sich in ein Landtier verwandelt. Oder umgekehrt. Und wenn also zuvor gesagt worden war, Lorenz Mohn sei ein Schwertfisch, so hatte er jetzt beschlossen, sich zu etwas zu entwickeln, was in keinem Punkt – zumindest nicht auf den ersten Blick – an einen solchen Schwertfisch erinnerte. Statt dessen wollte er die Karriere eines Landsäugetiers einschlagen. Und zwar eines undramatischen Landsäugetiers.
Der Anblick dieser Frau, die da seelenruhig an einem roten Ding strickte, während wenige Meter entfernt von ihr eine fiktive Erregung ablief, an der sie sich auftragsgemäß demnächst würde beteiligen müssen, dieser Anblick brachte Lorenz auf die richtige Idee. Auf die Idee nämlich, daß es Stricksachen, Knöpfe, Häkelzubehör, Nähzeug, vor allem aber in sämtlichen Farben erstrahlende Wollfäden sein würden, die sein zukünftiges Leben bestimmen sollten.
Er beschloß also in diesem heiligen Moment, ein Handarbeitsgeschäft zu gründen, jawohl, einen kleinen, gemütlichen, warmen Laden mit Regalen und Fächern bis zur Decke, in denen man die ganze Skala der Farben unterbringen konnte, vom reinsten Weiß bis zum dichtesten Schwarz, von der im Sonnenlicht gleißenden, schneebesetzten Bergspitze bis zur tiefsten, in ewige Nacht eingehüllten Stelle im Meer. Genau so würde er es anlegen: in der obersten linken Ecke das erste Weiß und in der rechten untersten Ecke das letzte Schwarz. Und dazwischen, in der schönsten Ordnung ihrer Abstufungen, die Farben, gepackt in weiche, handliche Knäuel. Knäuel, die mehr Zufriedenheit und Glück in das Leben der Frauen brachten als Männer und Beruf und Fitneß und Hormone.
Nicht, daß sich Lorenz plötzlich als Idealist fühlte und eine Weltrettung mittels des Glücks der Frauen im Sinne hatte. Aber zu einem guten Laden, einem funktionierenden Geschäft gehörte naturgemäß die Zufriedenheit der Kundschaft, und diese Kundschaft würde im Falle von Näharbeit und Strickarbeit und Häkelei und Klöppelspitze nun mal in erster Linie weiblich sein. Ein Faktum, welches eine bemerkenswerte Verbindungslinie zwischen Lorenz’ alter und neuer Tätigkeit bildete, eine Achse zwischen den Extremen, einen perfekten Antipodendurchstoß.
Welch besänftigende Vorstellung war es doch, die Frauen in Zukunft auf eine ganz andere Weise zu befriedigen. Keine hyperpotente Fickmaschine mehr zu sein, auch kein Mann, der bloß für eine Nacht taugte, bloß für einen Orgasmus, der nicht viel länger dauerte, als dreimal »Grüß Gott!« gesagt zu haben. Nein, Lorenz wollte als ein Meister der Wolle fungieren, dafür geliebt und verehrt werden, so gut wie jede Farbe anbieten zu können, und zwar auf engstem Raum. Eng darum, weil es sich um ein kleines Geschäft handeln mußte.
Warum denn klein? Lorenz hätte es nicht sagen können, aber so war es eben. Er schaute in die Zukunft, und dort in der Zukunft sah er halt keinen großen, sondern einen kleinen Laden.
Die Frau, die ihn auf diese wundervolle Idee gebracht hatte, legte nun mit einem sichtbaren Ausdruck des Bedauerns ihr Strickzeug zur Seite, erhob sich und ging daran, quasi ins Bild zu steigen. Sie setzte sich neben Lorenz aufs Sofa, zog die Schalen ihres Büstenhalters herunter und klemmte sie in den Ansatz ihrer Brüste. Dann schob sie Lorenz ihr helles Fleisch entgegen. Der Regisseur schnitt dazu Grimassen, die ihr signalisieren sollten, daß sie ruhig ein wenig mehr Leidenschaft zeigen könne und nicht so zu tun brauche, als lege sie sich einen ungeliebten Säugling an die Brust.
Lorenz aber konnte die Frau gut verstehen. Wieviel besser war es – um nun endlich dieses Wortspiel zu verwenden –, zu stricken statt zu ficken. Und weil Lorenz dies so gut verstehen konnte, wurde ihm jetzt klar, daß er diese Szene nicht zu Ende spielen konnte. Er hatte bereits das Ufer erreicht, war kein Schwertfisch mehr. Denn auch wenn ein solches Handarbeitsgeschäft noch gar nicht existierte, so bestand es bereits in einer theoretischen Weise. Und eine gute Theorie ist mehr wert als eine schlechte Praxis. Lorenz Mohn war der sich selbst vorausdenkende Besitzer eines idealen kleinen Ladens, und darum konnte er nicht mehr der reale Darsteller in einem Pornofilm sein. Das, was hier geschah, das träumte er bloß. Und aus einem Traum konnte man schließlich aufwachen. Man brauchte sich nur einzubilden, daß ein Wecker läutete.
Und genau das geschah in diesem Moment. Der Wecker war nicht zu überhören.
Lorenz schob die Frau, die über seinem Unterleib kniete, fürsorglich von sich herunter. Sie sah ihn verwundert an und erkundigte sich, als sei sie nicht in einem Film, sondern im wirklichen Leben: »Kommt’s dir schon?«
»Du, ich habe zu tun. Sei nicht böse.«
Er verabschiedete sich freundlich von den beiden Frauen, wobei er eine Höflichkeit einsetzte, die sich bereits darauf bezog, es hier mit zukünftigen Kundinnen zu tun zu haben. Sodann trat er aus der Szene, zog sich an und verließ den Raum, ohne in irgendeiner Weise auf den geradezu dirigentenhaften Wutausbruch des Regisseurs zu reagieren. (Allerdings auch nur darum, weil dieser Mann mit größter Wahrscheinlichkeit niemals zu seiner, Lorenz’, Kundschaft zählen würde.)
Lorenz trat hinaus auf die Straße. Es war Juli, so wie man sagt: Migräne ist kein Spaß. Seit Wochen wackelte das Wetter hin und her, mal kühl, mal heiß, mal unentschlossen. Die Wetterfühligen fühlten sich verfolgt. Aber wer hielt sich nicht für wetterfühlig? Es gab fast so viele Wetterfühlige wie Weinkenner und Fußballalleswisser. Lorenz blickte zu einem klaren blauen Himmel hoch, welcher aussah, als hätte er nichts anderes vor, als ein paar Pflanzen zum Sprießen zu bringen und einige Früchte in der warmen Luft zu backen. Lorenz dachte an sein Geschäft, seinen Laden. Seinen Laden als Liebling der Frauen.
Ein Geschäft braucht nun in erster Linie einen Namen. Und weil man es bei einem Handarbeitsladen glücklicherweise nicht mit einer Gaunerei zu tun hat, bestand kein Grund, eine dieser harten Kombinationen auszuwählen, die alle wie »Deutsche Bank« oder »Auf die Knie, ihr versicherten Würmer!« klingen oder sich in rätselhaften Abkürzungen ergehen. Logischer- und sinnigerweise dachte Lorenz natürlich wie alle Kleingewerbetreibenden sofort an seinen eigenen Namen: Mohn. Und ebenso rasch und unbekümmert überlegte er, seinen Laden Mohns Haupt zu nennen.
Im Spazierengehen aber erinnerte er sich daran, daß doch eine RAF-Terroristin so oder so ähnlich geheißen hatte. Er persönlich hatte nichts gegen diese Leute. Oder besser gesagt, es war ihm gleichgültig, was damals geschehen war, dieser Spezialkrieg, diese Familienfehde. Aber selbstverständlich wollte er keinen Namen für sein Geschäft wählen, welcher in irgendeiner Weise eine Verbindung zum Schmutz der Politik herstellte. Es ging ihm ja genau um das Gegenteil von Schmutz. Es ging ihm um absolute Reinheit, die nur in einer gewissen Weltferne ihren Ausdruck finden konnte. Denn das Stricken und Häkeln und sogar noch das Löcherstopfen und das Knöpfeannähen waren nun mal weltferne Tätigkeiten, heutzutage, da die wenigsten Kinder noch selbstgestrickte Pullover trugen und man eher ein neues Hemd kaufte, als einen Knopf anzunähen. Nur für Babys, ja für Babys konnte man noch stricken. Aber gerade Babys waren ziemlich weltferne Wesen.
Es mußte also ein Name her, der das Weltferne verkörperte. Was aber ist denn weltfern? Außer Babys. Nun, Inseln sind weltfern. Und noch weltferner sind die äußeren Planeten. Über das Sonnensystem hinauszugehen wäre wiederum Unsinn gewesen. Selbst die Weltferne hat ihre Grenzen. Daran wollte auch Lorenz sich halten.
Weil er nun zu denen gehörte, die noch mit neun Planeten aufgewachsen waren und nicht wie heute mit acht und er aus Überzeugung die Knauserigkeit von Leuten ignorierte, die einfach einen Planeten durchstrichen, als hätten sie dazu irgendeine Befugnis, darum also dachte Lorenz daran, sich des neunten und fernsten Planeten im Sonnensystem zu bedienen. Wobei es ihn überhaupt nicht störte, daß dessen Name auf den Totengott, den Herrscher der Unterwelt verwies. Denn welche Weltferne wäre perfekter als der Tod?
Man kann zudem sagen, daß Stricken und Nähen eine Verbindung des Weltfernen mit einem zutiefst menschlichen Harmoniebedürfnis darstellen. Und da sich Lorenz gerne einen handarbeitenden Totengott vorstellte, ergab sich der Name für sein zukünftiges Geschäft wie von selbst: Plutos Liebe.
Bei alldem wäre freilich zu erwähnen, daß Lorenz Mohn nie in seinem Leben eine Strick- oder Nähnadel oder sonst ein Handarbeitsgerät in Händen gehalten hatte. Aber was soll’s? Der Gott der Toten war ja wahrscheinlich auch noch nie tot gewesen.
2 | Wie aus einem »y« ein »i« wird
Es soll hier in keiner Weise behauptet werden, daß die Pornoindustrie und die Unterwelt notwendigerweise miteinander verbandelt sind. Dennoch war es so, daß Lorenz im Laufe der Jahre Leute kennengelernt hatte, die sich zwar allesamt als Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen bezeichneten, dieses auch waren, doch deren Geschäftspraktiken man nur schwer mit einem bürgerlichen Gesetzbuch in Einklang bringen konnte, selbst wenn deren Anwälte genau das hinbekamen.* [* Der Paläontologe James Farlow hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht – inspiriert von einer nicht minder dankenswerten Szene aus »Jurassic Park« –, zu berechnen, wie viele Anwälte ein erwachsener Tyrannosaurus rex jährlich verspeisen müßte, um zu überleben. Bei einem Warmblüter kam er auf die Zahl 292, bei einem Kaltblüter waren es 77 Anwälte. Man darf also sagen, daß die Anstrengungen, Saurier zum Leben zu erwecken, mit noch größerer Intensität betrieben werden sollten. Und es wichtig wäre, darauf zu achten, daß bei der ganzen Sache schlußendlich warmblütige Tyrannosaurier herauskommen.]Man könnte freilich sagen, daß derartiges für so gut wie jede geschäftliche Aktivität galt, ja daß Saubermänner in die Drogenhilfe und Altenpflege gehörten und nicht in eine der Auslese, dem Rivalen- und Revierkampf verpflichtete freie Marktwirtschaft. Trotzdem war es noch immer ein Unterschied, ob jemand seinen Kredit bei einer Bank aufnahm oder etwa bei einer Frau, die sich Claire Montbard nannte und die wegen ihrer Methoden der Geldeintreibung eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte. Die Berühmtheit ergab sich daraus, daß niemand genau wußte, wie Frau Montbard sich ihre Schuldner gefügig machte. Aber es funktionierte.
Es schien dabei keineswegs so zu sein, daß Claire Montbard den säumigen Kreditnehmern die Zähne ausschlagen ließ oder damit drohte, jemanden aus deren Familie entführen zu lassen. Man konnte nur feststellen, daß Personen, die sich von ihr Geld ausgeborgt hatten – und es waren nicht wenige in dieser Stadt –, niemals versuchten, dieses Geld schuldig zu bleiben. Und das mußte als ein echtes Wunder gelten. Denn so hart die Methoden offizieller wie inoffizieller Schuldeneintreibung auch sein mochten, viele Schuldner ließen sich immer wieder auf gefährliche Spielchen ein, versuchten, die Gläubiger auszutricksen, anzuwinseln, weichzuheulen, riskierten schon mal körperliche Zugriffe… Hingegen kam niemand auf die Idee, Claire Montbard austricksen oder anheulen zu wollen. Sie war auf eine namenlose Weise gefürchtet.
Ein vernünftiger Mensch wird jetzt sagen: Na, da gehe ich aber lieber zu einer Bank. Und das tun ja vernünftige Menschen in der Regel auch. Interessanterweise bringen sich einige von ihnen später um. Andere werden verrückt und bringen zwar nicht sich selbst um, dafür aber ihre Familie. Die Mehrheit allerdings kommt ohne Mord aus, versinkt bloß in einem Strudel von Problemen. Und dann gibt es nicht zuletzt die, welche die Rückzahlung ihres Bankkredits vollkommen unversehrt überstehen. Die gibt es immer, wir kennen sie…also, wir kennen meistens einen oder einen vom Hörensagen – so wie wir ja auch einen kennen, dessen Kinder vom ersten Tag an durchgeschlafen haben, oder so wie man früher einen kannte, der einen Juden versteckt hatte, sodaß sich die Frage stellte, wo eigentlich alle diese versteckten Juden hingekommen sind.
Ja, so war das mit den Bankkrediten.
Und weil nun noch dazukam, daß Banken nicht jedermann in den Genuß einer solchen Buße kommen ließen, ergab sich für Lorenz Mohn – der über kein Vermögen verfügte, lediglich eine kleine Eigentumswohnung besaß – die Überlegung, ob es nicht besser sein würde, wegen eines Darlehens bei Frau Montbard vorzusprechen. Keiner ihrer Kreditnehmer hatte sich umgebracht, keiner war in den Ruin geschlittert. Blieb allein der markante Umstand, daß auch keiner von ihnen je ein Wort über die Kreditgeberin verloren hatte, während ja umgekehrt konventionelle Schuldner ständig ihre Haßtiraden gegen die Geldinstitute und die ganze Geldwirtschaft verlautbaren.
Frau Montbard hatte einige der Filme mitproduziert, in denen Lorenz aufgetreten war. Wozu glücklicherweise nicht derjenige gehörte, dessen letzte Szene er soeben geschmissen hatte. Was allerdings kein echtes Problem darstellte, da es ja bloß um eine letzte Einstellung ging, in welcher man nicht unbedingt Lorenz’ Gesicht sehen mußte. Und auch wenn Männer das gar nicht gerne hören, muß gesagt werden, daß Schwänze lange nicht so unterschiedlich sind, wie gerne angenommen wird.
Lorenz war Claire Montbard bei der einen oder anderen Party begegnet, aber sie hatten nie ein Wort miteinander gewechselt. Wenn Lorenz jetzt daran dachte, sich ausgerechnet an diese dubiose Person wegen eines Darlehens zu wenden, dann aus zwei Gründen. Erstens vermutete er, daß eine Frau seinen Übertritt von der Pornographie zur Strickware eher verstehen würde. Und zweitens war ihm die Vorstellung einer mysteriösen Macht, die von dieser Frau ausging, lieber als das Risiko, welches sich im Falle der üblichen Kredithaie und kriminellen Geldverleiher ergab. Er fürchtete mehr das Zähneausschlagen als eine quasi metaphysische Bedrohung. Das war natürlich ein bißchen naiv, sich vor Dingen zu ängstigen, die man sah, und jene zu unterschätzen, die man nicht sah. Als wäre die unsichtbare Tiefe eines Gewässers dazu angetan, nicht unterzugehen. Doch Lorenz genehmigte sich eine solche Naivität. Ja, er würde Claire Montbard um Geld bitten.
Zuerst aber wollte er ein geeignetes Geschäftslokal finden. Und weil er das Bedürfnis hatte, soviel wie möglich an diesem einen Tag zu erledigen, zumindest die wichtigsten Entscheidungen zu treffen, marschierte er durch die Stadt, vollkommen überzeugt, daß sich ihm der einzig richtige, der einzige in Frage kommende Laden praktisch von selbst offenbaren würde, daß dieses Geschäft – gleich, was darin bisher untergebracht gewesen war – nur darum existierte, um diesem einen Zweck zu dienen: Plutos Liebe zu beherbergen.
Gerne hätte Lorenz die Augen geschlossen, um sich besser auf den unsichtbaren Faden zu konzentrieren, der ihn leitete. Leider stand diesem Ansinnen der Straßenverkehr im Wege, welcher im übrigen so gut wie jedem Ansinnen im Wege steht. Während nämlich in der Tat eine schicksalhafte Bindung zwischen Menschen und Orten gegeben ist, eine schnurartige Passage, vor allem aber auch zwischen Menschen und Menschen sowie Menschen und Tieren, bildet der Straßenverkehr eine gleichzeitig gottlose wie unnatürliche, von keiner Evolution vorausgesehene oder eingliederbare Barriere. Der Straßenverkehr ist sehr viel weniger darum so schlimm, weil er unsere Luft verpestet, sondern weil er verhindert, daß Dinge und Lebewesen zueinanderkommen, die füreinander bestimmt sind. Würde der Straßenverkehr fehlen, könnten sich jene Menschen begegnen, die gemäß einem logischen Plan sich versprochen sind und wie kosmische Brocken aufeinander zu fliegen. So aber müssen sie ständig dem Verkehr ausweichen, Umwege nehmen, mit dem Wahnsinn der Fahrer rechnen, kontrollierte Übergänge aufsuchen…oder sie sitzen selbst in einem Wagen, fabrizieren selbst die Barrieren, die ein solch fatales Unglück in ihr Leben tragen. Der Verkehr ist ein Teufelsding, viel schlimmer als der Umweltschutz und die Parkplatzjammerer meinen.
Das wußte Lorenz. Zumindest ahnte er es in diesem besonderen Moment. Rang also um höchste Konzentration. Und versuchte, nach einer jeden durch den Verkehr erzeugten Unterbrechung den Faden wieder neu aufzunehmen. Denn auch wenn ein solcher Faden unsichtbar war, so besaß er dennoch eine gewisse Spannung, eine durch den Zug zwischen A und B sich ergebende Elektrizität. Etwas, was viele Leute mit Magie verwechselten. Es gibt nichts Übernatürliches, es gibt nur Dinge, die, will man sie erkennen, ein gutes Meßgerät benötigen. Vielleicht eines, das noch gar nicht erfunden wurde.
Lorenz aber folgte auch ohne eine derartige Apparatur dem angespannten Faden, folgte der Elektrizität und tat dies mit offenen, freilich in sich geschlossenen Augen, die Beachtung des Straßenverkehrs auf ein Mindestmaß, ein Überlebensmaß reduzierend. Wobei er zwischendurch immer wieder erschöpft auf einer Bank Platz nehmen mußte oder sich gegen eine Häuserwand lehnte. Seine im Laufsport erarbeitete Ausdauer nutzte jetzt nichts. Hier war eine andere Kondition gefragt. Immerhin konnte er sich solche Pausen gönnen, da es sich bei seinem Ziel nicht um einen seinerseits bewegten, seinerseits ständig dem Verkehr ausweichenden Menschen handelte, sondern um ein still auf seinem Platz stehendes Haus.
Es war bereits spät am Nachmittag, als Lorenz im Rücken einer Kirche zu halten kam. Er befand sich im Schatten des Turms wie unter einem breiten Schiffsrumpf. Von der rechten Seite fiel rötliches Licht auf den mit Pflastersteinen ausgelegten Boden, ebenso auf die Fassaden nahtlos verbundener alter Häuser. Der Lärm des Verkehrs kam von der Vorderseite der Kirche. Hier hinten jedoch durften keine Autos fahren, es handelte sich um eine reine Zone für Fußgänger und Tauben. Man hätte also auf dieser nicht allzu langen Straße einen Faden zwischen zwei Menschen spannen können, die sich sodann kaum noch hätten verfehlen, ja die sich beim besten Willen nicht hätten ausweichen können. Aber welcher Gott wäre so gütig gewesen, zwei zusammengehörende Menschen zur gleichen Zeit in eine solche Gasse zu führen? Ein solches Gäßchen, eine Pflastersteinidylle?
Mit Häusern war es da einfacher. Lorenz erkannte es sofort, das kleine Geschäftslokal in dem mit einem kalten, grauen Rosa bestrichenen schmalen Gebäude, einem einfachen, glatten Bau, der mit erstaunlicher Kaltblütigkeit zwischen zwei historische Häuser gezwängt worden war, derart, daß man den Eindruck bekommen konnte, es handle sich um die simple Füllung einer Lücke, wie man Fugen mit Polyester füllt oder zwei Tortenteile mit einer Cremeschichte verbindet. Es war also so, daß Lorenz’ zukünftiger Laden zwar an einem verträumten, weltfernen Ort lag, aber ausgerechnet im einzigen häßlichen Gebäude der Straße. Das Lokal selbst bestand nach vorne hin aus zwei kurzen Auslagenscheiben und einer mittigen Eingangstüre, die alle in einen gemeinsamen Raum wiesen. Dieser leere Raum war nicht ganz so klein, wie es Lorenz erwartet hatte. Aber sicherlich klein genug. Ganz abgesehen davon, daß er natürlich genau die Größe besaß, die er besitzen mußte.
Dem oben auf der Fassade angebrachten Schild nach zu urteilen, war zuletzt eine Bäckerei hier ansässig gewesen. Keine von den bekannten Ketten, sondern eine Bäckerei Nix. Netter Name, dachte Lorenz. Mehr dachte er nicht. Hätte er jedoch über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen bezüglich der äußeren Zone unseres Sonnensystems Bescheid gewußt, wäre er doch sehr verblüfft gewesen ob dieses Namens. Beziehungsweise hätte er begriffen, daß sein Eindruck, an einem Faden zu diesem Lokal hingeleitet worden zu sein, mehr als ein bloßes Gefühl bedeutete. Es war nämlich so, daß die NASA – auch so eine Abkürzung, hinter der eigentlich nur eine Verschwörung stecken kann –, daß die NASA also erst im Oktober 2005 die Entdeckung zweier weiterer Plutomonde verlautbart hatte. Und daß im Juni 2006 die IAU (dieselben Mafiosi, dank derer Pluto um seinen Planetenstatus gebracht worden war) dem größeren der beiden kleinen Monde den Namen Nix gegeben hatte. Der Name bezog sich auf Nyx, die Königin der Nacht. Allerdings hieß so bereits ein Asteroid mit der Nummer 3908. (Das war, als wäre eine kleine häßliche Rauhhaardackeldame mit einer vierstelligen Steuernummer auf den Namen Madonna getauft worden, bevor noch eine nicht minder rauhhaarige amerikanische Sängerin auf diese Idee hatte kommen können.) Jedenfalls war man gezwungen gewesen, das »y« durch ein »i« zu ersetzen, um diesen Namen verwenden zu können. Worauf man keinesfalls hatte verzichten wollen, da die Göttin der Nacht auch als die Mutter von Charon fungierte, jener Charon, nach welchem Plutos größter Mond benannt war.
Wenn man nun bedachte, daß es die Bäckerei Nix gar nicht mehr gab und deren Gründung mindestens ein paar Jahre zurückliegen mußte, als niemand hatte ahnen können, daß dort oben zwei weitere Plutomonde existierten und man aus einem mythologischen Zusammenhang heraus bei der Namensgebung des einen Mondes orthographisch ein wenig würde schummeln müssen, und wenn man zudem bedachte, daß Lorenz Mohn erst kurz zuvor auf die Idee gekommen war – aber eben noch weit weg von diesem Ort –, seinen zukünftigen Kurzwarenladen Plutos Liebe zu nennen, ja dann mußte einem der Gedanke kommen, daß es so etwas wie eine ordnende Kraft gab, eine Kraft, die Zufälle hervorbrachte, die dann also gar keine Zufälle waren.
Doch wozu? Nur, weil Ordnung schöner war als Unordnung? Oder steckte vielleicht sogar eine Bösartigkeit dahinter, ein raffiniertes Manöver, mit dem Ziel irgendeiner Zerstörung oder Demütigung?
Es war wohl besser, daß Lorenz den Nix-Nyx-Charon-Pluto-Zusammenhang nicht erkannte. – Besser für wen?
Am nächsten Tag rief Lorenz einen Freund an, von dem er wußte, daß er hin und wieder mit Claire Montbard zu tun hatte.
»Ich würde dir nicht empfehlen, dich mit dieser Frau einzulassen«, sagte der Freund.
»Wie?« staunte Lorenz. »Aber du hast dich doch auch mit ihr eingelassen!«
»Na, warum glaubst du, daß ich dich warne?«
»Was ist denn so schrecklich an ihr?« fragte Lorenz.
»Das kann man nicht erklären«, antwortete der Freund. »Man muß es selbst herausfinden. Oder es bleibenlassen. Wozu ich dir nur raten kann. Es ist nicht nötig, alles zu wissen.«
Lorenz ignorierte die Warnung und verlangte eine Telefonnummer.
»Du denkst wohl, jeder hat ein Recht auf sein eigenes Unglück«, meinte der Freund.
Was Lorenz aber wirklich dachte, war, daß Montbards unheimlicher Ruf eine bloße Legende darstellte. Etwas, mit dem Leute, die sie kannten, ein wenig angeben konnten. Ohne etwas Konkretes in der Hand zu haben. Das Konkrete existierte einfach nicht. (Wie so häufig. Die meisten Ereignisse, die kolportiert werden, sind pure Erfindung. Würde man sich die Mühe machen und einmal nachrechnen, könnte man feststellen, daß viel Berichtetes zeitmäßig gar nicht möglich ist, etwa Politiker, welche das und das dort und dort gesagt haben sollen. Leute, die gleichzeitig bei einer Grundsteinlegung dabei sind und im Bundestag reden. Als verfügten sie über professionelle Doppelgänger.)
»Also gut«, servierte der Freund ein Seufzen. »Ich gebe dir eine Nummer, mit der du es versuchen kannst: 134340.«
»Danke dir«, sagte Lorenz.
»Wofür?« Der Freund legte auf.
Sofort gab Lorenz die sechs Ziffern ein. Ein Mann meldete sich mit einem »Ja!«, welches genügend Energie besaß, um damit eine Brotschneidemaschine zu bedienen. Zumindest eine Scheibe lang.
»Ich würde gerne mit Frau Montbard sprechen. Mein Name ist Lorenz Mohn.«
»Sie sind dieser Schwanzlutscher, was?«
»Nein, im Gegenteil…« Aber wozu sollte er sich einem Mann erklären, dessen subalterne Aufgabe es offensichtlich war, das Telefon zu bewachen. »Können Sie mich verbinden oder nicht?«
»Ich schaue mal…«, sagte der Mann.
Dann war eine Weile Ruhe. So eine rauschende Ruhe, wie man sich vorstellt, daß es im Weltraum tönt. Wenn das Nichts murmelt.
Lorenz dachte schon, er wäre auf ewig auf ein Abstellgleis verbannt worden, als sich endlich eine Frau meldete. Sie schien Unhöflichkeit nicht nötig zu haben. Ihre Stimme besaß das Timbre von Wasser. Wasser klingt auf eine geschmeidige Weise selbstsicher und auf eine erhabene Weise rücksichtsvoll. Frau Montbard bat um Entschuldigung für die lange Wartezeit. Dann fragte sie: »Sind Sie der Lorenz Mohn vom Film?«
Das war sehr nett von ihr, es so gesagt zu haben. Lorenz antwortete: »Bis gestern. Ich habe damit aufgehört.«
»Das ist wahrscheinlich vernünftig. Ich glaube auch nicht, daß der Pornographie die Zukunft gehört.«
»Exakt darum belästige ich Sie«, sagte Lorenz. »Einer Zukunft wegen, in der die Pornographie keine Chance hat.«
»Na, ich hoffe, Sie wollen die Zukunft nicht retten. Da müßten Sie nämlich in Hollywood anrufen.«
»Es geht allein um meine persönliche Zukunft.«
»Brauchen Sie Geld?«
»Ich würde Ihnen gerne erst einmal erzählen, was ich im Sinn habe«, sagte Lorenz.
»Mein Gott, sind Sie denn unter die Erfinder gegangen?«
»Es ist ganz undramatisch«, versicherte Lorenz.
»Warum wenden Sie sich gerade an mich, Herr Mohn?« fragte die Frau mit der Wasserstimme, die natürlich nichts von einem Wasserfall hatte. Eher reines Wasser in einem sauberen Glas. Beinahe bewegungslos.
»Man hat mir dazu geraten«, log Lorenz.
»Ach!?« sagte Montbard, wie man sagt: Die Flugangst ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Dann schwieg sie. Das Schweigen dehnte sich zur kleinen Pause. Aber es war sicher nicht so, daß Claire Montbard überlegte. Sie gehörte nicht zu denen, die nachdenken mußten. Bei ihr war das scheinbare Nachdenken bloß eine Geste an die Welt, welche Nachdenklichkeit für eine Stärke hielt, einen Prozeß des Erkennens. Dabei war es fraglos so, daß man etwas sofort erkannte oder überhaupt nicht. Denn, bitte, wie lange mußte jemand auf einen Tisch schauen, um die daraufstehende Schale zu entdecken? Wenn der Betreffende wiederum blind war, konnte er schauen, bis er tot umfiel. – Claire Montbards Entscheidung war also längst gefällt. Sie wartete noch ein wenig, dann sagte sie: »Sagen wir Montag, fünfzehn Uhr. In meinem Haus. Das ist Ihnen doch recht?«
»Wunderbar!« meinte Lorenz.
»Hat Sie denn eigentlich gar keiner vor mir gewarnt?« schickte Montbard eine Frage hinterher, wie einen kleinen Wind, der Kerzen ausbläst und Seemänner tötet.
Lorenz antwortete: »Wenn Sie erlauben, ich glaube nicht, daß Sie der Teufel sind.«
Sie lachte. Nettes Lachen. Was konnte einem ein solches Lachen sagen? Daß die Welt gar nicht so böse war, wie alle meinten? Daß die Welt vielleicht sogar noch viel schlimmer war?
Lorenz jedenfalls – der seit ein paar Stunden gerne in Strickwaren dachte – erschien dieses Lachen als ein leichtes, weißes, gehäkeltes Häubchen, das allen Gram zudeckte. Unter dem Häubchen mochte der Gram weiterkochen und weiterbrodeln, er hatte indes keine Chance. Das Häubchen war massiver als jeder Kern.
»Ich werde pünktlich sein«, sagte Lorenz. Er war voller Zuversicht.
Der Montag kam. Lorenz verbrachte die erste Tageshälfte im Bett. Dann stand er auf, machte sich hübsch, schlüpfte in einen leichten Anzug und verließ das Haus. Nach den vergangenen heißen Tagen war es ausgesprochen kühl geworden. Ein einzelner Tropfen benetzte Lorenz an der Schulter, bevor er in seinen Wagen stieg. Er fühlte sich getroffen. So in der Giftpfeilart.
Lorenz kannte die Adresse der Frau Montbard, wenngleich er noch nie in ihrem Haus gewesen war. Eine Jugendstilvilla, die deutlich die Spuren eines Jahrhundertalters trug. Natürlich war im Laufe der Zeit die eine oder andere Restaurierung vorgenommen worden, allerdings so, wie man sich ein bißchen Nivea ins Gesicht schmiert, wenn schon mal eine Dose davon in der Nähe steht, eben ohne System. Pflege als Zufall, und zwar als wirklicher Zufall. So sehen die meisten Leute dann ja auch aus.
Im Unterschied jedoch zu diesen bloß im Vorbeigehen und Vorbeischmieren gepflegten Gesichtern besaß Montbards Villa einen beträchtlichen Charme. Den Charme des Ungesunden. Das Ungesunde spiegelte sich vor allem im bröckeligen Fassadenschmuck wider, gleich einer künstlerischen Pose, die da sagt: »Richtig, ich bin krank. Doch was wäre schöner, als krank zu sein?«
Das Gebäude war umsäumt von hohen silbrigen Weißtannen, die den schwindsüchtigen Charakter der Architektur noch verstärkten, ein milchiges Licht produzierten, in dem alles gefangen schien. Die hohen Fenster waren zur Straße hin von dunkelgrünen Fensterläden abgedeckt. Man hätte ebenso meinen können, daß hier gar niemand mehr wohne. Am Tor fehlte die obligate Kamera, die so gut wie jedes Haus dieser Gegend kennzeichnete, eine der vornehmsten der Stadt.
Ein Haus frei von Überwachungssystemen war so ziemlich das Unheimlichste, was man sich in solcher Umgebung denken konnte. Denn entweder lebten in einem derartigen Gebäude Gespenster, oder es lebten darin Leute, die keinen Schutz nötig hatten, keine Kameras, sowenig wie scharfe Hunde oder eine Alarmverbindung zur Polizei (und es bestehen ja durchaus Situationen, in denen es einem Einbrecher, der von wehrhaften Hausbesitzern ertappt wurde, sehr viel lieber wäre, die Polizei würde kommen und einen kontrollierten Gang der Dinge ermöglichen).
Nein, Claire Montbard brauchte tatsächlich weder Polizei noch Hunde. Man wußte, wer sie war. Nicht etwa die Königin der Unterwelt, dazu waren ihre Aktivitäten viel zu moderat. Sie handelte nicht mit Menschen, nicht mit Rauschgift, nicht mit Müll, kaufte keine Politiker und ließ niemanden liquidieren, aber sie hatte ihre Finger in einer großen Zahl von Transaktionen. So wie jemand, der sich nicht zum Kochen, sondern nur zum Würzen herabläßt. Sie machte keine illegalen Geschäfte, sondern investierte bloß in selbige: Sie adelte diese Geschäfte. Wenn die großen Organisationen Claire einluden, sich an einer bestimmten Sache zu beteiligen, dann nicht, weil man ihr Geld nötig hatte, sondern weil man solcherart ihren Beistand erwarb, den guten Geist, den sie in die Dinge zu legen verstand. Dinge, welche sodann etwas von ihrem kriminellen Charakter verloren. Ein wenig wie bei einem gefälschten Bild, das jedoch nicht vom Fälscher, sondern vom Künstler des Originals signiert wird. Somit zwar nicht aufhört, eine Fälschung zu sein…aber was für eine Fälschung!
Claire Montbard war keine Königin, eine Instanz sehr wohl.
Der Umstand, daß sie auch an Privatpersonen Geld verlieh, schien eher eine Art Hobby darzustellen. Eine kleine Leidenschaft. Immerhin wählte sie ihre Schuldner genau aus. Sie hatte es einmal so ausgedrückt: »Ich gehe ja auch nicht mit jedem ins Bett.« Daran konnte man erkennen, welch große Bedeutung sie dem Geld beimaß, höchstwahrscheinlich dem Geld an sich, der Kommunikationskraft des Geldes, seiner inneren Schönheit.
Sie selbst wiederum verfügte über eine äußere Schönheit, ohne dabei zu übertreiben. Sie war also weder eine überirdische Erscheinung, noch sah sie mit ihren bald fünfundfünfzig Jahren wie ihre eigene Tochter aus. Sie war auf eine kräftige Weise schlank und auf eine künstliche Weise hellgoldblond. Man sah ihrer Haut an, wie wenig sie die Sonne leiden konnte. Claire war eine Frau, die viel lieber im Schatten blühte. Sie besaß ganz wunderbare Augen, ausgesprochen grau, mit einem leichten violetten Stich, violette Sternchen tief im Grau, so ein samtiges Grau, ein Teppichgrau.
Es versteht sich, daß Claire Montbard immer bestens gekleidet war, aber auch in diesem Punkt verhielt sie sich moderat. Ein bißchen modern, ein bißchen klassisch, ein bißchen streng und ein bißchen ausgelassen.
Als sie jetzt erschien, da trug sie einen knielangen schwarzen engen Rock, und es war ganz selbstverständlich, daß sie nur die untere Hälfte ihrer Beine zeigte. Dazu eine Bluse in einer Unwetterfarbe und eine Perlenkette, in die ein rötliches Kugelelement eingefügt war, ein Ding wie aus einem Kaugummiautomaten. Ihre Schuhe waren hoch und von einer bikiniartigen Knappheit. Sie stand perfekt darauf, und sie bewegte sich perfekt damit. Es war deutlich zu erkennen, daß man sie von diesen Schuhen nicht würde herunterschießen können.
Hätte man Claire Montbard mit einer berühmten Persönlichkeit vergleichen müssen, hätte man sagen können: eine Mischung aus Jeanne Moreau, Jerry Hall und Buster Keaton (der Augen wegen, die nie mitlachten, selbst wenn der Mund sich noch so verbog). Dieser Mund sagte jetzt: »Sie sind ganz schön mutig.«
»Einige«, erwiderte Lorenz, »würden wahrscheinlich sagen, ganz schön blöd.« Er war von einem dünnen, blassen, völlig harmlos anmutenden Mann ins Zimmer geführt worden. Sicher nicht jener, der ihn am Telefon als Schwanzlutscher tituliert hatte.
»Es gibt Leute«, äußerte Montbard, »die meinen, ich würde die Seelen der Leute, die mir Geld schulden, zur Jause verspeisen.«
»Ich wüßte nicht«, gestand Lorenz, »wie Seelen schmecken.«
»Ich auch nicht. Aber wie gesagt, die Leute glauben es.«
Sie zeigte hinüber zur Veranda, auf die man sich jetzt begab und Platz nahm auf alten Korbstühlen, aus denen ein Ächzen drang. Greise Möbel, die man nicht sterben ließ. Nach vorn hin lag eine kleine Wiese, teils im grellen Licht der soeben durch die Wolken gebrochenen Sonnenstrahlen, teils im Schatten der Weißtannen. Ein Mann mit einer dunkelblauen Schürze und einem karierten Flanellhemd kniete vor einem Blumenbeet, in dem er verbissen herumstocherte. Ansonsten war niemand zu sehen. Vor allem war nichts zu hören, nichts vom Verkehr, der in dieser Stadt wütete und Bänder zerriß, nur das Geräusch eines kleinen steinernen Springbrunnens, aus dessen Mitte zwei in sich verkrallte Löwen ragten, aus deren aufgerissenen Mündern dünne Fontänen drangen. Zwei Vögel saßen im Becken und beutelten ihr nasses Gefieder.
»Idyllisch hier«, kommentierte Lorenz.
»Ein bißchen primitiv«, meinte Frau Montbard, die übrigens keine Französin war, sondern, wie es hieß, aus Polen stammte. »Wenn man in der Nacht im Bett liegt und der Wind geht, meint man, man sei im Freien. Dieses Haus ist eine durchlässige Wabe. Nicht, daß ich es wirklich herrichten möchte. Das wäre vermessen. Ich gehe ja schließlich auch nicht zum Arzt, um mir das Alter aus dem Gesicht operieren zu lassen. Ich denke, ich werde mit diesem Haus zusammen sterben, oder das Haus mit mir. Wahrscheinlich wird es die Zugluft sein, die mich am Ende umbringt: Ich sterbe an einer Lungenentzündung, während das Haus auseinanderfällt. – Aber darum sind Sie nicht hier, um sich meine Todesphantasien anzuhören. Also, Herr Mohn, reden Sie.«
»Sie wissen ja, womit ich bisher mein Geld verdient habe.«
»Auch nur ein Beruf. Nichts, wofür Sie sich genieren müßten.«
»Das sehe ich genauso. Doch jetzt ist eben Schluß. Mit vierzig reicht es, gleich, wie gut man in Form ist. Wie Sie gerade sagten, man kann sich dem Alter nicht versperren. Die ganze Trickserei ist unwürdig und unsinnig. Ich kann nicht Liegestütze machen, bis praktisch nur noch die Liegestütze übrigbleiben. Sie verstehen mich, oder?«
»Natürlich«, sagte Montbard, während sie hinüber zu dem Gärtner sah.
Lorenz fuhr fort zu berichten. Zwar verzichtete er darauf, darzulegen, wie genau er auf die Idee gekommen war, ein Handarbeitsgeschäft zu gründen, erklärte aber, daß es für ihn keine Alternative dazu gebe. Er sagte: »Für manche Dinge ist man geboren.«
»Ganz sicher ist man das«, bestätigte Montbard. »Fürs Klavierspielen, für die Gärtnerei, dafür, ein Versager zu sein, im Krieg zu sterben, im Bett zu sterben, vielleicht sogar für die Pornographie. Doch ein Handarbeitsladen? Wie kann man dafür geboren sein? Ich meine, jemand wie Sie?«
»Nicht jede Begabung ist eine offenkundige.«
»Verstehe ich Sie richtig? Sie meinen, Sie seien auf eine verborgene Weise mit dem Talent des Strickens ausgestattet?«
»Nicht des Strickens«, sagte Lorenz. »Nur dafür, dieses Geschäft zu betreiben. Ich habe bereits den richtigen Laden gefunden. Er ist perfekt.«
»Und jetzt wollen Sie, daß ich Ihnen diese Schnapsidee finanziere.«
»Wenn Sie es als Schnapsidee auffassen, dann bin ich hier falsch«, sagte Lorenz und verzog sein Gesicht zur Grimasse kleiner Buben, denen man die Besteigung einer Kletterwand verwehrt. Er war im Begriff, sich zu erheben.
»Bleiben Sie«, befahl Montbard in jenem milden Ton, der gut geeignet war, durch Stahlplatten zu dringen. »Sie werden sich, wenn Sie diese Sache wirklich ernst meinen, noch einigen Spott anhören müssen. Wäre also besser, sich ein dickes Fell zuzulegen.– Möchten Sie etwas trinken?«
»Kaffee bitte.«
Claire drehte den Kopf ein wenig rückwärts und rief nach zwei Tassen Kaffee. Nicht, daß man jemanden sehen konnte. Aber wie gesagt, ihre Stimme querte selbst dichteste Materialien. Überhaupt könnte man sagten, daß Claire Montbard – eingedenk des Rühmann-Films – eine Frau war, die durch Wände ging.
Sie sagte: »Ich könnte in den Verdacht geraten, ein bißchen irre geworden zu sein, wenn ich ein solches Projekt fördere.«
»Ich will nicht unhöflich sein«, entgegnete Lorenz, »doch es geht mir nicht um Förderung. Was ich benötige, ist weniger Ihr Verständnis als Ihr Geld.«
»Bei mir läuft das aufs gleiche hinaus«, erklärte Montbard. »Wenn ich Geld herborge, dann nicht, um noch mehr Unsinn in diese Welt zu tragen.«
»Wie ich hörte, beteiligen Sie sich an Waffengeschäften.«
»Wenn Sie ein Problem damit haben«, meinte Montbard, »weiß ich nicht, wieso Sie ausgerechnet zu mir kommen.«
»Kein Problem. Ich frage mich nur…«
»Waffen sind eine gute Sache. Sie bringen das nötige Leid in die Welt, auf daß diese Welt sich ändert. Während zum Beispiel Drogen ein Leid erzeugen, das gar nichts ändert.«
Das war eine Position, die Lorenz in keiner Weise unterschrieben hätte. Aber Montbard hatte mit solcher Bestimmtheit gesprochen… Und er war ja nicht hier, um über den weltweiten Waffenhandel zu diskutieren. Zudem kam gerade der Kaffee, serviert von demselben dünnen Mann, der Lorenz hereingelassen hatte. Nicht nur ein dünner, auch ein steifer Mann. Jedoch frei vom Stil der Lakaien. Seine Steifheit schien echt, wie von einem Rückenschmerz verursacht oder einer Gicht. Er stellte die Tassen ab, richtete sich vorsichtig wieder auf, blickte ein paar Sekunden lang versonnen in den Garten hinaus – als spähe ein Fisch hinüber ans Land– und begab sich zurück in das Innere des Hauses, wo alte und neue Möbel, Wertvolles und Wertloses nebeneinanderstanden, so, als wäre über die Artefakte verschiedenster Herkunft mit einem Mal eine klassenlose Gesellschaft hereingebrochen, alle überraschend, alle auf dem falschen Bein erwischend. Darum insgesamt der Eindruck des Schiefen.
»Ihr Diener?« fragte Lorenz.
»Mein Bruder.«
»Sie lassen sich von Ihrem Bruder bedienen?«
»Warum nicht? Sie doch auch.«
»Aber…er ist ja nicht mein Bruder«, stellte Lorenz fest.
»Na und? Wäre er Ihr Bruder, was dann?« fragte Montbard. »Würden Sie ihn auf die Straße setzen? Würden Sie ihn wieder in die Schule schicken? Einen fünfzigjährigen Mann? Und wie ich schon sagte, er ist kein Diener, der Kaffee serviert, sondern mein Bruder, der Kaffee serviert. Ich halte es für sehr viel korrekter, sich von einem Familienmitglied bedienen zu lassen als von irgendeiner wildfremden Person, die ich dafür bezahle, als würde ich ein paar Stunden Sex abgelten.«
»Soll das heißen, Ihr Bruder arbeitet umsonst hier?«
»Klar. Wofür sollte ich ihn denn bezahlen? Dafür, Kaffee zu kochen und ihn in zwei Schalen auf den Tisch zu stellen?«
»Er hat mir die Tür geöffnet.«
»Ich denke nicht, daß er sich dabei ein Bein gebrochen hat. Er wohnt in diesem Haus, und zwar umsonst. Er muß für nichts aufkommen. Er muß keinen einzigen Groschen beitragen. Er kocht, wäscht, er öffnet Türen, trägt Tassen mit Kaffee. Und muß sich im übrigen um nichts kümmern. Er ist unbelastet von der Welt. Die Welt endet für ihn beim Supermarkt drei Straßen weiter. Ich finde, daß er ein beneidenswertes Leben führt.«
Es war ganz bezeichnend für Claire Montbard, daß sie mit ihrer Argumentation in keiner Weise in Richtung Emanzipation steuerte, also etwa darauf verwies, daß pflegende, kochende, Kaffee servierende, Türen öffnende, später dann die Hintern ihrer Lieben auswischende Schwestern und Töchter – allesamt unbezahlt – früher die Regel gewesen waren, eine selten hinterfragte Regel. Und so war es ja im Grunde noch immer, bloß daß das Element der Hinterfragung dazugekommen war, die neckische Alice-Schwarzer-Pose der Gesellschaft. Doch um all das schien sich Claire Montbard nicht zu kümmern. Sie war keine Rächerin, hatte nicht etwa Spaß daran, Männer zu erniedrigen. Was sie tat, tat sie unter dem Primat der Selbstverständlichkeit. Da war nichts, was sie ideologisch hätte rechtfertigen müssen. Ganz klar: Wäre ihr Bruder eine Schwester gewesen, wäre die Sache genauso abgelaufen.
»Na, immerhin muß er nicht im Garten arbeiten.«
»Stimmt. Das ist der Job meiner Mutter.«
»Ihrer Mutter?« wunderte sich Lorenz und blickte hinüber zu der vor dem Blumenbeet knienden, ausgesprochen maskulin anmutenden Gestalt. Nicht nur wegen des Holzfällerhemds, der kurzen, silbergrauen Haare und der bulligen Gestalt. Die ganze Haltung war die eines Mannes. – Wenn Männer graben, dann hat das immer etwas Verzweifeltes. Als würde es ihnen nicht reichen, eine Zwiebel einzusetzen. Als würden sie die Arbeit am Blumenbeet bloß als Vorwand nehmen, einen ganz bestimmten Knochen auszubuddeln, ein Missing link. Was wiederum nichts mit dem vielbeschworenen Forschergeist der Männer zu tun hat. Sie sind gar nicht die geborenen Entdecker, für die sie sich halten und auch von den Frauen gehalten werden. Ihre Suche gilt nicht einer unentdeckten Sache, sondern einer verlorenen. Etwas in der Art einer Murmel oder eines kleinen verbogenen Plastikspielzeugs. So gesehen, steht Orson Welles’ Citizen Kane zu Recht an der Spitze unseres filmischen Bewußtseins, weil dieses Opus einen Mann zeigt, dessen ganzer viriler Wahnsinn, dessen grandioses Gorillagebrüll allein mit dem Verlust und der Unauffindbarkeit eines Kinderschlittens zusammenhängt. Und es wäre keineswegs als ein Witz zu verstehen, wenn jemand die Forderung aufstellen würde, den Männern ihre Schlitten zurückzugeben. Auf daß sie nicht weiter wie wild die Erde umpflügen müssen und solcherart die Welt in eine katastrophale Unordnung stürzen.
»Meine Mutter«, erklärte Claire Montbard, »muß auch etwas tun. Die Gärtnerei paßt zu ihr. Sie hat ein gutes Händchen für Pflanzen. Wenn sie schon kein gutes Händchen für Männer hat.«
»Männer wie Ihren Vater?«
»Sie nehmen sich ein bißchen viel heraus«, meinte Montbard, ohne daß sie aber wirklich verärgert wirkte.
»Tut mir leid.«
»Mein Vater ist indiskutabel. Jeder Mann, mit dem meine Mutter sich eingelassen hat, war das. Weshalb man sich also fragen muß, ob nicht meine Mutter Schuld trägt. So wie es in der Physik heißt, etwas könnte nur dann bestehen, wenn es beobachtet wird. Hätte sich meine Mutter nicht immer für gräßliche Männer interessiert, hätten diese Männer niemals existiert, zumindest nicht in dieser gräßlichen Weise.«
»Würden Sie mir kein Geld leihen«, folgerte Lorenz, »dann wäre ich gar nicht hier.«
»Nicht dumm von Ihnen. Welche Summe, Herr Mohn, schwebt Ihnen denn vor?«
Ja, welche Summe? Absurderweise hatte sich Lorenz noch nicht den geringsten Gedanken darüber gemacht, wieviel Kapital er benötigen würde, um seinen Laden anzumieten, einzurichten und die erforderliche Ware zu besorgen. An eine Hilfskraft dachte er nicht. Vielleicht ein wenig Werbung, kleine Annoncen, andererseits war er überzeugt, daß ein Laden, der den schönen Namen Plutos Liebe trug und über dessen Betreiber gloriolenartig das Gerücht schweben würde, er habe sich einzig und allein zur Gründung dieses Geschäfts aus der Pornographie zurückgezogen, daß es einem solchen Laden nicht an der nötigen Mundpropaganda fehlen würde. Nicht, daß Lorenz das leidige Sexthema am Köcheln halten wollte, dennoch glaubte er, daß die Pornographievergangenheit sich als Vorteil herausstellen könnte, als Anziehungspunkt. Freilich nicht in der Hinsicht, eine Frau fürs Leben zu finden. Doch das wollte er ohnedies nicht mehr. Wenn er diesen Laden einmal besaß, dann würde er sich von seiner Frau-fürs-Leben-Phantasie endgültig verabschieden. Plutos Liebe statt Lorenz’ Liebe. Dachte Lorenz.
Aber wie gesagt, er hatte völlig vergessen, sich die Höhe der Finanzierungskosten durch den Kopf gehen zu lassen, hatte bloß die Person überlegt, die diese Finanzierung garantieren sollte. Welcher er aber nun einen Betrag nennen mußte, um nicht völlig meschugge dazustehen. Darum sagte er, gerade so, als sei er bei einem Quiz und versuche, die richtige Antwort zu erraten: »Ich denke, zweihunderttausend Euro müßten reichen.«
»Das ist nicht wenig«, fand Montbard.
»Das ist aber auch nicht richtig viel, oder?« Denn so viel Ahnung hatte Lorenz schon, daß er wußte, wie sehr Claire Montbard sich mitunter in schwindelerregende Höhen der Vorfinanzierung und Darlehensverleihung begab.
»Sie haben recht«, meinte Montbard, »auf den Betrag kommt es eigentlich nicht an. Sondern auf die Formalitäten der Rückzahlung.«
»Zinsen?«
Claire betrachtete Lorenz belustigt, ohne ihre violettbesternten, teppichgrauen Augen zu rühren, und meinte: »Wäre das nicht ein bißchen banal? Zinsen gibt’s an jeder Ecke. Wollte ich mit Zinsen herumwurschteln, würden wir zwei uns jetzt in einem Büro gegenübersitzen und mit Sicherheit einen sehr viel schlechteren Kaffee trinken. Welcher dann auch gar nicht von meinem lieben Bruder serviert worden wäre, sondern von irgendeiner grinsenden Tussi mit gestreckten Beinen. Leute, die Zinsen verlangen, versuchen immer, ihren Porsche und sonstwas zu finanzieren. Haben Sie vor meiner Türe einen Porsche stehen sehen?«
»Nein. Ich hoffe aber, daß Sie jetzt nicht doch noch nach meiner Seele fragen.«
»Würden es Sie denn so stören, sie zu verkaufen?«
Nun war es Lorenz, der ein bißchen lächelte. Verkrampft, jedoch von Herzen. Er sagte: »Solange ich nicht weiß, wo genau meine Seele sitzt und was genau in meiner Seele sitzt, möchte ich lieber nicht auf sie verzichten. Man verkauft keine Truhe, in die man noch gar nicht geschaut hat.«
»Das ist ein vernünftiger Standpunkt«, fand Montbard. »Und ich sagte ja bereits, daß ich keinen Gusto auf Seelen haben. Ich stelle mir vor, Seelen schmecken wie verbrannter Toast.«
»Wie sieht dann also der Deal aus?« fragte Lorenz.
»Sie bekommen die zweihunderttausend. Zinsfrei. Keine Spesen, nichts. Die Rückzahlung erfolgt in sieben Jahren, in exakt sieben Jahren. Ich will das Geld keinen Tag früher und keinen Tag später. Ich meine, heute in sieben Jahren. Zweihunderttausend, egal, was zweihunderttausend dann wert sein werden. Es geht um den puren Betrag. Und darum, sich an etwas zu halten.«
»Wo liegt der Haken?«
»Wenn Sie pünktlich zahlen, werden Sie glauben, es sei nie geschehen. Als gäbe es mich gar nicht. Kein Haken, keine Falle, keine böse Fee.«
»Und wenn ich nicht pünktlich zahle?«
»Nun, irgendeinen Zweck sollte unsere kleine Geschichte schon haben. Denn schließlich gehöre ich nicht zu einer Organisation namens ›Kreditgeber ohne Grenzen‹. Wenn Sie nicht zahlen, Herr Mohn, dann werde ich Sie in die Pflicht nehmen.«
»Was kommt jetzt? Sagen Sie nicht, ich soll jemanden für Sie umbringen.«
»Ah, gar nicht so schlecht. Ganz knapp vorbei. Nein, Sie sollen jemandem das Leben retten.«
»Wie habe ich das zu verstehen?«
»Das erfahren Sie, wenn es dazu kommt. Sollten Sie das Geld ordentlich zurückzahlen, brauchen Sie nicht zu wissen, was Ihnen erspart bleibt. Es würde Sie nur unnötig belasten.«
»Ich finde aber«, sagte Lorenz, »daß ich das Recht habe, zu erfahren, worauf ich mich einlasse.«
»Und ich finde«, entgegnete Claire, »daß es an mir ist, die Regeln zu bestimmen. Angesichts von zweihunderttausend Euro, die ich Ihnen unter den Baum lege, als wäre ich der Weihnachtsmann. Wir werden Weihnachten nach meinen Regeln feiern oder gar nicht. Und noch etwas: Denken Sie bitte nicht, Sie könnten in sieben Jahren simplerweise einen anderen Kredit aufnehmen, um den alten zu begleichen. Wenn Sie einmal bei mir in der Kreide stehen, wie man so sagt, wird Ihnen niemand helfen. Kein schmieriger Kredithai und keine korrupte Bank. Glauben Sie mir. Es ist nur fair, Ihnen das zu sagen. Ich warne Sie nicht, aber ich kläre Sie auf.«
»Warum ausgerechnet sieben Jahre?«
»Meine Lieblingszahl. Der Form wegen. Eine schöne, einfache Form. Es war die erste Zahl, die ich schreiben konnte. Man mag gar nicht damit aufhören. Sie kennen das doch sicher, man fährt die zwei Linien entlang, immer wieder… Sie sehen, die Zahl hat nicht die geringste mystische oder strategische Bedeutung. Sie entspringt einer puren Laune, einer hübschen Kindheitserinnerung.«
(Ein kenntnisreicher Beobachter hätte dies allerdings sehr in Zweifel ziehen müssen, und zwar in Anbetracht des Nix-NyxCharon-Pluto-Zusammenhangs. Denn der Tag, den man gerade schrieb, war der 14. Juli 2008. Gemäß den Planungen der NASA würde genau an einem solchen 14. Juli, und zwar in sieben Jahren, die Sonde New Horizons den Zwergplaneten Pluto erreichen. Das war erneut ein Hinweis, wie sehr sich Lorenz Mohn in einem Gespinst des Gewollten befand, gleich, ob dieses Gewollte über einen Sinn verfügte oder ob es sich der reinen Lust des Spinnens und alles Gesponnenen hingab.)
Doch Lorenz glaubte die Sache mit der Sieben. Er konnte sich ebenfalls gut daran erinnern, daß dies die erste Zahl gewesen war, die er mit einiger Lust und einigem Geschick zu Papier gebracht hatte, während Ziffern wie die Vier und die Acht eher den Charakter graphischer Zungenbrecher besessen hatten.
Wenn man nun um den Hinweis auf die Pluto-Mission mit Zieltag 14. Juli 2015 nicht wußte, dann waren sieben Jahre ein vernünftiger Zeitraum, um einen überschaubaren Betrag zusammenzutragen und termingerecht zurückzuerstatten. Einen Betrag, der sich in diesen sieben Jahren nicht erhöhen würde. Hingegen machte Lorenz die Vorstellung nervös, sich für den Fall seiner Säumigkeit zu einer nicht näher benannten Lebensrettung zu verpflichten. Das konnte eine Menge bedeuten. Er fragte: »Wir vereinbaren das doch schriftlich, oder?«
»Was würde das nützen?« fragte Montbard zurück. »Ich könnte Sie mit so einem Wisch kaum dazu zwingen, jemandem das Leben zu retten.«
»Und ohne Wisch?«
»Ja, ohne Wisch kann ich das.«
»Das muß ich Ihnen wohl glauben.«
»Das sollten Sie.«
»Es geht doch hoffentlich nicht darum«, blieb Lorenz lästig, »irgend jemandem ein Organ zu spenden? Oder gleich meinen ganzen Körper?«
»Ich mag es nicht, wenn man mich löchert«, sagte Montbard. »Aber wenn es Sie beruhigt, Ihre Organe können Sie behalten. – Und jetzt ist Schluß! Sagen Sie zu, oder lassen Sie es bleiben. Und entscheiden Sie sich jetzt. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie.«
»Zwei Minuten. Seien Sie so gut!« bat Lorenz. »Bis ich den Kaffee ausgetrunken habe.«
Montbard nickte, gleichzeitig erhob sie sich und bewegte sich auf ihren hohen, dünnen Absätzen die Veranda nach unten. Sie balancierte über die Wiese hinüber zu dem Blumenbeet und blieb aufrecht neben ihrer gärtnernden Mutter stehen.
Lorenz war alleine. Er dachte nach. So in der Art, wie wenn man seine Zähne in ein hartes, vollkommen undurchbeißbares Brot schlägt. Es war unmöglich, irgendein Für und Wider zu berücksichtigen, die diversen Für und Wider trieben ineinander und bildeten eine krallenartige Versteinerung. Das einzige, was deutlich vor Augen lag, waren der Vorteil der Zinsfreiheit sowie die saubere Möglichkeit, das Geld in sieben Jahren und auf den Tag genau zurückzuzahlen.
Tag genau? Welcher Tag eigentlich?