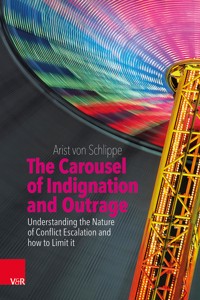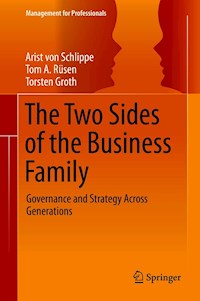Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der sehr erfolgreiche kompakte Band »Systemische Interventionen« der beiden Autoren wird in ihrem neuen Buch ergänzt durch die erkenntnistheoretischen Basics, ohne die systemisches Arbeiten in allen Beratungskontexten im luftleeren Raum bleibt. Es geht um die selbstverständliche Konsequenz einer systemischen Sicht auf die Welt. Interventionen, die als systemisch bekannt und beliebt geworden sind, lassen sich auf einige wesentliche Gedanken zurückführen: Das Interesse richtet sich nicht mehr darauf, Fakten herauszufinden, es wird also nicht nach etwas gesucht, das es gibt, sondern eher nach dem, was sich zwischen Menschen ereignet. Daraus entsteht wie von selbst eine Praxis, die nicht versucht, Defizite zu finden oder eine Ursache, eine Diagnose, eine Störung festzuschreiben. Systemische Praxis sucht danach, wie ein Phänomen, ein Problem von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich beschrieben wird. Sie will Beziehungsverhältnisse ergründen und Reflexionen anregen. Sie zielt auf die Muster flüchtiger Kommunikationen, die sich in den vielen, ständig neu erzeugten zwischenmenschlichen und psychischen Wirklichkeiten menschlichen Lebens beobachten lassen. Es geht weniger um den richtigen Einsatz von Techniken oder Tools als vielmehr um eine systemische Sicht auf die Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arist von Schlippe / Jochen Schweitzer
Gewusst wie, gewusst warum: Die Logik systemischer Interventionen
Mit einem Vorwort von Jürgen Kriz
Mit 7 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Robert Delaunay, Kreisformen, 1930/akg-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99893-0
Inhalt
Vorwort von Jürgen Kriz
1 Einführung
2 Theorie und Praxis systemischer Interventionen
2.1 Historisches
2.2 Konstruktivismus und sozialer Konstruktionismus
2.3 Systemtheorie(n) – eine oder viele?
2.3.1 Die Theorie sozialer Systeme/Differenztheorie
2.3.2 Die Theorie komplexer dynamischer Systeme
2.3.3 Narrative Theorien
2.3.4 Sinnbegriff als Klammer
2.3.5 Exkurs: Eine besondere Form von Sinn: Psychische »Krankheit«
3 Logiken systemischer Interventionen
3.1 Orientierung und Bündnisrhetorik
3.1.1 Erwartungen, Wünsche und Absichten
3.1.2 Bündnisrhetorik
3.2 Der Verzicht auf zielgerichtete Veränderung: Ein Rahmen für die Selbstorganisation
3.2.1 Stabilität als der »erklärungsbedürftige Sonderfall«
3.2.2 Rahmensteuerung
3.2.3 Keine Tricks
3.2.4 Dekonstruktion und Verstörung
3.3 Der Verzicht auf personenbezogene Zurechnung
3.4 Engagierter Austausch von Wirklichkeits-beschreibungen
3.5 Eine »Wolke aus Erwartungs-Erwartungen«
3.6 Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt
3.7 Potenziallandschaften hinterfragen
3.8 Suche nach alternativen Geschichten
3.9 Anwalt der Ambivalenz
3.10 Selbstreferenz: Sein eigener Beobachter werden
3.11 Fazit
4 Settings systemischer Interventionen
4.1 Settings im Kontext Familie
4.1.1 Das »klassische« Setting: Familie und Berater(in)
4.1.2 Multifamilientherapie
4.1.3 Multidimensionale und Multisystemische Familientherapie
4.1.4 Aufsuchende Arbeit mit Multiproblemfamilien
4.2 Kontext Paarbeziehung
4.3 Einzelpersonen
4.3.1 Systemische Einzelarbeit
4.3.2 Systemische Kinder- bzw. Spieltherapie
4.4 Elterncoaching
4.4.1 Selbstbeobachtung per Video: Das Marte-Meo-Modell und die »Babysprechstunde«
4.4.2 Gewaltloser Widerstand und systemisches Elterncoaching
4.5 Mediation, Trennungs- und Scheidungsberatung
4.6 Settings im Kontext Organisation
4.6.1 Die Differenz von Bindungs- und Entscheidungskommunikation
4.6.2 Teams
4.6.3 Zwischen Unternehmen und Familie: Unternehmerfamilien
4.6.4 Coaching
5 Schlusswort
Literatur
Sachregister
Vorwort von Jürgen Kriz
Die Autoren dieses Buches haben nicht nur seit vielen Jahren als Hochschullehrer und als systemische Lehrtherapeuten/Lehrsupervisoren eine große Zahl von Studierenden und Teilnehmenden an Ausbildungskursen mit dem systemischen Ansatz vertraut gemacht. Sie haben zudem durch zahlreiche Fachartikel den Diskurs in Wissenschaft und Praxis von systemischer Therapie, Beratung und Coaching befeuert. Ganz besonders aber dürften Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer vielen Menschen als Autoren zahlreicher gemeinsamer Bücher bekannt sein, die – wie etwa die vertrauten Lehrbücher I und II – deswegen hohe Auflagen und Verbreitung erzielen, weil sie den Weg auf dem schmalen Grat bewundernswert meistern, auf dem Theorie und Praxis in überzeugender Weise miteinander verbunden werden können. Schmal ist der Grat deshalb, weil gerade bei der Auseinandersetzung mit Themen und Fragen zum systemischen Ansatz die Gefahr besteht, dass auf der einen Seite durch allzu viel bzw. »tiefe« Theorie der Anschluss an die konkreten Anliegen systemisch Arbeitender verloren geht und dass auf der anderen Seite scheinbar gut verständliche, aber letztlich unzureichende bis irreführende metaphorische Ausdeutungen des Modebegriffs »systemisch« kein wirklich tragfähiges Fundament für verantwortungsvolles Handeln zur Verfügung gestellt wird.
Eine solche erfolgreiche Gratwanderung zeigt auch dieses Buch. Es wird dabei ein Weg durch bedeutungsvolle Hinweisschilder vorgezeichnet, denen man gut und gern zu folgen vermag. Es ist ein Weg, der sowohl gleichzeitig festen Tritt auf dem Boden theoretischer Fundierung gewährleistet als auch die spielerische Leichtigkeit der Experten vermittelt und solcherart viele Ausblicke in weite und ansprechende Landschaften ermöglicht.
Die zentrale Botschaft ist ebenso klar wie unterstützenswert: Das Essenzielle am systemischen Arbeiten mit Menschen beruht nicht auf der Anwendung eines möglichst großen Kastens voller »Tools« – so wichtig und nützlich die Kenntnis solcher prototypischen Handlungswerkzeuge auch sein mag. Vielmehr liegt das Essenzielle systemischer Arbeit in einem bestimmten Weltbild und einer Epistemologie, die, verbunden mit einer guten theoretischen Grundlage, das erst zur Entfaltung bringt, was dann von Beobachtern oft als Tools beschrieben wird.
Die Grenzen einer auf Tools und Techniken basierenden Vorgehensweise werden schnell deutlich, wenn man sich klar macht, dass jede Situation eigentlich einmalig ist, auch wenn wir natürlich dazu gezwungen sind, diese unfassbare Komplexität u. a. dadurch fassbar zu machen, dass wir Klassen ähnlicher Situationen erfinden. Eine erfolgreiche Anwendung von Tools setzt voraus, dass bestimmte Werkzeuge für bestimmte Klassen von Situationen passen – eine Zuordnung, die vergleichsweise starr und reduziert ist. Werden hingegen Vorgehensweisen auf der Basis eines theoretisch fundierten Verständnisses entfaltet, so dass man Vorstellungen und Leitbilder dazu entwickelt, warum man so handelt, so kann man in einem viel größeren Spektrum von Situationen passungsgerechtes Vorgehen entwickeln. Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer haben das so formuliert: »Wenn sich systemische Praxis darauf begrenzt, systemische Interventionstechniken anzuwenden, fehlt eine wichtige Reflexionsebene, auf der man sich fragt, warum man interveniert, wie man es tut.« Eine brauchbare theoretische Basis für praktisches Handeln gibt Spielraum, Freiheit und Kompetenz, das eigene Wissen, die eigenen Fertigkeiten kreativ und situationsadäquat zur Gestaltung hilfreicher Interaktionsprozesse einzusetzen.
Sehr ansprechend ist auch die Fokussierung im dritten Kapitel auf zehn wesentliche Aspekte, Prinzipien oder Heuristiken, mit denen eine Brücke von den zuvor dargestellten theoretischen Fundamenten zur konkreten Praxis hergestellt wird. Denn dies ist eine Ebene von Welt- und Wirkbildern, die Nicht-Theoretiker – also wohl die allermeisten Leserinnen und Leser – als handlungsleitende Grundprinzipien unmittelbar mit ihrer Arbeit verbinden und als Leitideen auch präsent halten können.
Die Absage an eine »toolzentrierte« Technologie wird dann auch im letzten (vierten) großen Kapitel durchgehalten, in dem relevante Fragen zu den Anwendungsfeldern anhand von unterschiedlichen Settings erörtert werden und nicht anhand von idealtypischen Anwendungs-»Tricks« (was manche Tool-Sammlungen im schlechten Sinne auszeichnet). Gleichwohl – um nicht zu sagen: gerade deshalb – werden auch hier die an Praxis Interessierten durch viele wertvolle Anregungen, Sichtweisen und Einladungen zu Reflexionsmöglichkeiten auf ihre Kosten kommen. Die Bedeutung des von Kurt Lewin geprägten Satzes »Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie« wird hier konkret sichtbar und erfahrbar.
Dieses Buch zeigt gerade in seiner prägnanten – auf das Essenzielle fokussierten – Kürze etwas, was man im Alltag als reife Leistung bezeichnet. Die Autoren sind genügend alt und berühmt, um sich weder von der Erodierung akademischer Tugenden zu vordergründig evidenzbasierter Effektivität und Multiple-Choice-Wissen verbiegen zu lassen noch als Rebellen der Zunft etwas beweisen zu müssen. Vielmehr können sie ihren Blick auf das Wesentliche systemischen Arbeitens (um nicht zu sagen: hilfreich unterstützender Begleitung und »Beisteuerung« bei den Auswegen aus narrativen Fallen) souverän und ausgewogen den Leserinnen und Lesern vermitteln. Die Evaluationskriterien, die Kurt Ludewig vor mehr als dreißig Jahren für systemische Arbeit vorgeschlagen hat – »Nutzen, Schönheit, Respekt« –, lassen sich bemerkenswerterweise auch auf dieses Buch anwenden: Es ist überaus nützlich für alle, die ihre systemische Arbeit mit theoretischen Fundamenten und daraus abgeleiteten heuristischen Prinzipien verbinden wollen. Es vermittelt die Schönheit, die in der gelungenen Passung von Theorie und Praxis zum Ausdruck kommt. Und es lädt zum kalkuliert respektlosen Umgang mit Sichtweisen und zu einer respektvollen Beziehung zu den dahinterstehenden Menschen ein. Dies gilt sowohl für die konkrete Arbeit als auch für die Vermittlung der Konzepte, Ideen, Erfahrungen und Verstehensangebote, die diesen Ausführungen zugrunde liegen.
Es ist ein Buch, das ich gern gelesen und als Anregung zum Nach-Denken genutzt habe. Daher wünsche ich ihm von Herzen, dass es auch von vielen anderen Menschen gelesen wird und dass sie es ihrerseits als hilfreiche Anregung erfahren.
Jürgen Kriz
1 Einführung
Die Gründerzeit der Familientherapie ist lange vorbei. In den 1950er Jahren machten mutige Rebellen die spannende Erfahrung, dass sich Störungsbilder völlig anders zeigten, wenn sie nicht nur gedanklich im Gespräch mit einer Einzelperson, sondern »live« im Kontext des jeweiligen engsten Bezugssystems des jeweiligen Patienten wahrgenommen werden konnten. Diese Pioniere mussten sich in den frühen Jahren gegen die – damals stark von der klassischen Psychoanalyse geprägten – akademischen Lehrmeinungen durchsetzen. Die Bereitschaft, sich quer zu diesen Standards zu verhalten, erforderte Mut: Man setzte seine berufliche Reputation, manchmal auch seine wirtschaftliche Existenz aufs Spiel – wie etwa Virginia Satir eindrücklich berichtete, die auch gern als »Mutter der Familientherapie« bezeichnet wird (von Schlippe u. Schweitzer, 2012, S. 32). Aus dem Mut heraus, die disziplinär gesetzten Grenzen zu überschreiten, entwickelte sich die Familientherapie zunächst eher pragmatisch sowie in Abgrenzung gegen starre Lehrmeinungen und gegen immer abstrakter werdende Forschungsergebnisse, die als zu wenig für die Praxis relevant erschienen.
Die theoretischen Bezüge, die hergestellt wurden, orientierten sich anfangs noch an tiefenpsychologischen Konzepten. Etwa ab den 1980er Jahren begann eine eigene Tradition der Theorieentwicklung, die sich mehr und mehr von den ursprünglichen Theorien der Gründermütter und -väter entfernte. Schließlich beanspruchte sie, eine eigene Form der Psychotherapie darzustellen, die Systemische Therapie (beispielhaft ist diese Entwicklung nachzulesen bei Ludewig, 2015). In ihr setzte sich die kritische Haltung über die gewohnten Arten, wie mit seelischen Phänomenen gearbeitet wurde, fort. Dabei begab sie sich auf einen stärker erkenntnistheoretisch ausgerichteten Weg. Dieser legte einen grundlegenden Unterschied zu der gewohnten Weise bisheriger wissenschaftlicher Beschreibungsformen nahe. Der Hintergrund für diese Nähe zu konstruktivistischen und sozialkonstruktionistischen Gedankengebäuden mag damit zu tun haben, dass besonders in der Arbeit mit Mehrpersonensystemen eine Erfahrung sehr augenfällig ist: Das, was Menschen als »Wirklichkeit« erleben, lässt sich nicht davon trennen, wie diese Wirklichkeit sozial erzeugt und stabil gehalten wird (Gergen, 2002; Gergen u. Gergen, 2009). Menschen machen »aus bloßem Rauschen, aus einem bloßen Geräusch im System selbst Ordnung« (Luhmann, 2004, S. 119). Diese Ordnung ist nicht vorgegeben, sondern sie wird in einem dynamischen Prozess immer wieder neu erzeugt. Die Frage, wie die Welt »ist«, verändert sich, wird weniger wichtig, man fragt mehr danach, wie sie »geschieht« (Kriz, 2017a, S. 75).
Der systemische erkenntnissuchende Blick versucht nicht mehr, feste Fakten herauszubekommen, er sucht nicht nach etwas, das es »gibt«, sondern eher nach dem, was zwischen den Menschen wirksam ist, nach den Mustern flüchtiger Kommunikationen, die wir in den Prozessen ständig neu erzeugter zwischenmenschlicher und psychischer Realitäten beobachten können. Ganz explizit verschiebt etwa die Systemtheorie von Niklas Luhmann die Frage vom System als einem Objekt auf die Frage, wie es sich mit der Differenz zwischen System und Umwelt verhält (Abschnitt 2.3.1). Man schaut also auf den Vorgang der Unterscheidung, nicht auf ihr Ergebnis. Damit ist aber immer ein Beobachter vorausgesetzt, der die Welt aktiv erkennt: »Es gibt keine beobachtungslose Welt […]. Wir brauchen nicht mehr zu wissen, wie die Welt ist, wenn wir wissen, wie sie beobachtet wird« (Luhmann, 2004, S. 139 ff.). Eine solche Sicht verändert übrigens auch den Umgang mit psychiatrischen Diagnosen, wie derselbe Autor an anderer Stelle betont: »[W]enn man wissen will, was ›pathologisch‹ ist, muss man den Beobachter beobachten, der diese Beschreibung verwendet, und nicht das, was so beschrieben wird« (Luhmann, 2009, S. 216).
Immer deutlicher wurde, dass die Familientherapie und die in ihrem Rahmen entwickelten Theorien und Methoden, über die man sich Mehrpersonensysteme erschließen kann, in eine andere Logik hineinführt, in eine, die viel mit der Frage zu tun hat, was unser psychosoziales Leben eigentlich genau ausmacht. So kann man nach Problemen wie nach einem »Ding« fragen, das »ist«: »Seit wann haben Sie ›es‹?«; »Wann ist ›es‹ das erste Mal aufgetreten?«; »Hat die Zahl der Schübe zugenommen?« usw. Diese Sichtweise wird Beobachtung erster Ordnung genannt, manchmal auch »essenzialistisch«, weil nach der »Essenz«, dem wahren Wesen eines Phänomens gesucht wird. Wenn man Probleme jedoch als etwas sieht, was im »Dazwischen« geschieht, wird man ganz anders fragen, nämlich nach Perspektiven von Beobachtern. Damit bewegt man sich dann in der Beobachtungsebene zweiter Ordnung (Unterkapitel 3.10). Man stellt etwa Fragen wie: »Wer hat das, was Sie als Problem beschreiben, zum ersten Mal so benannt?«; »Wer sieht es ähnlich, wer anders?« (zur Unterscheidung der Kybernetik erster und zweiter Ordnung ausführlich: Simon, Clement u. Stierlin, 2004, S. 192 ff.)
Eine kleine Illustration dazu: In meiner Ausbildung hatte ich (AvS1) mehrfach psychiatrische Vorlesungen mit Patienteninterviews gehört. Sie begannen vielfach mit der Diagnose: »Sie haben also eine Depression. Hmm, wann ist denn die Symptomatik zum ersten Mal aufgetreten?« oder: »Seit wann haben Sie die Depression?« o. ä. Diese Art Frage sucht nach der Natur der Dinge. Ich erinnere mich noch gut an meine Verblüffung, als ich das erste Mal in einem Interview in einem Lehrvideo (leider weiß ich nicht mehr, wer der Interviewer war) auf die Klage des Klienten, er habe eine Depression, die Frage hörte: »Ah ja, und woher wissen Sie das?« Die Fokusverschiebung liegt auf der Hand: Es wird nicht mehr nach dem »Ding« Depression gefragt, sondern nach der Art der Beschreibung, die dazu führt, dass ein Komplex aus Erleben, Verhalten und sozialer Interaktion von jemandem mit einem Begriff belegt wird – und getreu der Devise von Ludwig Wittgenstein, wonach alles, was wir sehen und alles, was wir beschreiben können, auch anders sein könnte (These 5.634 aus dem »Tractatus«, Wittgenstein, 1921/1968, S. 91), kann man mit einer solchen Einstiegsfrage beginnen, nach Unterschieden zu fragen: Wer stimmt der Beschreibung zu, wer nicht, und welche Beschreibung wählt der, der nicht zustimmt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Die Konsequenzen einer solchen Sicht sind durchaus beachtlich, etwa wenn es um das Verständnis psychischer »Krankheiten« geht. Diese nicht als etwas Vorgegebenes, sondern beobachterabhängig zu verstehen bedeutet, dass man danach sucht, in welchen komplexen sozialen Beschreibungsmustern und -traditionen sich die Phänomene bewegen, die als psychische »Krankheiten« bezeichnet werden – und diese Beschreibung dann als eine Möglichkeit neben vielen anderen möglichen Beschreibungen zu sehen. Ein solcher Zugang, vielfach als hilfreich und im positiven Sinn anders erlebt, bringt die systemische Therapie in viele Paradoxien, wenn sie sich mit den Methoden einer Wissenschaft beurteilen lassen muss, deren erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Wurzeln ganz anders aussehen.2 Auch wenn der systemischen Therapie die Anerkennung als wissenschaftliches Verfahren zugesprochen wurde, bleibt das Verhältnis doch schwierig, was man daran ablesen kann, wie lange es nach der wissenschaftlichen Anerkennung noch dauerte, bis diese Art des Zugangs auch im Rahmen der Gesundheitsversorgung in unserem Land zugelassen wurde (nämlich erst 2018, mehr als zehn Jahre später).
Zugleich, und das ist ein auffallender Kontrast, ist der systemische Ansatz in der Praxis nach wie vor stark nachgefragt, das Interesse geht hier weit über die Psychotherapie hinaus (Oestereich, 2013). Eine große Zahl von Ausbildungsinstituten verzeichnet ungebrochen reges Interesse an Ausbildungen in systemischer Therapie, Beratung, Coaching, Supervision. Offenbar gibt es einen großen Bedarf, mit der Komplexität kommunikativen Geschehens umzugehen, die verwirrende Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven zu handhaben, mit der man konfrontiert ist, sobald man mit mehr als einer Person zu tun hat (und das hat man in der Regel auch dann, wenn nur eine Person im Sprechzimmer sitzt). Das gilt für innerfamiliäre Konflikte und ihre Entstehung, die sich oft über Generationen hinweg rekonstruieren lassen, und das gilt genauso für Konflikte in Teams, Gruppen und Organisationen.
Im Gefolge dieser erfreulich großen Nachfrage kann man aber auch eine unerfreuliche Entwicklung beobachten: die Inflationierung des Begriffs »systemisch« und damit auch eine Trivialisierung systemtheoretischer Überlegungen: »Die über das ›Systemische‹ in die Gesellschaft getragene Systemtheorie ist inzwischen Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Inzwischen wird alles mit dem Begriff […] geschmückt […]. Es gibt ›systemisches Gesundheitscoaching‹, ›systemische Supervision‹, ›systemisches Mentoring‹, ›systemische Burn-Out-Prophylaxe‹, ›systemisches In- und Outsourcing‹, ›systemische Schulpädagogik‹, ›systemisches Sozialmanagement‹, ›systemisches Innovationsmanagement‹, ›systemische Personalentwicklung‹, ›systemische Hundeerziehung‹, ›systemische Heimerziehung‹ und ›systemisches Führen mit Pferden‹. Es scheint keine Expansionsgrenzen für das Adjektiv ›systemisch‹ mehr zu geben, die Durchsetzung der Substantivformen ›Systemik‹ oder ›Systemiker‹ ist nur noch eine Frage der Zeit. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es bald das Verb ›systemiken‹ oder ›systemisieren‹ geben wird« (Kühl, 2015, S. 333). So steht der Begriff in Gefahr, so weit zu verschwimmen, dass er unbrauchbar wird.
Bedenklich ist es unseres Erachtens auch, wenn man sich im Zuge der Popularisierung und Inflationierung dessen, was als systemisch verstanden wird, auf »systemische Werkzeugkästen« begrenzt. »Tools« sind derzeit hoch im Kurs. Die »Komplexitätsvergessenheit«, die Armin Nassehi (2017, S. 19 f.) beklagt, ist durchaus ein Thema für die systemische Praxis der Gegenwart. So warnt Wolfgang Loth eindringlich: »Mein Eindruck ist, dass bei all diesen zugestandenen notwendigen, wichtigen, nachvollziehbaren Schritten auf dem Weg zur Beantragung der Anerkennung die Tools und Techniken einfach überhandgenommen haben […]. Auf der Ebene von Tools und Techniken kann meiner Meinung nach die Unterscheidung zu anderen Therapieverfahren nicht substanziell durchgehalten werden« (Wortbeitrag im Streitgespräch Levold, Loth, von Schlippe u. Schweitzer, 2011, S. 165). Wie man eine Familien- oder Teamskulptur aufstellen lässt, ist leicht nachzuvollziehen. Auch die Mechanik einer zirkulären Frage ist von der Struktur her einfach, das Gleiche gilt für die Grundregeln des Reflektierenden Teams. Wenn sich systemische Praxis darauf begrenzt, systemische Interventionstechniken anzuwenden, fehlt jedoch eine wichtige Reflexionsebene, auf der man sich bewusst wird, warum man so interveniert, wie man es tut.
Und genau darum soll es in diesem kompakten Band gehen: Es soll ein Rahmen angeboten werden, der die Interventionen daraufhin überprüft, auf welchen Überlegungen sie beruhen, welche theoretischen Grundlagen ihnen zugrunde liegen. Denn – und das ist die wesentlichste These dieses Buchs – nicht die Intervention erschließt die Theorie, sondern umgekehrt. Eine system(theoret)ische Sicht auf die Welt führt nahezu zwangsläufig zu Formen des Intervenierens, wie wir sie als »systemisch« kennen.
Vor Jahren haben wir einen eher knappen Band vorgelegt, der als Ergänzung zu unseren »großen Lehrbüchern« (von Schlippe u. Schweitzer, 2012; Schweitzer u. von Schlippe, 2006) eine erste Einführung in systemische Praxis geben und die Vielfalt systemischer Interventionen vorstellen sollte (von Schlippe u. Schweitzer, 2009). Dieses Buch soll dazu dienen, den Hintergrund der dort vorgestellten Methoden auszuleuchten und nachvollziehbar zu machen sowie (system)theoretisch zu verstehen, wie und warum man in der Praxis handelt: »Gewusst wie … – gewusst warum …«
_________________
1 Eingeschobene Geschichten und Erfahrungsberichte, die von einem von uns erlebt wurden und entsprechend persönlich berichtet werden, kennzeichnen wir jeweils mit unserem Namenskürzel: AvS für Arist von Schlippe, JS für Jochen Schweitzer.
2 Umso erfreulicher ist daher, dass sie sich sogar in diesen Kontexten unter einer Perspektive, die nicht originär die ihre ist, durchaus als konkurrenzfähig erweist (Baumann, Haun u. Ochs, 2017; Sydow, Beher, Retzlaff u. Schweitzer, 2007).
2 Theorie und Praxis systemischer Interventionen
2.1 Historisches
»Patients have families.«
Richardson (1945)
Seit zu Anfang der 1950er Jahre das Tabu überschritten wurde, dass Psychotherapie nicht zwangsläufig in einer ausschließlich dyadischen Beziehung zwischen Psychotherapeut und Patientin oder Patient bestehen muss, hat sich die Familientherapie, und in ihrem Gefolge die Systemische Therapie, einen klar zu markierenden Platz in der Landschaft der Psychotherapiemodelle erobert. Natürlich war es kein gradliniger Prozess, der zu der heutigen Form der Systemischen Therapie geführt hat. Auch wenn im Folgenden der Akzent auf diese systemische Praxis gelegt wird, sollen die vielen anderen Quellen nicht unerwähnt bleiben, ohne die Systemische Therapie nicht das wäre, was sie heute ist (ausführlich von Schlippe u. Schweitzer, 2012; eine gute Zusammenstellung gibt auch Winek, 2010; prägnant und kompakt siehe Kriz, 2014a). Besonders sind hier verschiedene tiefenpsychologische Ansätze der Familientherapie hervorzuheben (exemplarisch hierzu Richter, 1963, 1972; Stierlin, 2001). Vor allem zu Beginn der Entwicklung dominierten ja die tiefenpsychologischen Konzepte das Feld, parallel entwickelten sich die humanistischen Ansätze der erlebnisorientierten Familientherapie (insbesondere ist hier die bis heute aktuelle Arbeit von Virginia Satir zu nennen, siehe z. B. Tschanz Cooke, 2014). Bis heute finden sich auch verhaltenstherapeutische Formen der Familientherapie (zum Vergleich und zur Verbindung systemischer und verhaltenstherapeutischer Familienarbeit siehe Lieb, 2010).
Aus der systemischen Familientherapie entwickelte sich im Laufe der Zeit die Systemische Therapie mit dem Anspruch, gleichwertig neben die bereits bestehenden anderen Psychotherapieansätze zu treten, aus denen heraus sie sich ja auch entwickelt hatte. Es lagen zahlreiche belastbare Studien vor, die diesen Anspruch auf Augenhöhe unterstrichen. Nach einer langen Auseinandersetzungsphase (ein erster Antrag war 1999 abgelehnt worden) erreichte die Systemische Therapie die formale Anerkennung. Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie bestätigte die Systemische Therapie/Familientherapie im Jahr 2008 als eigenständige, wissenschaftlich begründete und nachweislich bei einer Vielzahl psychischer Problemstellungen und Anwendungsbereiche wirksame Therapieform3 (Grundlage war die Übersichtsarbeit über den Stand der empirischen Studien durch von Sydow, Beher, Retzlaff u. Schweitzer, 2007).
Schon lange geht es dabei nicht mehr ausschließlich um die Familie im klassischen Sinn als Gruppierung blutsverwandter Mitglieder, von deren ausschließlicher Dominanz angesichts der Vielfalt der Möglichkeiten gemeinsamen Lebensvollzuges in der gegenwärtigen Gesellschaft ohnehin nicht die Rede sein kann (Bertram u. Bertram, 2009; Peuckert, 2012), zeigt sich doch »im Übergang zur ›zweiten Moderne‹ eine Pluralität miteinander konkurrierender gesellschaftlicher Leitbilder, an welchen sich das Individuum in seiner persönlichen Lebensplanung orientieren kann« (Gies u. Dietrich, 2015, S. 46). Es lassen sich zahlreiche unterschiedliche Familienleitbilder unterscheiden, wie ein intimes Zusammenleben von Menschen in unserem Kulturkreis gestaltet werden kann – und längst schon sind nicht alle mit dem Begriff »Familie« angemessen umschrieben.
Daher ist das Instrumentarium systemischer Praxis überhaupt nicht auf Familien begrenzt. Und es ist auch nicht auf »Therapie« im Sinne der Behandlung von Abweichungen im Erleben und/oder Verhalten von Menschen zu beschränken. Vielmehr bietet es sich überall dort an, wo es um soziale Systeme geht, in denen Menschen intensivere Beziehungen entwickelt haben, die für sie von persönlich hoher Bedeutung sind und die sich auf ihr Lebensgefühl und ihre persönliche Entwicklung auswirken. Denn der Fokus systemischer Praxis liegt auf dem Interaktionssystem, d. h., menschliche Probleme werden jeweils als eingebettet in Kommunikationen verstanden, und die Qualität des Kommunikationssystems ist entscheidend dafür, wie diese Probleme bearbeitet werden.
Ein Phänomen überhaupt als »Problem« zu beschreiben, ist ja bereits ein kommunikativer Vorgang, und auch Gefühle, innere Vorgänge, Vermutungen zu Problemursachen und Lösungsideen sind ja immer nur dann erkenn- und bearbeitbar, wenn sie auf der »Bühne« der Kommunikation auftauchen, also sprachlich oder nichtsprachlich ausgedrückt und vom Gegenüber als Kommunikation erkannt werden.
Das bedeutet dabei übrigens überhaupt nicht, dass man nicht auch mit Einzelnen »systemisch« arbeiten könnte. Man konzentriert sich nur nicht schwerpunktmäßig allein auf das, was sich »in« der Person abspielt, sondern darauf, wie der Betreffende sich aktiv handelnd in dem kommunikativen Gefüge bewegen kann, in dem er das »Problem« erlebt und beschreibt: »Wir interessieren uns für das Problem, wie es von den Leuten definiert wird. Die Art und Weise, wie über das Problem gesprochen wird, ist wichtiger als das Problem selbst« (Boscolo, Cecchin, Hoffman u. Penn, 1988, S. 71).
Ein wichtiger Aspekt kommt noch hinzu, wenn wir über »innen« und »außen« nachdenken: Auch innerseelische Prozesse sind nur denkbar, indem sprachliche Prozesse der Sinngenerierung berücksichtigt werden. Durch die Sprache kommt Kultur in unser Innerstes hinein, denn man kann auch mit sich selbst nicht anders kommunizieren als mit den gelernten Kulturwerkzeugen, also mit der Sprache (im weitesten Sinn, auch nonverbale Signale kann man als Form von Sprache erkennen) und den mit ihr vorgeformten Begriffen einer Kultur und den »Bedeutungsfeldern«, in denen sich diese Begrifflichkeiten bewegen (ausführlich dazu Kriz, 2017a; siehe Abbildung 1). Nach dem pragmatischen Start der Familientherapie entwickelte sich, etwa ab den 1970er, rasanter dann ab den 1980er Jahren, eine intensive Diskussion um die angemessene Theorie zur Rekonstruktion der Phänomene, die man vorfand. Dominierten zuvor noch die traditionellen Theorien, vor allem die psychoanalytischen Denkansätze, rückten zunehmend andere Modelle in den Vordergrund.
Abbildung 1: Wer sind wir ohne den Gebrauch von Kulturwerkzeugen? (© Björn von Schlippe)
Hier lassen sich zwei eng miteinander verflochtene Stränge beschreiben: Konstruktivismus und Systemtheorie. Das klingt einfacher als es ist, denn es handelt sich um alles andere als homogene Theoriegebäude. Vielmehr werden hier recht heterogene Denkfelder entfaltet. Es gibt zwar einen Konsens über eine Reihe von Grundprinzipien über die soziale Welt als »Konstruktion«. Doch die Ansätze sind von ihrer Begrifflichkeit und von dem her, worauf sie jeweils den Schwerpunkt legen, im Detail recht unterschiedlich. Daher wird der systemischen Praxis gelegentlich der Vorwurf gemacht, sie leide an einer »Inkohärenz der Pluralität an Theorie« (Jansen, 2016, S. 70), das Verhältnis von Theorie und Intervention sei oft nicht klar nachvollziehbar und die Interventionen zu wenig konsistent von der Theorie her gedacht (z. B. Schmitt, 2014, dieser Text löste übrigens eine interessante Theoriedebatte in der Zeitschrift »Familiendynamik« aus).
Nicht zuletzt gab diese Kritik den Impuls für dieses Buch. In den folgenden Unterkapiteln soll versucht werden, die Logiken der Intervention auf die jeweiligen theoretischen Überlegungen zurückzuführen. Dazu werden zunächst die grundlegenden Theorien im Überblick vorgestellt. Es soll kursorisch in die soeben skizzierten Denkfelder4 eingeführt werden: Was ist unter Konstruktivismus zu verstehen, welches sind die Systemtheorien, auf die sich die Familientherapie/systemische Praxis bezieht? Welche Rolle spielen sprachphilosophisch beeinflusste narrative Theorien? Einige ausgewählte Konzepte, die sich unmittelbar auf prägnante Interventionen beziehen, werden dabei bereits besonders hervorgehoben.
Im 3. Kapitel soll dann danach gesucht werden, welche Formen konkreter systemischer Praxis sich sozusagen zwangsläufig aus der Theorie ergeben. Hier sollen vertiefend Logiken der Intervention besprochen werden, die man als Metastrategien verstehen kann und die die Grundlage der therapeutischen oder auch beraterischen Aktivität in Bezug auf soziale Systeme darstellen. Dabei wird der Akzent mehr auf der jeweiligen Logik und weniger auf einzelnen Interventionen liegen. Dazu gibt es inzwischen sehr gute und ausführliche Werke (wie etwa Hansen, 2007; Levold u. Wirsching, 2014; von Schlippe u. Schweitzer, 2009, 2012; Schwing u. Fryszer, 2009, 2013; Lindemann, 2018, Eickhorst u. Röhrbein, 2019; sehr umfassend und mit einem besonderen Akzent auf Evidenzbasierung: von Sydow u. Borst, 2018).
Das 4. Kapitel befasst sich mit einem Überblick über Settings.
2.2 Konstruktivismus und sozialer Konstruktionismus
»Wir beginnen nun zu erkennen, dass wir nicht festen Boden, sondern eher Treibsand unter den Füßen haben. Bei unserer Analyse der unmittelbaren Erfahrung stellten wir fest, dass Kognition vor dem Hintergrund einer Welt emergiert, die zwar unsere individuellen Grenzen überschreitet, sich aber nicht von unserer Verkörperung trennen lässt.«
Varela, Thompson und Rosch (1992, S. 295)
Der zentrale Gedanke des Konstruktivismus kann mit einem Bonmot des chilenischen Biologen Humberto Maturana umrissen werden, der mit seiner Theorie der Autopoiese wesentlichen Einfluss auf die Theoriebildung der systemischen Praxis gehabt hat: »Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt!« (Maturana, 1982, S. 34). Das bedeutet nicht – wie dem Konstruktivismus manchmal vorgeworfen wird –, dass alles nur »Erfindung« von Beobachtern sei, dass es außerhalb der Erkenntnis »nichts« gäbe, sondern dass es müßig ist, von irgendwelchen Dingen zu sprechen, ohne das erkennende Subjekt miteinzubeziehen. Denn in gewisser Weise muss ein Gegenstand erst jemandem »entgegenstehen«, um Gegenstand zu werden5. Er muss erkannt, beobachtet werden, und beobachten heißt immer auch, etwas von etwas anderem zu unterscheiden: »Der Beobachter kann folglich einen Gegenstand nur beschreiben, wenn es zumindest einen anderen Gegenstand gibt, von dem er ihn unterscheiden kann, und wenn er Interaktionen oder Relationen zwischen beiden beobachten kann« (S. 34).
Damit wird eine Auffassung kritisch hinterfragt, nach der es möglich sei, die Welt zu erkennen (und sozusagen fotografisch abzubilden), wie sie »an sich« ist. Eine derartige Auffassung ignoriert nämlich, »dass sich in einer Welt wie der unseren keine Position denken lässt, von der her alles gleich aussieht«, wie Nassehi es in seiner »Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft« formuliert (Nassehi, 2017, S. 19 f.). Zudem ist man unweigerlich mit dem Dilemma konfrontiert, dass es kein Kriterium dafür gibt, »auf Grund dessen wir beurteilen könnten, wann unsere Beschreibungen oder Abbilder ›richtig‹ oder ›wahr‹ sind« (von Glasersfeld, 1981, S. 25). Jede Erkenntnis muss also aus Sicht einer solchen Erkenntnistheorie als Konstruktion von Bedeutung durch ein erkennendes Subjekt verstanden werden, das zwar so tun kann, als ob es außen steht (und in vielen Fällen damit auch handlungsfähig ist), das aber letztlich nie außerhalb der Welt sein kann, von der es ein Teil ist (von Ameln, 2004). Realität entsteht überhaupt erst in der Begegnung zwischen einem zu erkennenden System und einem erkennenden System (Kriz u. von Schlippe, 2011). Heinz von Foerster drückt das kritische Verhältnis zur Objektivität, das sich aus diesen Gedanken ergibt, in folgendem Bonmot aus (zit. nach von Glasersfeld, 1992, S. 31): »Objectivity is a subject’s delusion that observing can be done without him.«6
Diese Gedanken sind natürlich besonders bedeutsam, wenn es um die Art von Realität geht, die sich in menschlichen Lebenswelten abspielt. Die oben wiedergegebenen Überlegungen führen beinahe zwangsläufig in eine konstruktivistische Position hinein, die Konsequenzen für die Frage hat, wie die Psychologie und verwandte Wissenschaften ihre Erkenntnisse gewinnen. Denn diese Disziplin ist in einer besonderen Lage: Ihr Gegenstand »existiert« nicht, er muss erst erzeugt werden, bevor er untersucht werden kann (Herzog, 1984, 2012; Kriz u. von Schlippe, 2011). Walter Herzog spricht in dem Zusammenhang von einem »anthropologischen Vorverständnis«, das heißt einer zwangsläufig metaphorischen und philosophischen Antwort auf die Frage: »Was ist der Mensch? Was macht die menschliche Seele aus?«, bevor Theoriebildung überhaupt beginnen kann: »Es gibt nicht ein irgendwie Gegebenes, das als Gegenstand der Psychologie identifiziert werden könnte […]. Der Gegenstand der Psychologie kann nicht ›gefunden‹ oder ›entdeckt‹ werden, […] er muss vielmehr geschaffen werden« (Herzog, 1984, S. 91 f.). Er kritisiert in diesem Zusammenhang, dass viele Modelle in der Psychologie genau diesen Schritt nicht reflektieren, explizit etwa nennt er den klassischen Behaviorismus von Burrhus Frederic Skinner, dem implizit (und ohne dies zu reflektieren) ein Bild vom Menschen als Maschine zugrunde liegt: Der Versuch dieser Theorie, voraussetzungsfrei, ohne jede Metaphorik die conditio humana zu erforschen, macht sie blind für die eigenen impliziten Vorannahmen (Herzog, 2012, S. 91 f.). Eine Theorie kann, so Herzog, zwar ihre eigenen theoretischen Aussagen überprüfen (etwa im Fall von Skinner die Lerngesetze), ihr Menschenbild ist jedoch nicht überprüfbar.
Ein vertiefender Blick auf die hier skizzierten Zusammenhänge findet sich bei Jürgen Kriz (2017a). Er macht deutlich, dass es sich beim »Erkennen« nicht um einen rein verstandesmäßigen Vorgang handelt. Er bezieht sich dabei auf die Biosemiotik des Biologen Jakob von Uexküll. Dieser verstand Leben als »Zeichenprozess« und konnte zeigen, dass bereits einfache Lebewesen ihrer Umwelt Bedeutungen zuweisen, die je nach Kontext variieren können – ein Beispiel: Auf dem Schneckenhaus von Einsiedlerkrebsen sitzen gern Seeanemonen, die mit diesen eine symbiotische Verbindung eingehen – die Anemone schützt den Krebs vor Fressfeinden und nährt sich von den Resten seiner Mahlzeiten. Je nach Kontext, je nach Grad von Hunger des Krebses jedoch sieht dieser die Anemone als Gast, als Schutz oder aber auch als Futter (etwa wenn er sehr hungrig ist), und wenn er sein Schneckenhaus verloren hat, versucht er, in die Anemone einzudringen und sieht sie als »Haus« (Kriz, 2017a, S. 36 f.). Diese Fähigkeit, seine Umwelt spezifisch, aber nicht starr, sondern kontextgebunden variabel wahrzunehmen, nennt von Uexküll »Merkwelt«, beim Tier ist es eine angeborene und instinktive (aber zugleich durchaus dynamische) Fähigkeit der Unterscheidung, Phänomene der Außenwelt als »Zeichen« wahrzunehmen, ihnen damit bestimmte Bedeutungen zuzuweisen und sich dadurch in einer hochselektiven und spezifischen »Wirkwelt« zu bewegen. Kriz kommt zum Schluss: »Die ›Welt‹ ist für Lebendiges zeichenhaft strukturiert« (S. 76).
Der Konstruktivismus als grundlegende Erkenntnistheorie wird ergänzt durch den »sozialen Konstruktionismus« (Gergen, 2002; Gergen u. Gergen, 2009). Beide Theorien stehen einander sehr nah, sie stellen so etwas wie das erkenntnistheoretische Fundament systemischer Praxis dar. Noch stärker als der Konstruktivismus betont der Konstruktionismus den Prozess der Erzeugung von Wirklichkeit als einen sozialen Vorgang. Auch hier wird ein Wissenschaftsverständnis kritisiert, das davon ausgeht, dass da eine Realität sei, die man »entdecken« könnte. Wahrheitsansprüche können nie absolut sein: »Wahrheit ist nur innerhalb von Gemeinschaften zu finden« (Gergen u. Gergen, 2009, S. 21), die sich in für sie typischen »Sprachspielen« (ein Begriff von Wittgenstein) bewegen. Menschliche Wirklichkeit wird also gemeinsam und gesellschaftlich konstruiert: In einem jeweils spezifischen historischen Kontext sind die Dinge »wahr« oder nicht. Die Bedeutung von Sprache wird hier besonders betont: Sie tritt im Gebrauch zwischen Menschen in Form von Geschichten auf (damit steht der Konstruktionismus der narrativen Theorie besonders nah). Wichtig ist dabei, dass Erkenntnis im Rahmen dieser Theorie nicht beliebig wird. Wenn Realität nicht etwas ist, das man »da draußen« irgendwie »entdecken« kann, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass sich jeder seine eigene »einfach so« erfinden könne. Vielmehr geht es darum, zu verstehen, wie Gemeinschaften sich so verständigen, dass sie »Selbstverständlichkeiten« erzeugen: »Im Konstruktionismus gehen wir davon aus, dass soziale Ordnung aus dem heraus entsteht, was die Leute zusammen tun. Sie ist das Ergebnis von Konstruktionsprozessen. Das heißt, dass alles, was wir für selbstverständlich halten, aufrechterhalten wird durch eine oft (aber nicht immer) unausgesprochene soziale Übereinkunft« (McNamee, 2017, S. 242).
2.3 Systemtheorie(n) – eine oder viele?