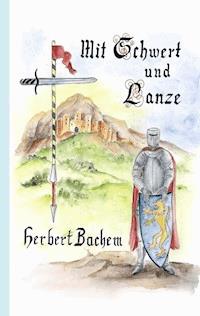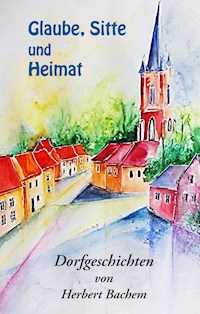
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schauplatz der sieben Geschichten dieses Bandes ist das kleine Dorf Ellen. An der Stadtgrenze zu Düren, zwischen Köln und Aachen gelegen, gehört der Ort heute zur Gemeinde Niederzier. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts lebten dort ungefähr sechshundert Menschen. Die Erzählungen führen den Leser zurück in diese Zeit. Sie haben einen wahren Kern, vermeiden aber die authentische Wiedergabe der Ereignisse. Nicht Anekdoten stehen im Vordergrund dieses Buches, sondern die Denkweisen und Stimmungen, die sie möglich machten. Die Geschichten erzählen von Freude und Leid, Liebe und Verrat und der Suche nach einem Platz in einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft. Glaube, Heimat und Sitte bilden den Sockel, auf dem die Erzählungen ruhen. Ohne thematisiert zu werden, geben diese Werte den Geschichten ihre Originalität. Ein weiteres verbindendes Element ist „die Ecke“, die „Agora“ der Jugend jener Zeit. Die Eckensteher, meist junge Männer, verstanden sich als Vertreter einer unangepassten Generation. Sie diskutierten alles, was im Dorf und der großen weiten Welt vor sich ging, und vergaßen dabei nicht, vorübergehende Dorfbewohner anzupöbeln oder vorbeieilenden Frauen und Mädchen nachzupfeifen. „Die Eckensteher“, ein gesellschaftliches Kurzzeitphänomen, das mit der Halbstarken-Bewegung Ende der 60er Jahre sang- und klanglos verschwand, finden in „Glaube, Heimat, Sitte“ eine kleine, erzählerische Würdigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Urenkel
Lionel Vincent
Danke Wenn ich in Danksagungen lese, von welcher Entourage manche Autoren während des Schreibens umgeben sind, wundere ich mich. Bei mir macht das Alles meine Frau. Entsprechend umfassend ist mein Dank an sie. Meine liebe Gudrun vielen, vielen Dank!
Inhalt
Katastrophensommer
Die sieben Fußfälle oder Eine bemerkenswerte Beerdigung
Der Gefangene
Maria
Maiball
Dorfpolitik
Vegetative Dystonie
Nur wer die Vergangenheit kennt,
hat eine Zukunft
Wilhelm von Humboldt
Katastrophensommer
Keine Frage, die allgemeine Hysterie, ausgelöst durch die Rinderseuche BSE, ging Willi gehörig auf die Nerven.
Um den Nachrichtensprecher zum Schweigen zu bringen, drückte er heftiger als nötig auf den Aus-Knopf des Autoradios und murmelte gleichzeitig: »Halt´s Maul.« Die Sendung drehte sich mal wieder um nichts anderes als dieses leidige Thema. Glaubte man den Medien, stand eine Epidemie biblischen Ausmaßes bevor, der mittelalterlichen Pest vergleichbar.
Aber die Sache hatte auch etwas Gutes. Während das BSE-Theater seinen medialen Höhepunkt erreichte und Talkshows hierzu auf allen Fernsehkanälen liefen, fielen die Preise für Rindfleisch in den Keller. Diese Gelegenheit ließ sich Willi nicht entgehen und füllte seine Tiefkühltruhe mit Rinderfilets. Wenn er Glück hatte, würde sein Großeinkauf bis zur nächsten Panikattacke reichen. Vielleicht bekam er dann Gänse oder Schweine nachgeschmissen. Egal, er würde nehmen, was kam.
Willi erreichte den Ort Ellen. Bevor er seinen Bruder aufsuchte, der, im Gegensatz zu ihm, das Dorf nie für längere Zeit verlassen hatte, machte er am alten Friedhof halt, der mitten im Dorf lag. Kaum hatte er ihn betreten, befiel ihn wieder jenes seltsame Gefühl, das er nur schwer beschreiben konnte. Es war eine Art Trauer, in die sich ein wehmütiges Verlangen nach seiner Kindheit mischte. Nirgendwo auf der Welt wurde ihm so deutlich, dass es zu viel verlorene Zeit in seinem Leben gab.
Langsam ging er an den Gräbern entlang.
Bis auf wenige Ausnahmen kannte er alle Menschen, die hier ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Er wusste, dass die meisten in ihrem Leben viel Leid und Entbehrung hatten erdulden müssen. Es gab kaum eine Familie, die keine Angehörigen in einem der beiden Weltkriege verloren hatte. Aber auch jenseits dieser nationalen Tragödien und ihrer Folgen war das Leben hart gewesen. Alle, die hier lagen, hatten schwer arbeiten müssen, um sich und die Ihren über die Runden zu bringen. An einige erinnerte er sich nur als Greise. Aber es gab auch Verstorbene, deren ganzes Leben er vom ersten bis zum letzten Tag überschauen konnte. Insbesondere diese Schicksale bewegten ihn zutiefst. Die Frage nach dem Sinn des Lebens sprang ihn nirgendwo mit einer solchen Wucht an wie auf diesem Stückchen Land.
Nachdem er seinen Rundgang beendet hatte, ging er zurück zum Auto, um zu seinem Elternhaus zu fahren. Doch bevor er in den Wagen stieg, fiel sein Blick auf die Ecke, die nur wenige Schritte von seinem Parkplatz entfernt war. Mein Gott, welche Erinnerungen verband er mit diesem unscheinbaren Platz! Er schüttelte lächelnd den Kopf. Nach so vielen Jahren fiel es ihm heute schwer, nachzuvollziehen, welche Rolle diese triste Kreuzung für die Dorfjugend damals gespielt hatte. Langsam, geradezu behutsam, ging er in Richtung des kleinen, menschenleeren Platzes.
Als er ihn erreicht hatte, blickte er sich um, sah die alten, kleinen Backsteinbauten, in denen seit Generationen die gleichen Familien wohnten, die sattgrünen Linden, die den Abriss der alten Zwergschule überlebt hatten, und die gotische Backsteinkirche mit ihrem spitzen Turm und den beiden Glocken. Ihr Geläut hatte ihn an Festtagen, wenn beide gleichzeitig erklangen, stets begeistert.
Wie schön sauber die Straßen sind, dachte er. Und wie hatten die in seiner Kindheit ausgesehen! Kuhfladen, Pferdeäpfel, Schmutz und Dreck, wohin man schaute. Er war sich nicht sicher, ob es überhaupt noch Pferde und Kühe im Dorf gab. Ihm fiel eine Geschichte ein, die sich Anfang der Fünfzigerjahre ereignet und das Dorf in helle Aufregung versetzt hatte. Er schmunzelte, als er an die damaligen Geschehnisse zurückdachte.
Es musste Anfang Juli gewesen sein, als ein Bauer, wie jeden Abend, seine sechs Kühe von der Weide in den Stall trieb. Plötzlich stellte er fest, dass sich Rosa – eine seiner besten Milchkühe – seltsam benahm. Das Tier stolperte und schwankte, als wäre es besofen, und war kaum in der Lage, mit den übrigen Kühen Schritt zu halten. Auf dem Hof angekommen, gingen alle Tiere – bis auf Rosa – zu ihren Plätzen im Stall und freuten sich darauf, gemolken zu werden.
Rosa irrte derweil auf dem Hof umher und reagierte weder auf ihren Namen noch auf laute Drohungen, ja nicht einmal auf das Schwingen des gefürchteten Knüppels, einem abgebrochenen Besenstiel, der sonst nie seine Wirkung verfehlte. Mal stolperte die Kuh in Richtung Geräteschuppen, dann in Richtung Misthaufen, dann zum Tor – nur nicht zum Kuhstall. Dem Bauer blieb nichts anderes übrig, als das Hornvieh erst einmal auf dem Hof zu lassen und seine Frau aus der Küche zu holen. Mit vereinten Kräften würden sie das Tier einfangen oder zur Stalltür treiben.
Das gelang schließlich auch. Außer Atem und schweißgebadet konnte der Bauer Rosa endlich den Kälberstrick, der sonst als Geburtshilfe beim Kalben gebraucht wurde, um den Hals legen. Während er vorne zog, schob seine Frau die Kuh von hinten, und schließlich stand Rosa an ihrem angestammten Platz und konnte wie alle anderen gemolken werden.
»Die bleibt morgen im Stall«, sagte der Bauer kurz und knapp, während er seine grün melierte Segeltuchmütze vom Kopf nahm, um sich damit den Schweiß von Glatze, Stirn und Hals zu wischen.
»Das wird das Beste sein«, pflichtete seine Frau bei und ging in ihren Gummistiefeln schweren Schrittes und keuchend zurück zum Haus.
Die beiden maßen dem Ereignis keine große Bedeutung zu, denn es kam immer wieder einmal vor, dass ein Tier, sei es nun eine Kuh, ein Schwein oder ein Huhn, verrückt spielte. Selbst der Hofhund oder die Katzen verhielten sich nicht an jedem Tag gleich, hatten ihre Launen genau wie Menschen und fingen sich deshalb auch gelegentlich einen leichten Fußtritt ein oder wurden von einer Kartofel getrofen, wenn sie es zu arg trieben.
Der Bauer und seine Frau aßen – wie immer – in der Küche. Die Küche war der größte Raum im Haus. In der Mitte stand ein großer rechteckiger Tisch, an dem gut und gerne zehn Leute Platz fanden. Auch der Kohleherd war riesig. Er hätte ohne Weiteres in einer Speisegaststätte als Kochgelegenheit dienen können. Diese Einrichtungsgenstände stammten noch aus der Zeit vor dem Krieg, als noch saisonale Hilfskräfte für Arbeiten gebraucht wurden, die nun Maschinen erledigten. Die Terrakotta Fliesen des Fußbodens hatten ihre Lasur längst verloren und waren an besonders strapazierten Stellen deutlich ausgetreten. Über der Mitte des Tisches und in der Nähe des Herdes baumelten je zwei klebrige Fliegenfänger von der Zimmerdecke, die derart mit Stubenfliegen übersät waren, dass Neuankömmlinge kaum noch Platz fanden. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass es kaum einen Flecken in der Küche gab, der nicht von ihnen in Beschlag genommen wurde. Den Bauer und die Bäuerin störten sie offensichtlich nicht. Nur wenn sie dem Bauer über die Glatze krabbelten, verscheuchte er sie hin und wieder mit einer mehr oder weniger unbewussten Handbewegung.
Es gab Reste vom Sonntag. Zuerst einen Teller Gemüsesuppe, dann Frikadellen und Kartoffelpüree, dazu Erbsen und Möhren. Die Eheleute sprachen während des Essens nicht miteinander. Das brauchten sie auch nicht, weil sie voneinander wussten, dass sich ihre Gedanken um die gleichen Dinge drehten.
»So machen wir es«, sagte der Bauer, nachdem er fertig gegessen hatte, als hätten sie nach einem langen Gespräch eine Übereinkunft gefunden.
Seine Frau nickte. Sie standen auf. Der Bauer ging Richtung Kuhstall, während sie die Küche aufräumte.
Am nächsten Morgen, so gegen fünf, ging ein wütendes Unwetter nieder. Blitze, Regen und Hagel prasselten in einer Heftigkeit auf die Erde, wie man es seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Den wilden Zuckungen der Blitze folgten dröhnende Donnerschläge, die selbst Dorfbewohner mit besonders gutem Schlaf auf unsanfte Weise aus dem Bett trieben. Es war, als wollte die wütende Natur ihren Unmut kundtun und mit ihrer ganzen Gewalt gegen etwas protestieren, wenngleich niemand wusste, worum es sich dabei handeln konnte. Die verschlammten Gräben an den Straßenrändern konnten solche Wassermassen nicht in den Ellbach ableiten. Die Straßen verwandelten sich im Handumdrehen in Seen. Dann überschwemmte die Flut auch die Vorgärten, bis sie zuletzt die Höfe erreichte und dort die Jauchegruben in kurzer Zeit zum Überlaufen brachte.
Nun ging es nicht mehr nur um Regenwasser, sondern um ein Gemisch aus Wasser, Kot und Jauche, das sich in die Keller ergoss und sogar die Hauseingänge überflutete. Eine Katastrophe! Es würde Monate dauern, bis die Räume wieder trocken waren und sich der Gestank der Exkremente verzogen hatte. Zum Glück waren die eingekellerten Vorräte des Vorjahres um diese Jahreszeit schon weitgehend aufgebraucht und die neuen noch nicht eingelagert.
Um sieben Uhr beruhigte sich das Wetter. Es war, als wollte der Himmel sagen: Das reicht fürs Erste, aber nehmt euch in Acht! Wie bei einem Rückzug nach gewonnener Schlacht zuckte in der Ferne hier und da noch ein Blitz als eine Art Warnung, sich ja nicht sicher zu sein, dass eine Wiederholung nicht möglich sei. Zwar ergossen sich noch immer heftige Regenströme, aber auch die waren bald verrauscht. Schwefelgelbe Wolken verkrochen sich am Horizont und machten einem sanfteren Himmel Platz, dessen Wolken von der Morgensonne goldgerändert waren.
Die Menschen waren schockiert und verängstigt. Viele hatten während des Unwetters im Gebet verharrt, gesegnete Kerzen abgebrannt und zu Gott gefleht, das Schlimmste von Haus und Hof fernzuhalten. Ihre Bitten waren erhört worden. Es hatte keine Blitzeinschläge in Gebäude gegeben: Mensch und Vieh waren verschont geblieben. Man dankte Gott in Gebeten und nahm sich vor, alle Gelübde zu erfüllen, die man während des Unwetters im Stillen abgegeben hatte.
Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Das Gewitter war nur die Ouvertüre zu einer Serie von Unwettern gewesen, die das Dorf in den nächsten Tagen und Wochen heimsuchen sollte. Die Kette der Gewitter riss bis weit in den August hinein nicht ab, und man konnte nur hofen, dass der Herbst ruhiger werden würde.
Verzweiflung machte sich breit. Der Pfarrer hatte bereits mehrere Bittgottesdienste abgehalten, aber auch das hatte nicht geholfen. Als Steigerung der heiligen Messen wurde eine Bittprozession zu Ehren des Heiligen Donatus von Münstereifel durchgeführt, der als Schutzpatron gegen Gewitter schon oft gute Dienste geleistet hatte. Die Prozession zog durch die ortsnahe Flur, und mit Sorge sahen die Teilnehmer, dass das Getreide flach auf den Feldern lag und in der Nässe zu faulen drohte. Welche Wonne war es an schönen Tagen, durch die Flur zu wandern und den Duft des Sommers mit seinem unvergleichlichen Aroma tief einzuatmen. Wie Gemälde wirkten dann die glänzenden Kornfelder, gerahmt von Mohn, Kornblumen und filigranen Gräsern. Und jetzt! Es roch nach nassem Stroh und Fäulnis. Die Wege waren schlammig, die Ackerraine ohne Farbe, ja, es war alles so traurig, dass selbst die Lerchen, die sonst allgegenwärtig waren, nicht mehr singen mochten.
Es war wirklich zum Verzweifeln! Außer Beten konnte nichts helfen, das war klar. Aber es schien, als ob Gott die Bitten der Menschen nicht hören wollte, denn die Bittprozession war kaum eine halbe Stunde unterwegs, als sich der Himmel erneut verdunkelte. Gelb-schwarze Wolken zogen von Westen auf, und man beschloss, den Bittgang vorzeitig zu beenden, um zu Hause zu sein, wenn sich die Schleusen des Himmels erneut öfneten.
Ein deutlicheres Zeichen für seinen Unmut konnte Gott nicht senden.
An die Kuh Rosa erinnerte sich im Dorf zu diesem Zeitpunkt niemand mehr. Schließlich hatte man genug andere Sorgen, als auch nur einen Gedanken an eine verrückte Kuh zu verschwenden, die mittlerweile längst zu Rinderbrust, Rinderbraten und Wurst verarbeitet worden war.
Das änderte sich schlagartig, als eine zweite Kuh in gleicher Weise erkrankte.
Es war an einem Tag in der zweiten Augusthälfte, als ein weiterer Bauer ein höchst merkwürdiges Verhalten bei einer seiner Kühe feststellte. Bei Erna zeigten sich die gleichen Symptome wie seinerzeit bei Rosa. Nun wurde die Sache zu einem Thema, und zwar bei allen Bewohnern des Dorfes. Zum ersten Mal brachte man die Wetterphänomene und die Erkrankung der Kühe miteinander in Verbindung. Mehr und mehr setzte sich die Überzeugung durch, dass die Gewitter und der Kuhwahnsinn zwei Seiten derselben Medaille seien.
An Vermutungen und Theorien, wie die Dinge zusammenhängen könnten, fehlte es nicht. Aber die letzte Erklärung für die Heimsuchungen wollte einfach nicht gelingen, was die Verunsicherung der Dorfbewohner noch steigerte.
Selbstverständlich hatte man sich in den Nachbargemeinden umgehört, um zu erfahren, wie dort die Lage war, und natürlich hatten auch dort Gewitter gewütet. Aber es schien tatsächlich so zu sein, dass das Zentrum der Unwetter regelmäßig über Ellen lag. Und von erkrankten Kühen wusste in den anderen Orten niemand etwas. Das klang alles wenig ermutigend, und erste Stimmen wurden laut, die befürchteten, der Ort Ellen könne im Laufe der Zeit unbewohnbar werden.
Auch wenn die Gebete das stärkste Mittel im Kampf gegen den Untergang waren, so suchte man doch auch nach irdischer Abhilfe. Einige Dorfbewohner versuchten, die Sache nüchtern zu analysieren, um so den Ursachen des Unheils auf die Schliche zu kommen. Man fragte zum Beispiel danach, ob die Gewitter in regelmäßigen Abständen kamen. Wöchentlich vielleicht? Oder alle zehn Tage? Kamen sie an bestimmten Wochentagen häufiger als an anderen? Vielleicht freitags öfter als dienstags? Niemand wusste es. Man versuchte sich gemeinsam zu erinnern, stellte aber schnell fest, dass die Wahrnehmungen weit auseinandergingen.
Bei den Kühen war die Sache einfacher. Die Tiere wurden, wenn es hell wurde, auf die Weide getrieben und, bevor es dunkel war, zurück in den Stall gebracht. Mehr gab es da nicht zu sagen. Und doch lag genau hier die Lösung des Problems.
Wer letztlich die entscheidende Frage als Erster stellte, wurde nie eindeutig geklärt. Sie stand plötzlich im Raum und führte zum Schlüssel des Rätsels. Sie lautete ganz simpel: Auf welchen Weiden hatten Rosa und Erna gegrast?
Nachdem klar war, dass sie auf direkt nebeneinander liegenden Wiesen gestanden hatten, fiel es den Menschen wie Schuppen von den Augen, denn diese Wiesen hatten eine Gemeinsamkeit: Über sie hinweg ging eine Hochspannungsleitung, die seit dem 1. Juli Strom führte!
Der Zusammenhang war ofenkundig. Niemand konnte bestreiten, dass der Beginn des Katastrophensommers exakt mit der Inbetriebnahme der Hochspannungsleitung zusammenfiel.
Alles war nun zu erklären: Die Hochspannung sättigte die Luft mit Elektrizität, die sich dann über Ellen (vielleicht angezogen durch den hohen Kirchturm?) entlud. Über die Kühe brauchte man kein Wort zu verlieren. Es war ein Wunder, dass nur Rosa und Erna erkrankt waren. Elektrische Strahlen dieser Dimension hätten – da war man sich sicher – die ganze Herde wahnsinnig machen können!
Obwohl man wusste, dass die Ursache allen Übels nicht von heute auf morgen zu beseitigen war, ging ein Aufatmen durch den Ort. Es war also nicht der Zorn Gottes, der sie getrofen hatte. Es gab eine irdische Ursache.
Willi war so in Gedanken, dass er einen Schreckenslaut von sich gab und heftig zusammenzuckte, als ihm plötzlich jemand von hinten auf die Schulter schlug.
»Maria und Josef«, hörte er sagen, »mach dir nicht ins Höschen!«
»Ach, ich war nur in Gedanken«, entgegnete Willi, der sich sofort wieder gefasst hatte, während er sich umdrehte.
»Kennst mich wohl nicht mehr?«, fragte sein Gegenüber und wartete gespannt auf Antwort. Als Willi nicht sofort reagierte, fuhr der Neuankömmling fort: »Ich bin es, der liebe Lukki!«
»Lukki«, erwiderte Willi überrascht, »nein, dich hätte ich jetzt wirklich nicht erkannt. Ist ja auch einige Zeit her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben!«
»Bestimmt zwanzig Jahre«, mutmaßte Lukki. »Und? Wie geht’s denn so? Was machst du denn? Arbeitest du noch? Ich habe die Rente durch.«
»Ich auch«, antwortete Willi, »ich bin mit sechzig gegangen.«
»Wartest du auf jemanden oder warum stehst du hier herum wie bestellt und nicht abgeholt?«
»Nein, nein, ich warte auf niemanden. Ich will zu meinem Bruder und war gerade auf dem Kirchhof. Ich weiß auch nicht warum. Plötzlich dacht´ ich, ich gehe mal auf die Ecke.«
Willi wollte noch etwas sagen, aber dazu kam er nicht, denn Lukki legte sofort los. »Von denen, die früher hier regelmäßig standen, ist ja keiner mehr da. Schmiss, Mücke, Klemens und der Schäl sind tot. Tonney lebt noch. Der ist in Niederzier im Altersheim. Und die anderen? Na ja, da bleibt ja kaum noch einer. Der Buckel und Hännes sind weggezogen. Ich weiß nicht, was aus denen geworden ist. Tja, so ist das, mein Lieber! Das Leben geht weiter. Aber du siehst gut aus. Wo wohnst du denn jetzt?«
»Am Rhein«, antwortete Willi, »in einem kleinen Dorf, das kennst du nicht. Aber sag mal, kannst du dich noch an den Sommer erinnern, in dem es so viele Gewitter gab? Das muss ´51 oder ´52 gewesen sein?«
»Du lieber Gott«, wunderte sich Lukki, »wer kann sich denn an so etwas erinnern? Woher soll ich denn wissen, ob es ´52 viele Gewitter gegeben hat? Fällt dir nichts Besseres ein? Aber ein bisschen bekloppt warst du ja immer.«
Willi ließ sich nicht beirren. »Hör mal, Lukki, damals war doch große Aufregung im Dorf, weil ein schweres Gewitter das andere jagte und dauernd die Straßen überschwemmt waren. Die Leute haben gemeint, das käme von der Hochspannungsleitung.«
Anscheinend dämmerte es Lukki. Er schaute in den Himmel, als wollte er prüfen, ob es ein Unwetter gab, und sagte dann lang gezogen: »Jaaa, jaaa, jetzt wo du es sagst, stimmt, da war irgendetwas. Gab es da nicht Messen und Prozessionen und weiß der Teufel was? Ja, ja, jetzt erinnere ich mich – und was soll das?«
»Nichts soll das! Das ging mir nur vorhin durch den Kopf, als ich hier stand. Wie ist das damals ausgegangen?«
»Ausgegangen? Was soll da ausgegangen sein? Im September war der schwüle Sommer zu Ende, und die Gewitter haben aufgehört. Aus, Ende. Klappe zu, Affe tot!« Lukki grölte über seine eigene Redewendung, wie zu alten Zeiten, und fügte noch hinzu: »Über so eine Scheiße machst du dir Gedanken! Du bist mir ein Kerlchen! Du bist ein Kerlchen wie das Davidchen, und das Davidchen war ein Scheißkerlchen!« Lukki schüttete sich erneut aus vor Lachen und klopfte Willi heftig auf die Schulter: »Komm, wir gehen einen trinken. Du kannst später noch zu deinem Bruder, der läuft dir nicht weg.«
»Von mir aus«, sagte Willi, »nur eines noch: Was ist aus der Stromleitung geworden, ist die noch in Betrieb?«
»Ach was«, sagte Lukki, der sich offensichtlich wieder erinnerte, »das Bergwerk ist doch Anfang ´60 zugemacht worden, weil es sich nicht mehr lohnte. Danach haben sie dann die Masten abgebaut. Heute ist da, wo das Bergwerk war, ein dreihundert Meter tiefes Loch, denn das ganze Gebiet gehört zum Tagebau Hambach. Sonst noch was? Oder können wir endlich gehen?«
»Wir können gehen«, sagte Willi, »ich habe Durst.«
»Das erste vernünftige Wort von dir«, stellte Lukki zufrieden fest.
Dann gingen die beiden Arm in Arm in Richtung Kneipe.
Die sieben Fußfälle
oder
Eine bemerkenswerte Beerdigung
Unmittelbar nach Trinitatis setzte die Schafskälte mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen und einem regelrechten Sauwetter ein. Das Thermometer zeigte in ungünstigen Lagen nachts Minusgrade an, es regnete in Strömen, ja, es graupelte sogar. Die Bauern klagten nun noch lauter über zu erwartende Ernteausfälle, als sie es schon im Mai getan hatten, der nach ihrer Ansicht viel zu trocken gewesen war.
Der Tod von Knollepief fiel exakt auf den Tag des Wettereinbruchs, und die Leute sagten spöttisch: »Das ist typisch für diesen alten Querkopf. Kaum ist er oben, macht er auch von da aus Durcheinander.«
Das kam nicht von ungefähr. Knollepief war zu Lebzeiten ein Dorforiginal gewesen, wenn auch kein beliebtes. Es galt der Spruch: »Man muss ihn nicht sehen, um zu wissen, dass er da ist.« Der ihm eigene üble Geruch, insbesondere aber der Gestank seiner Pfeife, waren Legende. Er nahm den Stinkkolben nur zum Stopfen aus dem Mund, ansonsten hing er in seinem linken Mundwinkel wie angewachsen. Der Spitzname Knollepief beruhte auf der Unterstellung, er würde statt Tabak getrocknete Rübenblätter rauchen, was natürlich kompletter Unsinn war. Aber irgendetwas musste er dem Tabak beigemischt haben, um dieses beißende »Aroma« zu erzeugen. Was es auch immer gewesen sein mochte, Knollepief nahm sein Geheimnis mit ins Grab.
Aber es war nicht nur der beißende Pfeifenrauch, mit dem er seine Mitbürger auf Abstand gehalten hatte. Seine ganze Wesensart war den Dorfbewohnern herzlich zuwider gewesen. Seine permanenten Sticheleien waren verletzend, und er schreckte auch nicht vor Gemeinheiten zurück, die dem einen oder anderen schwer zu schafen gemacht hatten. Rücksichtnahme kannte er nicht.
Selbst während der heiligen Messe, die er sonntags regelmäßig besuchte, konnte er zu einem wahren Ärgernis werden, auch wenn er dort seine Pfeife aus dem Mund nahm. Wenn ihm danach war, hob er ganz langsam und genüsslich eine Seite seines Gesäßes, knif die Augen zusammen und ließ lautstark entweichen, was bis dahin, Gott sei Dank, in seinem Gedärm verborgen gewesen war. Gegen das, was sich dann ausbreitete, war der Pfeifengestank himmlischer Wohlgeruch. Proteste gegen diese Abscheulichkeit waren sinnlos. Es konnte leicht passieren, dass er, statt sich zu entschuldigen, die andere Seite hob und eine zweite Wolke hinterherschob, sodass außer Flucht nichts blieb.
Den Verblichenen hatte der Schlag getroffen. Er war in seinem Garten vornübergekippt, als er Salat stechen wollte, und regungslos liegen geblieben. Ein Nachbar hatte zwar gesehen, wie er umgefallen war, sich aber nichts weiter dabei gedacht. Erst als er sah, dass Paul, so hieß der Tote mit Vornamen, nach geraumer Zeit immer noch genauso dalag, wie er hingefallen war, ahnte er, dass etwas nicht stimmen konnte. Er war über den kniehohen Zaun geklettert und hatte sofort gesehen, dass Knollepief im Jenseits war. Seine Pfeife hatte er noch im Mund. Wahrscheinlich hatte er reflexartig die Zähne zusammengebissen, als er zu Boden ging.
Leibliche Verwandte hatte er nicht. So wie es aussah, musste sich seine angeheiratete Nichte, die in der gleichen Straße drei Häuser weiter wohnte, um die Beerdigung kümmern.
Therese, genannt Dresje, lebte zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn Kaspar. Ihr Mann, der Nefe des Toten, wurde in Russland vermisst, und obwohl der Krieg schon acht Jahre vorbei war, hatte sie sich noch nicht entschließen können, ihn für tot erklären zu lassen.
Dresje erfuhr von dem Todesfall erst Stunden später, als sie von ihrer Putzstelle in Düren zurückkam. Sie hatte kaum das Postauto verlassen, als man sie informierte. Nachdem sie verstanden hatte, worum es ging, stockte ihr der Atem, denn ihr wurde schlagartig klar, was da auf sie zukam.
Ein enges Verhältnis zu dem Verstorbenen hatte sie nie gehabt. Eigentlich gar keines. Sie war immer froh gewesen, wenn sie nichts von ihm sah oder hörte. Trotzdem hatte sie ihn, wenn er krank im Bett lag, stets mit allem Nötigen versorgt. Dank hatte sie dafür nie erfahren. Es konnte im Gegenteil passieren, dass sie sich hier und da einen Rüfel einfing, wenn nicht alles so lief, wie der Onkel es sich vorstellte. Es war eben nie einfach gewesen, mit diesem Menschen umzugehen.
Mochte sie die Situation auch noch so sehr beklagen, es war für sie völlig unmöglich, sich um die Beerdigung zu drücken. Die hatte sie am Hals. Bei diesem Gedanken wurde ihr heiß und kalt. Um den Onkel anständig unter die Erde zu bringen, fehlte ihr ganz einfach das Geld. Sie konnte nur hofen, dass er irgendwie vorgesorgt hatte. Im Dorf gab es eine Notgemeinschaft, deren Mitglieder monatlich einen geringen Betrag in eine Sterbekasse einzahlten. Im Todesfall erhielten die Hinterbliebenen dann einige hundert Mark. Wie viel Geld es genau gab, wusste Dresje nicht. Das war ihr auch fürs Erste egal: Hauptsache, es gab überhaupt etwas. Vielleicht hatte er ja auch etwas gespart. Sie würde auf jeden Fall von der Zuckerdose im Küchenschrank bis zur Wäsche im Schlafzimmer alles im Haus gründlich durchsuchen.
Dass sie nur ans Geld dachte und nicht an den Toten, machte ihr kein schlechtes Gewissen. Statt Trauer empfand sie Ärger darüber, dass dieser ihr fremde Mann sie so in Schwierigkeiten brachte. Hatte sie nicht genug zu tun? Das Haus, der Garten, die Putzstelle – und dann noch ihr Sohn, der ihr das Leben nicht gerade leicht machte.
Nachdem sie eine Tasse Kaffee getrunken hatte, ging es ihr zwar nicht viel besser, aber immerhin konnte sie sich so weit sammeln, dass ihr klar wurde, was nun zu tun war.
Zuerst mussten der Pastor, die Totengräber und die Gemeinde informiert werden. Dann brauchte sie einen Sarg. Nun gut, das war alles zu regeln. Was ihr mehr Kummer bereitete, war die Beerdigung selbst. Wo sollte sie genügend Sargträger herbekommen? Wo sollte sie überhaupt jemanden finden, der sich bereit erklärte, diese Aufgabe zu übernehmen?
Bevor der Onkel unter die Erde kommen konnte, mussten zuerst einmal, nach alter rheinischer Sitte, die sieben Fußfälle gebetet werden. Ein Brauch, bei dem sieben Jungfrauen um das ewige Seelenheil des Verstorbenen beteten. Damit fingen die Probleme schon an.
Das würde was werden, dachte Dresje. Für diesen Stänkerer betete doch niemand! Und dann noch sieben Jungfrauen. Wo um alles in der Welt sollte sie sieben Jungfrauen finden, die auch noch in der Lage waren, den schmerzhaften Rosenkranz zu beten? Sie brauchte Hilfe!
Zuerst fiel ihr die Nachbarin ein. Diesen Gedanken verwarf sie aber wieder, weil ihr die Frau zu aufdringlich war. Die würde sie in der nächsten Zeit nicht mehr loswerden und sich noch in zehn Jahren anhören müssen, wie großherzig sie ihr in einer Notsituation geholfen hatte.
Fünf Häuser weiter wohnte eine Kriegerwitwe, deren Mutter vor einem halben Jahr beerdigt worden war. Die Frau galt als aufgeschlossen, hilfsbereit und hatte rheinisches Temperament. Sie war aktive Karnevalistin und eine glänzende Büttenrednerin. Vielleicht konnte die ihr helfen. Kurz entschlossen machte Dresje sich auf den Weg. Gleich nach dem ersten Klopfen hörte sie im Haus Schritte, und Sekunden später öfnete sich die Tür.
»Dresje«, sagte Sophia mit Erstaunen in der Stimme, »herzliches Beileid, komm rein.«
Sie gingen ins Haus. »Komm, mein Mädchen, setz dich da in den Sessel«, sagte die Frau, die höchstens zwei, drei Jahre älter war als Dresje. »Knollepief hat sich aber schnell davongemacht«, kam sie unvermittelt auf den Todesfall zu sprechen. »Eigentlich ein schöner Tod – habe ich nicht recht? Na ja, ist egal, irgendwann sind wir alle dran! Dresje, was kann ich für dich tun?«
»Ja, es geht um die Beerdigung. Weißt du, wie das mit den Fußfällen geht? Ich meine, wo soll ich sieben Jungfrauen herbekommen?«
»Oje, oje«, sagte Sophia und grinste über das ganze Gesicht. »Mit den Jungfrauen ist das so eine Sache. Wenn der alte Querkopf vor Fastnacht gestorben wäre, gäbe es vielleicht noch die eine oder andere! Aber jetzt, hm, hm, hm? Nun mal Spaß beiseite, das machen doch schon lange keine jungen Mädchen mehr. Da beten jetzt immer Kinder. Mädchen und Jungen. Das wird doch nicht mehr so genau genommen. Dein Sohn Kaspar zum Beispiel. Der ist im richtigen Alter, und Messdiener ist er auch noch.«
»Nicht mehr.«
»Ach, hatte er keine Lust mehr?«
»Doch, das wohl, aber der Pastor hat ihn rausgeschmissen.«
»Einfach so?«
»Nein, nein, Kaspar hat dummes Zeug gemacht. Der Pastor wäre am Altar fast hingefallen.«
»Ach du lieber Gott, wie ist das denn passiert?«
»In der Notkirche ist es doch so eng am Altar.«
»Ja und?«
»Na ja, als der Pastor bei der Wandlung mit dem Kelch in der Hand niederkniete, sah Kaspar dessen Schuhsole direkt vor seinen Bauch. Da hat der dumme Bub den Fuß mit beiden Händen gefasst und angehoben. Da kam der Pastor nicht mehr hoch.«
Sophia sah Dresje ungläubig an. Dann begann sie zu glucksen, bis sie schließlich in schallendes Lachen verfiel, das man sicher bis auf die Straße hören konnte. Tränen liefen ihr über die Wangen, und ihr Gesicht glühte, als hätte sie einen steilen Berg erklommen. »Das kommt in die Bütt, das muss in die Bütt«, rief sie und schüttelte sich erneut vor Lachen.
»Entschuldigung«, sagte Sophia, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte. »Und wie ging es weiter?«
»Ich war nicht in der Messe. Aber der Pastor hat wohl laut geschimpft, und darauf hat Kaspar den Fuß fallen lassen. Dabei verlor der Pastor fast das Gleichgewicht und wäre um ein Haar der Länge lang mit dem Kelch in der Hand hingefallen.«
Sophia wischte immer noch ihre Lachtränen ab, beherrschte sich jetzt aber und fragte ernsthaft: »Ja, aber was hat das mit den sieben Fußfällen zu tun?«
»Ich weiß nicht, ob der Pastor will, dass Kaspar mitbetet.«
»Was soll das denn heißen«, wunderte sich Sophia empört, »das geht den doch einen Dreck an, wer im Haus deines Onkels betet. Also, so weit sind wir ja noch nicht, dass der Pastor bestimmt, wen du einteilst. Der soll froh sein, dass sich da überhaupt noch jemand findet. Dein Sohn ist mit zehn Jahren im richtigen Alter, und den schmerzensreichen Rosenkranz beten kann er auch. Da haben wir schon den ersten Beter. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um den Rest. Du hast genug anderes zu tun.«
»Da wäre ich dir sehr dankbar«, sagte Dresje.
»Ist doch selbstverständlich. Ich komme heute Abend vorbei und nenne dir die Namen.« Die beiden Frauen standen auf und umarmten sich.
»Sei mir nicht böse, dass ich so lachen musste. Aber das ist wirklich eine Geschichte für die Bütt. Darüber sprechen wir noch. Zuerst muss der Kerl unter die Erde. Das einzig Gute, was der im Leben getan hat, war zu sterben und dir und deinem Jungen etwas zu vererben. Also nichts für ungut. Gegen acht Uhr bin ich bei dir.«
An eine Erbschaft hatte Dresje noch gar nicht gedacht. Auch jetzt stand ihr nicht der Kopf danach, darüber nachzudenken. Das würde sich alles ganz von alleine regeln.
Bei dem Gedanken, Kaspar zum Beten der sieben Fußfälle einzuteilen, hatte sie ein mulmiges Gefühl. Sicher, Leichen zu sehen war für die Kinder des Dorfes nichts Ungewöhnliches. Es kam sogar vor, dass sie sich nach einem Sterbefall spontan auf der Straße verabredeten, um die Leiche in Augenschein zu nehmen. Dann liefen sie zum Trauerhaus, und selbstverständlich ließ man sie an die Bahre oder den ofenen Sarg, zumal die Hinterbliebenen das Interesse der Kinder als eine Art Ehrerweisung missverstanden. Die Besichtigung dauerte natürlich nur ganz kurze Zeit, dann rannten sie – sich wohlig gruselnd – davon.
Überhaupt hatten die Menschen im Dorf ein entkrampftes Verhältnis zum Tod. Zu viele waren im Krieg gefallen. Zu viele waren Opfer der langen Entbehrungen geworden. Außerdem wurde ständig irgendwo geschlachtet, denn Haustiere mussten Nutzen bringen. Sentimentalitäten gab es da nicht. Federvieh und Schweine waren nun einmal auf der Welt, um gegessen zu werden.
Dresje sah es gar nicht gerne, wenn ihr Sohn solche Grausamkeiten miterlebte. Sie wollte ihn nicht in Watte packen, darum ging es ihr nicht. Aber der Junge war nun mal nicht wie andere Kinder. Seine Nerven waren stets auf das Äußerste angespannt und ließen ihn keine innere Ruhe finden. Ihre Versuche, beruhigend auf ihn einzuwirken, riefen gelegentlich zusätzliche Spannungen in ihm hervor, die ins Aggressive umschlagen konnten.