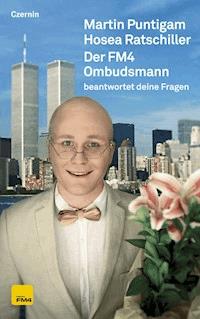Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Klimawandel mal anders: Die Science Busters erklären mit Witz und schwarzem Humor, welche verrückten Möglichkeiten sich uns zur Klimarettung bieten.
Herzlich willkommen zur Global Warming Party! Es gibt jede Menge zu feiern! Wir blasen mehr CO2 in die Atmosphäre als je zuvor! Jedes einzelne Jahr schreibt neue Temperaturrekorde! Also: Party! Tanz auf dem Vulkan! Leider ist der Klimawandel eine Partybremse. Aber Hilfe naht: Die Science Busters retten die Welt mit Wissenschaft und Humor. Gern geschehen!
Bekommt man Sonnenflecken bei 40° wieder heraus? Ist Planet B über Autobahn erreichbar? Hilft Komasaufen gegen die Klimakrise? Die Kelly Family der Naturwissenschaften führt den letztgültigen Beweis, dass wir Menschen erst als kleine, runde Vollidioten eine gute Klimabilanz hätten. Damit die Party, die wir Leben nennen, noch lange weitergehen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Klimawandel mal anders: Die Science Busters erklären mit Witz und schwarzem Humor, welche verrückten Möglichkeiten sich uns zur Klimarettung bieten.Herzlichen willkommen zur Global Warming Party! Es gibt jede Menge zu feiern! Wir blasen mehr CO2 in die Atmosphäre als je zuvor! Jedes einzelne Jahr schreibt neue Temperaturrekorde! Also: Party! Tanz auf dem Vulkan! Leider ist der Klimawandel eine Partybremse. Aber Hilfe naht: Die Science Busters retten die Welt mit Wissenschaft und Humor. Gern geschehen!Bekommt man Sonnenflecken bei 40° wieder heraus? Ist Planet B über Autobahn erreichbar? Hilft Komasaufen gegen die Klimakrise? Die Kelly Family der Naturwissenschaften führt den letztgültigen Beweis, dass wir Menschen erst als kleine, runde Vollidioten eine gute Klimabilanz hätten. Damit die Party, die wir Leben nennen, noch lange weitergehen kann.
Freistetter · Moder ·Puntigam · Gunkl ·Jungwirth · Oberzaucher ·Weinberger
Global Warming Party
Wie wir uns das Klima schönsaufen können und andere wissenschaftlich überprüfte Anregungen zur Rettung der Menschheit
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Vorwort
Party-Location
Planet B
Party-Löwen
Greta
Grab dich ein
Starlord
Das geht Sie einen Dreck an
Cat Content
Sleight of Hand
Volle Pulle!
Gas versus Vollgas
Party-Bremsen
Immer nie im Meer
Ingenieurskunst
Global Cooling
Nuke Mars
Auf die Plätze, Feuer, los!
Gimme Moor
Die Chemie der Moorleiche
Mengenlehre
Party-Kracher
The Masked Sleeper
Letzter Wille
Nudge, nudge, say no more!
Dies ist mein Fleisch
Fermentation
Transformers
Ozonlob
Österreich rettet die Welt
Freibier for Future
Aftershow
Hangover
Warum wir Menschen so gerne glauben
Dank an
Register
Vorwort
In der Kindheit und Jugend waren wir beeindruckt von Entdeckern, und die Vorstellung, in neue Länder vorzudringen, war faszinierend. Wie mochte es sich anfühlen, wenn man etwas als Erster sehen konnte? Die Enttäuschung darüber, dass es geografisch auf unserem Planeten nicht mehr so sehr viel zu entdecken gab, wich schnell der Begeisterung für die Naturwissenschaften. Die auch eine nicht endende Entdeckungsreise sind. Es ist die Suche nach der Wahrheit, die Forscherinnen und Forscher antreibt. Eine Suche, die nie abgeschlossen sein wird, denn in allen wissenschaftlichen Bereichen können wir uns mit unserem Weltverständnis zwar immer mehr an die Realität annähern — vollständig beschreiben werden wir sie aber nie. Was für einen Außenstehenden möglicherweise frustrierend klingt, macht tatsächlich den besonderen Reiz der Wissenschaft aus: Sie ist nie »fertig«, sondern wirft immer wieder neue faszinierende Fragen auf.
Heute — nach zwei Jahrzehnten als forschender Physiker an einer Hochschule — sehe ich aber noch weitere Parallelen zu den frühen Entdeckern der Menschheitsgeschichte: Entdeckungen müssen kommuniziert werden. Was nutzt es, wenn ich ein fernes Land oder einen neuen Kontinent gefunden habe, darüber aber nicht berichte? Genauso verhält es sich mit der Forschung und der daraus resultierenden wissenschaftlichen Erkenntnis. Das volle Potenzial der Wissenschaft ist erst dann ausgeschöpft, wenn die Entdeckungen der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden. Erst dann gehen sie auch in das allgemeine Wissen der Menschheit über, wo sie zum Nutzen aller eingesetzt werden können. Wissenschaftliche Fragestellungen und Arbeiten sind also erst dann abgeschlossen, wenn sie kommuniziert wurden.
Aber gerade hier haben Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren häufig zu wenig investiert. Aus verständlichen Gründen: Zu groß ist der Publikationsdruck für Fachartikel, die nur selten für die Öffentlichkeit verständlich sind, zu groß ist der Bedarf an Drittmitteln, für die Anträge geschrieben werden müssen. Und — und das kommt erschwerend dazu — es gibt im wissenschaftlichen System keine wirkliche Honorierung oder Anerkennung für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Aus diesen Gründen wurde diese wichtige Art der Kommunikation leider vernachlässigt, mit dramatischen Folgen.
Die Öffentlichkeit findet sich wieder in einer zunehmend komplexeren Welt. Wer versteht noch die elektronischen Geräte in der eigenen Hosentasche? Wie funktionieren diese 5G-Sendemasten, die Daten an mein mobiles Telefon übertragen? Muss ich mir Sorgen machen? Die Welt wird immer spezialisierter und die Menschen bleiben auf der Suche nach Antworten alleine mit ihren Fragen zurück. Diese Diskrepanz aus einer zunehmend komplexeren Welt und dem Mangel an Kommunikationsangeboten durch echte Experten schafft einen gefährlichen Nährboden, der von Verschwörungsideologen und Schwurblern geschickt für ihre Zwecke genutzt wird und die Bevölkerung verunsichert. Diese Verunsicherung lässt sich tatsächlich auch in Zahlen ablesen: Die in Deutschland für das Wissenschaftsbarometer 2018 erhobenen Daten basieren auf 1008 Telefoninterviews, die im August 2018 im Auftrag von Wissenschaft im Dialog geführt wurden. In dieser Umfrage gaben auf die Frage »Wie sehr vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung?« zwar 54 Prozent an, dass sie »voll und ganz« oder zumindest »eher« vertrauen, erschreckende 39 Prozent antworteten aber, dass sie »unentschieden« bei dieser Frage sind.
Eine solche Antwort darf uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht zufriedenstellen. Diese 39 Prozent bedeuten, dass wir in der Gefahr leben, große Teile der Bevölkerung für die Wissenschaft und die wissenschaftliche Methodik zu verlieren.
Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft gerade großen Herausforderungen und Krisen gegenübersteht, macht die Situation noch einmal dringlicher. Die Covid-19-Pandemie ist eine sehr akute Bedrohungslage, in der die Öffentlichkeit nach Lösungen sucht. Die Klimakrise ist eine noch ernstere Bedrohung auf anderen Zeitskalen. Die Effekte werden im Vergleich zu Covid-19 deutlich verzögert eintreten, aber dafür umso dramatischer sein.
In solchen Krisen liegt aber auch eine Chance für die Wissenschaft. Im Angesicht der akuten Bedrohung richten die Menschen ihren Blick auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um Antworten, Handlungsanweisungen und Hoffnung zu finden. Das oben bereits zitierte Wissenschaftsbarometer fragte die Bevölkerung auch zur absoluten Hochzeit der Covid-19-Pandemie (15./16. April 2020) nach ihrer Wahrnehmung: Auf die Frage »Wie sehr vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung?« antworteten nun 73 Prozent, dass sie »voll und ganz« oder »eher« vertrauen, und nur 20 Prozent gaben an, »unentschieden« zu sein. Das zeigt, dass die aktuellen Krisen auch als Chance für gute Wissenschaftskommunikation genutzt werden können und sollten.
Um dabei ganz besonders klar zwischen den haltlosen Erzählungen der Verschwörungsideologen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterscheiden, dürfen hier nicht nur die Ergebnisse und Fakten kommuniziert werden, sondern es müssen auch die wissenschaftliche Methodik und Arbeitsweise zur Sprache kommen. Denn da liegt der fundamentale Unterschied zu den Verschwörungserzählungen: Während auf der einen Seite Behauptungen ohne experimentelle Evidenz phantasiert werden, prüft das wissenschaftliche System sich und die experimentellen Daten unentwegt und rigide selbst. Jedes Ergebnis muss dem wissenschaftlichen Qualitätsstandard genügen. Die wissenschaftliche Methodik ist dabei das, was für die frühen Entdecker ihre Schiffe waren. Die Schiffe ließen die Entdecker vertrauensvoll in unbekannte Ozeane vordringen; die Forscherinnen und Forscher halten sich an die wissenschaftliche Methodik, um dem Sturm der Erklärungsmöglichkeiten zu trotzen. Das ist die Stärke der Wissenschaft, das ist Wissenschaftsethik und darum verdient sie das Vertrauen der Bevölkerung insbesondere in Krisenzeiten.
Dafür braucht es allerdings eine Wissenschaftskommunikation, die über das hinausgeht, was in den vergangenen Jahrzehnten getan wurde. Es braucht Vorbilder aus der Wissenschaft, die Forschung so kommunizieren, dass sie die Menschen erreicht. Wir können nicht mehr erwarten, dass die Menschen die richtigen Fakten schon selbst in der Informationsflut des Internets finden. Wir müssen die Wissenschaft in die Bevölkerung tragen. Echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die komplexe Zusammenhänge ehrlich und auf verständliche Weise erklären.
Das ist keine leichte Aufgabe, doch die Science Busters begegnen dieser Herausforderung seit Jahren mit überragendem Erfolg. Sie zeigen sich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht unfehlbar sind, die über sich selbst lachen können und die den Duktus von Lehrern hinter sich lassen, um gemeinsam mit dem Publikum auf eine Entdeckungsreise des Wissens gehen. Ihr Trick: Sie machen es mit Humor. Auf der Bühne etwa stellt ein auffällig gekleideter Kabarettist als MC so lange Fragen, bis die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dinge so erklären, dass er die Antwort verstehen kann. Denn dann können sie alle verstehen. So soll es sein. Dabei ist Ihnen kein Ziel zu weit und keine Möglichkeit fremd: in Blogs, auf Social Media, auf Bühnen, im Fernsehen, im Radio, als Podcast und auch in diesem Buch. Immer sind sie präsent, erreichbar und ganz nah bei den Menschen. Wissensentdecker im besten Sinne und Vorbilder in der Wissenschaftskommunikation.
Nicolas Wöhrl & Reinhard Remfort (Methodisch inkorrekt!)
Planet B
»No Planet B — Es gibt keinen Planet B« lautet einer der Slogans auf Klimademos. Manchmal gebeugt, manchmal nicht, um darauf hinzuweisen, dass wir Menschen keine Ausweichmöglichkeit haben, falls wir die Erde unbewohnbar machen. Das sagen aber vor allem Leute, die die Erde in ihrem Leben noch nie verlassen haben. Oder sich nicht weiter von ihr entfernt haben als auf Reiseflughöhe einer Passagiermaschine.
Aber stimmt das? Wird nicht schon jetzt alle paar Monate ein neuer Planet, eine zweite Erde entdeckt? Allein im ersten Halbjahr 2020 waren es zwei, drei erdähnliche Planeten, auf denen Leben möglich sein könnte. Hat die NASA gefunden. Stand in der Zeitung und war im Fernseher. Der Physik-Nobelpreis2019 ist sogar genau dafür vergeben worden. Für die Entdeckung des ersten Planeten in einem anderen Sonnensystem im Jahr 1995. Und was war es für ein Planet? Ein Planet B! Damals schon. 51 Pegasi b. Seither sind ein paar 1000 extrasolare Planeten aufgestöbert worden und es werden laufend mehr. Und viele davon sind Planeten b. Wer also sagt, es gebe keinen, kennt sich einfach im Universum nicht aus und macht sich auf der Erde wichtig?
Leider heißen Planeten nur deshalb b, weil a in der astronomischen Namensgebung immer der Stern ist, zu dem sie gehören, was aber eigentlich nie explizit erwähnt wird. That goes without saying. Planeten bekommen in der Regel den Namen des Sterns und dann in der Reihenfolge ihrer Entdeckung Buchstaben zugeordnet. Der erste heißt b, und je nachdem, wie viele weitere Planeten wir rund um den Stern entdecken, geht es im Alphabet weiter rauf. In unserem Sonnensystem gilt die Namensgebung übrigens nicht, weil wir die Erde zwar als ersten Planeten »entdeckt«, aber irrtümlich auch sehr lange fürs Zentrum des Sonnensystems gehalten haben. Da hat sich die Namensgebung aus historischen Gründen völlig anders ergeben. Es gilt quasi der Blick von außen. Würden Aliens unser Sonnensystem aufspüren, würden sie die Planeten vielleicht Sonne b und Sonne c und so weiter nennen. Aber von Aliens haben wir bislang noch weniger Spuren gefunden als von Planet B.
Wie immer wir andere Planeten auch nennen, kein einziger der bislang von uns entdeckten ist eine zweite Erde. Vermutlich. Der Hauptgrund, warum wir noch keine zweite Erde gefunden haben, liegt nämlich darin, dass unsere Teleskope dazu nicht in der Lage sind. Es sind tolle technische Geräte, die cool aussehen, in der Sonne glitzern, viel Geld gekostet haben und mit denen wir schon sehr viel beobachtet haben am Himmel und in den Tiefen des Weltalls. Aber um genau sagen zu können, ob ein Planet so aussieht wie unsere Erde, dazu sind sie, auf gut Wienerisch, zu schasaugert. Wir können die Masse berechnen und den Abstand vom Stern und wir können über die mögliche Oberflächentemperatur spekulieren, aber das war’s auch schon. Wenn Ihnen wer was anderes erzählt, dann wissen Sie: Blödmann. Oder sollten zumindest auch anderes kritisch prüfen, was aus der Quelle verlautet.
Aber nur weil die aktuellen Teleskope noch nicht gut genug sind, schließt das ja noch nicht aus, dass die kommende Generation eine zweite Erde lokalisieren könnte. Oder vielleicht erst die übernächste. Astronominnen und Astronomen sind ja bekanntlich sehr gut darin, Finanzierungen für immer neue und noch tollere und teurere Geräte auf die Beine zu stellen, um in die Ferne zu schauen. Einer der großen Nachteile von anderen Sonnensystemen ist nämlich, dass sie sehr weit weg sind. Also, wirklich weit weg. Wenn man von der Erde zum Stern TOI700 fliegt, dann stehen danach 101,4 Lichtjahre am Tacho. Mit einer Tankfüllung schafft man das nicht.
TOI700 ist ein Stern, um den drei Planeten kreisen, die man Anfang 2020 entdeckt hat.*1TOI700 b und TOI700 c und TOI700 d. Warum der Name? Hat man sich in der Hoffnung auf die Entdeckung einer weiteren Erde TOI, TOI, TOI gewünscht? Na ja, fast. Oder eigentlich gar nicht. TOI steht für Transiting Exoplanet Survey Satellite Object of Interestund ist nicht nur eines jener bresthaften Akronyme, bei denen man in der Wissenschaft so lange Buchstaben unterschlägt, bis ein schönes Initialwort rauskommt, sondern auch die Bezeichnung eines Sonnensystems, dessen d-Planet ein Erdenzwilling sein soll. Anfang Jänner 2020 war da das Hallo groß.
Ob wir wirklich einen Erdenzwilling gefunden haben, weiß, wie gesagt, heute noch niemand, und auch die NASA hat das natürlich nie behauptet, sondern nur verkündet, dass der Planet prinzipiell als Kandidat infrage kommen könnte. Auch das James-Webb-Teleskop, der nächste Superstar unter den Weltraumteleskopen, wird da noch keine Klarheit schaffen können. Vielleicht dessen Nachfolgefernrohr. Da werden allerdings viele von uns nicht mehr am Leben sein und sich höchstens jetzt schon für die Enkerl freuen können, dass die das einmal wissen werden. Dass TOI700 d eine zweite Erde ist, stand also nicht in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, sondern in dem, was sich zwar selbst Zeitung nennt, aber nicht nur wissenschaftlich meilenweit davon entfernt ist. Wie nicht zuletzt die Rufmordkampagnen im Laufe der Coronakrise gezeigt haben.
Aber gehen wir doch einfach einmal davon aus, dass wir in 30 Jahren wissen werden, wo eine zweite Erde ihre Kreise zieht. Warum also nicht heute schon einmal losfliegen — und sich die Koordinaten und die Autobahnausfahrt mit Lichtgeschwindigkeit nachschicken lassen, sobald auf der ersten Erde endlich die zweite entdeckt worden ist? Dann hätte man schon einen Teil des Weges zurückgelegt und vielleicht nur mehr 101 Lichtjahre vor sich.
Aber wo sollte man hinfliegen auf Verdacht? Wo wäre es am schönsten, wo eine Suche nach einer Zweitwohnerde am lohnendsten? Wo könnte sich Planet B versteckt halten?
Schauen wir uns einmal an, wie das Universum eigentlich aufgebaut ist. Wir leben auf der Erde und nach allem, was wir bislang wissen, ist sie der einzige Planet, auf dem Leben existiert. Die Erde umkreist als einer von acht Planeten die Sonne, die als einziger Stern das Sonnensystem beleuchtet. Neben den Planeten gibt es noch ein paar 100 Monde, ein paar Billionen Asteroiden und Kometen. Von einem Ende zum anderen misst das Sonnensystem ein bis eineinhalb Lichtjahre. Je nachdem, wer wie schaut. Eineinhalb Lichtjahre klingt viel, asphaltieren möchte man so eine Strecke nicht müssen, ist aber eigentlich nicht der Rede wert. Kosmologisch gesehen. Denn die Entfernung zum nächsten Stern Proxima Centauri beträgt bereits vier Lichtjahre. Quasi stellares Distancing. Kurz mal nachfragen gehen, ob man sich vom Nachbarn ein wenig Milch leihen kann, sollte man sich gut überlegen. Unsere Sonne und Proxima Centauri sind nur zwei von ein paar 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße. So nennen wir die Galaxie, in der sich unser Sonnensystem befindet. Sie misst 100.000 bis 150.000 Lichtjahre im Durchmesser und wir mit unserem Sonnensystem bewohnen eher eine Randlage, ungefähr 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt.
Wer jetzt jammert, dass das Leben am Land zwar idyllisch und ruhig sein könne, aber auch urfad, weshalb eine schmucke Wohnung im Zentrum besser sei als ein Haus in der Einschicht, der kennt die Milchstraße schlecht. Dort stehen die Sterne im Zentrum nicht so einsam herum wie hier in unserer Gegend, vier Lichtjahre voneinander entfernt, gerade noch in Sichtweite, sondern drängen sich dicht an dicht. Ziemlich oft explodiert einer. Die kosmische Strahlung ist gewaltig und es ist gut, dass sich unser Sonnensystem entschieden hat, dort nicht zu bauen. Sonst gäbe es uns nämlich gar nicht.
Wer 150.000 Lichtjahre für enorm hält, bekommt zwar ein Like von der Milchstraße. Die ist aber nur eine von sehr vielen Galaxien, wie die Andromedagalaxie oder die Große und Kleine Magellansche Wolke, die gemeinsam mit ein paar 100 anderen Galaxien die Lokale Gruppe bilden. Klingt zwar ein bisschen nach kosmischem Ballermann, es handelt sich aber nicht um eine galaktische Ausgehmeile, sondern um eine Einheit von Galaxien, die über die Schwerkraft miteinander verbunden sind und deshalb irgendwie auch zusammengehören. Wenn man angesichts der Ausdehnung noch von Zusammengehörigkeit sprechen kann. Sieben Millionen Lichtjahre hat die Lokale Gruppe in der Rubrik Körpergröße im Reisepass stehen. Wem der Jakobsweg zu kurz ist, der kann es dort mit einer Pilgerreise probieren.
Sie werden es schon vermutet haben, auch die Lokale Gruppe ist ein Fliegenschiss verglichen mit der nächstgrößeren Einheit im Universum. Get ready for: Virgo-Superhaufen. Virgo, lateinisch, heißt bekanntlich Jungfrau; könnte man also glauben, er sei der Gottesmutter zugeeignet, und wenn bei der die Verdauung passt, dann gibt es einen Superhaufen? Das wäre sicher vorschnell gemutmaßt. Was genau passiert, wenn bei der Himmelskönigin die Verdauung passt, darüber schweigen die Quellen, und dem Vernehmen nach war es auch bei den zahlreichen Marienerscheinungen noch nie Thema. Es ist noch nicht einmal bekannt, was sie isst. Außerdem spielt Religion in der Astronomie keine nennenswerte Rolle. Virgo heißt zwar Jungfrau, das stimmt, aber der gleichnamige Superhaufen trägt seinen Namen nur deshalb, weil sein Zentrum am Himmel in Richtung des Sternbilds Jungfrau zu sehen ist.
Mit 200 Millionen Lichtjahren gehört er zwar nicht zu den Winzlingen im Universum, bei den Großen darf er allerdings längst nicht mitspielen. Der Virgo-Superhaufen ist vielmehr eingebettet in einen noch wesentlich supereren Superhaufen mit dem klingenden Namen Laniakea, der seinen Namen ausnahmsweise nicht aus dem europäischen Kulturkreis bezieht — auch da gab es Fortschritte in den letzten Jahrzehnten —, sondern aus dem hawaiianischen und schlappe 560 Millionen Lichtjahre als Durchmesser vorweisen kann. Das ist wirklich schon sehr groß.
Laniakea bedeutet zwar auch »unermesslicher Himmel«, doch das Universum hat für derart läppische Distanzen nur ein müdes Lächeln übrig. Besteht es doch aus vielen dieser Super-Superhaufen, die sich wiederum alle in langen fadenartigen Strukturen durch den Weltraum ziehen, den folgerichtig sogenannten Filamenten. Weil? Wer es weiß, muss nicht aufzeigen, sondern kann gleich reinrufen, genau: Filum ist lateinisch für Faden. Der längste Faden im All misst bis zu 1,3 Milliarden Lichtjahre. Also fast dreimal so viel wie Laniakea. Und ist trotzdem noch nicht Sieger im Großsein im Universum. Denn er wird noch übertroffen von den Voids. Das ist nicht der niederösterreichische Dialektplural für Wälder, sondern Void bedeutet Leere. Und diese Leerräume im All sind mit bis zu zwei Milliarden Lichtjahren noch gewaltiger.
Das Nichts im Universum ist also größer als das Etwas. Das klingt wie ein tiefsinniger Kalenderspruch, bedeutet aber nicht mehr, als dass es eben mehr Nichts im Weltall gibt als Materie. Man könnte auf der Suche nach der größten Struktur hier Schluss machen. Man kann aber als Zugabe auch noch alle Voids und alle Filamente als die größte Struktur im Universum zusammenfassen. Also, alles ist alles und das Universum somit selber seine größte Struktur. So, das dann bitte doppelt unterstreichen.
Wie das Universum von außen aussieht, ob wie ein Giganto-Superhaufen oder wie ein Riesenfilament oder irgendwie anders, darüber lässt sich wenig sagen. Das Universum ist leider alles, was wir haben. Und es ist auch nicht möglich, an den Rand zu fliegen und von dort eine Selfie-Stange rauszuhalten, um sich ein Bild zu machen. Es ist jedoch so ordentlich groß, dass es doch gelacht wäre, wenn es da nicht irgendwo wenigstens einen Planeten B gäbe. Wenn nicht mehrere. Fragt sich eben nur immer noch: wo? Man müsste wohl aufs Geratewohl losdüsen. Nur was würde dabei wohl passieren? Wo im Universum würde man da vermutlich rauskommen?
Sie haben es sich vielleicht gedacht, wahrscheinlich irgendwo im Nichts. Denn davon gibt es eben am meisten. Das wäre nun einigermaßen enttäuschend und langweilig, weil Nichts nicht nur von der Bewertung her in der Kategorie Action eher nur null Sterne hat. Es gibt dort nichts zu erleben und nichts zu sehen. Aber es wäre nur sehr kurz sehr fad, denn im Nichts können wir nicht leben und wären daher umgehend tot. Falls Sie das für eine tröstliche Nachricht halten möchten.
Am zweitwahrscheinlichsten würden wir im Inneren eines Sterns landen. Das ist zwar spektakulärer, denn da findet Kernfusion statt, allerdings nur unwesentlich gemütlicher. Im Inneren von Sternen herrschen gern Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius. Und mehr. Man bräuchte zum Schutz der Haut einen sehr, sehr hohen Lichtschutzfaktor, wäre aber längst verdampft, bevor man mit dem Einschmieren begonnen hätte.
Das sind, wie gesagt, die mit Abstand wahrscheinlichsten Orte, die man im Universum finden würde, wenn man die Richtung nach dem Zufallsprinzip auswählt. Sollte man durch einen noch aberwitzigeren Zufall allerdings weder im Nichts noch in einem Stern landen, so kann man das im Inneren eines Planeten feiern. Allerdings vermutlich im Inneren eines Gasriesen wie Jupiter oder Saturn, wo vergleichsweise frostige 5000 bis 6000 Grad Celsius für ein nicht gerade besonders angenehmes Klima sorgen. Außerdem ist Sauerstoff, den wir Menschen so gerne atmen, außerordentlich knapp, stattdessen gibt es Wasserstoff und Helium im Überfluss. Das Leben wäre somit wie überall bisher nur sehr kurz, vielleicht einmal tief einatmen und mit hoher Stimme »Scheiße!« rufen, danach muss das Einwohnermelderegister angepasst werden.
Was ist mit Gesteinsplaneten wie Erde oder Mars? Sie sind sehr selten, aber es gibt sie. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Man würde sich erst einmal nicht auf der Oberfläche wiederfinden, sondern innen drinnen. Warum innen? Na ja, vom Inneren einer Kugel gibt es eben viel mehr als von der Oberfläche, weshalb man sehr viel wahrscheinlicher dorthin gerät. Innen zeigt das Thermometer in der Regel gute 5000 Grad an und der Druck ist enorm. Wie sollte man darauf reagieren? Dem Druck standhalten? Leider aussichtslos. Bevor Sie sterben, würden Sie entweder erst zerquetscht und danach verbrennen. Oder umgekehrt. Da ist die Quellenlage noch dünn.
Nur auf der Oberfläche eines erdähnlichen Planeten mit angenehmen Temperaturen, atembarer Atmosphäre und ausreichend Nahrung hätten wir Überlebenschancen. Die Wahrscheinlichkeit, im Universum einen solchen Ort zu finden, ist extrem klein. Zur Veranschaulichung: Würde man das gesamte Universum mit allen Voids, Filamenten, Superhaufen, Galaxien und Sonnensystemen auf einen Durchmesser von 300 Millionen Kilometern schrumpfen, was dem Durchmesser der Umlaufbahn der Erde um die Sonne entspricht, dann würden alle Orte in diesem Modelluniversum, an denen wir nicht sofort sterben müssten, einen Bereich ausmachen, der genauso groß ist wie ein Atom. So wenig Auswahl hat man nicht einmal, wenn nach den Hamsterkäufen die Supermarktregale leer gefegt sind. Im normal großen Universum wäre das so wenig, dass es fast schon wieder nichts wäre. Das Universum ist eine Scheißgegend. So hat schon ein früherer Befund der Science Busters gelautet.
Praktisch überall ist es grauslich, dunkel und lebensfeindlich. Planet B hat keine Adresse und schon gar keine Autobahnausfahrt. Nach allem, was wir bislang wissen, können wir Menschen nur auf der Erde leben. Wir haben keine zweite Erde, keine Ausweichmöglichkeit. Auswandern ist keine Option. Selbst die Mond- und Mars-Reisefantasien von Internetmilliardären sind leider nicht einmal nur umständlich, sie sind bis auf Weiteres undurchführbar. Niemand kann in absehbarer Zeit ein gefahrloses, sinnvolles Leben auf dem Mars führen, nicht einmal wenn er es schaffte, dort heil zu landen. Und selbst das ist bisher noch nie gelungen.
Die Erde ist die einzige Location für unsere Party, die wir Leben nennen. Und wenn wir wollen, dass diese Party für uns Menschen noch eine Zeit lang weitergeht, dann müssen wir auf die Erde aufpassen und beginnen, die Global-Warming-Party endlich so zu feiern, dass wir und andere Lebewesen auf dem Planeten dabei nicht zugrunde gehen. Und zwar umgehend. Ein Schulstreik allein wird dafür nicht reichen — aber es war kein schlechter Anfang.
Greta
Bei der Wahl der Überschrift von Teil 2 konnten wir uns lange nicht einigen, ob zu Party besser Löwe passt oder Tiger. Und haben deshalb die Frage auf dem Instagram-Account von Martin Moder zur Abstimmung gebracht. So werden also im Jahr 2020 Entscheidungen in populärwissenschaftlichen Publikationen getroffen. Finden Sie das gut oder schlecht?
Hier können Sie abstimmen.
Und: Finden Sie es nicht auch unfair? So viel Aufmerksamkeit für eine junge Frau, die eigentlich lieber den versäumten Schulstoff nachlernen sollte? Ein Käfer und eine Schnecke, benannt nach einer noch nicht einmal volljährigen Ausländerin? Unsereins kann froh sein, wenn sich im Alter die eigenen Kinder noch an einen erinnern können. Dass ein Platz nach uns benannt wird, davon können die meisten von uns nur träumen. Von einer Straße rede ich da gar nicht. Aber Greta Thunberg hat gleich zwei Tiere zugeeignet bekommen. Die zwei Millimeter lange Schnecke Craspedotropis gretathunbergae und den ein Millimeter langen Zwergkäfer Nelloptodes gretae. Der ist blind und hat Zöpfe. Das ist wenigstens ein gutes Bild für jemanden, der nicht sehen will, wie er von gewissen Lobbygruppen instrumentalisiert wird.
Sollen wir nun alle zurück ins Mittelalter? Warum bringt sie unseren Kindern das Schulschwänzen bei? Damit sie keine ordentliche Ausbildung bekommen und die Probleme der Welt in Zukunft erst recht nicht lösen können? Abgesehen davon, dass man zum Schulschwänzen gar nichts können muss, das wissen wir selber noch von früher. Aber wir haben damals wenigstens unseren Eltern ab und zu Geld aus dem Portemonnaie genommen und damit die Wirtschaft angekurbelt. Aber mit Wasserflaschen im Freien sitzen, davon hat niemand was. Und ja, es gibt einen Klimawandel, aber CO2 ist nicht immer nur schlecht. Im Champagner?! Oder als Treibhausgas