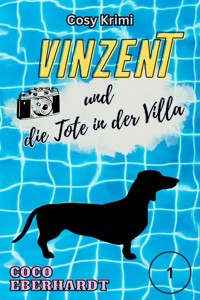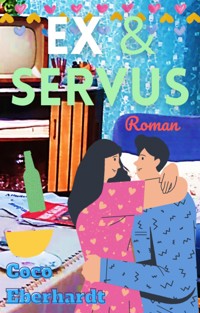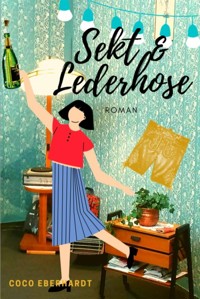0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Sprache: Deutsch
Eine romantisch turbulente Lebens- und Liebesgeschichte mit Herzklopf-Garantie.
Bei Andreas, der seit vielen Jahren in Kenia lebt, stehen acht Wochen Heimaturlaub bei seiner Familie im kleinen schwäbischen Dorf Biberach an. Mit gemischten Gefühlen sieht er dieser Zeit entgegen. Unverhofft führt ihn dann auch noch das Schicksal zurück auf den einsam gelegenen Glaserhof, wo er bereits früher eine glückliche Zeit verbracht hat, der ihn aber auch gleichzeitig an seine schmerzliche Vergangenheit erinnert. Viel Zeit zum Nachdenken hat er aber erst mal nicht, denn spontan muss er sich dort um die kleine Jara, den halbwüchsigen Mats und Opa Klaus kümmern. Außerdem gibt es noch jede Menge Tiere zu versorgen und ein Café zu wuppen. Als er dann auf die rührige Hofbesitzerin Edda trifft, steht seine Welt auf einmal völlig kopf...
Dieser Roman ist in sich abgeschlossen.
Weitere Bücher der Autorin:
Tanz im Staudenbeet - Roman
Langosch zum Frühstück - Roman
Sekt und Lederhose - Roman
Ex und Servus - Roman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Glückszeit auf dem Glaserhof
Das Glück liegt in uns selbst…BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenProlog
Abends war es hier immer am schönsten. Nach einem langen warmen Sommertag verließen die Menschen schlagartig den See. Eine unsichtbare Kraft schien sie nach Hause zu ziehen. Langsam wich das Kreischen von Kindern und der Geruch nach Sonnencreme, dem Summen der Insekten und dem Duft nach frischem Heu. Der leichte warme Sommerwind trieb leise Wellen an das Ufer. Das Schilf wippte im Takt dazu, ebenso wie der lange Vorhang der Trauerweide, der über mir hing. Entspannt lag ich auf der Decke im Gras. Meine Finger berührten sanft die ihren. Ein Kribbeln breitete sich in meinem ganzen Körper aus. Ich fühlte mich so stark, so erwachsen und irgendwie auch unsterblich. Gleichzeitig war da dieses Gefühl von Glück, Liebe und völliger Zufriedenheit, von dem ich mir nicht vorstellen konnten, dass es je vergehen würde. An ihrem Lächeln erkannte ich, dass sie ähnlich empfand. Ich atmete tief ein und schaute ihr in die Augen. Diese wunderschönen Augen. Sie trug ihr Bikinioberteil und dazu diese fransigen Hotpants. Eine Strähne ihres langen blonden Haars streifte meine Brust. Ich richtete mich kurz auf, um ihr einen Kuss auf den Bauch zu geben.
„Das kitzelt.“
Frech grinste ich sie an, bevor sich mein Mund auf ihre weichen Lippen drückte, die noch ein wenig nach dem Erdbeereis schmeckten, das ich uns vorhin am Kiosk geholt hatte. Zart berührten sich unsere Zungen. Die Sonne verabschiedete langsam den Tag und ließ den Himmel in verschiedenen Rottönen leuchten. Ich schloss meine Augen und genoss ihre Nähe. Irgendwo am anderen Ufer spielte jemand mit der Gitarre. Knockin' on Heaven's Door.
„Ich glaube, wir sollten langsam nach Hause. Nicht, dass Mama sich noch Sorgen macht“, flüsterte sie mir schließlich leise ins Ohr.
„Okay. Willst du heute fahren?“
„Oh, welche Ehre. Ich darf deine heilige Quickly fahren?“
Ihre Augen blitzten mich an. Ich drückte sie kurz zurück auf die Decke und küsste sie ein letztes Mal, bevor wir unsere Sachen ausschüttelten und in den Rucksack packten. Die Grillen zirpten munter um uns. Es war immer noch sommerlich warm, obwohl die Sonne mittlerweile fast ganz verschwunden war. Lagerfeuer flammten am gegenüberliegenden Ufer auf. Beim Gehen warf ich eine Dose in einen Abfallbehälter, der fast überquoll.
Während vorhin noch der ganze Platz voll Fahrräder, Roller und Mopeds war, stand meine rote NSU Quickly TTK Baujahr 1961 nun einsam und alleine da. Sie war mein ganzer Stolz. Wir zogen uns die Helme auf den Kopf und stiegen auf das Moped. Ich umschlang ihre schlanke Taille, die immer noch unbedeckt war, und legte mein Kinn kurz auf ihre Schulter.
„Ich liebe dich.“
Sie sagte nichts und startete das Moped. Gemütlich fuhren wir die lange Straße entlang, die uns zu ihr nach Hause bringen würde. Die Sichel des Mondes leuchtete uns den Weg und ich fühlte mich unendlich glücklich.
Zwölf Jahre kein Winter
Unsanft wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Wobei es fast schon an ein Wunder grenzte, dass ich überhaupt etwas Ruhe gefunden hatte. Das Dauerrauschen der Triebwerke hatte mich schon immer nervös gemacht. Doch hatte ich diese Unannehmlichkeit, die das Fliegen so mit sich brachte, völlig verdrängt gehabt. Mein letzter Langstreckenflug lag mehr als drei Jahre zurück. Das war noch bevor die Welt für kurze Zeit den Atem anhalten musste. Die Einreisebestimmungen waren mir zu kompliziert gewesen, außerdem hatten sie sich ständig geändert, sodass mir dieser Umstand eigentlich ganz recht gewesen war, um nicht nach Hause fliegen zu müssen. Wobei ich mir schon länger die Frage stellte, ob meine alte Heimat überhaupt noch mein zu Hause war.
Seit über zwölf Jahren lebte ich jetzt schon in Kenia und außer meiner Familie und jährlich vier Wochen im Sommer verband mich mit Deutschland nicht mehr viel. Klar war es schön, sie alle wiederzusehen. Gleichzeitig strengte mich ihre Lebensart zunehmend an. Es wurde mir immer unverständlicher. Und jetzt, nachdem ich so lange nicht mehr hier gewesen war, wusste ich nicht, wie ich es überhaupt aushalten sollte. Außerdem waren es diesmal nicht nur vier Wochen, sondern doppelt so viele. Schuld daran war Tomas, der diverse Entwicklungshilfeprojekte vor Ort in Kenia koordinierte. Er hatte sich nicht davon abbringen lassen, mich so lange in den Heimaturlaub zu schicken.
„Erhol dich gut. Du wirst deine Kräfte noch brauchen“, hatte er lachend zu mir gemeint, als er mich zum Flughafen in Nairobi begleitet hatte.
Der Bau einer kleinen Dorfschule stand für dieses Jahr auf seinem ehrgeizigen Plan, wofür jede helfende Hand benötigt wurde.
„Die Arbeit ist meine Erholung“, hatte ich ihm erwidert, was er schmunzelnd hinnahm.
Eine Stewardess bahnte sich mit ihrem Frühstückswagen den Weg durch die engen Reihen der Sitze. Ich nahm ein abgepacktes Sandwich und ein Glas Orangensaft. Mir war kalt. Beim Abflug hatte das Thermometer warme 30 Grad angezeigt, doch hier im Flieger lief die Klimaanlage auf Dauerbetrieb und ich war nur mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Wehmütig schaute ich aus dem Fenster. Lediglich ein paar Wölkchen trübten die Sicht, die von der aufgehenden Sonne in ein warmes Orange getaucht wurden.
Ich schloss für einen kurzen Moment meine Augen und stellte mir vor, wie ich jetzt auf den Stufen vor der kleinen Hütte saß, in der ich wohnte, meine Schüssel mit Brei aß, während neben mir eine Tasse mit Tee vor sich hindampfte. Ich sah mich mit Mahbub, einen Einheimischen, der mir in all den Jahren zum Freund geworden war, durch die trockene Landschaft wandern, deren Grasbüschel wie Schorf auf der rotbraunen Erde wirkten. Mahbub war wie ich Mitte 30 und verstand sich auf die Kunst des Fährtenlesens. Dank ihm hatte ich es mittlerweile zu einer beachtlichen Sammlung von Tierfotos gebracht. Das Fotografieren war eines der wenigen Hobbys, die ich pflegte. Die Gedanken daran wärmten mich.
„Sehr geehrte Passagiere. Wir befinden uns in Kürze im Landeanflug auf den Flughafen in München“, brachte mich die Stimme der Stewardess wieder zurück in die Realität.
Ich riss meine Augen auf und schaute aus dem Fenster. Eine weiße Decke überzog die Landschaft unter mir. Ich brauchte ein paar Sekunden, um das zu verstehen. Lange hatte ich keinen Schnee mehr gesehen. Zwölf Jahre. Bisher war ich nur im Sommer hier auf Besuch gewesen. Zwölf Jahre kein Winter. Was hatte sich Tomas nur dabei gedacht, mich mitten im Februar hierher zu schicken? Und wie hatte ich den Winter nur vergessen können?
Gänsehaut zog sich langsam über meine unbedeckten Arme und erst jetzt fiel mir auf, dass die anderen Passagiere mit ihren dicken Westen und langen Hosen wesentlich besser auf diese Situation vorbereitet waren als ich. Ich erinnerte mich, dass ich eine langärmlige Jacke in meinen Koffer gestopft hatte. Doch der befand sich noch im Rumpf des Flugzeugs und war momentan unerreichbar. Mit einem sanften Rumpeln setzte die Maschine auf der Landebahn auf.
„Bitte bleiben Sie noch angeschnallt auf Ihren Sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben“, erfolgte eine erneute Durchsage.
Schwer atmend schaute ich den Schneeflocken zu, die vor dem kleinen Fenster tanzten. Aufregung machte sich in mir breit. Kaum war die Maschine endgültig zum Stehen gekommen, strömte eine Unruhe durch den Raum. Hektisch holten die Leute ihr Handgepäck aus den Fächern über ihnen. Ich blieb noch eine Weile auf meinem Platz sitzen. Als sich die Reihen langsam lichteten, packte ich meine wenigen Habseligkeiten zusammen. Ich erntete ein paar argwöhnische Blicke, die mir wohl mein saisonal unpassender Kleidungsstil eingebracht hatte. Ein Bus wartete bereits mit laufendem Motor auf die Passagiere. Schnell spurtete ich die wenigen Meter dorthin. Dabei trafen mich die Schneeflocken wie ein Bombardement.
„Sie haben wohl Hitzen“, kommentierte ein älterer Mann im Bus mein luftiges Outfit.
Meine Antwort war lediglich ein verhaltenes Lächeln, während sich der Schnee auf meinen Schultern in der Wärme des Busses augenblicklich in Wasser verwandelte. Ich war froh, als ich endlich im Flughafengebäude angekommen war und vor dem Laufband auf meinen Koffer wartete. Eilig packte ich ihn und kämpfte mich durch die Menschenmengen in Richtung Schalterhalle, wo bereits meine Eltern auf mich warteten. Schon von Weitem winkten sie mir zu. Schnurstracks bahnte ich mir meinen Weg zu ihnen.
„Hallo Andi. Schön, dass du endlich da bist“, empfing mich meine Mutter, die fast zwei Köpfe kleiner war als ich.
Dabei nahm sie mich stürmisch in den Arm und drückte mich so fest, dass mir beinahe die Luft wegblieb. Ihr vertrauter Duft, der mich augenblicklich fünfzehn Jahr jünger werden ließ und das Gefühl von Geborgenheit vermittelte, stieg mir in die Nase. Es war doch schön, sie nach all der Zeit wiederzusehen, obwohl wir den Kontakt auch in den letzten Jahren immer sporadisch über Telefon und Internet gepflegt hatten. Die ein oder andere Falte war in ihrem Gesicht dazugekommen und auch so manches graue Haar, das sie wie immer zu einem geflochtenen Dutt hochgesteckt hatte. Aber aus ihren klaren Augen blitze noch immer eine Jugendlichkeit, die sie sich bis heute bewahrt hatte.
„Servus Andreas“, begrüßte mich auch mein Vater auf Augenhöhe mit einer kurzen Umarmung, die aber nicht weniger herzlich gemeint war als die von meiner Mutter.
„Aber sag mal, hast du eigentlich Lust, dir eine Lungenentzündung einzufangen?“, bemerkte Mama auch sogleich, während sie aus einer großen Stofftasche eine dicke Jacke hervorkramte. „Dass du keine richtige Winterkleidung hast, habe ich mir fast gedacht. Aber mit einer kurzen Hose habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Das musst du jetzt leider aushalten, bis wir zu Hause sind.“
Dankbar schlüpfte ich in die Jacke und bekam von Mama noch eine passende Mütze dazu. So liefen wir gemeinsam zum Parkhaus, wo Papa mit seinem schwarzen Amarok parkte.
„Schön, dass du wieder da bist“, murmelte meine Mutter noch leise vor sich hin, bevor wir in das Auto stiegen und im Schneegestöber langsam nach Hause fuhren.
Nummer drei
Ein glückliches Seufzen entfleuchte meiner Mutter, als wir die Autobahn verließen. Obwohl uns die Schneeräumfahrzeuge im Dauereinsatz immer wieder begegneten, waren die winterlichen Straßenverhältnisse alles andere als optimal. Eine dicke Schneematschschicht hatte sich auf der Fahrbahn gebildet. Papa lenkte konzentriert den Wagen, dabei sprach er fast kein Wort mit uns. Aber er war von Haus aus kein gesprächiger Typ.
„Wir haben fast doppelt so lange gebraucht wie normal“, stellte meine Mutter schließlich fest, gerade als wir das Ortsschild von Biberach passiert hatten.
Von Weitem konnte ich die zwei Türme des Klosters sehen, die bereits seit meiner Kindheit eine Faszination auf mich ausgeübt hatten. Ein magischer Ort, wenn es denn magische Orte gab. Gemächlich glitt das Auto die hügelige Straße hinunter, vorbei an der kleinen Dorftankstelle.
Über die lange Fahrzeit konnte ich mich nicht so recht beschweren. Ich hatte immerhin einen Flug hinter mir, der letztendlich über 20 Stunden gedauert hatte. Da kam es auf zwei mehr auch nicht an. Außerdem hatte ich während meiner Jahre in Kenia ein anderes Gefühl für Zeit entwickelt. Papa hatte die Heizung hochgedreht, sodass mir auch mit meiner kurzen Hose im Auto noch warm geworden war. Er drückte auf das Gaspedal. Langsam schnurrte das Auto den Berg wieder hinauf. Ich konnte unser Haus bereits sehen. Nur noch eine Kurve. Wir bogen in die gepflasterte Hofeinfahrt ein. Papa öffnete das alte Scheunentor, das in den ehemaligen Stall führte, der gelb gestrichen war und schon lange als Garage für das Auto diente. Außerdem standen dort noch ein Anhänger und verschiedene Fahrräder herum. Mein Blick fiel auf die dunkelgraue Plane an der Wand. Ich musste kurz schlucken.
„Alles aussteigen. Endstation“, tönte Mama fröhlich, als wäre ich ein Zehnjähriger und riss mich aus meinen Gedanken.
In diesem Moment schlug die Turmuhr der Kirche, die gleich neben unserem Haus stand, Viertel. Schnell stieg ich aus und holte mein Gepäck aus dem Kofferraum. Unser Haus war groß und lang. Sprossenfenster zogen sich in gleichmäßigen Abständen über die weiß gestrichene Fassade. Eigentlich ein Luxus, wenn ich an mein kleines Zimmer in Kenia dachte. Trotzdem wollte ich nicht tauschen. Mein Glück lag nicht in diesen Wänden, wenngleich ich auf eine schöne Kindheit zurückblicken konnte, die ich hier verbringen durfte. Ein kurzes Lächeln huschte mir übers Gesicht.
Aus dem Brauereigasthof gegenüber entließ die Abluftanlage den vertrauten Geruch nach Braten und Hopfen. Mama sperrte die dunkelbraune Haustüre aus Holz auf, die mit zwei Milchglasscheiben vor neugierigen Blicken schützte. Zügig huschte ich hinter ihr ins Gebäude. Papa folgte uns. Draußen prasselte ein kleines Schneegestöber vom Himmel. Obwohl es erst Mittag war, hatte ich das Gefühl, dass die dicken, grauen Winterwolken jederzeit den letzten Rest Licht verschlucken würden.
Meine Eltern wohnten im Erdgeschoss. In einem ebenerdigen Anbau war die Schreinerwerkstatt meines Vaters untergebracht. Der vertraute Duft nach Harz stieg mir in die Nase. Der alte Holzfußboden knarzte unter meinem Tritt. Eine gemütliche Wärme kam mir entgegen, kaum dass wir in der Wohnung standen.
„Hallo Oma“, spurtete ein Kind freudig auf Mama zu.
Ich nahm an, dass es sich dabei um meinen Neffen Laurin handelte. Bei meinem letzten Besuch war er noch ein Kleinkind gewesen. Mittlerweile ging er schon zur Schule. Als er mich entdeckte, stockte er kurz, versteckte sich hinter meiner Mutter und beobachtete mich von sicherem Posten aus. Große grüne Augen schauten mich mit ernster Miene an. Sein langes dunkelblondes Haar war zusammengebunden. Fest umklammerte er die Hüfte seiner Großmutter.
„Das ist dein Onkel Andreas“, erklärte sie dem Kind.
Ich ging in die Knie und lächelte dem Jungen zu, der sich jedoch nur noch fester an Mama drückte.
„Hallo Laurin, du brauchst keine Angst vor mir zu haben“, versuchte ich ihn aus der Reserve zu locken. „Kannst du dich nicht mehr an mich erinnern?“
„Der ist so cringe“, tönte es plötzlich neben mir.
Lässig bekleidet mit einem Hoodie und Jeans war meine Nichte Hanni aufgetaucht. Auch sie hatte sich ziemlich verändert seit meinem letzten Besuch. Das süße, quirlige Mädchen mit den langen Zöpfen hatte sich zu einem coolen Teenie mit Kurzhaarfrisur und einem leichten Akneproblem entwickelt.
„Hi Onkel Andi“, begrüßte sie mich kurz, bevor sie wieder in ihr Smartphone starrte und sich schwerfällig auf das Sofa in dem großen Wohn-Esszimmer plumpsen ließ.
„Wohnt Martin etwa immer noch hier?“, fragte ich rhetorisch.
„Das Haus ist doch groß genug“, verteidigte ihn Mama sofort.
Mein Bruder war lediglich zwei Jahre jünger als ich. Doch im Gegensatz zu mir wohnte er bis heute mit meinen Eltern unter einem Dach. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass er mit seiner Dauerfreundin Melli zwei gemeinsame Kinder hatte. Im Obergeschoss hatte er sich häuslich eingerichtet und lebte das Leben eines mittelmäßigen Schriftstellers. Seine Schriftstellerei betrachtete ich allerdings lediglich als Alibi, denn eigentlich war er der geborene Hausmann, der sich mit Herzblut um die Erziehung seiner Kinder kümmerte. Außerdem hielt er Melli, die als selbstständige Kunsttherapeutin arbeitete, beruflich den Rücken frei.
„Ich gehe kurz in mein Zimmer. Mich umziehen“, meinte ich zu Mama.
Mein Zimmer war immer noch im gleichen Zustand wie damals, als ich es vor zwölf Jahren verlassen hatte, was ich ein wenig beklemmend fand. Immer wenn ich hier war, fühlte ich mich in die Vergangenheit zurückkatapultiert und ich wusste nicht, ob ich das wollte. Aber andererseits war es auch eine nette Geste meiner Eltern, dass sie mir nach all den Jahren immer noch meinen Platz im Haus einräumten. Geschafft von diesem Tag ließ ich mich auf mein Bett fallen. Ich sog die Luft tief in meine Lungen. An der Wand hingen Poster von der Bloodhound Gang und von Eminem. Ein alter Bauernschrank stand an der Wand. Ob ich darin vielleicht eine passende lange Hose finden würde? Schwerfällig erhob ich mich und öffnete die quietschende Tür. Ich entdeckte eine schwarze Jogginghose mit Druckknöpfen, wie sie in den 90ern modern gewesen waren. Genau das Richtige für mich in diesem Moment. Dankbar zog ich sie an und freute mich, dass sie tatsächlich noch bequem passte. Ich setzte mich an meinen alten Fichtenholzschreibtisch, der vor dem Fenster stand und schaute nach draußen. Lautlos fielen schwere Flocken auf die Erde. Auch wenn ich die letzten Jahre den Schnee nicht vermisst hatte, hatte er nun doch eine gewisse Faszination auf mich.
„Möchtest du nicht zum Essen kommen?“
Meine Mutter stand plötzlich im Zimmer. Bei dem Gedanken an Essen grummelte mein Magen.
„Was gibt´s denn?“, wollte ich wissen.
„Dein Lieblingsgericht“, meinte Mama lächelnd. „Kässpätzle.“
„Ich komme gleich.“
Sie schloss die Tür wieder. Wenige Minuten später folgte ich ihr in das Wohn-Esszimmer, wo es schon herrlich nach Käse und angebratenen Zwiebeln roch. An dem großen Holztisch saßen bereits die Kinder meines Bruders und warteten auf das Essen. Ich setzte mich wie selbstverständlich dazu. Laurin beäugte mich weiter skeptisch, während Hanni immer noch mit dem Smartphone beschäftigt war. Mama stellte eine große feuerfeste Form in die Mitte. Auf gewisse Weise genoss ich es, wie ich von ihr verwöhnt wurde. Lange Käsefäden zogen sich, als Mama das Essen auf die Teller verteilte.
„Guten Appetit.“
Ich hatte gerade drei Bissen gemacht, als unser Essen plötzlich gestört wurde.
„Servus Andi“, begrüßte mich mein Bruder mit einem breiten Grinsen.
Sein braunes Haar stand lustig vom Kopf ab. Laurin hatte seine Augen geerbt. Etwas erstaunt starrte ich auf den seltsamen roten Rucksack, den er vor dem Bauch trug.
„Hallo Martin“, erwiderte ich überrascht und erhob mich kurz von meinem Stuhl.
Als ich mich ihm näherte, stellte ich fest, dass sein Rucksack mit einem kleinen warmen Knäuel bepackt war.
„Was ist denn das?“, fragte ich überrascht.
„Das ist Jaron“, erklärte mir mein Bruder.
„Jaron?“
„Das habe ich dir doch neulich am Telefon erzählt“, mischte sich Mama in das Gespräch ein.
„Nicht, dass ich wüsste“, meinte ich.
„Das ist dein Neffe“, stellte mir Martin das kleine Menschenbündel mit Stolz in der Stimme vor.
Ich konnte meine Überraschung nicht so recht verbergen.
„Kind Nummer drei also? Und wer ist die Mutter?“
„Wer wohl. Melli natürlich“, entrüstete sich Martin.
„Ihr werdet doch nicht endlich zusammengezogen sein und geheiratet haben“, frotzelte ich meinen Bruder und streichelte dem kleinen Jaron, der fest schlief, über die weiche Wange.
„Selbstverständlich nicht. Das ist schließlich das Geheimnis unserer Liebe“, meinte er augenzwinkernd zu mir, bevor er mir kurz auf die Schulter klopfte. „Schön, dass du da bist.“
Wenig später hockten wir alle am Tisch und es fühlte sich fast ein wenig so an, als wäre ich nie weggewesen. Und doch war die Zeit an uns allen nicht einfach vorbeigegangen.
Mantel der Vergangenheit
Urlaub war eigentlich etwas, das ich überhaupt nicht brauchte. Mein Lebensrhythmus war gut abgestimmt mit einer Arbeit, die mich erfüllte. Ich hatte eine abgeschlossene Schreinerlehre und mit meinem Handwerk konnte ich in Kenia viel bewegen. Obwohl das Leben dort nicht immer bequem war, hatte es doch eine ganz eigene Gangart, die weit entfernt war von Hektik und Stress und trotz aller Anstrengung immer auch Zeit ließ für schöne Augenblicke. Und als ich nun nach meiner ersten Nacht zurück in Deutschland erwachte, fehlte mir das alles. Ich fühlte mich seltsam leer und wusste nicht so recht, was ich mit diesem Tag anfangen sollte.
„Frühstück ist fertig“, meinte Mama zu mir, als sie kurz die Tür zu meinem Schlafzimmer geöffnet hatte.
Ich schaute auf den schwarzen, viereckigen Wecker, der mich schon während meiner Schulzeit begleitet hatte. Es war schon nach neun Uhr. Wann ich das letzte Mal so lange geschlafen hatte, konnte ich nicht so recht sagen. Ich schob meine Müdigkeit auf die Strapazen des Flugs. Langsam rappelte ich mich aus dem Bett. Mir war ein wenig kalt, was wohl daran lag, dass ich wie gewohnt mit nacktem Oberkörper geschlafen und dabei völlig vergessen hatte, die Heizung entsprechend aufzudrehen. Ich schaute aus dem Fenster. Das gestrige Grau des Himmels hatte sich in ein winterliches Blau verwandelt, das die weiße Schneedecke in hellem Glitzer scheinen ließ. Schnell zog ich ein T-Shirt aus meinem Koffer, um meine Mutter mit dem Frühstück nicht länger warten zu lassen.
„Wo sind denn die anderen?“, wollte ich von Mama wissen und setzte mich an den großen Holztisch, der von einer großzügigen Eckbank und vielen Stühlen umrahmt war.
„Papa ist beim Arbeiten, Martin ist mit Jaron bei der Hebamme zur Babymassage und Hanni und Laurin sind in der Schule“, erklärte mir meine Mutter, während sie mir eine Tasse dampfenden Kaffee auf den Tisch stellte. „Und ich muss nachher auch noch arbeiten. Sind leider etliche Mitarbeit krank geworden, sodass ich diese Woche einspringen muss. Ich bin aber bis 13:30 wieder zu Hause.“
Meine Mutter arbeitete schon seit Jahren in dem kleinen Klosterladen des Prämonstratenserklosters, der in den alten Gemäuern Bücher, Weihrauch und auch so manche kulinarische Köstlichkeit anbot.
„Dann bin ich alleine?“, stellte ich sachlich fest, was jedoch bei meiner Mutter sofort ein schlechtes Gewissen auslöste.
„Tut mir so leid, Andi“, sie legte ihre Hand auf meine und schaute mich mit großen, mitleidigen Augen an.
„Das ist doch nicht schlimm. Ich bin eh noch etwas k. o. vom Flug und um meine Ruhe ganz froh“, versuchte ich sie mit einem Lächeln zu beschwichtigen.
Eilig ging sie in die Küche und brachte mir einer Tüte mit Semmeln, Butter und Marmelade.
„Lass es dir schmecken. Bis später.“
Kurz wuschelte sie mir durch mein Haar, dann verließ sie eilig die Wohnung. Gedankenverloren schmierte ich mir eine Sesamsemmel und biss hinein. Der süße Geschmack nach Erdbeeren war ungewohnt und doch so vertraut. In Kenia bestand mein Frühstück meist aus einem Maisbrei. Meditativ tickte die alte Standuhr vor sich hin, die schon seit meiner Kindheit am gleichen Platz stand und alle paar Tage von Papa aufgezogen werden musste.
Etwas unbeholfen räumte ich wenig später meinen Frühstücksteller und die Kaffeetasse in die Spülmaschine. Ich überlegte, was ich nun machen könnte. Doch mir wollte nichts einfallen, also ließ ich mich auf das bequeme Sofa fallen und schaltete den Fernseher an. Allerdings überforderten mich die vielen Knöpfe der modernen Fernbedienung völlig, sodass ich diese Art der Freizeitgestaltung sofort wieder einstellte, zumal ich die letzten Jahre sehr gut ohne ein solches Gerät gelebt hatte. Stattdessen glotze ich eine Zeit lang einfach aus dem Fenster, hinunter zu Papas Schreinerwerkstatt, die sich in einem separaten Gebäude befand, das jedoch mit dem Haus verbunden war. Die Fassade war in einem angenehmen Gelb gestrichen und die hohen Sprossenfenster waren mit roten Putzbändern umrandet. Der Schnee hatte die Biberschwanzdachplatten weiß getüncht.
Wie mein Vater hatte ich ebenfalls den Beruf des Schreiners gelernt. Ich war mit Holz aufgewachsen und konnte mich schon früh dafür begeistern. Zu meiner Leidenschaft kam auch noch ein instinktives Talent, das meinem Bruder allerdings schon immer gefehlt hatte. Wir waren grundverschieden, trotzdem verstanden wir uns ganz gut. Mein Blick schweifte durch den Wohnraum, der seit meiner Kindheit relativ ähnlich geblieben war. Viele Möbel hatte mein Vater selbst gezimmert. Auch die große Schrankwand aus Buchenholz, die mit ihren dezenten Schnitzereien eine zeitlose Gemütlichkeit in den Raum zauberte.
Ich lehnte mich zurück auf die Sofakissen, faltete meine Hände über der Brust und betrachtete die Astlöcher in der Holzdecke, wie ich es schon früher getan hatte, immer wenn ich krank zu Hause war. Ein Seufzer kroch aus meiner Kehle. Obwohl ich mich freute, meine Familie wieder zu sehen, stiegen in dieser ungewohnten Ruhe plötzlich Gedanken in mir hoch, von denen ich geglaubt hatte, sie fest unter dem Mantel der Vergangenheit verstaut zu haben. Wie wabernder Nebel legten sie sich um mein Herz und ich wünschte mich wieder zurück nach Kenia.
Erleichtert hörte ich, wie wenig später die Haustür aufgesperrt wurde. Mein Bruder war von der Babymassage zurück. Jaron schlief zufrieden in dem Rucksack, den mein Bruder sich um den Bauch gebunden hatte.
„Nach der Massage ist er immer total entspannt“, meinte er zu mir, setzte sich neben mich und befreite seinen Sohn von einer dicken Strickmütze.
Vorsichtig streichelte ich ihm über den zerbrechlich wirkenden Kopf, der einen Flaum weicher Haare aufwies. Der typische Geruch nach Baby lag in der Luft.
„Hast du nachher Lust mit mir zusammen Laurin von der Schule in Roggenburg abzuholen? Es ist so herrliches Winterwetter draußen“, meinte Martin zu mir.
„Prinzipiell schon. Aber…“
„Aber was?“
„Für Winter bin ich nicht so recht ausgerüstet.“
Er lachte amüsiert.
„Das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Da findet sich sicherlich noch etwas im Schrank.“
Wenig später hatte sich in Papas Schrank ein blauer Langlaufanzug aus den 70ern gefunden, der zwar etwas aus der Zeit gefallen schien, mir aber wie auf den Leib geschneidert und vor allem warm war. Wir packten den dick eingemummten Jaron in den Kinderwagen und spazierten in gemütlichem Tempo die Straße hinauf. Kaum hatten wir das Dorf verlassen, lagen weit verschneite Felder neben uns, die im Sonnenlicht glitzerten und meine trüben Gedanken verscheuchten.
Hoffnung
Vier Tage war ich bereits hier, allerdings hatte ich mich noch immer nicht so richtig eingelebt in meine alte Heimat, was nicht nur an dem ungewohnten kalten Wetter lag. Ich konnte mit dieser erzwungenen Ruhe, die sich Urlaub nannte, nichts anfangen und konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, wie ich diesen Zustand acht ganze Woche durchhalten sollte, obwohl es wirklich schön war, dass ich nach der langen Zeit endlich mal wieder meine Familie um mich hatte. Mama hatte mich ganz zu Beginn einmal in Kenia besucht, allerdings ohne Papa. Er war wie ein empfindliches Gewächs, das mit der Erde hier tief verwurzelt war und dem die kleinste Luftveränderung nicht unbedingt wohl bekam.
Seit ich wieder zurück war, hatte ich ihn nicht viel gesehen. Er hatte mich zwar vom Flughafen abgeholt und auf seine Art freundlich empfangen, aber seit seine Arbeitswoche begonnen hatte, war er meist unterwegs bei irgendeiner Kundschaft und kam erst am Abend zurück. Um nicht weiter untätig herumzulungern, hatte ich mir für einen kurzen Augenblick überlegt, ob ich ihm nicht etwas unter die Arme greifen sollte. Obwohl er nicht mehr der Jüngste war, war er körperlich noch fit, aber eine Unterstützung hätte ihm mit Sicherheit trotzdem gutgetan. Diese Idee hatte ich allerdings sofort wieder verworfen, denn ich wollte in ihm keine Hoffnungen wecken, die ich nicht erfüllen konnte.
Nachdem mein Bruder noch nie mit handwerklichem Geschick geglänzt hatte, war eigentlich schon von jeher klar gewesen, dass irgendwann ich den Schreinerbetrieb meines Vaters hätte übernehmen sollen. Doch diese Vorstellung hatte ich jäh zerstört, als ich meinen Eltern erklärte, dass ich nach Kenia gehen würde. Zu Beginn dachten sie noch, es wäre nur eine Phase, die irgendwann vorbeigehen würde. Doch nach gut zwölf Jahren war diese Sache kein Thema mehr und ich wollte nichts tun, das einen anderen Eindruck vermittelte. Andererseits lechzten meine Hände nach Holz und Arbeit, genauso wie mein Kopf, dessen Gedankenkarussell sich immer mehr zu drehen begann.
Wenigstens schaffte es der kleine Jaron, mich ein wenig abzulenken. Schlafend lag er auf meiner Brust und atmete kaum hörbar, während mir mein Bruder Passagen aus seinem neuen Buch rezitierte.
„Wie fandest du die Stelle?“, wollte er schließlich erwartungsvoll von mir wissen.
„Gut.“
Ich saß neben Martin auf dem Sofa und streichelte gedankenverloren meinem Neffen über die weiche warme Backe. Ein kurzes Lächeln huschte über sein kleines Gesicht.
„Ich glaube, du wärst ein guter Vater“, meinte mein Bruder völlig unerwartet zu mir.
„Und ein noch besserer Onkel“, konterte ich und warf ihm einen Blick zu, der jegliche weitere Diskussion zu diesem Thema unterband.
Genau in diesem Moment bohrte sich in meinen Kopf eine Idee. Es war nichts Weltbewegendes. Aber etwas, das mich zumindest für kurze Zeit auf andere Gedanken bringen würde. Als Jaron erwacht war, gab ich ihn behutsam meinem Bruder zurück, damit er ihn füttern konnte, während ich mich sofort aufmachte und in mein Zimmer ging.
Mein Blick fiel auf das Regal mit den vielen Schubladen. Ich öffnete eine nach der anderen und fand schließlich, wonach ich gesucht hatte. Eilig zog ich Papier und Stifte hervor, bevor ich mich an meinen Schreibtisch setzte und konzentriert zu zeichnen begann.
Es war bereits dunkel draußen, als ich mit meinem Ergebnis halbwegs zufrieden war. Der Dreck von Spitzer und Radiergummi hatte sich gleichmäßig auf der Tischplatte verteilt und deutete auf einen kreativen Arbeitsprozess hin. Ich nahm das Blatt noch einmal in die Hand und betrachtete es mit Genugtuung. Das Schöne dabei war, dass ich die letzten Stunden keinen negativen Gedanken verschwendet hatte.
„Möchtest du nicht zum Abendessen kommen?“, durchbrach Mamas Stimme plötzlich die Stille im Raum.
„Ich komme gleich.“
Angenehm satt von der abendlichen Brotzeit legte ich mich wenig später in mein Bett, verschränkte die Hände hinter meinem Kopf und starrte an die dunkle Decke. Zum ersten Mal, seit ich wieder zurück war, empfand ich eine gewisse innere Ruhe.
Frieden
Als ginge es um mein Leben, packte ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück mein Werk und huschte schnell in die Werkstatt. Hier hatte sich seit meiner Kindheit kaum etwas verändert. Der vertraute Geruch nach Holz stieg mir in die Nase und auf dem Boden lagen gleichmäßig verteilt Sägespäne. Die große alte Werkbank, die noch von meinem Großvater stammte und die Patina von Jahrzehnten in sich aufgesogen hatte, stand wie ein Monument an der Wand vor den hohen Fenstern, die helles Licht in die Räume ließen. Ich ging zu dem Stapel, wo mein Vater feinsäuberlich Holz in allen Variationen aufgeschichtet hatte und schaute, welches sich am besten eigenen würde. Papa war bereits unterwegs bei der Kundschaft, sodass ich hier in Ruhe arbeiten konnte. Schnell fand ich, wonach ich gesucht hatte. Ich übertrug meine Pläne auf das Holz und suchte mir wenig später eine Stichsäge aus dem Regal. Konzentriert ließ ich das Sägeblatt durch das Holz gleiten.
„Was wird das?“, hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter hinter mir, gerade als ich die Säge abgeschaltet hatte.
Überrascht von dem ungebetenen Besuch, drehte ich mich hastig um.
„Das werden kleine afrikanische Tiere. Elefanten, Giraffen, Löwen. Ich dachte mir, ich mache daraus ein Mobile für Jaron.“
Ruhig begutachtete sie mein Werk, das jedoch noch einige Arbeitsschritte nötig hatte.
„Du hast so ein unglaubliches Talent, Andreas“, meinte sie anerkennend zu mir, während ich nur stumm nickte.
Ich ahnte bereits, in welche Richtung dieses Gespräch gehen würde und hoffte, dass sie nicht weiterreden würde. Eine Weile herrschte Stille zwischen uns.
„Du könntest hier so viel bewegen“, sprach sie leise zu mir.
„Ich kann auch in Kenia viel bewegen“, erwiderte ich ihr trotzig und versuchte gefasst zu bleiben.
„Dein Vater arbeitet jeden Tag von früh bis spät, weil er immer noch die Hoffnung hat, dass du irgendwann zurückkommst und den Betrieb übernimmst.“
Ich schloss kurz meine Augen und seufzte tief.
„Das wird aber nicht passieren, Mama. Wir haben diese Diskussion doch schon so oft geführt. Ich dachte, ihr habt es endlich kapiert“, polterte es schließlich ziemlich undiplomatisch aus mir heraus.
Sie schüttelte fast unmerklich den Kopf, dabei streichelte sie mir sanft über die Schulter.
„Du musst endlich deinen Frieden mit dir machen, Andreas.“
Mein Atem ging auf einmal ganz schnell und in meinem Hals hatte sich ein dicker Kloß gebildet. Trotzdem war ich noch bemüht um Fassung.
„Ich habe meinen Frieden gefunden“, sprach ich leise zu ihr. „Aber nicht hier.“
„Dir kannst du vielleicht etwas vormachen, aber nicht deiner Mutter. Ich spüre deine innere Zerrissenheit. Du bist selbst eines deiner afrikanischen Tiere, gefangen in einem selbstgezimmerten Käfig und unfähig, sich selbst zu befreien. Ich will doch nur, dass es dir gut geht.“
Energisch schüttelte ich den Kopf. Ich suchte nach Worten. Doch da war auf einmal nur noch diese Leere in mir. Und dann tat ich das, was ich in solchen Situationen am besten konnte. Ich ließ alles liegen und stehen, zog hastig meine Winterklamotten an und stürmte aus dem Haus.