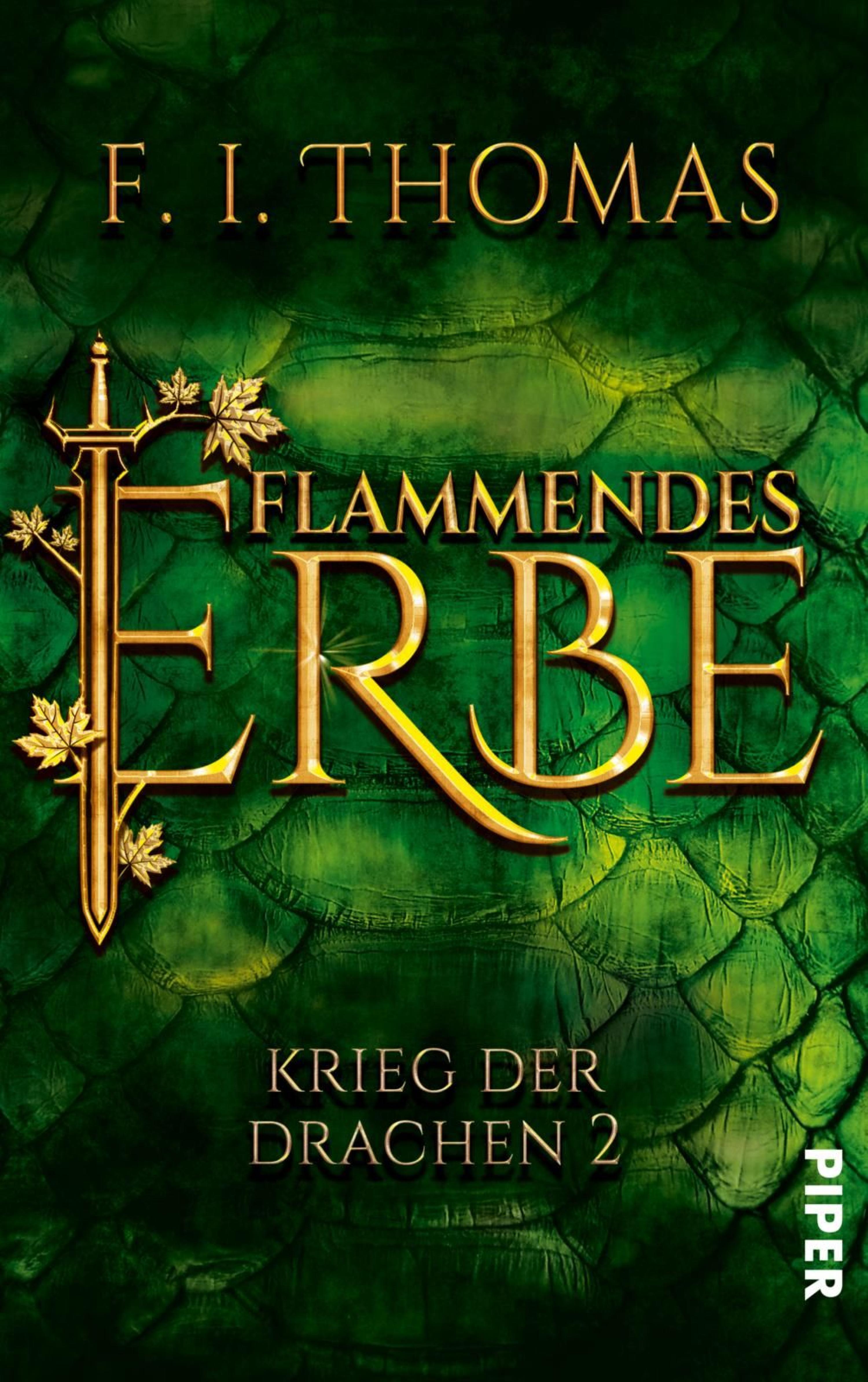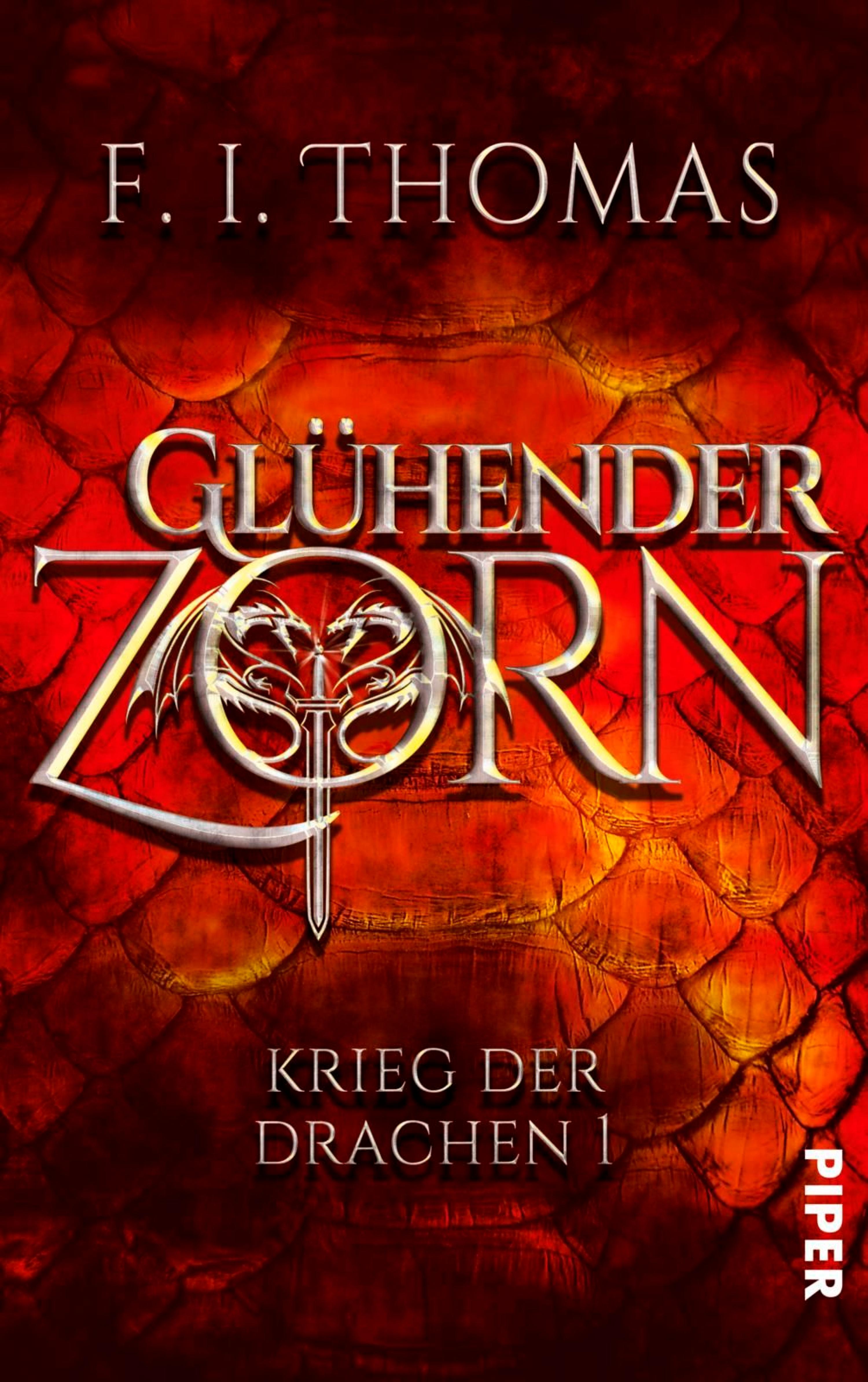
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jahrhunderte sind vergangen, seit sich die Bewohner der Jungen Königreiche von der Schreckensherrschaft der Drachen befreit haben. Das kostbare Vermächtnis der Drachen, die Zauberei, liegt jetzt in den Händen von sechs Magiern. Doch deren Novizen kommen einer schrecklichen Tatsache auf die Spur: Sie sollen getötet werden, um ihren machtgierigen Lehrmeistern so die Unsterblichkeit zu verleihen. Gejagt von den mächtigsten Zauberern der Welt, versuchen die jungen Magier nun selbst, ihr Wissen zu mehren und das Geheimnis der Zauberei zu ergründen. Doch hinter der Magie steckt eine furchtbare Wahrheit, deren Entdeckung die alten Zauberer unbedingt zu verhindern suchen. Es entbrennt ein magischer Krieg, als unerwartet ein alter Feind zurückkehrt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ISBN 978-3-492-97882-8
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Karte: Daniel Jödemann
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
Sechs Leben
Tandurin
Dania
Geron
Kyrell
Boltan
Ambra
Der Drachenthron
Getrennte Wege
Das Auge
Königliches Blut
Die Greisenmaid
Am Katarakt
Feuer und Wasser
Todesboten
Der Sturm beginnt
Für Philipp, Astrid, Jasmin und Loki,
ein jeder von ihnen auf seine Weise ein Magier.
Einen auf die Grausamkeit der Drachen,
möge die Sonne ihre Gebeine bleichen.
Einen auf die Arroganz der Elfen,
mögen die Feiglinge in ihrem Exil verrotten.
Einen auf die Verschlagenheit der Zauberer,
mögen sie an ihrem Eigennutz ersticken.
Und einen auf die Tapferkeit all der Recken,
denen du deine Freiheit verdankst!
– Trinkspruch aus Kesselfurt –
Prolog
Das Schlachtfeld war übersät mit verbrannten Leichen.
Es waren Hunderte. Aberhunderte.
Jene, die das Drachenfeuer am schlimmsten erwischt hatte, waren zu unkenntlichen schwarzen Gestalten verkohlt, die hilflos nach dem Himmel zu greifen schienen. Dazwischen lagen aufgeblähte Leiber, deren verschmortes Fleisch die Luft mit einem unerträglichen Geruch erfüllte. Noch immer krampften sich ihre Hände um Waffen, die sie nicht mehr einsetzen konnten.
Inmitten der Rauchschwaden, die von zahllosen Brandherden aufstiegen und träge über das Schlachtfeld wehten, hielten einzelne Reiter zwischen den Leichen nach Verletzten Ausschau. Andere stachen mit ihren Lanzen auf überlebende Drachendiener ein.
Der Zauberer trat vor, denn auch zwei ihrer eigentlichen Feinde waren dort unten im Tal.
Drachen. Tote Drachen.
Unweit dreier zerrissener Pferde und ihrer Reiter lag ein blau geschupptes Monstrum von der Größe eines kleinen Segelschiffs. Cundrath.
Noch bis vor wenigen Wochen hatte der Lindwurm grausam über ein Gebiet am Oberlauf des Großen Flusses geherrscht. Jetzt war sein Leib übersät von Pfeilen, Bolzen und Katapultspeeren, und der Zauberer erkannte, dass es den Männern gelungen war, ihm eine seiner gewaltigen Schwingen abzuschlagen. Ein weiterer Drachenleib lag weiter hinten zwischen den Bäumen. Die geflügelte Kreatur hatte bei ihrem Absturz eine tiefe Schneise in den Wald geschlagen.
Die Drachen waren zwar schon lange nicht mehr so zahlreich wie in den ganz alten Tagen, doch vor 200 Jahren – während des Zweiten Drachenkrieges – war es ihnen gelungen, abermals Teile des Nordens zu unterwerfen. In den beiden zurückliegenden Jahrhunderten hatte Drachenkönig Yolsulgur weniger mit Gewalt, dafür mit List und Magie versucht, die standhaften freien Reiche gegeneinander auszuspielen. Er und die anderen Drachen hatten mit ihrer Magie das Wetter verändert, so die Ernten ganzer Jahre vernichtet und für Hunger und ausbrechende Krankheiten gesorgt. Sie hatten die Menschen gezwungen, in den Bergen Gold für sie abzubauen und ihnen als Tribut Sklaven zu überlassen. Das Schicksal dieser Unglücklichen hatte sich selbst den Zauberern vom Orden der Stäbe erst allmählich offenbart. Die menschlichen Diener der Drachen hatten Revolten gesät und versucht, die Reiche von Innen her zu stürzen.
Trotz all der Verluste würde die heutige Schlacht daher in die Annalen der Jungen Königreiche eingehen. Die Kunde vom Sieg über den Drachenkönig würde sich rasch verbreiten. Boten überall im Land würden das Ende des Dritten Drachenkrieges verkünden.
Die Völker lechzten nach Frieden.
Doch zu welchem Preis?
Vom Schlachtfeld aus näherten sich drei Reiter in schimmerndem Kürass dem zurückeroberten Drachenthron. Sie mussten weiter unten am Berg absteigen, um auf der von Geröll und Leichen übersäten Anhöhe nicht ihre Reittiere zu gefährden. Ihre grün-gelben Wappenröcke verrieten dem Zauberer, dass die Ritter aus dem Königreich Waldaleth stammten.
Ihre Rüstungen waren kunstvoll mit Rankenornamenten verziert und auch der Stahl ihrer Waffen war härter als jener der anderen Verbündeten. Der Magier verzog geringschätzig die Lippen. Die Waldalether entstammten dem einzigen der Jungen Königreiche, das ihren einstigen Gönnern noch die Treue hielt: den Elfen.
Vermutlich würde sich die Menschheit auch heute noch in Höhlen und dunklen Wäldern verkriechen, wären nicht vor 600 Jahren aus dem fernen Westen die Schiffe des Alten Volkes an den Küsten erschienen. Die Legenden kündeten von einem nicht näher beschriebenem Unglück, das ihre einstige Heimat verheert hatte. Für ihrer aller Vorfahren hatte ihr Erscheinen einen Wendepunkt markiert, denn ebenso wie die Drachen beherrschten die geheimnisvollen Neuankömmlinge die Zauberei.
Die Elfen hatten die geknechteten Bewohner des Landes zum Widerstand ermutigt, sie im Ersten Drachenkrieg gegen ihre Unterdrücker angeführt und es tatsächlich geschafft, die Drachen zu vertreiben. Gleich hier, unmittelbar am Drachenthron, hatten sie daraufhin ihre Stadt Sil’Bariath errichtet, die im ganzen Land die Strahlende genannt wurde.
In ihrem Schutz waren bis hinunter zur Wogensee neue Reiche und Stadtstaaten entstanden. Auch die Magier vom Orden der Stäbe verdankten ihre arkane Kunst den Unterweisungen und Hinterlassenschaften des Alten Volkes.
Und doch empfand der Zauberer den Elfen gegenüber nur wenig Dankbarkeit.
400 Jahre nach dem erstmaligen Sieg über Yolsulgur war der Drachenkönig wiedergekehrt und hatte im Zweiten Drachenkrieg den Drachenthron von den Elfen zurückerobert. Die Drachen hatten die Vulkane in den nahen Bergen geweckt und Feuer und Asche auf Sil’Bariath niederregnen lassen. Die Elfen waren daraufhin feige ins Unbekannte geflohen und hatten die übrigen freien Völker von einem Tag auf den anderen sich selbst überlassen.
Heute waren sie nicht mehr als eine verblassende Erinnerung.
Allein die Waldalether, die sich stets als vom Alten Volk auserwählt betrachtet hatten, wollten trotz ihrer Enttäuschung nicht von ihnen lassen.
Die drei Ritter erreichten das Plateau vor der Drachenhöhle, und ihr Anführer nahm schwer atmend seinen Helm ab. Man sah dem jungen Mann die Anstrengungen der zurückliegenden Schlacht an, dennoch wirkte sein Blick klar und wach.
»Meister!« Er und seine Begleiter verbeugten sich.
Der Zauberer nickte den Rittern zu. »Ihr seid?«
»Mein Name ist Kaleth von Blauquell. Ich bin die rechte Hand von Hauptmann Barion. Barion ist im Drachenfeuer umgekommen, und so führe ich jetzt die Männer an.«
»Wie viele von ihnen haben überlebt?«
»Etwa siebenhundert – von viertausend.« Der Ritter senkte niedergeschlagen den Blick. »Es liegt jetzt an mir, König Belegius über den Schlachtausgang zu unterrichten. Unter den Männern kursiert das Gerücht, dass der Sieg diesmal endgültig sei. Ist das wirklich wahr?«
Hinter sich hörte der Zauberer Schritte und als er über die Schulter schaute, sah er zwei seiner Ordenskollegen aus der Drachenhöhle treten. Einen Mann und eine Frau. Beide stützten sich auf schlanke Stäbe. Letztere war für ihre Schönheit bekannt, doch jetzt war sie ebenso von dem Kampf gegen Yolsulgur gezeichnet wie die übrigen. Ihr langen Haare waren von grauen Strähnen durchsetzt und ihr Gesicht von tiefen Falten durchzogen.
Die Ritter verbeugten sich auch vor ihnen.
Der Zauberer wandte sich Kaleth von Blauquell zu. »Richtet Seiner Königlichen Majestät aus, dass wir die Drachen ausgelöscht haben. Diesmal endgültig.«
Die Männer schauten ihn ungläubig an und erstmals erlaubten sie sich ein Lächeln.
»Wir werden dem mit Freude nachkommen«, sprach Kaleth von Blauquell. »Mehr noch: Wir werden dafür sorgen, dass sich die Nachricht überall in den Jungen Königreichen verbreitet.«
Abermals verneigten sie sich, dann machten sie sich an den Abstieg.
Die beiden Magier traten neben ihn.
»Wie viele von uns sind noch übrig?«, fragte der Zauberer.
»Es haben sich noch nicht alle gemeldet«, meinte sein Kollege zögernd. »Ich befürchte, kaum ein Dutzend. Auch unser Blutzoll ist hoch. Ganz zu schweigen von den anderen Opfern, die wir erbracht haben.«
»Niemand darf wissen, was dort drinnen vorgefallen ist«, sagte der Zauberer beschwörend, »noch, was wir dort gefunden haben.«
Seine Kollegin nickte in düsterem Einvernehmen. »Was schlägst du vor, was wir jetzt tun sollen?«
»Wir werden den Einstieg in den Berg versiegeln. Danach müssen wir einen Weg finden, um das Tor weiterhin geschlossen zu halten.«
»Unmöglich«, widersprach der Magier neben ihm. »Sieh uns doch an. Du weißt selbst, dass uns dafür zu wenig Zeit bleibt.«
»Dann werden wir es eben wie die Drachen halten«, sagte der Zauberer ungehalten. »Wir werden uns der Magie Yolsulgurs bedienen.«
»Drachenmagie!?« Entgeistert blickte sein Kollege ihn an. »Du willst …? Niemals! Ist dir nicht klar, was das bedeutet? Das würde mit all unseren Traditionen –«
»Welche Traditionen?«, unterbrach ihn seine Kollegin bissig. »Wir haben uns doch nur zusammengeschlossen, um gegen die Drachen zu bestehen. Ein Zweckbündnis. Mehr nicht. Und jetzt gibt es nur noch uns. Skrupel können wir uns nicht leisten.«
»Nein, da mache ich nicht mit!«, antwortete der Magier wütend.
»Es ist aber notwendig!«, widersprach der Zauberer.
»Das ist mir egal. Dann trennen sich unsere Wege eben. Und ich werde die anderen –«
Die Hand des Zauberers schnellte vor, packte seinen überraschten Kollegen am Hals und hinderte ihn so am Weitersprechen. Der versuchte sich noch zu wehren, doch statt eines Zaubers entstieg seiner Kehle bloß ein verzweifeltes Röcheln, während er erstarrte und sich seine Haut steingrau färbte.
Der Zauberer ließ den Verwandelten los. Steif wie eine Statue kippte er neben sie auf das Plateau und sein Körper zerbrach rumpelnd in drei Einzelteile.
Die Magierin trat einen Schritt zurück und betrachtete den Toten ungerührt. Dann sah sie sich argwöhnisch zur Drachenhöhle um. »Was, wenn von den anderen auch nicht alle mitmachen wollen?«
Der Zauberer verengte die Augen. »Die, die sich weigern, werden wir ebenfalls beiseiteräumen. Eine kleine Gruppe reicht.«
Seine Kollegin ließ ihren Blick über das Schlachtfeld wandern und lächelte böse. »Nein, wir werden sie nicht einfach nur beiseiteräumen. Ich denke, fortan wissen wir etwas Besseres mit ihnen anzufangen …«
420 Jahre später
Sechs Leben
Tandurin
»Ich hoffe, du weißt, was du zu tun hast?«
»Ja, Magistra.« Tandurin und seine Lehrmeisterin ritten auf klappernden Hufen durch die engen Gassen Silbersteigs. Die einfachen Holz- und Fachwerkbauten waren edleren Steinhäusern gewichen, doch die Straßen der alten Bergbaustadt waren auch in der Innenstadt steil und unwegsam. Immerhin würden sie ihr Ziel bald erreicht haben, denn es war kühl und in der Ferne kündigte sich grollend ein Gewitter an.
»Den neugierigen Blicken der Magistratsbediensteten zu entgehen«, fuhr Tandurin fort, »sollte kein Problem sein. Auch mit der Tür zur Schatzkammer werde ich wohl leicht fertig. Aber was, wenn das Horn wirklich durch Zauberei geschützt wird?«
»Du bist bald selbst ein richtiger Zauberer. Improvisiere!« Magistra Escalia Rotdrud maß ihn hochmütig mit ihren grünen Augen. »Jeder Schutzzauber ist nur so gut wie der Magier, der ihn einst wirkte. Sollten sich die Gerüchte als wahr erweisen, dann denke daran, dass Schutz-Sigillen nur unter fest vorgegebenen Bedingungen ausgelöst werden. In diesem Fall lass dir etwas einfallen. Versuch, die Lücke zu finden. Zwar bist du jetzt etwas Besseres, aber du entstammst immerhin dem fahrenden Volk. Mach ihm keine Schande. Denn was Diebstähle betrifft, sind die deinen ja sonst auch nicht gerade auf den Kopf gefallen.«
Verärgert fasste Tandurin seinen Falben am Zügel und führte das Pferd an einer überfüllten Abfalltonne vorbei, auf deren Unrat unzählige Mäuse herumturnten. Er mochte es nicht, wenn seine Lehrmeisterin so über seine Leute sprach. Ihre Worte würdigten sie zu einer Schar vagabundierender Diebe und Gauner herab. Sicher, die Lebensart seines über die Jungen Königreiche versprengten Volkes, deren Sippen von Reich zu Reich zogen, um sich ein Auskommen als Kesselflicker, Löffelschnitzer, Schausteller und Pferdehändler zu sichern, brachte es mit sich, dass der Respekt vor dem Besitz jener, die ein festes Heim besaßen, nicht besonders hoch war. Andererseits war sein Volk auch wie kein anderes der Willkür und den Vorurteilen jener ausgesetzt, die nicht wussten, wie es war, seit über 400 Jahren ohne Heimat zu sein.
Nur würden Widerworte nichts nutzen.
Nicht bei Magistra Rotdrud, die mit dem stolzen Habitus einer Königin durch die schmutzigen Gassen des Bergwerkstädtchens ritt – und die selbst keine Gelegenheit ausließ, sich zu bereichern. Sie war eine ebenso gefährliche wie schöne Frau mit kühlen, alterslosen Gesichtszügen und schräg stehenden Augen, in deren Blick sich meist Spott und das überlegene Wissen von Jahrhunderten die Waage hielten. Ihr langes schwarzes Haar verbarg sie heute unter einer mit Hermelinfell besetzten Gugel, und auch ihr vornehmes grünes Reisegewand erweckte Aufsehen. Unvorsichtige übersahen dabei gern den langen Zauberstab aus dunklem Ebenholz, der klarstellte, dass sie keine gewöhnliche Adlige war. Doch Zauberer waren selten geworden. Dass man sie nicht erwartete, war in den letzten sechs Jahren, die Tandurin bereits Magistra Rotdruds Adept war, schon drei Gruppen von Strauchdieben zum Verhängnis geworden.
Und die Zauberin genoss die Zurschaustellung von Macht und Magie.
Ebenso, wie sie es genoss, ihn hart zu betrafen, wenn er nicht spurte. Er hatte es sich daher angewöhnt, seine wahren Gefühle hinter einer Maske der Gleichmut zu verbergen. Ende des Monats, nach der Großen Weihe, aus der er als vollwertiger Zauberer hervorgehend würde, würde er eh eigene Wege gehen. Und dann würde er mit seiner Zaubermacht dazu beitragen, das Los seines Volkes zu verbessern. Bis dahin würde er die Zähne zusammenbeißen und durchhalten.
Natürlich war ihre Ankunft nicht unbemerkt geblieben. Aus Fenstern und Gassen schauten ihnen blasse Gestalten entgegen, deren Gesichter von einem harten arbeitsreichen Leben zeugten. Mägde, Handwerker, Tagelöhner. Der einzige Lichtblick, der sich ihnen hier trotz der aufziehenden Regenwolken in der Innenstadt bot, war die schroffe, majestätische Silhouette der Blauen Zinnen, die hinter den schiefen Dächern der Stadt aufragten. Ein Gebirge, mit dem das Schicksal der Stadt untrennbar verbunden war.
Die Vorfahren der heutigen Bürger Silbersteigs waren Sklaven gewesen, die in den Bergen Gold und Silber für die Drachen hatten abbauen müssen. Und sie waren geblieben, als die Drachen im Dritten Drachenkrieg vor etwas über 400 Jahren endgültig ausgerottet worden waren. Als freie Bürger, die hofften, durch das Edelmetall selbst zu Wohlstand zu gelangen. Einige Zeit war ihnen dies gelungen, doch inzwischen fand man kaum noch Gold und auch die Silberadern waren zunehmend erschöpft, obgleich die Bergleute immer tiefer und verzweifelter gruben. Kurz: die Stadt dämmerte dem Niedergang entgegen, nur wollte das hier niemand wahrhaben.
Umso härter traf die Bewohner die Mäuseplage, die den Ort schon seit Wochen heimsuchte. Man musste nicht lange suchen, um die frechen Nager zu finden. Sie tummelten sich überall in den Straßen und Gassen, wuselten auf Hinterhöfen herum, hüpften über Kellerstiegen und knabberten an Säcken und Kisten, die die Stadtbewohner leichtfertig hatten stehen lassen. Einen Nager erspähte Tandurin sogar direkt über sich, an einer der Wäscheleinen, die über die Straße gespannt waren.
Vor ihnen kam der große, kopfsteingepflasterte Marktplatz mit dem Brunnen in Sicht, dessen Blickfang das Rathaus mit den hohen Butzenglasfenstern war. Die Fassade des Gebäudes wurde von Balkonen geziert, außerdem befanden sich dort Nischen mit bunten Figuren aus der Stadtgeschichte, darunter Bergleute, Ratsherren, Krieger und – unmittelbar unter dem Giebel – Radulf aus den Blauen Zinnen.
Er war der größte Held der Stadt und die Ruhmestaten, die er im Dritten Drachenkrieg vollbracht hatte, lieferten den Bänkelsängern noch heute Stoff für Geschichten. Es hieß, dass er für den Tod des Drachen Wyrfeuer verantwortlich war, den er auf einzigartige Weise zum Zweikampf herausgefordert hatte: auf dem Rücken eines Gipfelalks.
Der Künstler der Skulptur hatte den berühmten Sohn der Stadt daher als Ritter mit Lanze auf dem Rücken eines dieser Riesenvögel dargestellt, die selbst schon lange ausgestorben waren.
Magistra Rotdrud interessierte sich weniger für die alten Legenden, sondern vielmehr für ein altes Kriegshorn, das Radulf angeblich mit Zauberkräften ausgestattet hatte. Seine Lehrmeisterin hatte Tandurin nicht verraten, welcher Art die Kräfte dieses Horns waren, doch seit sie von seinem Verbleib erfahren hatte, war sie wie besessen davon.
Bis heute hüteten es die Bürger dieser Stadt. Und die würden sich angesichts der legendären Abstammung des Blasinstruments keinesfalls freiwillig von ihm trennen. Magistra Rotdrud hatte daher beschlossen, das Horn durch Diebstahl an sich zu bringen, und es kümmerte sie nicht, dass das Artefakt in einer speziell versiegelten Schatzkammer im Obergeschoss des Rathauses verwahrt wurde.
Mit dem Gebäude hatte es eine eigentümliche Bewandtnis. Um die Schätze Silbersteigs zu schützen, hatten die Stadtgründer einst einen der Zauberer vom Orden der Stäbe dazu gebracht, einen Bann um das Rathaus zu ziehen. Die Schwelle konnten nur jene übertreten, die vom Stadtrat eine spezielle Einladung erhielten. Und das galt leider auch für Zauberer.
Der Hilferuf des Magistrats, der Stadt bei einer Mäuseplage beizustehen, war Magistra Rotdrud daher mehr als gelegen gekommen. Wie massiv die Plage jedoch ausfiel, war auch für Tandurin überraschend.
Vor den Treppen des Rathaus warteten bereits drei Vertreter des Stadtrates in vollem Ornat auf sie. Ihre prächtigen Schürzen erinnerten an Bergmannkittel, und ein jeder von ihnen trug vor der Brust ein silbernes, handtellergroßes Siegel mit dem Stadtwappen: ein Berggipfel, vor dem Lanze und Pickel gekreuzt waren.
»Es geht los«, murmelte die Magierin mit falschem Lächeln. »Betrachte deine heutige Aufgabe gewissermaßen als Gesellenprüfung.«
Tandurin seufzte innerlich und nickte.
Stadtdiener halfen ihnen beim Absteigen und sogleich kam der Mittlere der Männer auf sie zu. Er trug einen dichten Vollbart und verneigte sich höflich. »Magistra Rotdrud. Wir fühlen uns geehrt, dass Ihr unserer Bitte nachgekommen seid.«
»Oberster Ratsherr, es ist mir ebenfalls eine Ehre.« Huldvoll hielt die Magierin dem Mann ihre beringte Rechte hin, auf die dieser einen Kuss hauchte. »Die Probleme Eurer Stadt sind mehr als offensichtlich.«
»Ja, sind sie.« Der Bärtige sah sich gequält zum Rande des Marktplatzes um, wo sich längst ein Ring an Schaulustigen eingefunden hatte. Zwischen ihren Füßen waren hin und wieder huschende Schatten zu erahnen – und plötzlich dämmerte Tandurin, dass die Mäuseplage vielleicht nicht ganz zufällig über den Ort hereingebrochen war.
»Wir haben alle Ratschläge befolgt, die uns die hiesigen Ratten- und Mäusefänger genannt haben«, führte der Mann weiter aus. »Aber wir werden der Plage nicht Herr. Inzwischen bedrohen die Nager auch unsere Kornspeicher. Wir sind also etwas verzweifelt.«
»Nun, ich bin mir sicher, es wird Wege geben, um dem Problem beizukommen. Am besten, Ihr führt mich gleich ins Rathaus und gebt mir einen detaillierten Überblick, wo das Ungeziefer am schlimmsten wütet.«
»Ja, sicher … äh …« Der Mann beäugte misstrauisch die bunt geflochtenen Zöpfe, die Tandurins hageres Gesicht umrahmten. Mit seiner praktischen ledernen Reisekleidung unterschied er sich zwar nur wenig von anderen Reisenden, aber durch diese spezielle Haartracht war er unschwer als Angehöriger des fahrenden Volkes zu erkennen. Und eben das schien bei den Herren einen gewissen Argwohn zu wecken. Tandurin kannte solche Reaktionen von anderen Orten. Und so zwinkerte er dem obersten Ratsherrn frech zu.
»Und das ist?«, fragte der Mann die Magistra verschnupft.
»Mein Adept.«
»Ah, verstehe. Nun, ich befürchte, er wird hier draußen warten müssen.«
»Oberster Ratsherr, ich bitte Euch.« Magistra Rotdrud warf ihre Kaputze zurück, enthüllte ihr langes schwarzes Haar und verzog kummervoll ihre vollen Lippen. Sie war eine hübsche Frau. Und sie wusste das zu nutzen. »Wir haben eine lange Reise hinter uns. Die Unterredung führen wir selbstverständlich in aller Verschwiegenheit.« Sie nickte den übrigen Amtsmännern freundlich zu. »Aber es ist kühl geworden. Und ich denke, es ist ein Gebot der Höflichkeit, auch meinen Zögling nicht von Eurer Gastfreundschaft auszunehmen. Allzumal ich ihn vielleicht benötige.«
»Natürlich. Ja …« Der Mann warf seinen Kollegen einen gequälten Blick zu. »Euer Adept soll natürlich nicht im Kalten stehen.« Er trat beiseite und beschrieb eine einladende Geste in Richtung Eingang. »Seid willkommen! Für eine Stunde …«
Das erste Hindernis war genommen.
Magistra Rotdrud und Tandurin folgten den Ratsleuten über die Schwelle der großen Doppeltür ins Innere des Gebäudes. Sie gelangten in eine getäfelte Eingangshalle mit Ölgemälden einstiger Krieger und gewichtig dreinblickenden Ratsherren, aus der eine geschwungene Treppe hinauf ins Obergeschoss führte. Nahe der Treppe standen zwei Stadtwachen mit Lederharnischen und Schwertern.
Die Ratsherren führten seine Lehrmeisterin bereits die Treppe hinauf, als Tandurin eine vergitterte Nische bemerkte, in der eine Sammlung alter, schwarz angelaufener Waffen ausgestellt war. Speere mit Widerhaken, seltsam gebogene Sichelschwerter und Äxte mit Klingen wie Halbmonde.
»Ich sehe, Ihr erkennt sie?«, fragte ihn ein Ratsheer, der ebenfalls zurückgeblieben war. Ein Mann mit Backenbart und verständigem Blick.
Aufgeregt trat Tandurin an das Gitter heran. »Das sind Waffen der Gaale.«
»In der Tat. Radulf hat das Drachengezücht Zeit seines Lebens bekämpft.«
»Radulf hat gegen Gaale gekämpft?« Tandurin wandte sich dem Mann erstaunt zu. »Ich dachte, er habe damals bloß einen Drachen vom Himmel geholt?«
»Bloß?« Der Mann verzog belustigt die Lippen, wurde aber schnell wieder ernst. »Nein, er kämpfte damals sogar an vorderster Front gegen die Armee dieser Unholde. Angesichts seines Zweikampfes gegen den Lindwurm Wyrfeuer ist dies weniger bekannt. Bedauerlicherweise konnte auch er nicht verhindern, dass das Drachengezücht die Heimat Eures Volkes verheerte.« Er seufzte. »Die heutigen Aschetäler in den Fackelbergen, richtig? Wie man hört, sind die Hochebenen bis heute ein Ort der Ödnis und des Todes.«
»Ihr wisst davon?«
»Natürlich wissen wir davon. Auch unsere Vorfahren haben schwer unter den Drachen und ihren Heerscharen gelitten.«
Tandurin schenkte dem Ratsherrn einen traurigen Blick. Es gab nicht viele, die das Schicksal des fahrendes Volkes scherte. Umso mehr bedauerte er, dazu gezwungen zu sein, ihn zu hintergehen.
»Und nun kommt. Eure Lehrmeisterin erweckt nicht den Eindruck, eine geduldige Frau zu sein.«
Das war sie in der Tat nicht.
Tandurin folgte dem Ratsheren nach oben zu einer im Schatten liegenden Galerie, von der Türen und Gänge abzweigten. Von hier aus musste er irgendwie noch weiter nach oben gelangen, denn ihren Informationen zufolge lag der Zugang zur Schatzkammer im zweiten Stockwerk.
Die Wachen folgten ihnen. Eine bezog vor einer reich mit Bergwerkszenen verzierten Säule Aufstellung, die andere blieb auf der Mitte der Treppe zum Untergeschoss stehen.
Magistra Rotdrud wurde jetzt von den Ratsherren in eine Art Sitzungssaal geführt. Bevor sie verschwand, wandte sie sich ihm noch einmal zu. »Du bleibst hier, bis ich dich rufe. Kann etwas dauern.«
»Wie Ihr wünscht, Magistra.« Tandurin nickte ergeben und wartete, bis sich die Türen hinter den vieren geschlossen hatten.
Er trat an die hohen Butzenscheiben heran, durch die man hinaus auf den Marktplatz sehen konnte. Die Menge dort unten hatte sich verlaufen und die Wolken am Himmel sorgten dafür, dass es zunehmend dunkler wurde. Für sein Vorhaben war dies von Vorteil. Die Einladung ins Rathaus galt offenbar nur für eine Stunde, dann würde der magische Bann greifen, und Tandurin hatte nicht vor herauszufinden, wie sich dieser genau auf einen Missliebigen auswirkte. Von dieser einen Stunde waren bereits einige wertvolle Minuten verstrichen. Er musste sich also beeilen. Er kramte in seiner Umhängetasche nach einer Schreibkladde und gab vor zu lesen.
Als er sicher war, dass die Wache an der Säule das Interesse an ihm allmählich verlor, konzentrierte er sich auf die Macht, legte ein Abbild seiner Selbst um sich und trat dann mit einem raschen Schritt aus dem heraufbeschworenen Gaukelbild heraus, hinter eine zweite Säule. Die Illusion seiner Selbst stand weiterhin reglos da und flackerte nicht einmal.
Die Deckung der Säule nutzend, wirkte er einen chamäleonhaften Tarnzauber, der ihn mit dem Hintergrund verschmelzen ließ, schlich zu einer nahen Tür und schlüpfte ungesehen in ein Schreiberzimmer, das glücklicherweise leer stand. Sofort öffnete er die Fensterläden und betrat einen der Balkone, die er bei seiner Ankunft bemerkt hatte. Draußen regnete es mittlerweile leicht, was auch die letzten Silbersteiger ins Trockene getrieben hatte. Tandurin verknotete seine bunten Haarzöpfe am Hinterkopf, zog Handschuhe aus den Taschen seiner Jacke und fasste dann die Nischen an der Außenfassade ins Auge, in denen die bunten Figuren standen. Hoffentlich waren diese fest verankert.
Er erklomm die Brüstung, sprang – und packte einen Bergmann mit Hammer und Stemmeisen. Der Bergmann stand fest. Rasch hangelte sich Tandurin von dort zu einer weiteren Nische und hielt nur kurz inne, um zum Marktplatz hinabzuschielen. Niemand bemerkte ihn, obwohl er seinen Tarnzauber vor Anstrengung hatte abbrechen müssen. Allein eine vollgefressene Katze neben dem Brunnen stierte zu ihm empor.
Er und sein Bruder waren seit frühester Jugend als Artisten tätig gewesen. Und Magistra Rotdrud hatte in den sechs Jahren, seit sie ihn unter ihre Fittiche genommen hatte, dafür gesorgt, dass er nichts verlernte. Im Gegenteil: Sie hatte ihm überdies so manchen magischen Trick beigebracht, der es ihm gestattete, noch erfolgreicher auf Diebestour zu gehen. So dauerte es nicht lange, bis er einen der Balkone am gegenüberliegenden Flügel des Rathauses erreichte, der ein Stockwerk höher lag. Die Fenster des Raumes rechts des Balkons waren als einzige vergittert.
Das musste die Kammer sein, in der das Horn lag.
Rasch kramte Tandurin einen von drei Mistelzweigen hervor, die es ihm ermöglichten, jedes Schloss zu öffnen. Doch dann zögerte er. Keinesfalls durfte er diese magischen Hilfsmittel verschwenden.
Er brach die Tür daher mit dem Stemmeisen auf und gelangte in ein kahles, allein von einem mannshohen Berggemälde geziertes Balkonzimmer, von dem zwei Türen abgingen. Die eine führte vermutlich hinaus auf einen Gang, die andere, deutlich massivere, war mit zwei schweren Eisenbändern versehen. Hinter ihr lag die Schatzkammer des Ratshauses.
Er nahm wieder einen der Mistelzweige zur Hand, als er etwas Eigenartiges entdeckte. Er bemerkte es nur, weil das diffuse Licht hinter ihm schräg auf den Boden fiel. Die Dielen des Zimmers waren lediglich in einem schmalen Bereich ausgetreten. Von der Tür zum Gang bis hin … zum Gemälde.
Tandurin trat misstrauisch an das Bild, ruckelte daran und stellte fest, dass es sich nicht abnehmen ließ. Vielmehr war es fest in der Wand verankert. Er grinste. Fast wäre er auf eine Tricktür hereingefallen. Er ginge jede Wette ein, dass die Tür mit den Eisenbändern mit einem Alarm oder einer Falle ausgestattet war. Das Bild war die eigentliche Pforte.
Er berührte es mit dem Mistelzweig, der sofort in Rauch aufging, und mit einem Klicken klappte ihm das Gemälde entgegen. Unmittelbar dahinter führte eine schmale Steintreppe schräg hinunter in die Tiefe. Ihm blieb vielleicht noch eine knappe halbe Stunde. Er musste sich beeilen.
Tandurin beschwor eine Lichtkugel herauf und eilte die Stufen vorsichtig nach unten.
Er hätte sich denken können, dass ein Volk von Bergleuten seine Schätze nicht in luftiger Höhe, sondern irgendwo in der Tiefe versteckte. Etwas später stieß er abermals auf eine Tür mit Eisenbändern. Er seufzte. Noch eine Finte? Er musste es darauf ankommen lassen. Auch der zweite Mistelzweig verging zu Rauch, es klickte und rasselte – und knarrend öffnete sich auch diese Pforte.
Tandurin ließ die magische Lichtkugel emporsteigen – und ihm blieb angesichts all des Gleißens, dem er jetzt gegenüberstand, der Mund offen stehen.
Vor ihm erstrecke sich ein großes Gewölbe, das über und über mit Goldschmuck, Silberpokalen und -tellern, Juwelen, kostbarem Geschmeide und sogar einigen mit bunten Edelsteinen verzierten Büchern gefüllt war. Offenbar lagerten die Silbersteiger hier die Besitztümer anderer Adliger und reicher Kaufleute. Oder sie waren Räuber. Anders war die schiere Masse an Reichtümern hier unten kaum zu erklären. Und so schwer es ihm auch fiel, seinen Blick von all den Kostbarkeiten abzuwenden, sah er doch sofort, was er eigentlich suchte.
In einer Nische, ganz hinten im Gewölbe, erhob sich eine breiter, oben abgeplatteter Granitblock, in den ringsum silberne Zauberglyphen eingelassen waren. Über der Granitfläche lag eine unterarmhohe, silbrig blitzende Lichtsphäre, die gleich zwei Gegenstände wie eine Haube umschloss. Das eine war ein geschwungenes, fast armlanges Horn aus Drachengebein. Es war mit ledernen Bändern umwickelt und mit einem Trageband ausgestattet, mit dem es sich um den Hals hängen ließe. Tandurin hatte nicht den leisesten Zweifel, dass es das gesuchte Instrument war. Direkt daneben lag ein schlichtes ovales Amulett aus Gold – und auch in dieses waren Zaubersymbole eingeritzt.
Tandurin trat an den Granitblock heran und wollte nach dem Horn greifen, zögerte jedoch. Dann nahm er sein Stemmeisen zur Hand, um das Horn zu sich zu schieben. Doch kaum berührte das Eisen die Lichtsphäre, zischte es und das Metall verbrannte rückstandslos in einem grellen weißen Feuer. Entsetzt riss Tandurin das Eisen zurück und blinzelte. Sein Einbruchswerkzeug war bei dem Vorgang nicht einmal heiß geworden. Doch er begriff sofort, was passiert wäre, hätte er unbedacht seine Finger in die verdammte Sphäre geschoben.
Was jetzt? Er sah sich um und probierte es mit einer wertvollen silbernen Spange, dann mit einem reich ornamentierten Holzlöffel. Alle Objekte verbrannten sofort in dem weißen Feuer.
Ein Schwebezauber? Er beherrschte keinen. Vielleicht ein magisches Passwort? Doch wie sollte er das je herausfinden? Tandurin wurde zunehmend verzweifelt. Er konnte hier höchstens noch einige Minuten verbleiben, dann musste er zurück. Die Zeit rannte ihm davon. Was hatte ihm die Magistra eingeschärft? Schutzsigillen besaßen Lücken. Nur vernichtete die von ihnen erzeugte Sphäre einfach alles, was in sie hineingeschoben wurde.
Wirklich alles?
Tandurin musterte die beiden Gegenstände im Innern genauer. Was, wenn das, was es umhüllte, davon ausgenommen war? Drachenknochen? Hier unten lagen keine weiteren Gegenstände aus dem kostbaren Material. Granit? Wie sollte er einen hinreichend langen Brocken aus dem Gestein finden? Es blieb also das Leder des Tragebands. Tandurin nahm seinen Gürtel ab und tauchte eines seiner Enden in das Licht.
Er hätte vor Freude schreien mögen, denn es geschah … nichts.
Der Gürtel war zu weich und elastisch, um damit etwas zu verschieben. Dann anders. Er führte den Gürtel wie eine Peitsche und hieb damit vorsichtig nach dem Horn. Mit jedem Schlag rutschte es ein Stück weiter über die Granitfläche nach hinten, bis das Mundstück endlich aus der Lichtsphäre herausragte. Der Rest war schlichtes Geschick.
Tandurin verstaute seine Beute in der Umhängetasche, dann machte er, dass er aus dem Gewölbe herauskam und wieder nach oben gelangte.
Er hatte längst jedes Zeitgefühl verloren. Dennoch schloss er sorgsam die Gemäldetür hinter sich, kraxelte über den Balkon zurück zum gegenüberliegenden Flügel des Rathauses und erreichte die Galerie mit seinem illusionären Ebenbild in dem Moment, als sich die Tür des Besprechungssaals öffnete und Magistra Rotdrud in Begleitung der drei Ratsherren heraustrat. Tandurin nutzte die kurze Ablenkung der Wache, um die llusion seiner Selbst aufzulösen, arglos vorzutreten und die Schar nach unten, vor die Stufen des Rathauses zu begleiten, wo sich die ehrwürdigen Herren euphorisch von der schönen Zauberin verabschiedeten. Niemand hatte Augen für die leicht durchfeuchtete Kleidung ihres Adepten. Und niemand bemerkte sein erhitztes Gesicht.
Tandurin war froh, als sie endlich in Richtung Stadtor ritten.
»Und, hast du, was ich dich zu besorgen beauftragt hatte?«, fragte die Magierin.
Tandurin reichte ihr wortlos die Tasche und sie spähte hinein. Zufrieden lächelte sie. »Gut gemacht. Gesellenstück bestanden.« Sie spornte ihren Rappen an und ritt voraus.
Eine betrogene Betrügerin.
Denn da war auch noch das zweite Objekt.
Tandurin berührte grinsend das goldene Amulett in seinem Rockschoß und ritt ihr nach.
Dania
Das Baldachinbett knarrte rhythmisch in der alten Kemenate und Dania biss die Zähne zusammen. Ganz so, wie es Meister Goltar liebte, lag sie bäuchlings und mit den Händen magisch an den Bettpfosten gefesselt auf der alten Matratze, während er zwischen ihre Schenkel drängte und sie pfählte, wie er es nannte. Der Magier keuchte und schnaubte wie ein altersmüder Ackergaul, während er sie von hinten nahm und trotz seiner Fettleibigkeit versuchte ihre Brüste zu umfassen. Es gelang ihm nicht.
»Los, du kleines Flittchen, konzentriere dich«, stöhnte er, während er sein Tempo steigerte. »Dein kleiner Hurenzauber fängt an nachzulassen.«
Dania versuchte sich auf das Trugbild zu konzentrieren, das sie ihm schon seit einer halben Stunde vorgaukelte. Die Illusion eines unschuldigen jungen Elfenmädchens, wie sie es auf einem alten Gemälde in dem Bordell in Kesselfurt erblickt hatte, aus dem Goltar vom Grauwald sie ausgelöst hatte.
»Ja, ja, ja …« Begeistert steigerte der Zauberer sein Tempo. »Du dreckige Elfendirne, Meister Goltar besorgt es dir jetzt gründlich!« Dann, endlich, röhrte er auf und kam in ihr. Im nächsten Moment sank er erschöpft auf Dania nieder und drückte sie mit seinem ganzen Gewicht in die Matratze.
Dania wurde schlecht, denn jetzt stieg ihr der säuerliche Geruch seines Schweißes in die Nase, den auch das schwere süßliche Parfum nicht überdecken konnte, mit dem er sich eingenebelt hatte.
»Meister, Ihr erdrückt mich«, klagte sie.
Der fette Zauberer murmelte etwas Unverständliches und rollte sich von ihrem geschundenen Leib herunter. Mit einiger Verzögerung löste er die magischen Fesseln und blieb schweratmend neben ihr liegen.
»Du bist wirklich das beste Stück Weib, das ich je hatte. Und glaube mir, ich hatte viele Weiber. Sehr viele.«
»Ein Mädchen wie ich merkt, wenn sie es mit einem erfahrenen Liebhaber zu tun hat«, schmeichelte ihm Dania gewohnheitsmäßig und richtete sich gequält auf. Ihr Schoß brannte und ihr Hinterteil war derart mit roten Striemen bedeckt, dass jede Bewegung schmerzte.
»Genug Erfahrung hast du ja, um das zu beurteilen.« Goltar vom Grauwald lag wie ein rosafarbenes Hausschwein neben ihr und lachte dreckig. Das fettige rote Haar klebte ihm schweißnass über der Stirn, und Dania stellte einmal mehr fest, dass es keine Region an seinem teigig-blassen Körper gab, die nicht abstoßend war. Angefangen bei dem feisten Gesicht, über die speckigen Lippen bis hin zu der wabbeligen, weit überhängenden Wampe.
Er grinste beim Anblick ihres mit Striemen übersäten Hinterteils. »Aber ich muss zugeben, dass ich heute gut in Form war.« Er ließ sich wieder zurückfallen. »Was für ein Glück, dass du vom besten Heilmagier des Landes bestiegen wirst. Ich hab dir ja beigebracht, wie du solche Wunden beseitigst.«
»Ja, habt Ihr, Meister.«
Erschöpft von dem Zauber, mit dem sie Goltar die Sinne vernebelt hatte, und darauf bedacht, die beanspruchten Körperregionen nicht zu belasten, verließ sie das Baldachinbett und humpelte am alten Kamin vorbei in Richtung des Erkers, wo sie den großen Waschzuber und die Heilsalben bereitgestellt hatte. Zunächst konzentrierte sie sich auf den Heilzauber, den Goltar sie gelehrt hatte. Wärme durchströmte ihren Unterleib und die Schmerzen verebbten fast unverzüglich. Dann stieg sie in den Zuber, griff zur Wasserkanne und wusch sich ausgiebig Goltars Säfte vom Leib. Am liebsten hätte sie sich mit Siebenbrückener Seife abgeschrubbt, doch um den Ekel loszuwerden, würde nicht einmal ein Bad im Großen Fluss genügen. Für den Moment reichte es, dass sie seinen Gestank loswurde. All das würde eh bald enden.
»Eigentlich traurig«, schwadronierte der Zauberer drüben im Bett. »Trotz meiner langen Erfahrung habe ich bis heute nicht herausfinden können, wie du das hinkriegst. Also mich vergessen zu lassen, wie gewöhnlich du eigentlich bist.«
»Ihr sagtet es doch selbst.« Dania erhob sich, um sich abzutrocknen. »Ich bin eine Wilde.«
»Oh ja, das bist du.« Ihr fetter Meister stemmte sich schwerfällig in die Höhe, griff nach einem Tuch und wischte sich den Schweiß von der fleischigen Stirn. Dann zog er sein grünes protziges, mit arkanen Glyphen besticktes Zaubergewand zu sich.
Goltar vom Grauwald war trotz oder vielleicht gerade wegen seiner enormen Körperfülle ein eitler Geck, der viel Wert auf kostbare Kleider legte. Für seine Gewänder gab er ein kleines Vermögen bei den Schneidern in den großen Städten aus. Gold besaß er genug, doch in seinem Haushalt, einem heruntergekommenen Rittergut inmitten des weitläufigen Grauwaldes, geizte er. Schon seiner Vergnügungssucht wegen hielt er sich hier nur auf, wenn er neue Elixiere und Heiltinkturen herstellte. Bewirtschaftet wurde das Gut in der Zwischenzeit von einem unterwürfigen Verwalterehepaar aus dem nahen Dorf, deren drei Töchter Goltar ebenfalls nach Belieben hernahm.
»Dennoch«, fuhr Goltar vom Grauwald fort, während er sich in die kostbare Magierrobe zwängte, »deine außergewöhnliche kleine Gabe muss sich doch irgendwie in eine Formel pressen lassen? Ich habe schon Königinnen und Prinzessinnen gehabt, aber selbst der Spaß, sich eine dieser Blaublütigen vorzunehmen, verblasst dagegen.«
»Ihr schmeichelt mir, Meister.« Dania drehte ihm den Rücken zu, während sie ihr einfaches braunes Bauernkleid überstreifte. Der Kerl widerte sie an. Sie wusste nur zu gut, wie sich der Fettsack seine arkanen Dienste als Heiler am liebsten bezahlen ließ. Vor Krankheiten und Seuchen war nicht einmal der Adel gefeit, und wo die herkömmliche Medizin versagte und die Lage besonders verzweifelt war, da ließen sich auch hochwohlgeborene Damen überreden.
Dania hatte wenig Mitleid mit ihnen.
Da draußen in den Jungen Königreichen gab es Tausende Mädchen wie sie, die sich für einen Kanten Brot prostituieren mussten. Wenn es mal eins dieser arroganten reichen Weiber traf, dann war das nur gerecht. Als Tochter armer Tagelöhner aus der Vagantenstadt Kesselfurt war sie schon ihr ganzes Leben lang männlicher Willkür ausgesetzt. Mit zwölf Jahren hatten ihre Eltern sie und ihre Zwillingsschwester Vala an ein Bordell im ewig dunklen Stadtviertel unterhalb des großen Kataraktes der Stadt verkauft. Dorthin, wo es immer kalt und feucht war und die ärgsten Schlägerbanden der Stadt regierten. Zahllose Männer hatten sich dort an ihnen vergangen. Schmutzige und derbe Männer. Männer ohne Bildung, von denen viele selbst nicht wussten, wie sie den kommenden Tag überstehen sollten. Viele Mädchen aus dem Bordell waren schon lange nicht mehr am Leben. Gestorben an Geschlechtskrankheiten, Auszehrung und nackter Gewalt.
Ihr Schicksal wäre vermutlich ähnlich verlaufen, wenn sich bei ihr und ihrer Schwester nicht die Gabe gezeigt hätte. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen war es ihnen möglich gewesen, die Sinne ihrer Freier derart zu vernebeln, dass diese mit ihnen besonders zufrieden waren. Vala hatte die Gabe zuerst entdeckt und sie Dania beigebracht. Doch im Gegensatz zu ihrer Schwester, die es sogar schaffte, dass sich die Freier nur noch mit einem Gaukelbild ihrer Lust vergnügten, brachte es Dania lediglich fertig, ihren eigenen Leib mit einem trügerischen Abbild zu überziehen.
Natürlich hatten die Bordellbesitzer die Gabe rasch in klingende Münze umgesetzt und beide irgendwann nur noch an solvente Kunden verkauft, wodurch vor zweieinhalb Jahren Meister Goltar auf Dania aufmerksam geworden war.
Zu jenem Zeitpunkt war nur noch sie im Geschäft gewesen. Ihre Schwester hatte sich in dem schrecklichen, nasskalten Klima unterhalb des ewigen Wasserschleiers Alt-Kesselfurts am Ende doch mit einer Sieche infiziert, die sie zunehmend auszehrte, die Haut dünn und die Haare fahl werden ließ. Ihre Besitzer hatten zunächst alles dafür getan, um ihr bestes Pferdchen im Stall wieder aufzupäppeln, doch die Mühen waren umsonst gewesen. Valas Gestalt glich zunehmend einer jener abgehalfterten Straßendirnen Kesselfurts, die in den Gassen dahinvegetierten und ihren halben Hurenlohn für Rauschpilze ausgaben, um ihr Elend erträglicher zu machen. Aus Angst sich anzustecken, hatten die Bordellbetreiber sie schließlich auf die Straße geworfen. Vala hauste vermutlich noch heute in einer armseligen Unterkunft und hoffte auf ein Wunder.
Dania hatte beschlossen, ihr dieses Wunder zu ermöglichen. Denn niemals würde sie ihre geliebte Schwester aufgeben.
Bei diesem Gedanken trat Dania energisch vor den prachtvoll mit mythischen Wesen umrankten Raumspiegel und steckte sich das feuchte Haar mit einem Holzstift zusammen. Die zurückliegenen Jahre hatten auch sie gezeichnet. Früher war sie mit ihrer schlanken Figur, der Stupsnase und den großen braunen Augen vermutlich hübsch gewesen, doch ihre Züge waren längst hart geworden und ihre Brüste begannen bereits ihre Straffheit zu verlieren. Auch sonst war an ihr nichts Kindliches mehr. Niemand würde ihr die siebzehn Lenze abnehmen. Die Augen ihres schmalen Gesichts waren leicht eingesunken und bildeten Schatten, die sie mit schwarzem Kohl-Pulver zu ihrem Vorteil zu verändern wusste. Ihre langen schwarzen Haare ergrauten frühzeitig. Sie wirkte mindestens zehn Jahre älter, was in ihrem Gewerbe das Zeichen für den baldigen Abstieg war. Nur war sie jetzt keine Hure mehr. Zumindest keine gewöhnliche.
Sie war eine Adeptin.
Und in wenigen Tagen sogar eine richtige Zauberin – auch wenn Goltars Unterweisungen in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren lausig gewesen waren. Wollte sie, dass er ihr etwas von Wert beibrachte, dann musste sie das mit Schmeicheleien und sexuellen Gefälligkeiten einfordern. Dabei war es gerade seine spezielle Kunst, auf die sie setzte. Die Heilmagie.
Mit diesen Fähigkeiten wollte sie nach Kesselfurt zurückkehren, um Vala zu heilen. Und wenn sie hier nicht finden würde, was sie für ihre Heilung benötigte, dann vielleicht bei jenen Zauberern, die sie schon bald bei ihrer Großen Weihe traf. Gelehrte Männer.
Alle Männer hatten Begierden. Und Dania besaß die Mittel, um diese Begierden zu stillen.
»Fast bedauere ich es, künftig auf dich verzichten zu müssen«, murmelte Goltar ungewöhnlich ernst. »Du wirst schwer zu ersetzen sein.«
Dania zwang sich zu jenem koketten Augenaufschlag, mit dem sie die Männer üblicherweise umgarnte, und die Lüge kam ihr glatt über die Lippen. »Selbst nach meiner Weihe werde ich Euch sicher häufig besuchen kommen, um weiter von Eurem Wissen zu profitieren.«
Goltar stierte sie eine Weile schweigend an, dann kippte er sich den Inhalt eines Weinpokals in den Rachen, der auf einer alten Kommode stand.
»Wir werden sehen«, grunzte er. »Auf jeden Fall werden wir heute Abend noch einmal Spaß haben.« Schmierig grinsend fasste er sich erst an den Schritt und dann an den weit überhängenden Bauch. »Jetzt habe ich Hunger. Geh in die Küche und sieh nach, ob das Essen fertig ist. Anschließend überprüfe, ob Vicor die Kutsche repariert hat. Für die Reise hinauf ins Fackelgebirge benötigen wir mindestens zwei Wochen.«
Froh, endlich aus dem Zimmer herauszukommen, eilte Dania die Treppe hinab ins Untergeschoss, betrat den gepflasterten Innenhof des Ritterguts und genoß die frische Luft, die ihr entgegenwehte. Hühner gackerten und es roch nach Pferdemist. Die Sonne war bereits hinter den windschiefen Anbauten der alten Burg untergegangen und beleuchtete die Wolken am Himmel mit ihrem roten Schein. Sie wirkten wie in Blut getaucht. Kurz betrachtete Dania die Mauern und Flügelbauten der alten Burg, die bis hinauf zu den Fenstern dicht mit Efeu bewachsen waren, und entschied, den Stall auszulassen. Vicor befolgte eh stoisch jede von Goltars Weisungen. Er nahm es ja sogar hin, dass sich der fette Magier an den Frauen seiner Familie vergriff.
Stattdessen ging sie hinüber zur Burgküche, von wo ihr der Geruch von gebratenen Hähnchen, köchelnden Suppen und frisch gebackenem Apfelkuchen entgegenwehte. Ihr lief das Wasser im Munde zusammen. Als sie die Küche betrat, verstummten Vicors dralle Frau und deren drei Töchter, die soeben Platten mit Fleisch, Beilagen und Süßspeisen belegten.
»Er hat Hunger. Beeilt euch besser!«
»Ja, Adeptin«, antwortete Lenne, die jüngste und hübscheste von ihnen.
»Und vergiss nicht, ihm seinen … Wein zu kredenzen.« Dania deutete abfällig zu einem Regal, auf dem mehrere verkorkte Flaschen lagen.
»Ganz sicher nicht.« Die junge Frau hob eine Braue, und die Frauen warfen Dania dankbare Blicke zu. Tatsächlich war es Danias Idee gewesen, den Gewürzwein mit Schlafpulver zu versetzen, das den genusssüchtigen Zauberer stets für eine ganze Nacht außer Gefecht setzte. In dieser Zeit hatten sie alle Ruhe vor ihm. Dania griff nach einigen Stücken Bratfleisch und schlang sie hinunter. Jetzt galt es, ihr eigentliches Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Sie verließ den Küchentrakt und eilte zu dem windschiefen und ebenfalls von Efeu umrankten Torhaus der Burg mit dem schlanken Glockenturm. Dort schloss sie eine Tür auf, spähte vorsichtig hinüber zum Rittersaal, in dem Goltar gleich sein Essen in sich hineinschlingen würde, und betrat eine Kellerflucht, in der es leicht nach Schimmel roch. Sie entzündete mit Feuerstein und Zunder ein Talglicht und folgte im Schein der Lampe den ausgetretenen Stufen in die Tiefe. Die Luft wurde rasch kühler. Wenig später stand sie in einem Gang, von dem aus mehrere große Gewölbe abzweigten. Die großzügig angelegten Kellerräume der Burg dienten als Speicher für Nahrungsmittel und Baumaterialien, doch Danias Ziel lag hinter einer dicken Tür mit drei rostigen Eisenbändern am Ende des Ganges, auf denen neben verschnörkelten Zauberrunen grässliche, mit Zähnen und langen Zungen versehene Dämonenfratzen prangten. Jedes der Bänder war mit einem dicken Schloss gesichert. Hinter der Tür lag Goltars alchimistisches Laboratorium.
Dort braute er seine Arzneien, Zaubertinkturen und Wunderelixiere zusammen. Die Fratzen dienten der Abschreckung, und Goltar hatte Dania, als sie zum ersten Mal hier unten gewesen waren, davor gewarnt, die Tür je ohne ihn zu öffnen, da sie dann fürchterliche magische Sicherungen auslösen würde.
Inzwischen wusste sie, dass das Mumpitz war. Die Schutzzauber mochten vielleicht einst existiert haben, doch sie waren lange ausgebrannt. Goltar hatte das Rittergut und alles, was darauf war, von seinem eigenen Lehrmeister geerbt – dem vormaligen Meister vom Grauwald. Dania war dahintergekommen, weil sie in einem versteckten Raum der Burg verstaubte Zaubergewänder und andere Kleidungsstücke entdeckt hatte, die unmöglich zu Goltars Statur passten. Daraufhin hatte sie so lange die Frauen der Verwalterfamilie ausgequetscht, bis diese erzählten, dass ihre Vorfahren noch vor etwa einundeinhalb Jahrhunderten einem anderen Meister vom Grauwald gedient hatten. Einem Magier, der sogar das Ende des Dritten Drachenkrieges vor 420 Jahren und damit den Aufstieg der Jungen Königreiche miterlebt hatte. Goltar hatte verboten, über ihn zu sprechen, denn der einstige Herr der Burg war während einer seiner magischen Beschwörungen oben auf dem Bergfried von einem Blitz erschlagen worden. Die Burg hatte daraufhin Besuch von einer Gruppe anderer Zauberer erhalten, die dessen Lehrling mitgenommen hatte – und das war Goltar gewesen. Mehrere Monate später brachten sie ihn wieder zurück, und seitdem hatte er hier das Sagen und spielte sich auf, als habe er hier schon immer gelebt. Wenn Dania den Berichten traute, war sie sein zweiter Lehrling. Vor 60 Jahren hatte es offenbar schon einmal einen jungen Mann gegeben, den er unterrichtet hatte.
Dania hätte zu gern gewusst, was aus ihm geworden war.
Die drei Schlüssel, die man für die Tür benötigte, hatte sie dem schlaftrunkenen Goltar eines Nachts abgenommen und beim Schmied in einer nahen Ortschaft nachmachen lassen. Wann immer Goltar auf Reisen war, nutzte sie die Zeit, um in dem alten Labor ihr eigenes Wissen zu mehren.
Dania fischte die drei Nachschlüssel unter einem nahebei stehenden Fass hervor und öffnete die Tür. Vor ihr lag ein Gewölbe, von dessen Decke getrocknete Kräuter baumelten, die den Raum mit einem aromatischen Geruch erfüllten. Die Wände waren voller Nischen für unzählige alchimistische Bücher, Flaschen, Dosen und Schachteln. Darunter standen dickbauchige Gefäße mit gelblich-klaren Flüssigkeiten, in denen Dinge wie Rabenaugen, die Finger Gehenkter und Katzenpfoten eingelegt waren. Auf langen Tischen davor standen und lagen Brenner, Glaskolben, Retorten und Keramikschalen. Hier unten gab es auch einen Ofen.
Danias Herz klopfte vor Genugtuung, wie immer wenn sie verbotenerweise das Gewölbe betrat. Gern hätte sie auch heute einige der mit bunten Abbildungen versehenen Bücher studiert. Die meisten waren ihr unverständlich, da sie in Elfenschrift abgefasst waren. Doch jene, die sie dank eines solventen Freiers, der ihr das Lesen beigebracht hatte, verstand, hatte sie umso eifriger studiert. Zauber beherrschte sie nicht viele, aber sie hatte in der Zeit, seit sie hier lebte, ein gutes Verständnis für die Zubereitung magischer Heilmittel entwickelt. Dies war das einzige Gebiet, auf das Goltar während seiner Ausbildung Wert legte. Ihm kam es offenbar gelegen, wenn sie gewisse Sachen für ihn vorbereitete, die er sonst selbst hätte aufwändig herstellen müssen. Doch die Rezepturen seiner besten Heiltoniken hütete er eifersüchtig. Dabei war sie seinem größten Geheimnis längst auf die Spur gekommen.
Und das rein zufällig. Beim Saubermachen. Nachdem ihr während einer ihrer heimlichen Aktivitäten hier unten eine Tonschale mit Schweinegalle umgekippt war.
Dania eilte an den langen Tischen mit den Glasgeräten vorbei und blieb schließlich neben dem Ofen stehen. Rasch räumte sie einen Schemel beiseite, beäugte die steinernen Bodenplatten und wischte in einer eingeübten Bewegung über die Fliesen. Unvermittelt wurden diese transparent und vor ihr erschien eine massive Bodenluke aus Holz samt Zugring. Sie zog die Luke kurzerhand auf und betrat die knarrenden Holzstiegen, über die man in ein tiefer liegendes Gewölbe gelangte.
Schlagartig sank die Temperatur und ihr Atem wurde zu kleinen Wölkchen. Doch trotz der Kälte faszinierte sie der Anblick dessen, was sie hier unten erwartete, immer wieder aufs Neue. Denn inmitten des Geheimgewölbes, ruhend auf einem riesigen Dreifuß aus Gusseisen, thronte ein gewaltiges … Drachenei.
Es reichte ihr bis zur Brust. Die dicke Außenschale war seltsam verkrustet und besaß einen Stich ins Bräunliche. Das mochte daran liegen, dass es seit mindestens 420 Jahren hier unten ruhte, denn so lange lag die Ausrottung der Drachen zurück. Aus diesem Ei würde kein neuer Drache entspringen, denn das obere Drittel der Schale war schon vor Langem aufgebrochen worden, um an den Inhalt zu gelangen. Diesen hatte die Kälte – oder die Magie, die hier unten wirkte – bis heute konserviert. Dania trat bewundernd an das gewaltige Objekt heran und spähte über den Rand der dicken Kalkschale auf einen etwa knietiefen Rest weißlichen Dotters sowie Überbleibseln von Eigelb.
An den Überresten der Drachen galt fast alles als magisch. Alchimisten, Kunsthandwerker und Schmiede zahlten viel Gold, um an Schuppen, Zähne und Drachengebein heranzukommen. Der Inhalt von Dracheneiern galt gewissermaßen als die Königszutat der Alchimie. Es potenzierte die Heilwirkung aller Arzneien, verstärkte Elixiere – und verwandelte schleichende Gifte in heimtückische Substanzen, die einen Menschen im Handumdrehen umzubringen vermochten.
Oben auf dem Burghof, nahe dem Hühnerstall, wuchsen Purpurhäublinge. Geschmacklose Giftpilze, die für Ratten tödlich waren und Menschen schwere Krämpfe bescherten. Gefährlich wurden sie, wenn man sie mit Alkohol zu sich nahm. In der Kombination mit Drachenei jedoch sollte daraus ein derart hoch potentes Gift entstehen, dass nicht einmal mehr Goltar Zeit bliebe, dagegen mit seiner Heilzauberei anzugehen.
Dania würde das Gift in seinen geliebten Gewürzwein mischen und die Flasche in der Küche deponieren. Sie wusste, dass er gleich nach seiner Rückkehr von der Großen Weihe, in der sie zur Zauberin erhoben werden würde, ein großes Mahl zelebrieren würde.
Nach seinem Tod würde sie auf der Burg Einzug halten, ihn beerben und alle Geheimnisse erforschen, die er bislang vor ihr verborgen gehalten hatte. Geheimnisse, die sie dazu nutzen würde, nach einem Heilmittel für ihre Schwester zu forschen.
Denn dann war sie die neue Meisterin von Grauwald.
Geron
Der Hieb kam völlig unerwartet. Die Klinge aus nachtblauem Waldalether Stahl fegte Gerons Schwertarm beiseite, dann folgte ein brutaler Tritt gegen seinen Brustharnisch, der ihn stolpern ließ und bis zur Turmzinne zurücktrieb. Hart schlug er mit dem Rücken gegen das Gestein. Rasch stieß er das Schwert nach vorn, um zu verhindern, dass seine Gegnerin nachsetzte. Doch die narrte ihn ein weiteres Mal. Mit einer Drehung wich sie dem Stich aus, deutete einen Hieb gegen seine Brust an, um dann ihr Schwert über den Kopf zu reißen und ihm die Klinge mit einer schnellen Drehung des Unterarms gegen den Helm zu prellen. Es schepperte laut, Gerons Kopf flog zur Seite, und er ging mit dröhnendem Schädel zu Boden. Schon stand seine Kontrahentin über ihm und schlug ihm das Schwert aus der Hand, das mit kratzendem Geräusch hinüber zur Turmluke schlitterte. Geron spürte die Spitze der gegnerischen Klinge an seiner Kehle.
»Besiegt, Brüderchen!« Shira lachte unter ihrem Helm.
Geron packte ihre Klinge mit seinem Panzerhandschuh und konzentrierte sich auf die Macht. Sogleich glühte das Metall der Waffe bis zum Griff rot auf. Seine Schwester stieß einen Schmerzenschrei aus und ließ das sengend heiße Schwert los. Klirrend fiel auch ihre Waffe zu Boden, wo sie rasch abkühlte.
»Magie! Das ist unfair!«
»Jeder eben so, wie er kann.« Das Grinsen verging ihm, als er bemerkte, dass der Zauber auch seinen Panzerhandschuh derart erhitzt hatte, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als diesen abzustreifen und zu Boden zu schleudern. Fluchend starrte er die Brandblasen an seinen Fingern an.
»Wirklich beeindruckend.« Shira löste belustigt die Gurte ihres Helms, zog ihn vom Kopf, und schweißnasses, dunkles Haar fiel bis auf den Stoßkragen ihrer Rüstung. Der Wind, der schräg hinter ihnen die gelb-grüne Fahne Waldaleths mit den Königswappen – einer Krone, umrahmt von zwei weißen Pferdeköpfen – zum Flattern brachte, hob die Strähnen leicht an und ermöglichte Geron so den Blick auf ein ausdrucksstarkes schmales Gesicht mit energischem Kinn und dunklen, spöttisch dreinblickenden braunen Augen. Leicht wäre es als Ebenbild seiner Selbst durchgegangen, nur dass sein Gesicht etwas breiter war und Shira an Oberlippe und Kinn keinen Bart trug.
Sie hatten sich schon immer ähnlich gesehen. Daran hatten auch die letzten fünf Jahre seiner Abwesenheit nichts verändert. Doch aus seiner drei Jahre jüngeren Schwester war inzwischen eine gut aussehende junge Frau geworden. Und eine verdammt gute Kämpferin.
Geron erhob sich ächzend, lockerte die durch die Rüstung verspannte Muskulatur und nahm ebenfalls den Helm ab. Auch ihm fiel das dunkle Haar bis auf die Schulterplatten. Missmutig rieb er sich die schmerzende Stelle am Kopf. »Ich gebe zu, deine artistische Einlage eben war nicht von schlechten Eltern.«
»Du hingegen scheinst während deiner Zeit als Zauberlehrling vieles verlernt zu haben.« Seine Schwester schüttelte mitleidlos den Kopf, bevor sie ihre Waffe vom Boden auflas.
»Es heißt Adept und nicht Zauberlehrling«, erklärte Geron gereizt. »Herzogin Alruna von Greifenfels setzt bei ihrer arkanen Ausbildung eben andere Schwerpunkte.«
»Und dann passiert dir so was?« Shira schob ihre Klinge ins Schwertgehänge zurück und deutete auf die Brandblasen an seinen Fingern. »Was nützt dir die Zauberei, wenn du dich mit ihr am Ende bloß selbst verletzt?« Sie lachte auf. »Und jetzt sag schon: Was hast du noch drauf? Kannst du dich unsichtbar machen? Ein Unwetter herbeihexen? Oder eine Mauer zum Einsturz bringen?«
»Nein, kann ich nicht. Noch nicht.« Zerknirscht hob Geron Schwert und Handschuh auf, trat vor die Turmzinnen und blickte auf die unter ihm liegenden Anbauten, Arkaden und Innenhöfe des Königspalastes.
Die Weiße Burg seiner Familie thronte auf einem Hügel über der Stadt und beeindruckte bereits aus der Ferne. Das lag nicht nur an der einzigartigen Architektur der wehrhaften Anlage, die so wirkte, als habe ein Maler eine Phantasie aus luftig wirkenden Türmen und Erkern mit leichter Hand in die Wirklichkeit versetzt, sondern auch an den Außenfassaden, die allesamt mit weißem Marmor verkleidet waren. Eindrucksvoll brach sich auf ihnen das Licht der Mittagssonne.
Geron hatte den vertrauten Anblick in den Jahren seiner Abwesenheit vermisst. Die verspielten Blattornamente an den Fenstergiebeln und Simsen erinnerten an die Blütezeit der Elfen und damit an die weit zurückreichende Geschichte des Königreichs. Die Annalen berichteten, dass das stolze Volk der Wälder und Auen nach dem Ersten Drachenkrieg vor gut 1000 Jahren selbst am Bau der Burg mitgewirkt hatte, um den versprengten Menschen des Nordens eine Heimat zu schaffen. Auch heute mochten sich allenfalls die reichen Stadtstaaten im Süden mit der Schönheit seiner Heimat messen. Zumindest, soweit Geron wusste. Selbst bereist hatte er die Küste noch nicht.
»Aber du wirst es nach dieser Zauberweihe in wenigen Tagen können?« Shira trat neben ihn und beäugte ihn neugierig.
»Na, ich hoffe es doch.« Geron versuchte selbstbewusster zu klingen, als er sich fühlte. »In den letzten Jahren ging es eher darum, meinen Geist und Verstand für den Gebrauch der Zaubermacht zu öffnen. Unmittelbar nach der Großen Weihe, wenn ich formell zum Zauberer erhoben werde, erhalte ich dann mein eigenes Zauberbuch. Und damit verrate ich dir gerade Geheimnisse, über die ich eigentlich nicht sprechen darf.«
»Sieh an!« Shira musterte ihn beeindruckt.
Geron mied ihren Blick, denn in Wahrheit war er ein lausiger Magier. Die Zauber, die er nach all den Jahren sicher beherrschte, konnte er an einer Hand abzählen. Selbst der kleine Trick von eben beruhte auf reiner Improvisation. Der Zauber diente eigentlich dazu, die Schmelztiegel im Laboratorium der Herzogin zu erhitzen. So, wie er die letzten fünf Jahre überhaupt mehr damit zugebracht hatte, seiner Lehrmeisterin bei ihren langweiligen alchimistischen Versuchen zur Hand zu gehen, als die Zauberei zu studieren.
Dabei hatte er das Angebot der Magierin, ihn zu unterrichten, als diese vor etwas mehr als fünf Jahren auf seine magische Begabung aufmerksam geworden war, begeistert angenommen. Magie! Das bedeutete nichts Geringeres, als dazu fähig zu sein, die Welt aus den Angeln zu heben.
Heute hörte man zwar kaum noch von Zauberern und ihrem Wirken, aber er erinnerte sich noch gut daran, wie er in seiner Kindheit fasziniert den alten Legenden um Drachenjäger, Elfen und Zauberer gelauscht hatte. Etwa um Radulf aus den Blauen Zinnen, Gelionde Silberhaar oder Juniper dem Schatten. Keine der alten Geschichten kam ohne Zauberei aus. Wie real das alles gewesen war! Man musste sich bloß in der Weißen Burg umsehen, in der bis heute genug Zeugnisse aus den zurückliegenden Drachenkriegen und den magischen Schlachten lagerten.
Umso enttäuschender hatten sich die letzten Jahre für Geron gestaltet. Der magische Unterricht bei der Herzogin war schlicht ernüchternd gewesen.
Nur, wie sollte er das seiner Schwester erklären? Er war früher kein Musterbeispiel für Disziplin und Pflichterfüllung gewesen, hatte sich dem Unterricht ihrer Lehrer stets gekonnt entzogen und sich lieber auf Jagden oder bei Waffenübungen amüsiert.
»Weiß Vater eigentlich, wie gut du mit der Klinge umgehen kannst?« Er wechselte das Thema. »Dir ist schon bewusst, dass die Schwertkunst nicht gerade als eine jener Tugenden gilt, die sich für eine Prinzessin von Waldaleth geziemt.«
Shira schnaubte abfällig. »Na und? Du bist ja auch der erste Prinz des Reichs, der sich zum Magier ausbilden lässt.«
»Ganz unrecht hast du nicht. Und Vater? Was sagt der dazu?«
Sie schenkte ihm einen gequälten Seitenblick. »Er weiß von meinen Übungen, aber er nimmt sie nicht ernst. Dabei übe ich jeden Tag unten im Park. Du weißt schon, im Irrgarten. Da sieht mich keiner.«
»Allein?«
»Nein. Jedenfalls anfangs nicht.« Shira seufzte. »Bis letzten Sommer hat mich Yendrick von der Burgwache unterrichtet.«
Geron lachte. »Der alte Zausel hat auch mich früher in die Mangel genommen. Ich hoffe, ich sehe ihn noch.«
»Das wird schwierig, denn er ist zum Jahreswechsel gestorben. Seitdem übe ich allein. Und solange ich nur hübsch Harfe spiele und fleißig Elfisch lerne, ist es Vater offenbar egal. In den fünf Jahren, da du fort warst, ist überhaupt viel passiert. Du weißt, dass er meine Hand dem ältesten Sohn von König Sirin versprochen hat?«
Überrascht sah Geron auf. »Harald von Schwalbensee? Der Thronerbe? Schon in einigen Jahren würdest du zur Königin Schwalbensees werden. Nicht die schlechteste Partie.«
»Der Kerl ist ein primitiver Säufer!«, sagte Shira aufgebracht. »Ich habe mich erkundigt. Er und seine sauberen Freunde treiben sich mehr in den Bordellen und Wirtshäusern Goldheims herum, als dass sie ihren Pflichten nachkommen. Erst jüngst, beim Turnier in Albenhain, hat er einen seiner Kontrahenten halb tot geschlagen.«
»Na ja, das passiert während eines Turnier schon –«
»Nicht während des Turniers. Danach! Der Ritter hatte ihn beim Tjost besiegt und so lauerte ihm Harald nachts vor einem Wirtshaus auf, um ihn sich vorzunehmen.«
Geron betrachtete seine Schwester hilflos. »Du musst Vater verstehen. Er versucht, einen Krieg zwischen unseren Königreichen abzuwenden. Du weißt doch, wie häufig es in den letzten Jahren zu Streitigkeiten wegen der Goldfunde in den Bussardshöhen gekommen ist. Das Gebiet wird sowohl von uns als auch von Schwalbensee bean–«
»Geron!«, zürnte Shira. »Vater will allen Ernstes, dass ich mit diesem Widerling mein Bett teile. Mein Leben lang – und das der Staatsräson zuliebe.« Sie formulierte den Begriff so, als wollte sie ihn ausspucken. »Du musst mit ihm sprechen. Du bist jetzt Mitte zwanzig. Und Vater ist alt. Ich glaube, er will dir nach deiner Rückkehr die Königswürde übertragen. Und auf dich hört er.«
»Nur werde ich nicht so schnell zurückkehren.« Geron sah verzagt auf seine Brandblasen. »Alruna von Greifenfels hat angekündigt, dass ich nach meiner Erhebung zum Magier verpflichtet bin, für sieben Jahre auf Reisen zu gehen.«
»Du wirst sieben weitere Jahre fort sein?« Shira sah ihn entgeistert an. »Ich dachte, du wärst zu Vaters fünfzigstem Krönungsjubiläum zurück? Das ist doch schon bald.«
»Nein, ich muss mich in dieser Zeit von Waldaleth fernhalten. Ich bin verpflichtet, einer mir selbst gestellten Aufgabe nachzugehen.«
»Und … was soll das bitte für eine Aufgabe sein?«
»Ich habe mir vorgenommen herauszufinden, warum die Elfen verschwunden sind.«
»Die Elfen?« Seine Schwester schüttelte ungläubig den Kopf. »Ihr Verrat ist jetzt fast sechshundert Jahre her. Länger als die Drachen tot sind. Wen interessiert es noch, was aus ihnen wurde?«
»Du willst es nicht wissen? Und das, obwohl du aus Waldaleth stammst?« Geron deutete hinunter zu dem prächtigen Schlosspark, der sich südlich der Weißen Burg wie ein Halbmond erstreckte. Er war einst von den Elfen angelegt worden und dort wuchsen Pflanzen, die man nirgendwo sonst in den Jungen Königreichen bestaunen konnte. Auch in der Stadt selbst hatten viele Zeugnisse der elfischen Kultur überdauert. Es reichte ein Blick auf das grüne Dächermeer, das sich hinter dem Park bis zur fernen Stadtmauer erstreckte. Da war die schnurgerade und von Ahornbäumen flankierte Königsallee, auf der früher der Einzug siegreicher Elfen- und Menschenheere gefeiert wurde, das alte elfische Aquädukt, das die Stadt mit Wasser aus dem nahen Kupfergebirge versorgte, die großen Statuen der Elfen, die beim Aufbau der Stadt geholfen hatten, und nicht zuletzt die königlich elfische Bibliothek mit der Philosophenschule, deren verspielte und ebenfalls weißmarmornen Türme und Erker sich über das umgebende Dächermeer erhoben.
»Wir alle sind doch gewissermaßen Erben Sil’Bariaths«, erklärte er, indem er der zerstörten Elfenstadt nahe des einstigen Drachenthrons gedachte. »Unsere ganze Kultur gäbe es ohne die Elfen nicht. Warum genießt wohl Waldaleths Philosophenschule so einen guten Ruf? Weil unser Wissen von den Elfen stammt. Warum lassen sich Heiler aus fernen Reichen bei uns zum Medicus ausbilden? Weil bei uns die alte elfische Arzneikunst gelehrt wird. Denk an unsere Musik, an unsere Malerei oder unsere Architektur.« Geron hob sein Schwert. »Selbst den berühmten Waldalether Stahl, der bis heute zum Reichtum unseres Königreichs beiträgt, würde es ohne sie nicht geben. Und das, obwohl wir beide nur zu gut wissen, dass er nicht einmal annähernd an die echte Schmiedekunst der Elfen heranreicht. Und davon ab … nicht einmal uns Zauberer würde es ohne sie geben.«
»Du bist kein richtiger Zauberer.«
»Ja, aber schon bald.«
Shira schnaubte. »Du lebst in der Vergangenheit. Und du sprichst so, wie nur ein Mann sprechen kann. Du musst Harald ja nicht ehelichen.«
»Ach, komm.« Geron legte seiner Schwester eine Hand auf die Schulter. »Ich werde bei der Wahl meiner Braut ebenfalls nicht frei sein.«