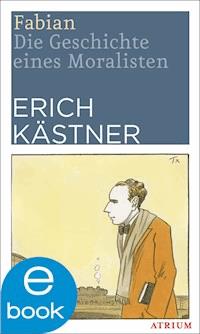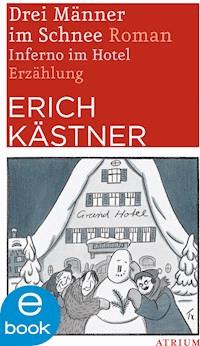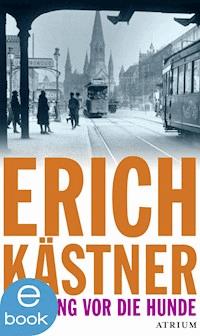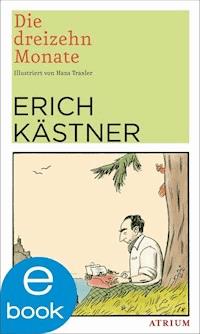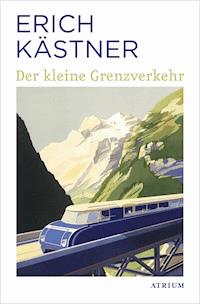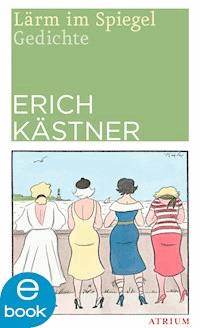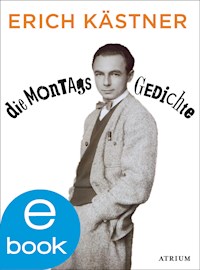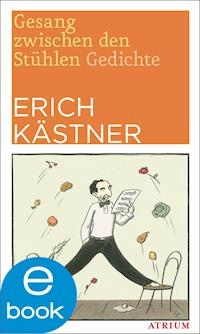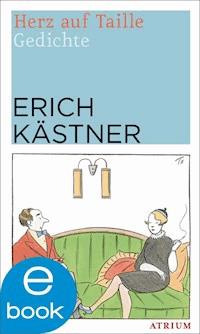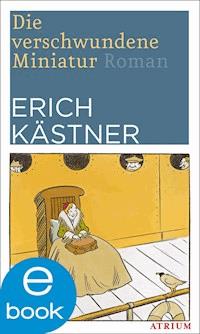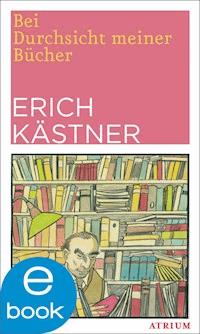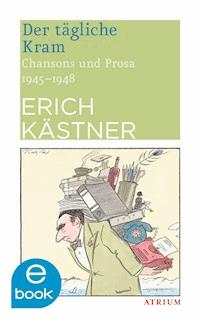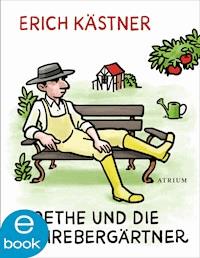
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Zürich
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ich möchte einen Schrebergarten haben, mit einer Laube und nicht allzu klein. Es ist so schön, Radieschen auszugraben à Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!« Erich Kästner, iHymnus an die Zeit/i Warum es nützlich sein kann, weder Telefon noch Fahrrad zu besitzen, was es mit dem sächsischen Stammescharakter auf sich hat und was Schrebergärtner mit Goethe verbindet: Sylvia List hat in diesem beglückenden Band Erich Kästners schönste Geschichten und Gedichte aus der Provinz Deutschland versammelt. Bei der Schilderung von allerlei Kuriositäten, Schildbürgerstreichen, Turbulenzen und anderen atmosphärischen Störungen kommt nicht nur der heiter-melancholische Idylliker Kästner zu Wort, sondern auch der ironische Skeptiker, der engagierte Gesellschaftskritiker wie der Satiriker, der scharfe Beobachter und der augenzwinkernde Zuschauer, Augenzeuge seiner Zeit in seiner deutschen Heimat. »Also das, denkt man, ist die Natur? Man beschließt, in Anbetracht des Schönen, mit der Welt sich endlich zu versöhnen. Und ist froh, dass man ins Grüne fuhr.« Erich Kästner, Misanthropologie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Vorbemerkung
Ich möchte einen Schrebergarten haben,
mit einer Laube und nicht allzu klein.
Es ist so schön, Radieschen auszugraben …
Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!
Erich Kästner, Hymnus an die Zeit
Ursprünglich sollte dieses Buch ganz anders heißen, nämlich … mich lässt die Heimat nicht fort. Unter diesem Titel sollten Texte wie Kleine Stadt am Sonntagmorgen oder Der kleine Herr Stapf versammelt werden, die den Idylliker Kästner zeigen wie auch den liebevoll-kritischen Beobachter kleinbürgerlichen deutschen Daseins, dazu atmosphärische Schilderungen des alten Dresden (Märchen-Hauptstadt, Zwischen Heller und Hinterhöfen) und Geschichten wie Hausmittel und Außerhausmittel, die vom tröstlichen Flanieren durch eine vertraute Münchner Straße erzählen.
Aber irgendwie wollte eine ganze Reihe von Texten sich unter diesen eher elegischen Titel nicht so recht fügen. Etwa ein Gedicht wie Kleine Führung durch die Jugend oder Fabians Besuch in der Kinderkaserne – in beiden Texten geht es doch eher darum, dass der Autor so schnell wie möglich fortwill von den einst vertrauten Orten, weil sie nur alte Traumata wecken. Oder, ganz anders, ein Gedicht wie In Harburg, da ist es gewesen …, das die provinzielle Schildbürgerei einer lokalen Feuerwehr aufs Korn nimmt, oder aber die beklemmende Groteske Brief aus Paris, anno 1935, eine so böse wie hellsichtige Vision des kommenden deutschen Größenwahns. Und eine so temperamentsprühende Glosse wie Goethe und die Hausbesitzer verlangte erst recht nach einem anderen Titel. Darum haben wir den wunderbaren Vorschlag Kästners aus diesem Text aufgegriffen und den Band Goethe und die Schrebergärtner genannt.
Denn es soll ja nicht nur der heiter-melancholische Idylliker Kästner zu Wort kommen, sondern auch der ironische Skeptiker, der engagierte Gesellschaftskritiker wie der Satiriker, der scharfe Beobachter und der augenzwinkernde Zuschauer, Augenzeuge seiner Zeit in seiner deutschen Heimat.
Die hier gesammelten Texte ergeben, da die meisten von ihnen einen autobiographischen Hintergrund haben, wie von selbst eine kleine Chronik Deutschlands, so wie Kästner es erlebt hat – das Dresden seiner Kindheit und Jugend, Leipzig während seiner Zeit als Werkstudent und junger Journalist, die kulturell und politisch turbulenten Jahre in Berlin, die im Schrecken der Naziherrschaft und des Krieges endeten, bis hin in die frühe Nachkriegszeit, in der Kästner von München aus als »Reisender in Deutschland« versuchte, sich ein eigenes Bild seines gevierteilten und verheerten Heimatlandes zu machen.
Und Goethe? Ist in vielen der hier vorliegenden Texte erstaunlich präsent. Zum einen natürlich in Kästners ironischen bis furiosen Glossen über die Heerschar von Adabeis und deren publizistische Ergüsse anlässlich von Goethe-Jubiläen (Goethe und die Hausbesitzer, Das Goethe-Derby). Zum anderen in seinem wütenden Verriss von Franz Léhars Operette Friederike mit Richard Tauber als Goethe (Goethe als Tenor). Verkitschung, »Vermessenheit«, »allergrößte Gemeinheit« gegenüber Goethe – Kästner spart nicht mit Vorwürfen. Besonders verübelt er Richard Tauber, dass dieser, weil der Beifall kein Ende nehmen will, mehrmals die Szene wiederholt, in der er gerade, mit der Gänsefeder in der Hand, »Sah ein Knab’ ein Röslein stehn« dichtet – eine Szene, die ein Opern- oder Operettenliebhaber genießen würde, auch in ihrer unfreiwilligen Komik. Kästner jedoch wird in seiner Empörung über die Schändung des verehrten Dichters geradezu gallig. Wie wir längst wissen, hat Goethe dieses Léhar’sche Attentat unbeschadet überstanden.
Dass Kästner seinen Goethe aber wirklich kennt, beweist der kurze literaturgeschichtliche Abriss, den er der Friederike-Kritik voranstellt. Mehr als einmal finden sich Goethe-Zitate in seinen Gedichten. Am berühmtesten wohl in Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?, wo es Kästner gelingt, durch den Austausch weniger Buchstaben Mignons Sehnsuchtsruf in eine Drohung zu verwandeln.
Das ist typisch Kästner: Gegenwart und Goethe kunstvoll miteinander zu verbinden, ohne Erstere zu verharmlosen oder den Zweiten zu diskreditieren. Er ist ein »Sohn des Volks«, wie sein Freund Hermann Kesten ihn genannt hat, und dabei ein würdiger Vertreter der Spezies Dichter und Denker, jedoch keineswegs der Ansicht, die Welt solle am deutschen Wesen genesen. Das Risiko hielt er für zu groß. Dazu hing er auch zu sehr an diesem Land.
München, Herbst 2013 Sylvia List
Die Fabel von Schnabels Gabel
Kannten Sie Christian Leberecht Schnabel?
Ich habe ihn gekannt.
Vor seiner Zeit gab es die vierzinkige,
die dreizinkige
und auch schon die zweizinkige Gabel.
Doch jener Christian Leberecht Schnabel,
das war der Mann,
der in schlaflosen Nächten die einzinkige Gabel
entdeckte, bzw. erfand.
Das Einfachste ist immer das Schwerste.
Die einzinkige Gabel
lag seit Jahrhunderten auf der Hand.
Aber Christian Leberecht Schnabel
war eben der Erste,
der die einzinkige Gabel erfand!
Die Menschen sind wie die Kinder.
Christian Leberecht Schnabel
teilte mit seiner Gabel
das Schicksal aller Entdecker, bzw. Erfinder.
Einzinkige Gabeln,
wurde Schnabeln
erklärt,
seien nichts wert.
Sie entbehrten als Teil des Bestecks
jeden praktischen Zwecks,
und man könne, sagte man Schnabeln,
mit seiner Gabel nicht gabeln.
Die Menschen glaubten tatsächlich, dass Schnabel
etwas Konkretes bezweckte,
als er die einzinkige Gabel
erfand, bzw. entdeckte!
Ha!
Ihm ging es um nichts Reelles.
(Und deshalb ging es ihm schlecht.)
Ihm ging es um Prinzipielles!
Und insofern hatte Schnabel
mit der von ihm erfundenen Gabel
natürlich recht.
Othello und die Droschkenkutscher
Treppenhaus des Kleinen Theaters. Abends ½ 11 Uhr. Kurz vor Schluss der Vorstellung. Ich warte. Auf wen? Gott, Sie kennen Frau Schramm ja doch nicht!
Der Portier unterhält sich mit der Toilettenfrau. Ein Droschkenkutscher unterhält sich mit der Garderobefrau. Der Portier sieht missgelaunt nach der Uhr: »Der Odello had gud seine elf Agde.« Der Droschkenkutscher tritt frierend von einem Bein auf das andere und versteckt seine Hände muffartig in den Ärmeln seines grenzenlosen Schafpelzes. »Ham Se Gadrobe rauszulejen?«, fragt die Garderobefrau den Portier. Der knurrt: »Ja. Awr die mit ihre lumpjen zwanzj Marg!« Und dann schleppen sie Breitschwanzkragen und Sealmäntel und zierliche Überschuhe herbei. Der Kutscher kommt förmlich auf den Zehenspitzen näher und fährt mit leisen Fingern über einen kostbaren Pelz, als ob er ein krankes Kind streichelte. Dann tritt er wieder resigniert von einem Bein aufs andere. Plötzlich hört man Kortners durchdringenden Schrei gedämpft durch die Wände dringen. Die Garderobefrau sagt kopfschüttelnd: »Nee, gann där awr blägn!« Der Portier sagt: »Gordner? Ja, där gann blägn.« Die Toilettenfrau tritt hinzu: »Heide frie zur Brobe haddr in seim Mandl geschpield. Där brauchd sich gar nich zu schmingen: Där sieht ooch so wie e Näjr aus.« »Nee«, sagt der Portier, »wie e Chinese.« »Nee«, sagt die Toilettenfrau, »wie e Näjr.«
Da poltert wer die Treppe herunter. Es ist ein anderer Droschkenkutscher. Er hat ein paar Minuten im Zuschauerraum gestanden, weit hinten an der Tür. Nun fragt er den Kollegen: »Emil, hasde noch de Ferde gesähn?« Dann lacht er merkwürdig, trampelt herum wie der alte Huhn, wedelt mit den Armen und flötet: »O, Däsdemona!« Die andern lachen. Der zahnlose Portier taxiert: »Nu wirdr se gleich dodmachen, das arme Mächen.« Der Droschkenkutscher Emil lächelt mitleidig: »Hoffendlich is das Messer ooch scharf genuch.« Der andere Kutscher denkt nach: »Ä Messer? Ä Messer had där gar nich gehabbd.« Die Garderobiere wendet logischerweise ein: »Womid sollr se denn awr dann drstechen?«
Und da schreit Kortner wieder auf! »Da brilln se nu wie de Viecher und machen sich dod. – Und dann stehn se wiedr off, lassen sich begladschn und gehn Amdbrod ässn –«, sagt der Portier und denkt über irgendetwas nach. Man kann sehen, wie ihn das Denken körperlich anstrengt. – Emil, der Kutscher, denkt auch nach: »Ich weeß nich. Wie man bloß ins Deadr gehn gann –.« »Sachn Se das nich«, unterbricht ihn die Garderobefrau energisch, »die Brillerei, die gann ich ooch nich leidn; awr was so e hibsches Lusdschbiel is, das seh ich vor mei Lämn gerne.« »Ja«, sagt der Portier, »e Lusdschbiel, das is ja ooch was ganz andres.« Diesem abschließenden Urteil wagt sich keiner zu widersetzen.
Und wieder hören wir Kortners Aufschrei: »Nu muss se awr gleich dod sein«, sagt der Portier, »’s is schonn dreivirdl elfe. ’s wird ooch Zeid. Meine Muddr wird off mich wardn.« »Ham Sie ’ne gude Frau«, sagt Emil, der Kutscher. »Sie nich?«, fragt die Garderobefrau. Emil scheint zu frieren und tritt von einem Bein auf das andere.
Da werden oben die Türen aufgerissen. Und das Theaterpublikum strömt. »Stellen Sie sich vor«, sagt eine Dame zu ihrem Begleiter, »580000 Mark hat mich die Operation gekostet! Ich bin auf den Rücken gefallen.« »O«, sagt der Begleiter, »gnädige Frau sind so anschaulich.« »Haha!«, meint die Gnädige. – »War Kortner nicht einfach wundervoll?«, fragt eine andere Dame einen anderen Herrn. »Ein bisschen zu laut fand ich ihn«, sagt er. Sie findet auch. – »Also hundert Zentner netto frei ab Bahn?«, fragt ein Herr einen anderen. »Nein, brutto!«, sagt der andere, »brutto! – Kommen Sie noch mit ins Café?« –
Der Portier hilft in die Mäntel und kassiert Zwanzigmarkscheine. Die beiden Kutscher humpeln fröstelnd zu ihren Gäulen. Die Garderobefrau sagt: »Ich danke scheen, mei Herr.« – Und dann kommt auch Frau Schramm.
Als Schröder am 26. November 1778 den »Othello« zum ersten Mal aufgeführt hatte, schrieb ein Augenzeuge: »Ohnmachten über Ohnmachten erfolgten … Die Logentüren klappten auf und zu, man ging davon oder ward nothfalls davongetragen, und beglaubigten Nachrichten zufolge war die frühzeitige missglückte Niederkunft dieser und jener namhaften Hamburgerin Folge der Ansicht und Anhörung des übertragischen Trauerspiels …«
Es scheint doch fast, als ob sich die Zeiten geändert hätten. Und die Menschen. Sind sie besser geworden? Oder schlechter?
Nein. Aber – anders.
Sächsische Sonette
Die sächsische Mundart eignet sich bekanntlich wie keine zweite zum Austausch lieblicher Gefühle.
Erich Kästner, Drei Männer im Schnee
Als einer seine Braut streichelte
Na meine Micke, nu schenier dich nich!
Du duhsd ja so, als wärn wir beede fremd …
Und dabei kenn wir uns. Und du kennsd mich.
Das scheene Hemd …
Hau mir doch nicht gleich egal off de Fohdn!
Bis doch mal wiedr wie in’ Blauner Wald!
So mach dir doch e Schild vors Kleed: »Verbohdn.«
Mensch, bis du kald.
Das saach ich dir. Das gehd mir so nich weidr.
Das is doch keene Ahrd is das doch nich!
Endwehdr wirs du endlich bald gescheidr –
Na ja! Warum nich gleich, mei Wühderich!
Was ich noch saachen wollde: Du wirschd breidr.
Hm? Irr ich mich?
Als einer nach dem Stammescharakter fragte
Momendchen … ja, bei uns is Sie das so:
Dass wir egahl gemiedlich wärn, is Quadsch.
Im Grunde sinn wir’s garnich – e, iwo!
Und gar phlechmadsch?
Da missdn se uns mal bsoffn sehn!
Da bliebe Ihn’ beschdimmd de Schbucke ford.
Und nähmse ruhich an, Sie ärchern wen,
bloß so zum Schpord …
Mein guhder Herr, das wäre Ihr Ruiehn!
Das gehd bei uns dann gleich off Dohd und Lähm.
Da feixen Sie? He! Warum feixen Sie’n?
Ich kennde Ihn’ aus Wut gleich eine klähm!
Hadds weh gedahn? Das gald ja garnich Ihn’.
So sinn wir ähm.
Mess-Ouvertüre
Nun es dunkelt, hält der Hauptbahnhof seine Bogenlampen in den Nebel, dass es flimmert wie das Schaufenster eines Juweliergeschäfts. Und der Himmel darüber ist mit roter Tapete ausgeschlagen … Und dann sagt der Bahnhof plötzlich ganz laut: »Hurr …, hurr …, hurr …!«, und spuckt den Berliner Zug aus. – Das feuchte Pflaster glitzert wie Christbaumschnee.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!