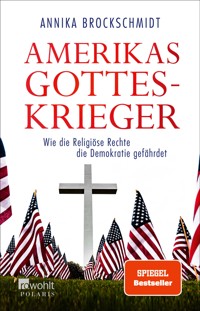9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ring frei für einen Wissenswettkampf voller Überraschungen! Immer wieder wird darüber gestritten: Halten Physik, Chemie und Biologie die besseren Antworten parat oder Geschichte, Germanistik und Philosophie? Höchste Zeit, beide Lager gegeneinander antreten zu lassen! In mehreren Runden präsentieren ein Naturwissenschaftler und eine Geisteswissenschaftlerin die witzigsten und originellsten Fakten aus ihrer Zunft – und geben sehr unterschiedliche Antworten auf dieselben Fragen: Wer hat den verrücktesten Forscher zu bieten? Die einprägsamsten Formeln und Zitate? Die glänzendste Einzelleistung? Seien Sie selbst der Ringrichter – und erfahren Sie viel Obskures und Unerwartetes aus beiden Wissenswelten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Annika Brockschmidt • Dennis Schulz
Goethes Faust und Einsteins Haken
Der Kampf der Wissenschaften
Über dieses Buch
Ring frei für einen Wissenswettkampf voller Überraschungen!
Immer wieder wird darüber gestritten: Halten Physik, Chemie und Biologie die besseren Antworten parat oder Geschichte, Germanistik und Philosophie? Höchste Zeit, beide Lager gegeneinander antreten zu lassen! In mehreren Runden präsentieren ein Naturwissenschaftler und eine Geisteswissenschaftlerin die witzigsten und originellsten Fakten aus ihrer Zunft – und geben sehr unterschiedliche Antworten auf dieselben Fragen: Wer hat den verrücktesten Forscher zu bieten? Die einprägsamsten Formeln und Zitate? Die glänzendste Einzelleistung? Seien Sie selbst der Ringrichter – und erfahren Sie viel Obskures und Unerwartetes aus beiden Wissenswelten.
Vita
Annika Brockschmidt und Dennis Schulz haben ganz unterschiedliche Interessen, aber eine gemeinsame Leidenschaft: die Wissenschaft. Während Annika für Team Goethe in den Ring steigt (Geschichte und Germanistik), macht sich Dennis, der in Tieftemperaturphysik promoviert, für Team Einstein warm. Seit zwei Jahren betreiben sie den Podcast Science Pie zu natur- und geisteswissenschaftlichen Themen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-40144-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Fight!
Nehmt die Boxhandschuhe vom Haken, staubt sie ab und folgt dem Ruf der Sprechgesänge! Auf zum Wettkampf in die Arena des Wissens! Wir treten an, um eine Frage zu lösen, die seit vielen Generationen diskutiert wird und die nicht zuletzt eine Menge Menschen vor dem Beginn ihres Studiums umtreibt: Welcher Disziplin will man sich ein paar Jahre oder unter Umständen sein Leben lang widmen? Was ist besser, wer hat mehr drauf, wer ist stärker – die Geistes- oder die Naturwissenschaften?
In diesem Buch soll diese Frage endgültig geklärt werden. Ein Kampf in mehreren Runden, entschieden dadurch, wer die bessere Story erzählen kann, wer die spannendste Anekdote zu bieten hat. Im Ring trifft man sie alle: die größten Exzentriker, die besten Forschungsleistungen und die weitreichendsten Schlüsse. Wer trägt am Ende die Krone der besten Disziplin, den Meistergürtel des Wissens? Titanen wie Newton, Alexander der Große, Einstein und Shakespeare werden sich gegenüberstehen. Hier sollen Fakten wie Fäuste fliegen: Nur die härtesten Tatsachen kommen auf die Bretter, die das Verstehen der Welt bedeuten.
Wer kann sich behaupten im Kampf um den heftigsten Diss? Wer ist gewitzter und spitzzüngiger, wessen Schlagkombination bringt die Gegenseite aus dem Gleichgewicht? Können es Shakespeares Verse im Ring mit ihrer Eleganz und Kraft gegen die Relativitätstheorie aushalten, deren Verteidigung aus der äußerst geschickten Verbiegung des Raumes besteht? Kann die Mathematik wirklich etwas gegen das Reich von Alexander dem Großen ausrichten?
Die Stimmung ist aufgeheizt, die Banner sind gehisst, Sprechchöre schallen durch die Arena. Kurz bevor die Ringglocke läutet, ziehen die romantischen Feingeister mit den dramatischen Capes andere Saiten auf, lassen, was die Metrik angeht, den Hexameter Hexameter sein, und beginnen, geistreiche Sprechchöre zu brüllen. Natürlich rechnen sie sich gute Chancen aus, denn widmen sie sich nicht aufgrund ihrer Liebe zu mitreißenden Büchern, Versen, Epen und Dramen überhaupt dem Verständnis der Welt? Ist Musik nicht der Ausdruck von Emotion schlechthin, Literatur nicht viel komplexer als alles, was die Naturwissenschaften zu bieten haben? Gibt ein gutes Buch nicht viel mehr Zuflucht als ein paar Formeln? Die Sprachvirtuosen sind sich ihrer Sache sicher!
Ihnen gegenüber machen sich die Nerds bereit: Der Physik-Leistungskurs prostet den Historikern mit Dosenbier zu, die Chemie zündet bengalische Feuer, die Informatiker bräunen sich im Licht ihrer Laptopbildschirme – direkter Kontakt mit Tageslicht würde ja einen sofortigen Sonnenbrand nach sich ziehen. Der Fanblock ist bunt anzuschauen, denn man trägt, was morgens im Schrank ganz oben lag – wahre Schönheit ist ja ohnehin nur in mathematischen Beschreibungen der Natur zu finden. Die Mathematik ist für ihre Anhänger die schönste Ausgeburt menschlicher Kreativität – nur verständlich zu erklären ist sie leider meistens nicht.
Ein paar Meter weiter batteln sich die Metal-Fraktionen der Physiker und der Geschichtswissenschaftler. Wessen Haarpracht schimmert schöner im Moshpit? Der Kampf der Disziplinen ist immer auch ein Kampf der Eitelkeiten! Da prallen Egos aufeinander, da kommen Minderwertigkeitskomplexe mit ins Spiel, wird mit Fäusten gefuchtelt und Geltungsbedürfnis befriedigt. Es wird trompetet, getönt, geprahlt und argumentiert, aufgeführt und aufgezählt, dass die Schwarte kracht!
Lang gehegte Fehden innerhalb der beiden Wissenschaftsfelder werden für den Moment auf Eis gelegt. Die Mathematiker, sonst nur spöttisch bereit, sich mit Physikern abzugeben – ungenaue Wissenschaft! –, und eben jene verbünden sich auf einmal. Die Physiker, die soziale Interaktion meist als notwendiges Übel ansehen und vor Facharroganz strotzen, besinnen sich heute allein auf den Kampf. Niemand kommt unvorbereitet. Die Chemiker haben einige Substanzen aus ihren Laboren mitgebracht, um den Gegnern die Sinne zu vernebeln. Auch die theoretischen Physiker haben ihre schärfste Waffe dabei, einen gut gespitzten Bleistift, den sie hinter dem Ohr tragen, dazu einen Radiergummi und einen Stapel weißes Papier. Gestern brachte die Riemannsche Vermutung sie noch um den Schlaf, heute aber sind alle Augenringe egal. Denn sie sind überzeugt: Alle Probleme dieser Welt kann man mit Zahlen und Modellen lösen! Dieser Kampf kann also eigentlich gar nicht zu verlieren sein. Die «Laberfächer» sind vielleicht ganz nett, aber doch keine «echte» Wissenschaft. Werden nicht Biologie- oder Informatikstudenten deswegen nur äußerst selten gefragt: «Und was willst du damit mal machen? Taxifahrer?»
Die Deutsch- und Englischcracks hingegen reagieren, wenn überhaupt, nur noch stoisch auf solche von Unwissenheit und Ignoranz triefenden Nachfragen. Jeder weiß ja, wie die drauf sind: Geisteswissenschaftler, das sind doch die, die nicht mit Zahlen können, oder? Die, die immer schon gut palavern konnten und sowieso den ganzen Tag nur in ihrem Elfenbeinturm sitzen, dicke Wälzer lesen und sich Gedanken über Zeug machen, das eh niemand im Alltag braucht, ohne dabei wenigstens so nützliche Dinge wie die Glühbirne zu erfinden.
Widmen wir uns auch hier den Untergruppen: Da wäre einmal der Philosophiestudent, der jedes fachfremde Seminar zum Stöhnen bringt, weil seine Wortmeldungen immer aus fünfminütigen Monologen bestehen, die meist nur äußerst entfernt etwas mit dem Seminarthema zu tun haben. Der Ethnologiestudent, den man schon von weitem riecht oder an seinen gebatikten Klamotten erkennt, der Althistoriker, der seine Zeit am liebsten mit Papyri verbringt und mit diesen auch weit besser kommuniziert als mit Menschen. Dann der Geschichtsprofessor im Tweedanzug, der die Nase oben trägt und darauf besteht, dass er gesiezt wird, auch wenn das in allen anderen Instituten längst anders ist. Der Romanist, der mit den Anglisten auf Kriegsfuß steht (warum, weiß eigentlich keiner mehr so genau), der Theaterstudent, der das Drama auch im eigenen Leben sucht. Aber ist eine Disziplin, die nicht versucht, alles auf bloße Zahlen zu reduzieren, nicht die viel schönere Wissenschaft? Die Geschichtswissenschaft enthüllt große Zusammenhänge, die niemand sonst sehen kann, und die Literaturwissenschaft bringt kluge Gedanken, akribische Analysen und eine Weitsicht mit sich, die man durch kein noch so riesiges Experiment erreichen könnte. Die besten Ideen der Menschheitsgeschichte haben doch die Geisteswissenschaften hervorgebracht, und die interessantesten Persönlichkeiten sowieso. Wie also sollen die Naturwissenschaften dagegen ankommen?
Dieses Buch versammelt zwei Trainer, die ihr Aufgebot an Kämpfern für dieses epische Duell sorgfältig ausgewählt haben. Dennis postiert sich auf der Seite der Naturwissenschaften und durchlief die lange Physiker-Trainerausbildung. In der anderen Ecke des Rings steht Annika, Spezialistin der gedruckten Buchstaben – und für die Vergangenheit, für das kulturelle Gedächtnis. Die Stunden, die sie vor Buchseiten verbracht hat, zwischen Urkunden, Inschriften, Chroniken, Dramentheorie und Gedichten, sind mit Zahlen nicht aufzuwiegen – Geschichte und Germanistik sprengen jede Skala.
Beide brennen für die Wissenschaft, ohne Frage. Und alle Geister, die sie riefen, sind gekommen. Man kennt einige der Sparringspartner, die sich gerade am Rand des Rings warm laufen. Altbekannte Stars mit zerzaustem Haar stretchen ihre knackenden Hüften, und etwas verwirrt ins Rampenlicht blinzelnde, unbekannte Neulinge, die sich noch an die Aufmerksamkeit gewöhnen müssen, hüpfen nervös auf und ab. Etwas abseits stehen die, die sich weigern, ins Rampenlicht gezogen zu werden, die es sich aber doch nicht nehmen lassen wollten, zu kommen. Die Spannung ist greifbar, die Luft wie elektrisiert.
Nun legt sich Stille über die Ränge. Wer wird der unparteiische Ringrichter sein, wer wird entscheiden, wie es heute ausgeht? Die Leserin, der Leser! Erlaubt ist, was gefällt – und vor allem, was überzeugt. Wer hat die besseren Punches? Hat Lessing den fieseren linken Haken und Goethe den härteren Faustschlag? Hat Einstein die bessere Fußarbeit, und wird Newton alle auf Abstand halten? Wer wird k.o. gehen? Wer hat am Ende des Kampfes, wenn die Glocke das letzte Mal läutet, die meisten Punkte? Viel Spaß beim Zuschauen – auf in den Kampf!
1. RundeSchillernde Gestalten
Bissige Naturforscher, wortlose Mathematiker und Drogen aus der Plastiktüte
Die Wissenschaften sind voll von exzentrischen Figuren. Aber die großen Namen, die man kennt, zitiert und schätzt, sind viel zu häufig Künstler, Geisteswissenschaftler, Schreiberlinge. Dabei ist das Potenzial für Exzentrik in den Naturwissenschaften enorm groß. Selbst Oscar Wilde muss sich warm anziehen, sobald Physiker, Chemiker und Konsorten die gesellschaftlichen Normen in die Schranken weisen!
Mein erster Kandidat, Paul Erdős, tänzelt im Mathematikerleibchen – dem abgewetzten Jackett – durch den Ring. 1913 in Budapest geboren, ist er sträflicherweise außerhalb der Mathematik noch immer kaum bekannt – dabei lebte er im Grunde die mathematische Version eines Jack-Kerouac-Romans. An die sechzig Jahre seines Lebens reiste er von Mathematikinstitut zu Mathematikinstitut – sein komplettes Hab und Gut in einem schäbigen, halbleeren Koffer verstaut, in dem sich ein bisschen Kleidung und sein riesiges Radio befanden. Er klopfte – mal angekündigt, mal unangekündigt – an die Türen verschiedener Größen des Faches, nistete sich eine Weile ein, um mit ihnen zu arbeiten. Das Ergebnis: über 1000 Veröffentlichungen. Noch sieben Jahre nach seinem Tod wurden Artikel veröffentlicht, die ihn als Mitautor nannten. Denn er war einer der wenigen Mathematiker, die selbst im hohen Alter noch unermüdlich die Forschung vorantrieben.
Wenn man Mathematik betrieb, eines Tages die Tür öffnete und Erdős davorstand, eine hagere, hochgeschossene Gestalt mit blauen Augen hinter einer großen Brille, und wie üblich verkündete: «My brain is open» – dann hatte man wohl gemischte Gefühle. Fachlich konnte man sich einiges erwarten – eine Vielzahl von Mathematikern hob für seinen Besuch extra spezielle Probleme auf. Privat glich Erdős’ Ankunft aber wohl eher einem K.-o.-Schlag. Drei, vier Stunden Schlaf pro Nacht genügten ihm. Der Mathematiker Mike Plummer erinnerte sich daran, bis ein Uhr nachts mit ihm über Problemen gesessen zu haben. Nur dreieinhalb Stunden später, um halb fünf, weckte ihn das Zusammenschlagen von Töpfen in seiner Küche – Erdős teilt ihm mit, dass er jetzt ausgeruht sei und weiterrechnen wolle. Als Plummer sich um etwa sechs Uhr aus dem Bett quälte, wurde er in der Küche nicht mit einem «Guten Morgen» begrüßt, sondern mit den Worten: «Nehmen wir an, dass n eine ganze Zahl ist …»
Nichtmathematiker, «triviale Wesen», wie Erdős sie nannte, hielt er aus seinem Leben heraus. Sowieso pflegte er eine ganz eigene Weltsicht: Menschen wurden nicht geboren, sondern «kamen an» und «verschwanden», statt zu sterben. Das Wort «sterben» verwendete er, wenn jemand aufhörte, Mathematik zu betreiben. Männer waren «Sklaven», Frauen «Bosse»: Wer verheiratet war, war «gefangen». Auch das Wort «Gott» benutzte er nicht – «SF» nannte er das übersinnliche Wesen, kurz für «Supreme Fascist». Dieser Über-Faschist, fand Erdős, bestrafe ihn viel zu häufig: Er ließ seinen Pass verschwinden, plagte ihn mit Erkältungen oder besaß empörenderweise ein Buch mit den elegantesten Beweisen der Mathematik, ohne es irgendjemandem zu zeigen.
Erdős war ein Fisch im Meer der Mathematik. Kein Wunder, dass er nicht aus diesem Wasser kommen wollte. Sein erstes Butterbrot schmierte er sich mit 21 Jahren. Seine Mutter begleitete ihn einige Zeit auf allen seinen Reisen. Nach ihrem Tod, der Erdős zutiefst betrübte, kümmerte sich ein bekanntes Mathematiker-Ehepaar um ihn: Fan Chung und Ronald Graham organisierten seine Korrespondenz – über 1000 Briefe pro Jahr –, seine Reisen und bauten sogar ihr Haus aus, um Erdős ein eigenes Schlafzimmer mit Bibliothek zu bieten. Gastgeber Graham und Gast Erdős müssen eine eigenartige Paarung gewesen sein – während Erdős stundenlang sitzen konnte, war Graham ein begabter Sportler, der mitten in mathematischen Diskussionen in den Handstand sprang, einige gute Ideen während seiner Saltos auf dem Trampolin hatte und sein Büro gern auf Pogo-Stöcken durchquerte.
Erdős’ unerschöpfliche Energie, sein anscheinend stets leistungsfähiger Geist waren übrigens nicht nur natürlich gegeben, sondern entsprangen auch seinem Drogenkonsum: Benzedrin und Ritalin waren Treibstoff seiner neunzehn Stunden Mathematik pro Tag. Natürlich machten sich seine Freunde Sorgen – und boten Erdős eine Wette an: 500 US-Dollar, wenn er einen Monat ohne seine Drogen auskäme. Er nahm an und war erfolgreich. Aber sobald der Monat um war, fing er sofort wieder an. «Ich bin jeden Morgen aufgestanden», sagte er, «um auf ein weißes Blatt Papier zu starren. Ich hatte keine Ideen, genau wie eine normale Person.» Zu dem Freund, der ihm die Wette angeboten hatte, sagte er: «Du hast die Mathematik um einen Monat zurückgehalten.»
Das Geld, das er aus der Wette erhielt, behielt er wohl nicht für sich: Er spendete viel für Zwecke, die ihm sinnvoll schienen, unter anderem an Radiosender für klassische Musik oder eine entstehende Bewegung von Ureinwohnern. Als er von den 50000 Dollar Preisgeld des angesehenen Wolf Prize alles bis auf 720 Dollar spendete, kommentierten einige seiner Freunde, dass das für ihn immer noch eine Menge Geld sei.
Eine ähnlich eigenartige Paarung wie Graham und Erdős waren die Nobelpreisträger für Physik des Jahres 1933. Erwin Schrödinger und Paul Dirac wurden für ihre Arbeiten zur Quantenmechanik ausgezeichnet. Während sie im selben Gebiet forschten, hätte ihr soziales Verhalten kaum unterschiedlicher sein können. Schrödinger war ein bekannter Womanizer, der Partys liebte und eine offene Beziehung führte, Dirac hingegen, das nächste Schwergewicht im Ring, war sozial wirklich ein ganz harter Brocken. An seiner fachlichen Kompetenz ist nicht zu zweifeln. Immerhin war er mit 31 Jahren einer der jüngsten Nobelpreisträger überhaupt, war Mitbegründer der Quantenphysik; eine ganze Reihe seiner Beiträge hallen bis heute nach. Unter anderem sagte er die Existenz von Antimaterie voraus. Viele sehen ihn auf einer Stufe mit Einstein, trotzdem ist er weitgehend unbekannt geblieben. Warum?
Während andere sich ins Rampenlicht drängten, drängte er sich hinaus. Er war allgemein bekannt als distanzierter, kalter, zurückhaltender Mensch. Selbst seinen verschrobensten Kollegen war er nicht ganz geheuer. Einstein bemerkte: «Ich habe Probleme mit Dirac. Dieses Balancieren auf dem schwindelnden Grat zwischen Genie und Wahnsinn ist schrecklich.» Dirac selbst führte sein Verhalten häufig auf seinen hochautoritären Schweizer Vater zurück. Dieser erteilte ihm schon am Frühstückstisch – abgesondert vom ganzen Rest der Familie – Französischstunden. Schon beim kleinsten Grammatikfehler wurde dem kleinen Dirac der nächste Wunsch, den er äußerte, verwehrt. Das Kind reagierte, indem es gar nicht mehr redete. Eine Angewohnheit, die ihn auch noch als Erwachsenen auszeichnen sollte. «Er würde», so wurde er später von dem Biographen Graham Farmelo beschrieben, «nicht ein Wort benutzen, wo auch keines ausreichend war.» Niels Bohr, der berühmte dänische Physiker und späterer enger Freund von Dirac, grummelte: «Dieser Dirac scheint eine Menge von Physik zu verstehen, aber sagt kein Wort.» Seine Kollegen in Cambridge definierten für die kleinste Anzahl an Worten, die man in Gesellschaft sagen könnte – eines pro Stunde –, die Einheit «1 Dirac». Er beschränkte sich, wenn möglich, auf Antworten wie «Ja», «Nein» oder – maximal – «Das ist mir egal».
War irgendwo ein offizielles Foto angekündigt, verschwand er gern oder versteckte sich in einer der hinteren Reihen. Als er sich einmal bei einem Treffen nicht entziehen konnte, schaute er nicht etwa in die Kamera, sondern studierte konzentriert eine wissenschaftliche Zeitschrift. Dennoch sind auch einige seiner Vorlieben überliefert: Er pflegte eine Liebe zur klassischen Musik und, später, zu Cher. Seine Begeisterung für die amerikanische Sängerin war so groß, dass er einen zweiten Fernseher kaufte, um einen Ehestreit zu vermeiden. Seine Frau wollte unbedingt die Oscar-Verleihung sehen, gleichzeitig lief aber ein Cher-Konzert.
Nun aber, meine Damen und Herren, macht sich mein absoluter Favorit für den Ring warm. Charles Waterton, überragender Naturforscher und Tierpräparator, geboren 1782, gestorben 1865, hat das Zeug zum Publikumsfavoriten. Er liebte die Natur über alles und hatte im Gegensatz zu den bisherigen Kandidaten einen Hang, seine Exzentrik wie ein Schild vor sich her zu tragen. Hüte waren zu seiner Zeit gerade besonders in Mode – also trug er keinen. Lange Haare waren angesagt, er schnitt seine kurz. Er war bekannt dafür, sich als Butler zu verkleiden und seine Gäste mit der Kohlebürste zu kitzeln oder tagelang verkleidet in der Rieseneiche seines Parks zu sitzen, in aller Geduld die Gewohnheiten seltener Vögel zu beobachten oder aus dem Nest gefallene Küken wieder zurückzusetzen. Schon zu Schulzeiten begann er seine Ausflüge ins Grüne. Die Jesuiten-Schulleiter entschieden sich dazu, seine Angewohnheiten nicht zu bekämpfen, ganz im Gegenteil: Sie ernannten ihn zum offiziellen Rattenfänger, Fuchshäscher, Mardertöter. Außerdem wurde er damit beauftragt, die Armbrüste zum Jagen mit Pfeilen zu beladen.
Die Partys, die er später in seinem Haus in der englischen Pampa gab, waren denkwürdig: Um seine Gäste von den Vorteilen des Barfußlaufens zu überzeugen, kratzte er sich bei Tisch gern mit seinen Zehen am Kopf – und das im Alter von über 70 Jahren! Zu seinen typischen Gästen gehörten protestantische Priester genauso wie Insassen der nahe gelegenen psychiatrischen Klinik. Einen seiner guten Freunde begrüßte er, indem er sich unter dem Tisch versteckte, von dort das Bellen eines Hundes nachahmte und ihn schließlich ins Bein biss.
Aber Waterton konnte auch wütend werden. Zum Beispiel, wenn man seine Bahia-Kröte, der er gern gut zusprach und den Kopf streichelte, beleidigte. «Dass ein Gentleman», so schrieb er, fähig sei, die Kröte ruchlos als «garstiges Vieh» zu bezeichnen, «war genug, um mich für eine ganze Woche zu verstimmen.» Die Natur erwiderte seine Liebe: Als ein als besonders brutal geltender Orang-Utan im Zoo gezeigt wurde, verlangte Waterton Zugang zum Käfig. Er trat ein, blickte Richtung Orang-Utan, der Orang-Utan blickte zurück – und es war Liebe auf den ersten Blick: Küsse wurden getauscht, Umarmungen fanden statt, und Forscher und Affe untersuchten gegenseitig Zähne, Hände und Haare.
Es ist also nur fair, dass der wunderschöne, abgelegene Waterton-Lakes-Nationalpark in Kanada seinen Namen trägt. Waterton bricht das Bild des kühlen, rationalen Denkers auf, er ist ein Naturwissenschaftler mit Herz und Verstand. Zwar sind einige der Geschichten über ihn schwer belegbar, aber das mindert nicht den großen Reiz, der von ihm ausgeht.
Exzentriker findet man übrigens auch unter noch lebenden Wissenschaftlern. Der Mathematiker und Zahlenjongleur Grigori Jakowlewitsch Perelman verkörpert, ähnlich wie Paul Dirac, einen extrem introvertierten Menschentyp, der sich wenig um soziale Normen schert. Und trotzdem hat alle Welt versucht, aus ihm einen Star zu machen. Aber der Reihe nach.
Grigori Perelman arbeitete zehn Jahre am Steklow-Institut in Sankt Petersburg, ohne dass er über die engen Grenzen seiner Unterdisziplin besonders bekannt geworden wäre. Wenige wussten überhaupt von seiner Existenz. Er besaß unter allen Wissenschaftlern des Instituts den niedrigsten akademischen Grad und veröffentlichte kaum in angesehenen Zeitschriften. Im normalen Wissenschaftsbetrieb verliert man so ganz leicht seine Stelle – Perelman aber wurde mit anderen Maßstäben gemessen. Man ließ ihn arbeiten, da jeder im Institut um sein ungewöhnliches Talent wusste.
Zu dieser Zeit veröffentlichte das Clay Mathematics Institute, eine private Stiftung aus Cambridge, Massachusetts, sieben mathematische Probleme und setzte auf ihre Lösung jeweils ein Preisgeld von einer Million Dollar aus. Die Probleme galten als die großen Gipfel, die noch niemand in der Mathematik bestiegen hatte – und bei denen es fraglich war, ob sie überhaupt in den nächsten hundert Jahren lösbar wären. An einem dieser Probleme arbeitete Grigori Perelman bereits seit einigen Jahren: der sogenannten Poincaré-Vermutung (1904 von Henri Poincaré aufgestellt). Sie besagt, dass jedes geometrische Objekt, das kein Loch hat, zu einer Kugel umgeformt werden kann – insbesondere eine zweidimensionale Fläche im dreidimensionalen Raum oder eine dreidimensionale Oberfläche in einem vierdimensionalen Raum. Bisher hatte kein Mathematiker eine Lösung präsentieren können, deswegen wähnte sich auch die Clay-Stiftung zumindest für ein paar Jahre in Sicherheit. Aber nur zwei Jahre nach der Auslobung der Preise war Perelman am Ziel: Er veröffentlichte den kompletten Beweis in drei Teilen 2002 und 2003. Ein Beweis, der so komplex war, dass die Überprüfung vier ganze Jahre dauerte.
Am Ende stand fest: alles korrekt. Perelman hatte vermutlich auch diese Lösung mit einer Version seines ganz persönlichen Rituals entwickelt: Nach dem Lesen der Fragestellung lehnte er sich mit geschlossenen Augen zurück, fing an, seine Handflächen immer fester an seinen Hosenbeinen zu reiben, rieb schließlich seine Hände aneinander, öffnete seine Augen und schrieb eine exakte und komplette Lösung nieder. Fehler unterliefen ihm nie. Bei komplexeren Problemen summte er leise vor sich hin – eine Melodie, die nach eigener Aussage das Musikstück Introduction und Rondo Capriccioso von Camille Saint-Saëns war, von seinen Kameraden aber als «Jaulen» und «akustischer Terror» beschrieben wurde. Der Beweis der Poincaré-Vermutung war eine Sensation, aber ein Star wollte Perelman nicht werden. Er lud seinen Beweis lediglich auf eine Internetseite hoch und wies per Mail einige wenige sorgfältig ausgewählte Kollegen darauf hin. Natürlich blieb seine Arbeit nicht dem kleinen Kollegenkreis vorbehalten. Als der Welt klarwurde, was geschehen war, konzentrierte sich alle Aufmerksamkeit auf Perelman. Er hätte jede Position an jeder Uni haben können, die Mathematik trug ihm die renommierte Fields-Medaille an. Das Clay Mathematics Institute wollte ihm die versprochene Million überweisen, inklusive einer Vortragsveranstaltung, die den Beweis und ihren Schöpfer feiern sollte. Das alles interessierte Perelman nicht. Interviews verweigerte er, er wollte nichts über sich in der Zeitung lesen. Er brach den Kontakt zu Kollegen ab, die sich über ihn äußerten. Die Million ließ er sich nicht auszahlen, die Fields-Medaille nahm er nicht an.
Vermutlich hätte er mehr Ruhe gehabt, wenn er die Ehrungen angenommen hätte. Die Geschichte des kauzigen Mathematikers in seinem kleinen Büro in Sankt Petersburg schlug die russische Boulevardpresse in ihren Bann. Perelman zog sich noch weiter zurück, betrieb keine Mathematik mehr und suchte die vollkommene Isolation. Er lebt bei seiner Mutter und spielt laut Hörensagen zeitweise Tischtennis gegen eine Wand.
Ob das nun der Knockout ist oder eher ein Befreiungsschlag – das kann jeder für sich selbst entscheiden. Die Naturwissenschaftler haben jedenfalls, das konnte wohl gezeigt werden, einiges zu bieten, wenn es um die größten Exzentriker geht.
Von Dandys und Träumern
Exzentriker bevölkern die heiligen Hallen der Geisteswissenschaft traditionellerweise sehr zahlreich. Schriftsteller, Musiker, Könige, Künstler – viele unter ihnen waren anders als der Rest. Manchmal ging das gut, oft aber auch nicht. Die Grenzen zwischen Exzentrik und Wahnsinn können fließend sein, daher sollten wir unsere Perspektive wechseln: Meist wird die Andersartigkeit von Exzentrikern als etwas zu Begaffendes dargestellt – vielleicht sollten wir stattdessen differenzierter betrachten, was sie denn so anders gemacht hat.
Während auf der gegnerischen Seite nur Forscher ihre Schwinger austeilen, steht bei uns der Stoff der Geschichte selbst auf den Brettern. Klar, schräge Forscher machen Spaß, aber das Bild vom schrulligen Literaturprofessor dürfte eher abgenutzt als erheiternd sein. Darum wenden wir uns lieber den Sujets dieser Professoren zu, den Menschen, die selbst zum Forschungsgegenstand geworden sind. Sie bilden ein unkonventionelles Team, das für die Gegner in der anderen Ecke des Rings schwer einzuschätzen sein dürfte.
Weil jeder Boxkampf auch von der Show lebt, schicken wir zuerst Oscar Wilde (1854–1900) in den Ring. Der erste Dandy überhaupt, heute als Literaturgröße gefeiert, eckte im viktorianischen England ordentlich an. Wilde war bekannt, gefeiert und gefürchtet für seinen schwarzen Humor und beißenden Spott. Noch dazu trat er als besonders auffällige, schillernde Gestalt auf. In seinem Essay The Philosophy of Dress schreibt er: «Mode ist nur eine Form der Hässlichkeit, die so unerträglich ist, dass wir sie alle sechs Monate ändern müssen!» Konsequenterweise trug er Samtjacketts, dekadente Pelzmäntel, Hüte in jeder Form und Höhe, Kniestrümpfe und beschleifte Schuhe à la Ludwig XIV. Außerdem gemusterte Halstücher, raffinierte Gehstöcke, Pfauenfedern und Capes, darüber die wallende dunkle Haarmähne.
Wilde war ein Unterstützer der Victorian Dress Reform-Bewegung, die praktischere Kleider für Frauen forderte – weg von den einschnürenden Korsetts. Für Wilde waren Geschlechter fließend: Er zog an, was er wollte und wie er es wollte – was nicht jedem gefiel. Und auch zur Innendekoration hatte er eine Meinung (wie eigentlich zu allem): «Diese Tapete wird mein Tod sein – einer von uns beiden muss gehen.» Vermutlich war das das Ende der Tapete.
Mit Büchern wie Bunbury oder Ernst sein ist alles und Das Bildnis des Dorian Gray gewann er zwar literarisch Anerkennung, aber seine Werke brachten ihm auch eine Menge Empörung ein. Wilde ist heute noch bekannt für seine knackigen, vor Dekadenz strotzenden Zitate: «Es ist eine sehr traurige Sache, dass heutzutage so wenig sinnlose Informationen verfügbar sind.»
Nun, wenn’s nur darum geht, hätte es ihm in unserer heutigen Zeit bestimmt gut gefallen (ich sage nur: Buzzfeeds Katzen auf Glastischen!). Wildes Markenzeichen – seine linke Gerade sozusagen – waren feinsinnige Beobachtungen von federleichter Eleganz, verpackt in böse Seitenhiebe (was uns Perlen wie «Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klassen» eingebracht hat). Außerdem ranken sich einige spleenige Anekdoten um dieses literarische Genie. So soll er beispielsweise angeblich eine Nacht lang an der Seite einer Schlüsselblume gewacht haben, weil sie ihm krank erschien.
Andere Aspekte seines Lebens waren allerdings deutlich weniger komisch. Wilde war mit Constance Lloyd verheiratet, die beiden hatten zwei Kinder. Sein Herz schlug jedoch für Männer. Wildes Homosexualität führte zum Skandal – obwohl seine sexuelle Orientierung ein offenes Geheimnis war. Seine Beziehung mit dem jungen Lord Alfred Douglas flog auf – Wilde drohte dafür eine Gefängnisstrafe. Douglas’ Vater, der Marquess of Queensberry, dem diese Affäre sehr missfiel, hatte großen Anteil an ihrer Aufdeckung.
Wilde tat nun etwas sehr Mutiges und zugleich sehr Gefährliches: Er verklagte Queensberry wegen Rufmord und brachte die ganze Angelegenheit 1895 damit erst vor Gericht. Queensberrys Anwalt Carson nahm unseren Schriftsteller im Kreuzverhör auseinander – hier wurde Wilde sein legendärer Witz zum Verhängnis. Carson zitierte aus Wildes literarischem Werk, unter anderem aus Dorian Gray, um Wildes homosexuelle Neigungen zu beweisen. Wilde verlor vor Gericht. Die Affäre wurde durch den Prozess aktenkundig und seine Homosexualität somit öffentlich, außerdem war er durch die Kosten finanziell ruiniert. Die Katze war nun ganz offiziell aus dem Sack – und die Räder der puritanischen Justiz kamen quietschend ins Rollen.
Wilde wurde wegen «grober Unanständigkeit» angeklagt und schließlich zu zwei Jahren «hard labour» verurteilt. Nach dem Absitzen seiner Strafe nahm er ein Schiff nach Frankreich und kehrte nie wieder nach England oder in sein Geburtsland Irland zurück. Wildes Mut und seine Beharrlichkeit machen ihn zu einem Kämpfer für die Literaturwissenschaft, der so schweigsame Gegner wie Dirac mit seinen Bonmots ganz schön zum Schwitzen bringt.
Wilde räumt nun den Ring für einen weiteren Anwärter auf den Titel des größten Exzentrikers, der schon seine seidenen Boxhandschuhe schnürt: Ludwig II. von Bayern (1845–1886). Über Ludwig ist viel geschrieben worden, manches ist wahr, manches erfunden. Er wurde als Verschwender bezeichnet, als Herrscher, der gar keiner sein wollte – jedenfalls nicht im realen Sinne, sondern irgendwo in seiner Tafelrundentraumwelt. Wie das immer so ist mit besonderen Figuren – über sie wird viel geredet. Ludwig war nie sonderlich interessiert an militärischen Dingen. Stattdessen ist seine ausgeprägte Phantasie überliefert, seine Vorliebe für Theater und seine Großzügigkeit. Er wurde jung König – mit nur 18 Jahren bestieg er 1864 den Thron.
Der «Märchenkönig» liebte den Komponisten Richard Wagner – und alles, was auch nur im Entferntesten mit dem Sagenkreis um König Artus und seine Ritter der Tafelrunde zu tun hatte. In diesen Phantasien war noch alles in Ordnung, der König war eine mächtige, mythische Gestalt. Die Realität sah ganz anders aus. So hatte Ludwig nach dem verlorenen Krieg 1866 gegen Preußen ein «Schutz- und Trutzbündnis» mit den Siegern schließen müssen. Er verlor damit die Macht über seine Armee im Kriegsfall – fatal, denn ein König ohne Heer ist kein wirklicher Herrscher mehr. Es wird klar, was Ludwigs Schlössertraumwelt war: eine Flucht aus der Realität.
Auf den Ruinen der Burg Hohenschwangau ließ Ludwig sein Traumschloss Neuschwanstein errichten. In einem Brief an Richard Wagner schrieb er: «Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöllatschlucht neu aufbauen zu lassen im echten Styl der alten deutschen Ritterburgen, und muss Ihnen gestehen, dass ich mich sehr darauf freue, dort einst […] zu hausen […] Sie werden sich rächen, die entweihten Götter, und oben weilen bei Uns auf steiler Höh, umweht von Himmelsluft.»
Und tatsächlich mutet Neuschwanstein an wie ein Schloss aus einer Sagenwelt. Es gibt Wandgemälde mit den Zyklen um Sigurd, Gudrun, Parzival, Lohengrin, Tristan und Isolde sowie Tannhäuser, die auch von Wagners Opernbearbeitungen dieser Erzählungen inspiriert sind. Besonders Lohengrin, der Sohn Parzivals und Gralsritter, hatte es Ludwig angetan. Er fühlte sich dem mythischen Lohengrin schon dadurch verbunden, dass sowohl dieser als auch sein eigener Vater Maximilian II. wie die Herren von Schwangau den Schwan als Wappen führten.
Ludwigs Bedürfnis zum Rückzug in eine Traumwelt wurde immer stärker. Ab 1875 schlief er tagsüber und lebte nur noch nachts. Neuschwanstein war seine Gralsburg und er selbst der Gralsritter. In der Dunkelheit bereiste Ludwig in prachtvollen Kutschen und Bahnen sein Traumreich und unternahm – möglich gemacht durch modernste Technik – Fahrten in der Schwanenbarke auf dem See. Zudem hatte er etwas für Grotten übrig – er ließ sich in seine Wohngemächer sogar eine künstliche Tropfsteinhöhle einbauen.
Diese Extravaganzen gingen nicht lange gut. Zwar hatte seine Technikfaszination auch positive Auswirkungen – er gründete 1868 die «Königliche Polytechnische Hochschule», die heutige TU München –, aber seine Baubegeisterung steigerte sich zur Besessenheit. 1886 war Ludwigs Kasse leer: Seine Schulden waren private, nicht die des Königreichs Bayern.
Mit Hilfe eines Gutachtens (der Gutachter hatte ihn nie getroffen, mit dementsprechender Vorsicht ist das Schriftstück zu sehen) wurde er entmündigt. Das Gutachten stellt fest: «Seine Majestät sind in sehr fortgeschrittenem Grade seelengestört und zwar leiden Allerhöchstdieselben an jener Form von Geisteskrankheit, die den Irrenärzten wohl bekannt mit dem Namen Paranoia (Verrücktheit) bezeichnet wird.»
Ludwig wurde von der Regierung abgesetzt und zunächst in Schloss Neuschwanstein interniert. Ein König, eingesperrt in seinem eigenen Schloss? Klingt nach dem Stoff, aus dem Märchen gemacht sind. Für Ludwig gab es allerdings keine sagenhafte Rettung mehr. Man fand ihn am Pfingstmontag 1886 tot im seichten ufernahen Wasser des heutigen Starnberger Sees.
Die Grenze zwischen Exzentrik und Wahnsinn ist fließend – und abschließend werden wir sie nicht sauber definieren können. Um Ludwigs Tod ranken sich heute noch Gerüchte und Verschwörungstheorien. Wie und warum der Monarch starb, werden wir wohl nie erfahren. Aber einer seiner Wünsche ist doch in Erfüllung gegangen. Seiner Erzieherin hatte Ludwig einst geschrieben: «Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen.» Das hat er erreicht.
Übrigens klotzte nicht nur Ludwig II