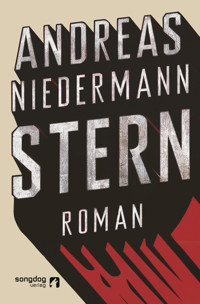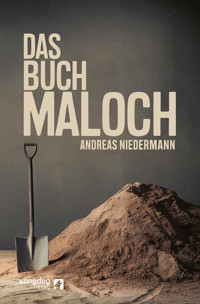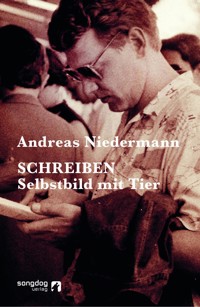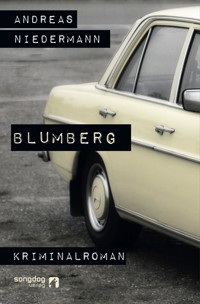7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Songdog-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In seinem zehnten Buch lässt Niedermann den jungen Kriminellen Rambo Rimbaud über die «Goldenen Tage» berichten, als dieser, inmitten der Jugendunruhen der achtziger Jahre und ihrer Häuserbesetzungen und Straßenschlachten, unbeirrt an seinem Plan feilt, der Post jene sagenumwobene Goldladung zu stehlen, von der ihm der alternde und publikumsmüde Schriftsteller Andreas erzählt hat. RRs Plan ist erst einmal völlig wasserdicht. Denn wenn es daneben geht, bleibt ihm immer noch die Fremdenlegion. Aber die Hilfe des alten Mannes hat einen hohen Preis. Und was ist gewonnen, wenn er die Goldbarren hat? Und was ist mit Zora? Und der schönen, flatterhaften Denise? Und wo soll das alles hinführen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Niedermann
Goldene Tage
Roman
Songdog-Verlag
Andreas Niedermann, *1956 in Basel. Lebt als Schriftsteller, Verleger und Blogger in Wien.
In Niedermanns zehntem Buch versucht ein junger Kleinkrimineller, »Rambo Rimbaud« genannt, sein Glück mit dem großen Coup. Er will der Bahnpost die sagenumwobenen »Goldeier«, zwei Goldbarren im Wert von fast einer Million Franken, stehlen. Das geht nicht allein. Der alternde, publikumsmüde Schriftsteller Andreas bietet seine Hilfe an. Nicht umsonst. »RR« soll ihm als Gegenleistung bei seinem Selbstmord behilflich sein. Irgendwann, wenn der Alte die Zeit für gekommen hält.
Im »Auge des Hurrikans«, während der Jugendunruhen der 80er Jahre, der Häuserbesetzungen und Demonstrationen, der Straßenschlachten und der »freien« Liebe, feilt »RR« unbeirrt an seinem Plan und führt ihn auch aus.
2. Auflage 2012
© Songdog Verlag, Wien
Cover: Yvo Egger
Lektorat: Markus Schütz
ISBN 978-39502890-7-7t
Für F. und B.
»Scheiß auf die Welt!«
John Rambo
»Oh! Verdammt Verdammt Verdammt Verdammt Verdammt!«
Arthur Rimbaud
»A troubled cure
for a troubled mind.«
Nick Drake
Kapitel 1
Ich bin ein Scheißkerl. Einige sagen, ich sei nur kriminell, aber das trifft die Sache nicht genau. Wer sich umhört, kann auch auf die Meinung stoßen, dass ich ein Künstler sei. Diese Ansicht sollte man nicht ernst nehmen. Ich jedenfalls tus nicht. Ich habe keine Ahnung, was einen Künstler ausmacht. Fragen Sie Boris und fragen Sie Zora. Die wissen solche Dinge. Oder Andreas. Der weiß Bescheid.
Kriminell zu sein ist einfach. Diesen Titel kriegt man umsonst. Der wird bei jedem Ladendiebstahl mit eingepackt. Aber Scheißkerl nicht. Den muss man sich erarbeiten. Aber das wurde mir erst später bewusst. Mein Name? Tut nichts zur Sache. Bleiben wir einfach bei den Namen, die Andreas mir gab: Rambo Rimbaud, »RR«. Der eine war mir ein Begriff, der andere nicht. Raten Sie, welcher mir ein Begriff war.
Vielleicht hätte ich all das nicht tun sollen. Aber wie ich von Andreas gelernt habe: Es zählt letztlich nur, was du getan hast. Und nicht das, was du hättest tun sollen. Oder lassen. Aber das wusste ich noch nicht, als ich aus dem pinienduftenden Süden in mein blödes Land zurückkehrte.
Den ersten Teil der Strecke blickte ich aus dem Fenster und dachte an die bevorstehende Schwierigkeit, die Grenze zu passieren. Es konnte sein, dass mein Name auf der Fahndungsliste stand und die Grenzer mich bei einem Routinecheck entdeckten und aussteigen ließen. Aber als es so weit war, zeigten die Zöllner kein Interesse an mir, und ich hörte auf, daran zu denken.
Den zweiten Teil der Fahrt dachte ich nur noch daran, wie ich an Sigurds und Bodos Geld herankommen konnte.
Sigurd und Bodo hießen natürlich nicht Sigurd und Bodo, aber ich konnte mir ihre richtigen Namen nicht merken. Da ihr Haar lang und deutsch und wallend war, der eine blond, der andere schwarz, nannte ich sie Sigurd und Bodo, nach den Comics aus den 60er Jahren, die ich im Nachlass meines Vaters gefunden hatte. Das war im Übrigen alles, was er mir hinterlassen hatte. Einen turmhohen Stapel Sigurd-Comics. Ich hatte sie noch am Tage seiner Beerdigung verkauft. Vermutlich weit unter Preis. Aber was solls? Ich hatte das Geld gebraucht. Gleich. Sofort. Und wenns brennt, nimmt man, was man kriegen kann, und rennt los. Aber nun war das Geld aufgebraucht. Und ich benötigte gewissermaßen neue Sigurd-Comics. Und da waren sie auch.
Ich war den beiden zu Dank verpflichtet. Ohne ihre Großzügigkeit hätte ich es nicht geschafft, von der Insel herunterzukommen. Ich hatte, ohne für Nachschub zu sorgen, mein ganzes Geld ausgegeben. Bankrott zu sein hat auf einer Insel gewisse Nachteile. Denn die kaputten Straßen enden immer an einem Hafen. Dort muss der Tramp dann aussteigen und sein Glück als blinder Passagier versuchen. Mir blieb diese Anstrengung erspart, denn die beiden nahmen mich in ihrem alten Mercedes mit, und sie bezahlten auch die Überfahrt auf den Kontinent.
Sigurd und Bodo waren grundanständige Typen, verdienten ihr Geld in einem harten Beruf. Sie waren Betreuer in einem »Heim für gefallene Mädchen«, wie sie manchmal halb im Scherz sagten. Aber die Mädchen, mit denen sie es ihren Erzählungen gemäß zu tun hatten, waren nicht »gefallen«. Die legten sich höchstens zu einer schnellen Nummer hin, beklauten dann den Freier oder drohten mit der Polizei und einer Anzeige wegen Verführung Minderjähriger, die sie dann großzügig unterließen, falls der Freier – ebenfalls großzügig – sein Portemonnaie leerte. Es waren gewissermaßen weibliche Kollegen von mir.
Diese »gefallenen Mädchen« aus ihren Erzählungen jagten mir Angst ein. Sie schienen jegliche Skrupel abgelegt, ja, nie welche besessen zu haben, und dies unterschied sie doch wesentlich von mir. Ich hatte Skrupel. Noch. Und um diesen wirkungsvoll zu begegnen, häufte ich während der Fahrt Negativpunkte für Sigurd und Bodo an, türmte im Geiste schwarze Chips zu schwarzen, wackligen Türmen und blickte leer aus dem Fenster.
»Wahnsinn, dieser Reichtum überall«, sagte Sigurd, der gerade mit Fahren an der Reihe war. Bodo knisterte mit der Karte auf den Knien.
Gut. Sie bemeckerten mein blödes Land. Das war ein schwarzer Chip mehr.
»Nur noch drei Zentimeter bis zur Stadt«, sagte Bodo. »Da legen wir eine Kaffee-Schiff-Pause ein.«
Das war ihr Spiel mit der Straßenkarte. Sie hatten es aus einem Film, über den sie oft sprachen. Mit Marius Müller-Westernhagen, der als Theo seinem gestohlenen Truck hinterherjagt und seinem Kumpel die Distanzen immer in Millimetern und Zentimetern angab. Es nervte. Noch ein schwarzer Chip.
Wie auch immer. Sie lagen falsch, was das Land anlangte. Zumindest aus meiner Sicht. Denn wenn ich aus dem Fenster blickte, konnte ich keinen Reichtum sehen. Ich sah nur eine trostlos zersiedelte Gegend mit flachen Betonbauten. Ich wollte sie nicht sehen. Darum beschäftigte ich mich intensiv mit dem Stapeln von unsichtbaren schwarzen Chips. Die Zeit drängte. Ich musste mir etwas einfallen lassen.
Kapitel 2
Ich hatte sie kennengelernt, als ich wie jeden Abend von meinem Beobachtungsposten in die Bucht zurückkehrte. Mein Posten befand sich auf einem kleinen Hügel direkt über dem Trainingscamp der Fremdenlegion, das sich zwischen Meer und Stadt erstreckte; ein unübersichtliches Gelände, wild und trocken und von einer Mauer umgeben.
Auf diesem Hügel verbrachte ich meine Tage, schwitzend in der sengenden Sonne, und sah den Legionären beim Training zu. Manchmal, wenn der Wind vom Meer kam, konnte ich ihren rasselnden Atem und ihr Keuchen hören, wenn sie unter dem Stacheldrahtverhau durchrobbten. Dann bildete ich mir ein, den Fremdenlegionärsschweiß zu riechen, eine Mischung aus Käsefüßen, wildem Thymian und ranzigem Gewehrfett. Aber das war nur Einbildung. Denn in Wirklichkeit knallte die Sonne wie ein Stößel in den Mörser und zerrieb die Welt zu einem brennenden, graugelben Pulver.
Aber wenn die Soldaten sich für eine Rauchpause im Schatten der kleinen Mauer niederkauerten und ich die Wolken des Zigarettenrauchs aufsteigen sah, dann dachte ich daran, durch das Tor zu gehen, das sich zweihundert Meter weiter westlich über der siedenden Asphaltstraße wölbte. Ich wollte es tun, aber ich tat es nicht. Das war mit ein Grund, warum ich täglich auf dem Hügel an der Sonne hockte und ihnen bei ihrer Schinderei zusah. Ich wollte es tun. Runtergehen. Durchs Tor. Rein ins Büro und dem diensthabenden Wachtmeister sagen: »Bonjour Caporal. Je voudrais être un soldat de la Légion étrangère!«
Aber wie gesagt, ich tat es nicht.
In den Nächten lag ich am Strand und blickte angetrunken in diesen Himmel mit den Van-Gogh-Sternen.
Als dann Sigurd und Bodo auf dem Campingplatz in der Bucht auftauchten, bedeutete dies eine gewisse Abwechslung. Sie hatten bereits einige Abenteuer bestanden, und gegenwärtig steckten gerade eineinhalb Dutzend Seeigelstacheln in Sigurds rechtem Fuß. Bodo machte sich am Steg mit Pinzette und Jod darüber her. Ich fands bescheuert, auf einen Seeigel zu treten. Sie waren derselben Ansicht. Aber letztlich waren sie ganz froh darüber, denn die vielen schmerzenden und entzündeten Löcher in Sigurds Fuß nahmen das Tempo aus ihrem Urlaubstrip und zwangen sie endlich, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen.
Ich ging nun eine Weile nicht mehr auf den Hügel und begleitete Bodo und den hinkenden Sigurd an den Abenden in die Altstadt, wo in den engen Gassen und den Hauseingängen die schönen Huren standen und mit den Fremdenlegionären verhandelten. Aus der Nähe sahen die Söldner wahrhaft furchterregend aus, und niemand hätte es gewagt, sich mit ihnen anzulegen. Sigurd, Bodo und ich zogen durch die Straßencafés und sahen den Touristinnen nach. Aber ich dachte nur an das Tor.
Sigurd und Bodo machten sich in den nächsten Tagen an zwei Mädchen, Angestellte des Campingplatzes, heran und verbrachten von nun an die Tage am Strand. Sie lagen dicht an dicht an der Sonne, rieben sich gegenseitig mit Sonnenöl ein und hörten keine Sekunde auf zu lachen und zu kichern, während sie einander deutsche und französische Sprachbrocken zuwarfen. Dieser neue Zeitvertreib meiner Bekannten verbannte mich wieder auf den Hügel. Aber ich wollte da nicht mehr hin und hockte im Camping-Café herum und beobachtete die Touristen, wie sie Café au lait tranken. Aber es war blöde, so alleine herumzusitzen, und als ich schon wieder meinen Hügel aufsuchen wollte, lernte ich ein deutsches Pärchen kennen.
Ich ging mit ihnen zu den Lagunen. Sie hatten Hobbytaucherausrüstungen mit dabei, und sie gaben mir eine Tauchermaske, Schnorchel und Flossen. Wir zogen uns nackt aus und ich schwamm dicht hinter der Frau her und beobachtete durch die Tauchermaske das Spiel ihrer Schamlippen.
Später ließen wir uns im Sand nieder und schickten uns an, zur Sache zu kommen. Aber es roch so durchdringend nach Aas, dass ans Ficken nicht zu denken war. Ich erklomm die Düne, die sich hinter uns erhob. Direkt hinter dem Kamm lag eine Ziege mit geblähtem Bauch an der Sonne und faulte. Ich sah, wie die Maden aus ihrem Arsch krochen.
Wir packten unser Zeug zusammen, verließen eilig den Ort und suchten uns einen Platz, wo man die Ziege nicht mehr riechen konnte. Wir wollten es nochmals versuchen, aber irgendwie war die Luft draußen. Dann begann die Frau zu reden und hörte nicht mehr auf. Daraufhin erklärte ich ihnen, dass ich noch einen Termin im Büro der Fremdenlegion hätte. Sie taten höchst verwundert und wussten nicht, ob sie mir glauben sollten. Ich sagte, es tue mir leid, und verschwand auf den Hügel beim Camp.
Dieses Mal war auf dem Hügel alles anders. Vielleicht lag es an dem alten Strohhut, den ich unten am Strand gefunden hatte und der mein Gehirn vor dem Sonnenstößel schützte und seine Schläge dämpfte. Vielleicht lag es auch nicht daran, und es war schlicht so, wie es im Leben oft war: unverständlich, undurchdringlich, stiefelsinnig und banal. Denn meine Unfähigkeit, einfach durch das Tor zu gehen und zu tun, was ich schon längst zu tun gedachte, fußte auf der Tatsache, dass es irgendwie unschicklich war. Ich wähle dieses Wort bewusst, denn ein besseres will mir nicht einfallen. Es schickte sich einfach nicht, in einer Gemeinschaft von Mördern, Dealern, Räubern und Vergewaltigern nichts anderes vorzuweisen zu haben als den Kleinkram, den ich verbrochen hatte.
Die Fremdenlegion war der allerletzte Zufluchtsort. Und man meldete sich nicht in die Legion, ohne zuvor etwas »Richtiges« versucht zu haben. Das schickte sich einfach nicht. Aber nur ein kompletter Idiot versuchte auf einer Insel, die nur mit Flugzeug oder Fähre wieder zu verlassen war, etwas »Richtiges«.
Das war der Grund, warum ich zurück wollte. Zurück in mein blödes Land.
Kapitel 3
Nach einigen Stunden erreichten wir die Stadt in meinem blöden Land und ließen uns mit dem Verkehrsstrom ins Zentrum treiben. Die Zeit drängte, denn hier würden sich unsere Wege trennen. Aber ich hatte noch immer keine Idee, wie ich sie abziehen wollte.
Bodo parkte den Mercedes beim Dom und wir wanderten ein wenig herum. Ich zeigte ihnen die Innenstadt, das übliche Touristenprogramm, die berühmte Kirche, das Theater und so, und Sigurd sagte, dies sei eine »ganz nette Kleinstadt«.
Niemand, den ich kenne, hört gerne, dass die Stadt, in der er lebt, eine »ganz nette Kleinstadt« sei. Ich versuchte die beiden deswegen zu hassen, gab es aber bald auf, denn es ist anstrengend, jemanden wegen einer beiläufigen Äußerung zu hassen.
Das Treiben in den Straßen erschien mir vollkommen sinnlos. Die anfahrenden und abfahrenden Trambahnen, das Volk in den Straßencafés, die Süchtigen, die im Schatten einer Mauer auf die Dealer warteten. Alles Theater. Es wäre mir lieber gewesen, es hätte Hämmer geregnet.
Davon angewidert lotste ich uns dann in einen Biergarten, den ich von früher kannte. Dort saßen wir im Schatten von muskulösen Platanen, und ich konnte nicht verhindern, dass meine Füße nervös in Kies und Zigarettenstummeln herumscharrten. Sigurd und Bodo bestellten Kaffee und Wasser. Ich dachte an ihr Geld. Der Abschied nahte. Ich sah zu, wie sie den Kaffee und das Wasser schlückelten, und mit jedem Schluck schwanden meine Chancen. Dann kam der Moment, wo ich mir sagte: »Scheiß drauf!«, und ich fand mich damit ab, dass ich ohne Geld in einer Stadt war, die ich vor einiger Zeit verlassen hatte. Ein eigenartiges Gefühl der Erleichterung und Bitterkeit überkam mich.
Sigurd und Bodo erhoben sich gleichzeitig, als hätten sie das lange eingeübt. Ich versuchte noch mal die imaginären schwarzen Chips zu zählen, die ich im Geist zu ihren Ungunsten aufgetürmt hatte, aber es war vorbei.
»Du musst dein Gepäck aus dem Auto holen«, sagte Bodo.
»Ich habe kein Gepäck.«
»Du hast kein Gepäck?«
»Ich habe diese Tasche da«, sagte ich und hob sie auf, um sie ihm zu zeigen.
»Und so warst du die ganze Zeit unterwegs?«
»So war ich die ganze Zeit unterwegs.«
Bodo machte ein Gesicht wie ein Typ, der plötzlich merkt, dass ihm ein Ärmel an der Jacke fehlt.
»Was hast du jetzt vor?« fragte Sigurd und legte einen Schein für die Rechnung auf den Tisch.
»Ich werde wohl ein Ding drehen«, sagte ich.
»Mach keinen Scheiß«, sagte Bodo.
»Pass auf dich auf«, sagte Sigurd. Dann zog er sehr langsam zwei Hunderter aus seiner brandneuen Lederbrieftasche, die er in Sartène gekauft hatte, und überreichte sie mir.
»Gibst du mir nächstes Mal zurück«, sagte er.
Nächstes Mal? Es würde kein nächstes Mal geben. Wir umarmten uns.
Ich sah ihnen nach, wie sie lässig über den knirschenden Kies zu ihrem Auto schlurften. Wir würden uns nie wieder sehen. Wie seltsam das war. Seltsamer war nur, daran zu denken, dass es so war.
Kapitel 4
Den Anfang der Nacht verbrachte ich auf dem Bahnhof. Ich saß in einem neu erbauten Glaskubus, der als Wartesaal ausgewiesen war, und sah den Typen von der Bahnpost zu, wie sie Pakete und Säcke in die Züge ein- und ausluden. Sie trugen graue Arbeitskittel, und in ihren Brusttaschen steckten kleine, schwarze Büchlein, die sie oft herauszogen, um hineinzusehen.
Manche der Waggons, die sie ausluden, waren bis unter die Decke mit Postsäcken vollgestopft. Die Graukittel schafften ganze Karawanen an Leiterwagen heran, die sie mit den Säcken beluden und die dann von kleinen, gelben Zugmaschinen zu den Liften am Ende der Bahnsteige gezogen wurden. Dort koppelten die Liftjungs die Wagen ab, schoben sie in die Lifte und ließen sie mit einem Knopfdruck verschwinden. Einer nach dem anderen versank unter den Gleisen.
Irgendwann kam ein uniformierter Angestellter der Bahn und wollte meine Fahrkarte sehen. Ich sagte ihm, er solle sich verziehen, was er auch tat. Aber dann sah ich ihn mit zwei Bullen im Schlepptau wieder heranmarschieren. Das war schlecht. Mir fiel ein, dass ich vermutlich immer noch auf der Fahndungsliste stand, und ich wollte nicht gleich die erste Nacht in der Stadt im Knast verbringen – eine Nacht, der möglicherweise noch weitere folgen würden, und diesen dann noch ein paar, und so weiter und so fort.
Ich zog mich zurück, tauchte in die Unterführung ab, stieg die Treppe wieder hoch und stand dann auf dem Bahnhofsplatz. Ich sah zu, wie drei der Typen mit den grauen Kitteln durch den Taxistau tanzten und in einer Bahnhofskneipe mit Butzenscheiben verschwanden. Ich folgte ihnen.
Dann saß ich ein paar Stunden an einem Tisch in dem gemütlichen, holzgetäfelten Pub, trank Bier und sah den Jungs bei ihrem Treiben zu. Die Graukittel kamen und gingen. Sie steckten die Köpfe zusammen und blickten in ihre kleinen Bücher, die nicht schwarz, sondern schwarzweiß marmoriert waren, tranken Bier und waren guter Dinge. Wenn sie wieder gingen, dauerte es meist nicht lange, bis sie wiederkamen. Dann tranken sie wieder Bier und aßen mit Käse überbackene Toasts, die offenbar zu den Spezialitäten des Hauses gehörten.
Die Kellnerin trug eine weiße, weit aufgeknöpfte Bluse, aus der ihre Brüste quollen. Wenn sie an meinem Tisch vorbeiging, konnte ich hören, wie ihre schwarzen Strümpfe aneinanderrieben. Beim Zahlen setzte sie sich neben den Mann mit der Brieftasche und drängte ihre Schenkel gegen seine. Ein guter Kellnerinnentrick. Das gab fettes Trinkgeld.
Als das Lokal schloss, war ich betrunken. Ich machte mich auf den Weg hinunter zum Fluss. Die Straßenbahnschienen schimmerten wie falsche Zähne, und die Sterne am mitteleuropäischen Himmel nahmen sich mickrig aus. Wie die Pimmel fetter Nudisten. Dann wurde ich sentimental, weil ich dem Süden den Rücken gekehrt hatte. Ja. Der Norden war gut für alte Kerle. Von mir aus. Aber der Süden gehörte der Jugend.
Unten am Fluss kannte ich eine Badeanstalt, die auf Pfählen in den Strom gebaut war. Da wankte ich hin. Die Straßen waren leer, aber trotz meiner Trunkenheit war ich achtsam. Ich war immer achtsam. Das war das Beste an mir. Meine Achtsamkeit.
Die Badeanstalt war umzäunt. Der Zaun trug eine Krone aus Stacheldraht, aber irgendwie schaffte ich es, sie zu überwinden. Man sagt, dass Besoffene einen Schutzengel haben. Das glaube ich nicht. Aber in jener Nacht mochte es wohl stimmen. Kein Kratzer. Kein Riss. Weder in Hemd noch Hose.
Ich suchte den Frauenumkleideraum und streckte mich auf der Holzbank aus. Bei den Frauen roch es einfach besser. Obschon ich nur das Wasser riechen konnte, Sonnenöl und Fisch. Ich hörte den Fluss, der unter mir nach Norden strömte, und ich hörte, wie er dabei an den Pfeilern schmatzte und sog. Sein steter Strom wirbelte kühle Luft durch den Bodenrost. Sollte er.
Kapitel 5
Boris und Zora waren nicht zu Hause. Ihr Briefkasten, das konnte ich durch die Perforierung sehen, war leer. Also waren sie nicht verreist. Aber sicher war das nicht.
In der Nähe gab es einen Supermarkt, und ich ging rein, legte etwas Weißbrot, Schinken und Essiggurken für Sandwiches in den Einkaufswagen. Die Filialleiterin kam aus ihrem Büro und beobachtete mich, während sie tat, als suche sie im Süßigkeitenregal nach abgelaufener Ware. Kein Wunder. Ich brauchte dringend eine Dusche und frische Kleidung. Meine Hose hatte an der Innenseite des rechten Knies einen großen Dreiangel, den ich mir beim Verlassen der Badeanstalt geholt hatte. Er ließ sich nur verbergen, wenn ich beim Gehen die Knie dicht beisammen hielt. Aber das tat ich nicht. Ich ging zu ihr hin und fragte, ob »ihr Geschäft« auch Nähsachen führe. Sie musterte mich durch eine Goldrandbrille. Ich zeigte ihr den Dreiangel und sagte, dass mich unten am Fluss ein Schäferhund gebissen habe. Zumindest habe er es versucht.
»Und jetzt wollen Sie diesen Riss nähen?«
»Ich bin auf der Durchreise, und man hat mir am Bahnhof mein Gepäck gestohlen.« Das war dicke Post. Aber wenn schon lügen, dann richtig.
Sie sah mich an, ich sah sie an, und ich sah, wie ihr Misstrauen verglomm wie ein gerissener Lampendraht.
»Ach Gott, heute wird einfach alles gestohlen. Es ist schrecklich.«
»Und überall diese freilaufenden, unerzogenen Hunde«, sagte ich.
Sie wies mir den Weg zu den Nähsachen. Ich bedankte mich und lenkte den Wagen zu den Spirituosen, wo ich mir eine Flasche V.S.O.P.-Cognac in einer flachen Flasche griff und sie in den Wagen stellte. Auf dem Weg zu den Nähsachen nahm ich sie wieder heraus, ließ sie an Gürtel und Bund vorbei in die Unterhose gleiten und parkte den Wagen vor den Nähsachen. Während ich mit der einen Hand die Fadenspulen prüfte, platzierte ich mit der anderen die Flasche so, dass sie erstens nicht sichtbar war und zweitens beim Gehen nicht durch ein Hosenbein rutschte.
Dann kam die Filialleiterin.
»Haben Sie den passenden Faden gefunden?«
»Noch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich bin bald zu Hause und kann die Hose wegschmeißen.«
»Man soll nicht immer alles gleich wegwerfen. Es macht Freude, wenn man etwas reparieren kann, finden Sie nicht?«
Sie blickte abwechselnd auf meine ausgebeulte Hose und die Fadenspulen. Dann nahm sie eine blaue aus dem Regal, beugte sich vor und brachte sie nahe an den Hosenstoff.
»Der passt«, sagte sie.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Ich schob den Wagen zur Kasse. Als ich bei den Getränken vorbeizog, hörte ich sie rufen.
»Hallo! Hallo! Warten Sie!«
Ich positionierte die Flasche in der Unterhose so, dass sie höchstens wie ein imposanter Ständer aussah.
»Haben Sie denn alles?«
»Was meinen Sie?«
»Fehlt Ihnen nichts?«
Ihre Augen hinter den Gläsern sahen aus, als hätte sie gerade um einen toten Kanarienvogel geweint und die Tränen mit einem Jutesack aufgetrocknet.
Ich verneinte. Aber sie schüttelte mit gespielter Traurigkeit den Kopf und fragte, ob ich sicher sei.
»Mir fehlt nichts.«
Sie streckte mir die offene Hand hin. Ein schwarzes Wachspapier lag darin. Nähnadeln.
»Oh!« sagte ich und wollte gleich noch »Wie dumm von mir!« anhängen, ließ es aber bleiben, da mir der Zusatz zu übertrieben erschien. Ich nahm die Nadeln, bedankte mich noch mal und zahlte an der Kasse.
Draußen auf der Straße fischte ich den Cognac aus der Unterhose, ungeschickt und tatterig wie ein alter Alkoholiker in einem Penner-Film, und so entglitt die Flasche meinen Händen und zersprang auf dem Asphalt.
Ich tauchte mit leeren Händen bei Boris und Zora auf.
Kapitel 6
Zora packte Unterwäsche in eine Reisetasche mit Schottenmuster. Boris saß in der Küche, trank Espresso und las die Zeitung. Sie taten, als wären sie nicht überrascht.
»Möchte jemand ein Schinkensandwich?« fragte ich.
»Du kannst hier für ein paar Tage wohnen«, sagte Boris, ohne von seiner Zeitung aufzublicken. Dann kam Zora in die Küche und schlang ihre Arme um mich.
»Wir fahren in Urlaub«, flüsterte sie in mein Ohr. Wir hielten uns umschlungen, und sie machte keine Anstalten, mich loszulassen. Ihr Haar roch noch immer gleich wie das letzte Mal, und ihr Hals war weiß und kühl wie der Hals von jemandem, der sich gerne in abgedunkelten Zimmern aufhält und die Sonne mied.
Ich konnte mir schwer vorstellen, wie Zora Urlaub machte. Oder Boris. Ich nahm an, sie fuhren irgendwohin und taten dort alles genau gleich, wie sie es hier taten. Aber da ich nicht genau wusste, was sie eigentlich taten, stellte ich mir vor, dass Boris durch die Straßen ging, um einen Laden mit seiner Leibzeitung zu finden. Dann würde er zurückgehen und sie lesen, Espresso schlückeln, während Zora bei heruntergelassenen Jalousien in einem Buch las. So stellte ich mir ihren Urlaub vor.
Boris und Zora waren Künstler und hatten was übrig für Kriminelle. Wenn man darüber nachdachte, war das seltsam und vielleicht grotesk, aber ich habe gelernt, dass viele Künstler so empfinden. Weil sie gegen die Gesellschaft sind. Warum Künstler gegen die Gesellschaft sind? Ich glaube, weil die Gesellschaft ihnen nicht freiwillig die Herrschaft überlässt. Das ist eine Vermutung.
Bei Boris mochte es wohl so sein. Es gab nichts, worüber er nicht stundenlang reden konnte und eine Meinung hatte. Er hatte zu allem eine verdammte Meinung. Das war beachtlich. Ich selber hatte zu vielen Dingen keine Meinung. Aber was heißt hier, zu vielen? Zu den meisten Dingen. Ich denke, dass es fast allen so ergeht. Trotzdem tun sie so, als hätten sie eine Meinung, einen Standpunkt. Aber in Wahrheit plappern sie nur nach, was sie irgendwo aufgeschnappt haben. Wie sollte es auch anders sein? Und was ist dagegen zu sagen? Sollen sie doch so tun, als hätten sie eine Meinung. Es kümmert keinen und macht keinen Unterschied. Meine Meinung. Ebenso war ich der Meinung, dass Meinungen hinderlich sind und den Blick und die klare Sicht auf die Wirklichkeit vernebeln. Aber das behielt ich für mich.
Boris tat nun irgendwas in meinem Rücken, was Zora veranlasste, sich von mir zu lösen.
»Ich muss fertigpacken«, sagte sie und glitt auf nackten Sohlen aus der Küche.
»Sollte ich fragen, was dich in unsere Gegend führt?« fragte Boris.
»Ja, frag doch mal.«
»Ach was. Interessiert doch keinen.«
»Aber du könntest ein wenig Interesse heucheln.«
Boris faltete die Zeitung zusammen.
»Wir sind in zwei Wochen wieder da«, sagte er, stand auf und schob den Kaffeehaussessel zur Seite. »Und … ach ja … kann sein, dass du Gesellschaft bekommst. Wird dich nicht stören. Sie heißt … he, Zora, wie heißt sie … «
Zora rief aus dem Nebenzimmer einen Namen, den wir nicht verstehen konnten. Boris machte eine Handbewegung.
»Wir betreiben jetzt eine Pension. Pension › Umsonst ‹. Wenn wir wieder zurück sind, bist du verschwunden … «
»Wie immer.«
»Wo kommst du eigentlich her?«
Ich sagte es ihm. Er brummte was und schlurfte aus der Küche. Ich machte mir ein Schinken-Gurken-Sandwich. Ich aß es an den Türrahmen gelehnt und sah ihnen beim Packen zu. Einmal sah Zora auf und lächelte.
Kapitel 7
Am nächsten Tag hatte ich die Wohnung für mich allein. Mir blieb noch genügend Geld, um die Supermärkte der Umgebung zu besuchen und kleine Einkäufe zu tätigen. Ich ließ bei jeden Einkauf eine Flasche des besten Schnapses mitgehen. Es lief ganz gut.
Ich hatte mir einige Sachen aus Boris’ Schrank ausgeliehen. Die Hosen passten, die Hemden nicht. Boris war Pykniker und ich Athlet. Behauptete Zora. Bei den T-Shirts spielte es keine Rolle.
Schwieriger als das Stehlen war das Hehlen. Aber das war meistens so. Ein guter Dieb war nicht immer auch ein guter Hehler, und oft bedeuteten Hehlerfehler den Absturz brauchbarer Diebe. Und mit Absturz meine ich Erwischtwerden. Das Stehlen war eine Frage der Konzentration, und wie der erfolgreiche Berufsspieler durfte sich der Dieb nie in Sicherheit wiegen, musste hellwach seinen Eingebungen vertrauen und niemals gegen seine Instinkte handeln. Der Dieb ist ein Schakal. Das paranoideste Tier unter der Sonne. Hatte ich mal gelesen. Vielleicht stimmte es. Vielleicht auch nicht. Aber aufpassen musste man.
Aber ich konnte das Hehlerproblem lösen. Ich traf unten am Fluss, wo immer eine Menge junges Volk und Touristen anzutreffen waren, einen arbeitslosen Drucker namens Semmy. Er riet mir, den Stoff in den Kneipen, die er frequentierte, anzubieten. Das tat ich. Es funktionierte. Mein Preis war besser als der vom Großhändler, und sie konnten den Schnaps schwarz verkaufen. Gegen einen kleinen Zusatzgewinn hatte niemand etwas einzuwenden. Auch wenn es illegal war. Legal, illegal, scheißegal. Nun, das waren so meine Theorien. Niemand interessierte sich dafür. Nicht mal ich selber. Sie waren ein abendlicher Zeitvertreib. Besser als Fernsehen. Aber Zora und Boris hatten kein Fernsehen, und darum saß ich im Dunkeln in der Küche und hörte bei offenem Fenster in den Hinterhof hinein. Manchmal dachte ich auch an die Legion, an die Huren in den Gassen und daran, wie gut sie alle ausgesehen hatten.
Kapitel 8
Eines Abends zog es mich wieder zum Bahnhof.
Ich setzte mich in den Glaskubus und sah zu, wie die Sonne in den Schlitz zwischen Dach und Bahnsteig sank. Als sie beinahe hinter der Bahnsteigkante verschwunden war, gleißte die Bahnhofswelt, als wäre sie aus Gold. Die Dachstützen, die Züge, die Passagiere, die Wagen, Automaten, Geländer und Gepäckstücke. Alles in Gold. Sehr schön.
Ich verließ den Kubus und den Bahnhof, überquerte die Straße und ging ins »Bristol«, das Lokal mit den Butzenscheiben. Eine Menge Graukittel waren da. Alles, so schien es, war wie das letzte Mal. Die Kellnerin trug die weiße Bluse und den schwarzen Rock, und die Strümpfe machten dieses Geräusch, wenn die Schenkel sich beim Gehen berührten. Nur waren dieses Mal alle Tische besetzt.
An einem Ecktisch saß allein ein wuchtiger Mann. Mit seinen langen Haaren wirkte er wie eine nachdenkliche Hyäne, der ein Spaßvogel ein kariertes Hemd angezogen hatte. Vielleicht war er gar nicht wuchtig, sondern nur dick. Vor ihm standen eine Flasche Rotwein und ein volles Glas. Ich fragte ihn, ob es ihm recht sei, wenn ich mich eine Weile an seinen Tisch setze. Er sah mich an und nickte. Ich meine, er nickte nicht mit dem Kopf, sondern schloss nur kurz die Augen, was ich als ein Ja deutete. Ich zog einen Stuhl heran. Er musterte mich.
»Du siehst aus wie der junge Rimbaud«, sagte er.
»Schön für ihn«, sagte ich.
Er grinste etwas spöttisch.
»Du hast keine Ahnung, wer Rimbaud ist, stimmts?«
»Ich weiß, wer Rambo ist«, sagte ich.
»Na klar«, sagte er.
»Suchen Sie Streit?«
»Immer«, sagte er.
»Nur zu«, sagte ich. »Hier bin ich. Wir können vor die Tür gehen. Jederzeit.«
»Also gut. Lass uns gehen, Rambo Rimbaud.«
Seine Reaktion überraschte mich. Wer erwartet denn, dass ein alter Mann gleich pampig wird? Ich versuchte ihn einzuschätzen. Er wog vermutlich weit über hundert Kilo, und auch wenn da einiges an Fett war, so war mir klar, dass er mich nicht in die Hände kriegen durfte. Nun, dies war nicht meine erste Prügelei. Und es wäre auch nicht die erste, die ich verloren hätte.
Er erhob sich erstaunlich behände für seine Körpermasse und schob den Tisch beiseite. Als er zur Tür ging, sah ich, dass er ein wenig hinkte. Als wäre sein rechtes Bein ein bisschen kürzer, oder so. Aber vielleicht bildete ich mir es nur ein.
»Alter«, sagte ich, als er sich umdrehte, um sich zu überzeugen, dass ich ihm auch folgte, »jetzt kannst du noch aussteigen. Denn das wird richtig hart für dich.«
»Wird das Hemdchen feucht, Rambo Rimbaud?«
»Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!«
Die Kellnerin war stehengeblieben und sah uns nach. Ihre Lippen bewegten sich lautlos und ihr Busen hob und senkte sich schnell. Eins war sicher: Sie kannte den alten Bastard. Ganz bestimmt kannte sie den alten Bastard. Ich fühlte mich in der Minderheit. Ich konnte das Ding nicht gewinnen. Nicht wirklich. Auch wenn ich es gewann.
»Du gehst schon, Andreas?« sagte sie und dehnte die Worte. Ihre Stimme zitterte ein wenig.
Der Alte hob die Hand und wedelte damit ein Nein. Aber er wandte sich dabei nicht um und stieß die Tür auf. Ein Schwung Graukittel flutete herein und drückte sich an seinem Bauch vorbei. Zwei begrüßten ihn mit Namen.
Ich trat dicht hinter ihm auf die Straße. Normalerweise hätte ich diese Chance bereits genutzt und ihm von hinten die weiche Faustseite auf die Halsschlagader gesetzt. Oder zumindest in diese Gegend. Man traf nicht immer richtig. So einfach war das nicht. Manchmal bewegten sie sich just in diesem Moment, oder sie sahen aus den Augenwinkeln die Faust heranfliegen und hielten deswegen nicht still. Wenn man einen Kampf gewinnen wollte, sollte man ihn entweder vermeiden oder aus dem Hinterhalt agieren. Alles andere war romantischer Bockmist. Oder Hollywood.
Aber es kam alles ganz anders.
Kapitel 9
Am nächsten Morgen erwachte ich später als sonst und spürte, dass etwas anders war. Ich richtete mich auf der Matratze auf. Die Sonne stemmte sich gegen das Bambusrollo vor dem Fenster. Ich horchte und vernahm Schritte. Ich war nicht mehr allein. Dann betrat sie das Zimmer. Blieb in der Tür stehen.
»Es gibt keinen Kaffee mehr, weißt du das?« sagte sie. Ich antwortete nicht und betrachtete ihre Knie, das Spiel ihrer Kniescheiben. Sie waren groß und lebendig und die Haut darüber war ein wenig schrumpelig, wie bei jemandem, der nie, auch nicht in der Kälte, Strümpfe trug. Der Anblick der Knie warf mich in der Zeit zurück, wie ein alter Song. Aber ich wusste nicht, wohin. Es brannte ein wenig. Sehr seltsam.
»Ich trinke keinen Kaffee«, sagte ich.
»Das wird sich ändern.«
Sie drehte sich um und ging. Der Luftzug hob ihre blonden Haare auf der Schulter sachte an, und dann war sie verschwunden. Ich hörte, wie die alte, schwere Haustür ins Schloss fiel.
Ich stand auf, ging ins Bad und betrachtete mein Gesicht im Spiegel. Keine Blessuren. Das war noch mal gutgegangen. Gestern. Was hatte ich getan? Ich hatte es an Vorsicht fehlen lassen. Emotionen. Machoscheiße. Testosteron. Man geht nicht vor die Tür einer Kneipe und prügelt sich mit einem Fremden. Vor allem nicht, wenn man vielleicht auf der Fahndungsliste steht. Tut man nicht. Einerseits. Andererseits, was war denn schon geschehen?
Noch während der Alte und ich aus dem Lokal gingen, drängte ich mich an ihm vorbei, bezog auf dem Gehsteig Stellung und erwartete seinen Angriff. Ich meine, ich wollte erst mal sehen, was er vorhatte. Es war unwahrscheinlich, dass er sich gleich auf mich stürzte, aber ich wahrte etwas Distanz. Der Alte blieb gleich bei der Tür stehen. Wir sahen uns im gelben Licht der Straßenbeleuchtung an, wie zwei unschlüssige Touristen vor dem Einlass zur »Frau ohne Unterleib«. Die Distanz zwischen uns betrug drei Schritte. Da war auf die Schnelle nicht viel zu machen. Der Alte hatte seine Hände in die Levi’s gesteckt, aber so, dass nur die Fingerspitzen in den Taschen waren. Als ich einen halben Schritt nach vorne machte, erblickte ich eine Streife, die schnurstracks auf uns zukam. Ein riesiger Polizist und seine Kollegin. Sie sahen aus, als wären Vater und Tochter als Polizeistreife verkleidet auf dem Weg zum Maskenball. Ich drehte ab, ließ die Hände sinken und ging los. Zuerst langsam, dann schneller. Ich umrundete den Block, kam am Pförtner der Bahnpost vorbei, der in seinem Glashaus saß und auf einen kleinen Fernseher starrte.
Es dauerte eine Weile, bis ich wieder vor der Tür des Lokals stand. Andreas war nicht mehr da. Ich ging hinein. Er saß wieder an seinem Tisch. Diesmal nicht allein, sondern in Gesellschaft der Kellnerin. Ihr Gesicht drückte tiefe Missbilligung aus, als sie mich herankommen sah. In diesem Moment fragte ich mich, warum ich zurückgekommen war. Was wollte ich hier? Ein paar Dinge klarstellen. Wollte dem Alten sagen, dass ich nicht abgegangen war, weil sein Anblick so furchteinflößend war, dass einer wie ich einen wie ihn nicht zu fürchten brauchte. All so was.
Der Alte hatte seinen Blick auf das Weinglas gerichtet, das jetzt leer war. Er drehte es in seinen Fingern. Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich ihm gegenüber. Die Kellnerin sagte etwas zu ihm, das ich nicht verstehen konnte. Andreas schüttelte den Kopf. Sie stand auf und füllte sein Glas wieder auf. Sie würdigte mich keines Blickes mehr. Sie stellte die Flasche hart auf den Tisch und ging, ritsch, ritsch, ritsch. Ihr weiche Hüfte streifte dabei meine Schulter.
»Nicht scharf auf die Bullen, was?« sagte der Alte.
»Ich nenn sie nicht Bullen«, sagte ich.
»Interessant. Wie nennst du sie denn? Polizisten?«
»Ich nenn sie gar nicht.«
»Wir nannten sie Bullen. Oder Schmier«, sagte er und leerte das Glas in einem Zug. Dann goss er nach. »Schmier. Interessant, oder? Kommt vermutlich von schmieren. Oder was meinst du, Rambo Rimbaud?«
»Ich meine gar nichts. Aber dein Lieblingswort scheint › interessant ‹ zu sein, und wer andauernd interessant sagt, will vermutlich verbergen, dass er ziemlich langweilig ist.«
»Oh, ein Psychologe? Du überraschst mich. Ich hielt dich für einen dieser Revoluzzer, die zurzeit ziemlich Wind machen.«
Ich wusste, was er meinte. Unten am Fluss gab es ein paar besetzte Häuser. Ich hatte nicht weiter darauf geachtet, mir war aber aufgefallen, dass in den Vorgärten dieser Häuser eine Menge Müll herumlag. Transparente prangten unterhalb der Fensterreihen. Ich hatte sie gelesen, aber sofort wieder vergessen. Ich habe eine spießige Seele, und herumliegender Müll in Vorgärten stößt mich ab, ganz gleich, was auf den Transparenten darüber geschrieben steht.
»Du scheinst permanent danebenzutippen. Ist das angeboren oder im Laufe deines › interessanten ‹ Lebens erworben?« sagte ich.
Zu meiner Überraschung lachte er.
»Komm, setz dich und gönn einem alten Kerl die Gesellschaft von Rimbaud.«
»Alter, ich sitze schon.«
»Okay, dann trink was.«
»Ich trinke nicht mit jedem.«
»Das versteht sich von selbst. Aber mit mir schon.«
Ich hatte mit ihm getrunken. Na klar. Mein Gesicht im Spiegel gab darüber Auskunft.
Ich ging in die Küche und setzte Teewasser auf. Ich räumte ein wenig herum und schaffte das schmutzige Geschirr aus der Spüle und stapelte es. Es war klar, dass ich dies nur machte, weil sie bald zurückkommen würde. Das verdross mich. Und die Aussicht auf Gesellschaft verdross mich noch mehr.
Ich brauchte Nick Drake.
Aber ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, mir die Kassetten zu besorgen. Musik bedeutete mir nichts. Sie war eine Form von Gewalt, mit der man allerorten konfrontiert wurde. Im besten Fall nervte sie nur. Aber ohne die Songs von Nick Drake konnte ich nicht leben. Gut. Das war Unsinn. Aber er war der Einzige, der mir etwas bedeutete. Er hatte in seinem kurzen Leben drei Alben herausgebracht. Es schmerzt mich, etwas über ihn zu sagen, ich meine, über das, was er mir bedeutet. Er war mein Bruder. Er war nicht von dieser Welt. Er war der Einzige, den ich kannte, der nicht von dieser Welt war. Und seine Songs berühren mich auf eine Weise, die ich nicht beschreiben mag. Ich würde mich fühlen wie ein zwölfjähriges Mädchen, dessen knospende Brüste an eine Melkmaschine angeschlossen würden. Oder so. Also lasst mich in Ruhe damit. Seine Songs sind bengalische Feuer in der Dunkelheit. Nick ist unser aller Bruder.
Das Leben ist traurig. Traurige Songs über das traurige Leben machen mich glücklich. Das ist wie Mathematik. Verstehst du? Minus mal Minus ergibt ein Plus. Soviel ich weiß.
Aber zurück zum Abend.
Andreas und ich schwemmten richtig was in die Tonne. Auf seine Kosten. Er war mal ein Schriftsteller oder so was gewesen. War er immer noch, soweit ich es verstanden habe, aber nicht mehr so wie früher. Betty, die Kellnerin, verriet mir, dass er mal eine Berühmtheit gewesen war. Betty. Sie hatte ihr Misstrauen mir gegenüber um Mitternacht herum, und nach einer Batterie Drinks, abgelegt und sich zu uns gesetzt. Eine richtige Berühmtheit, hatte sie gesagt, ein verdammtes Ass und gutaussehend. Preise und so, hatte sie gesagt und dabei hastig an der Zigarette gezogen, als würde sie das nervös machen. Das mit den Preisen. Und so. Ich glaube, sie machte sich Sorgen um ihn.
Als Andreas wieder zurückkam, blieb er an einem Tisch der Graukittel stehen und redete mit ihnen, wie mit guten Bekannten.
»War selber mal einer von denen«, sagte er, als er sich an seinen Platz quetschte. »War eine gute Zeit. Man hat nicht oft gute Zeiten bei der Arbeit, aber das war eine. Gutes Geld, gute Kumpels, gute körperliche Arbeit an der frischen Bahnhofsluft, viel Bier, du siehst ja selber: Denen gehts gut.«
»Ich steh nicht so auf Arbeit«, sagte ich.
»Da verpasst du was.«
»Habs probiert, aber sie gibt mir nichts.«
»Na ja, weißt du, eigentlich ist alles Arbeit. Selbst der Kerl, der sich nur von der Gesellschaft aushalten lassen will, muss arbeiten. Seine Arbeit ist halt die Vermeidung von Arbeit … «
»Ja«, sagte ich. »Genau.«
»Ich habe oft daran gedacht, der Arbeiterei ein Ende zu bereiten. Vor allem, wenn ich wieder einmal eine Ladung Gold hinten auf dem Wagen hatte. Das gab mir zu denken. Das gab uns allen zu denken.«
Er schwieg und blickte versonnen durch Bettys Zigarettenrauch in die gute, alte Zeit.
»Wie soll ich das verstehen? Was für Gold?«
»Hm?«
»Das mit dem Gold. Was für Gold?«
»Na, was schon? Gold eben. Goldbarren.«
»Was denn für Goldbarren?«
»Goldbarren. Zwei prächtige Kerlchen zu genau 12,44 Kilogramm.«
»He, was redest du da? Die Dinger lagen bei euch hinten auf den Wagen? Aber mit bewaffneter Eskorte. Oder?«
»Quatsch, Eskorte. Nichts da. Das war doch der geniale Truc: Niemand wusste, wann so eine Ladung auf die Reise ging. Meistens waren zwei Barren in einem Sack. Manchmal nur einer.«
Er lächelte versonnen und strich sich sein Hyänenhaar aus dem Gesicht.
»Da siehst du einen schlaffen, kleinen Jutesack liegen, oben die › rote Flagge ‹, was › eingeschriebene Wertsendung ‹ bedeutet, du gehst hin und du schnappst dir das Ding. Locker, mit zwei Fingern. Denkst du. Aber der kleine, schlaffe Sack wiegt einen Zentner. Falls zwei Barren drin sind, genau 24,88 Kilo. Und wenn du ihn anhebst, stoßen die Barren gegeneinander, und es macht › klack ‹. Ein warmes, tiefes und weiches Geräusch. Du weißt sofort, dass da etwas Besonderes drin ist. Du kannst es nicht sehen, nicht berühren, nicht riechen, nicht schmecken, du spürst nur das Gewicht. Deine Finger ertasten durch das Jutegewebe die innere Folie aus Plastik, und dann befühlen sie diese spezielle Form, diesen Barren, eine Art Cake. Er fühlt sich glatt an, und du hast Mühe, deine Finger darunterzuschaffen, weil er so schwer ist. Und wenn der Sack dann hinten auf dem Wagen liegt und du ihn durch den Bahnhof ziehst, kannst du an nichts anderes mehr denken. Du denkst nur an das Gold da hinten auf dem Wagen. Gold, denkst du, Gold. Und du fragst dich jedes Mal, warum du dir den Sack nicht einfach schnappst, den Wagen bremst und aus dem Bahnhof gehst. Niemand würde dich aufhalten. Niemand. Zumindest nicht in den nächsten zwei Minuten.«
So hatte Andreas es letzte Nacht erzählt. So in etwa. War es wahr? Schätze, schon. Jedenfalls eines stimmte: Man bekam dieses Gold nicht mehr aus dem Kopf. Nicht mal, als sie wieder zurückkam. Mit Kaffee, Milch, Zucker und diesen Kniescheiben.
Kapitel 10
Die Zeit drängte. Boris und Zora waren noch im Urlaub, aber nicht mehr lange. Ich hatte mich noch nicht um eine neue Bleibe gekümmert. Das Gold ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
Ich ging wieder ins »Bristol«, aber Andreas war nicht da. Nicht mal Betty. Alles wirkte fremd. Selbst die Graukittel. Als ich wieder zurück in die Wohnung kam, saß Denise, das Mädchen mit den magischen Kniescheiben, in der Küche. Wir redeten ein bisschen. Sie trug lange Hosen, und ich konnte ihre Knie nicht sehen, was das Reden einfacher machte. Ich sagte nicht viel, ließ ihr den Vortritt. Sie war der Meinung, dass ihre Geschichte etwas »kompliziert« sei. Darauf bestand sie. Aber ihre Geschichte war nicht kompliziert. Die meisten Lebensgeschichten sind nicht kompliziert, sonder sehr simpel. Wenn man es schafft, sie aufs Wesentliche einzudampfen. Und das Wesentliche an Denises Geschichte war, dass sie einen kleinen Sohn hatte. Er hieß Oliver. Sie war mit ihm in die Stadt gekommen. Olivers Vater lebte hier. Er sollte sich um den Jungen kümmern, während Denise darauf wartete, dass sich in einer anderen Stadt irgendwas wegen eines Jobs entschied. Ihr Leben war, wie sie sagte, auf einer Schwelle geparkt. Und sie wartete darauf, dass das Schicksal oder sonst wer sie von dieser Schwelle schob.
Sie schmückte die Geschichte mit vielen Details aus, die ich sogleich wieder vergaß. Dann ging ich zu Bett.
Mitten in der Nacht kam sie in mein Zimmer, weckte mich auf und fragte, ob ich etwas dagegen hätte, wenn sie sich ein wenig zu mir legte.