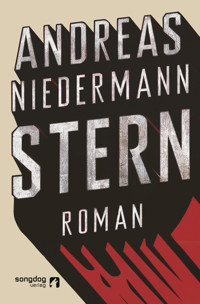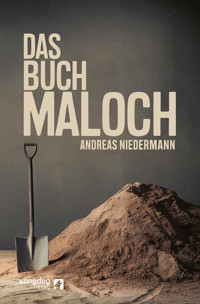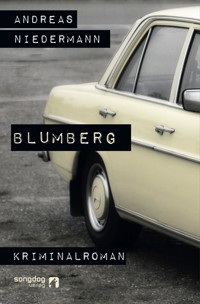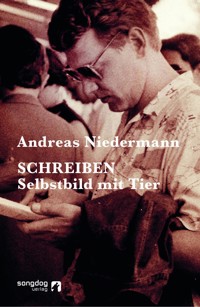
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Songdog-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rasant, brutal, komisch und witzig erzählt Andreas Niedermann vom gefährlichen und abenteuerlichen Leben eines Getriebenen. Schonungslos ehrlich mit sich und anderen sucht er in dieser Odyssee, die ihn durch Schweizer Städte, durch Wien, Paris, Italien, Griechenland treibt, nach der Gelegenheit, das zu tun, was er will: Schreiben. Aber wie schreibt man? Und vor allem, wie erschafft man eine Situation, die Schreiben erst ermöglicht? Und was soll das überhaupt: das Schreiben? Für wen denn? Wie muss es klingen? Und was ist ein Schriftsteller? Mit der Veröffentlichung seines ersten Romans scheinen die Fragen beantwortet. Aber dieser Zustand ist nicht von Dauer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andreas Niedermann
SCHREIBEN
Selbstbild mit Tier
© 2022 Songdog-Verlag, Bern
Cover-Gestaltung und -Foto: Yvo Egger
Lektorat und Satz: Buchwerkstatt.ch
ISBN 978-3-903349-17-9
Andreas Niedermann, geboren in Basel. Veröffentlichte Romane und Storys. Zuletzt bei Songdog «Blumberg». Er lebt in Wien.
Kann man schreiben, ohne zu lesen? Rein technisch gesehen eher nicht. Ohne die Bedeutung der Zeichen zu kennen, was nichts anderes als lesen ist, wird auch das Schreiben nicht so richtig gelingen.
Aber muss man wirklich lesen, um schreiben zu können?
Einmal, an der Bar eines Literaturfestivals, hörte ich, wie eine berühmte Autorin ihrer Bekannten für alle Barbesucher hörbar erklärte, dass die jungen Autorinnen nicht mehr lesen wollten. Nur schreiben. Es klang nicht besonders schmeichelhaft.
Jahre später las ich ein Interview mit einem bekannten Schweizer Autor, der an einer Schreibschule junge Frauen unterrichtete. Er beklagte sich, dass keine seiner angehenden Autorinnen etwas anderes las als das, was sie alle in der Schreibschule produzierten. Außer vielleicht, fügte er hinzu, «Malina» von Ingeborg Bachmann. Die Selbstgenügsamkeit der Schülerinnen war bezeichnend für ihre Herkunft. Schule, Abi, Schreibschule, berühmte Autorin.
In meinen Ohren klang das ziemlich crazy.
Aber.
Ich bin alt. Ich habe Anfang der sechziger Jahre lesen gelernt. Wir hatten ein Radio, aber keinen Fernseher, dafür gab es einige Regale mit den Büchern meines Vaters.
Wenn uns nach heftigen Bildern gelüstete, um ein bisschen die Angstlust zu kitzeln, dann hielten wir uns an eine mit Radierungen und Kupferstichen illustrierte Bibel. Das war’s in etwa, was uns zur Unterhaltung zur Verfügung stand. Nicht zu vergessen die Hörspiele, die wir, um das Radio gruppiert, anhörten. Serien. Immer kurz vor dem Abendessen.
Dann waren da noch diese Bücher. Wenn es draußen regnete, bekam man die Enge der Wohnung zu spüren. Was tun? Mehr Platz als auf dem Bett war nicht. Also Bücher. Wer Unterhaltung indoor wollte, musste lesen. Kein Smartphone, kein Internet, kein TV, keine Spielkonsolen, nix. Nur diese seltsamen Dinger mit diesen schwarzen Zeichen drin. Sie waren magisch.
Noch vor meinem neunten Lebensjahr hatte ich die etwa dreißig Bände Karl May mindestens einmal gelesen. Einige auch mehrere Male. Nächtens, unter der Bettdecke. Wer aus meiner Generation kennt es nicht?
Das Lesen von Büchern galt damals nicht etwa als Aktion, die bei Jugendlichen zu fördern war, sondern es wurde misstrauisch beäugt. Nicht selten hörte man die Meinung von Erwachsenen, dass Lesen irgendwie gefährlich sei. Sie waren beunruhigt. Und ob sie es sich eingestanden oder nicht: Sie fürchteten den Kontrollverlust. Wer wusste denn schon, was so ein Buch in einem jungen Geist anrichtete?
Groschenromane? Übelst. Abgesehen von jenen Arztromanen, die von Müttern gern gelesen wurden.
Lassiter und Jerry Cotton. Kommissar X. Ich hatte alle zu Gast und war ihnen für eine Weile verfallen. Es war eine gute Zeit, und sie ging dann über in eine andere.
Ich kam in Berührung mit Hermann Hesse, der zu meinem Leitstern wurde. Ich war sechzehn, und ich war der Steppenwolf. Dann war ich Siddhartha, und später Goldmund. Ich rauchte Haschisch und nahm, eine Weile täglich, LSD.
Aber wie sich mein Leben auch immer veränderte, Haken schlug und die Schauplätze wechselten: Das Lesen blieb. Ich kannte niemanden – oder beinahe niemanden –, der nicht rauchte und nicht Bücher las. Das hatte natürlich zur Folge, dass man oft über das sprach, was man gerade gelesen hatte. Es hagelte Empfehlungen. «Das musst du unbedingt lesen, das ist heavy!» So gruppierte sich nach und nach um meinem Leitstern Hesse ein kleines Universum aus Autoren-Satelliten.
Aber was las ich?
Ich war auf der Suche (bin es noch).
Wonach suchte ich?
Erkenntnis. Unterhaltung. Belehrung. Einsicht. Erbauung. Abenteuer. Inspiration. Und ja: Gefahr.
Und es bleibt ein wenig wie damals, als man sich etwas Angstlust aus den Mordbildern der Bibel bezog: Welches waren die «gefährlichen» Bücher?
Einmal hörte ich zufällig ein Gespräch mit, in dem eine Frau erklärte, dass man, wenn man Albert Camus las, «echt wahnsinnig» würde. Und schon hatte ich mir den «Fall» von Camus besorgt.
Und tatsächlich erschütterte dieses existenzialistische Werk meinen jungen Geist bis in die Grundfesten. Er verfügte noch nicht über die Erfahrungen, die heftigen Stöße eines anderen, großen Geistes auszupendeln.
Nichts ist gewiss, außer dem Tod. Warum sich nicht gleich selbst morden? Und damit begann sie. Die Philosophie.
Auf diese Weise kam ich auch zu Nietzsches «Also sprach Zarathustra». Welche Macht ging von diesen Büchern aus?
Ich las mit siebzehn fast das gesamte Werk von Sigmund Freud, ohne ein verdammtes Wort zu verstehen. Aber es tat irgendwie gut, all diese unverständlich formulierten Sätze zu lesen. Natürlich las ich auch Jung und Fromm. Und Andersch und Böll und Brechts «Baal». Auf jeden Fall Huxleys «Pforten der Wahrnehmung», ein Must für jeden Acidhead. Undenkbar, «Politik der Ekstase» von Oberacidguru Timothy Leary nicht irgendwo rumliegen zu haben. Ich hab’s nie gelesen, aber immer erfolgreich vorgegeben, es getan zu haben. (Am besten spricht es sich doch noch immer über ungelesene Bücher.)
Auch wenn es danach aussah, dass ich und auch meine Freunde mehr oder weniger wahllos herumlasen, so war dieser Eindruck falsch.
Das Prinzip war einfach: Man las ein Buch, in dem vielleicht ein anderes Buch, eine Autorin oder ein Autor erwähnt wurde. War das Buch gut, so besorgte man sich auch ein Buch der erwähnten Autor*innen. Und so weiter und so fort.
Auf der Basler Bahnpost, wo ich Ende der siebziger Jahre hin und wieder als Aushilfe engagiert war, gab es kaum einen Temporären, der nicht ein Bändchen von Suhrkamp – die wunderbar in die schlanken Kitteltaschen passten – mit sich herumtrug und in den Wartezeiten darin las.
Oft saßen wir in den Pausen im «Bristol», tranken Bier, rauchten und redeten über die Bücher, die wir gerade lasen. Je unbekannter der Autor war, desto besser.
Wir waren eine Art gebildetes Subproletariat.
So viel ich weiß, ist keiner von den Jungs von damals Autor geworden.
Ich denke, aus gutem Grund. Sie waren zu schlau dafür. Vielleicht ahnten sie, wie beschwerlich es sein würde, einer zu werden. Und waren wir nicht auch selber Zeugen oder auch nur Leser von abschreckenden Beispielen geworden? Was waren Schriftsteller? Alkoholiker, Süchtige, Verfolgte, Verarmte, Getriebene, Verachtete, Scheiternde. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist die andere Seite. Ruhm, Reichtum, Jetset. Oder ein verachtenswertes Leben als ein in der Freizeit schreibender Lehrer.
Wie schrieb Jack Kerouac an Allen Ginsberg: «Der Ruhm zerstört alles.»
Aber was hat das mit Schreiben zu tun?
So einiges.
Lisez!
***
Mein erstes Buch erschien 1978 oder 1979 und war nicht wirklich ein Buch, sondern eine Art Broschüre, geklammert, zwanzig Schreibmaschinenseiten, voller Tippfehler und handschriftlicher Korrekturen. Mein Freund Mexx fand es wert, die Gedichte herauszugeben, was nichts anderes bedeutete, als dass er irgendwo hundert Kopien davon fertigte, die wir an einem Bierabend zusammentackerten. Das war’s. Mein erstes Buch.
Ich kann mich nicht erinnern, was für ein Gefühl es war, dieses mein «erstes Buch» in den Händen zu halten. Vermutlich Stolz, Scham, Betretenheit und Furcht vor Kritik.
Den Titel hatte ich mir bei Bob Dylan ausgeliehen, dessen schmales Bändchen «Elf Entwürfe für meinen Grabstein» mich beeindruckt hatte. Ich hatte in dieser Zeit gerade meinen Hesse-Entzug hinter mir und meinen Kopf von Harry Haller, Goldmund, Siddhartha und Demian gewissermaßen entrümpelt und war dabei, Platz für Bob Dylan zu schaffen. Dylan, Dylan, Dylan, wo vorher Hesse, Hesse, Hesse gewesen war. Dylan hatte gegenüber Hesse auch den Vorteil, dass er Musiker war, und sowas wollte ich auch werden. Ein Gitarre spielender Protestsänger, der der Gesellschaft hinjaulte, was alles falsch lief. Und ich war der Meinung, dass so ziemlich alles falsch lief. Wobei es mir nicht richtig gelang, das Persönliche vom Gesellschaftlichen zu trennen.
Meine Freundin Rea, mit der ich in einer WG zusammenlebte, war dabei, sich von mir zu trennen. Sie hatte kurz hintereinander zwei Abtreibungen hinter sich gebracht, ihr Vater war unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben, und das war für eine noch nicht zwanzigjährige Frau etwas viel.
Aber war nicht das Persönliche das Politische?
In St. Gallen hatte ich in derselben Zeit zwei Prozesse vor einem Militärgericht ausgestanden, wobei der erste mir eine Konsultation bei einem Psychiater eingebracht hatte, die sich in der Aussage erschöpfte, dass ich eine gute Intelligenz besaß, aber ein leidender junger Mann war. Der zweite Prozess entlarvte mich dann als sektiererischen Pazifisten, was ich zweifellos nicht war, sondern nur vorgab zu sein. Vor mir selber, und vor Gericht. Man schloss mich mit einer Gefängnisstrafe auf Bewährung aus der Armee aus.
Ich hatte eigentlich nichts gegen eine Armee, aber ich fürchtete den rauen Wollstoff der Uniformhosen, die Massenunterkunft und vor allem den Gehorsam, der von mir verlangt würde. Natürlich hätte ich das niemals zugegeben, nicht vor mir selber und auch nicht vor anderen. Ich gab den Pazifisten, der sich strikt gegen jede Art von Gewalt wandte und der der Meinung war, dass sich alle Konflikte durch das Gespräch lösen ließen.
Aber dies alles war längst vorbei, als 1978 oder 1979 die «Grabsteinentwürfe» sozusagen «herauskamen». Vorbei war auch die Zeit, als ich täglich Haschisch rauchte und LSD schluckte. Die Lust auf Glückseligkeiten, Horrortrips und Paranoia schien sich, zusammen mit Hesse, verflüchtigt zu haben. Und mit den langen Haaren und der Peacenik-Attitüde.
Mexx besaß eine 9 mm Smith & Wesson, und wir schossen im Keller, Wilhelm-Tell-like, auf Äpfel, die wir auf dünne, wacklige Hölzchen stellten und die bei Treffern nicht einmal runterfielen, obschon wir sie danach einfach umpusten konnten. Das war faszinierend.
Trotzdem war alles nicht zum Aushalten. Die Mädchen färbten sich die Haare rot, und überall lief Nina Hagen. Überall «heavy» Politik, und ich schrieb Gedichte. Und das galt gewissermaßen als Blasphemie. Es war nicht «Nach Auschwitz kann es keine Gedichte mehr geben», aber es fühlte sich falsch an. Man schrieb jetzt keine Gedichte. Und Bob Dylan war in den Augen der Linken, mit denen ich Umgang hatte, ein von ihnen geächteter zionistischer Büttel der amerikanischen Imperialisten.
Mein «Buch» hatte den Titel «Grabsteinentwürfe», was einerseits, wie gesagt, eine Reverenz an Bob Dylan war, aber andererseits etwas mit meinem realen Leben zu tun hatte, denn ich hatte gerade meine Lehre als Grabsteinbildhauer abgebrochen. Nach zwei Jahren. Ich wollte unbedingt ein Künstler werden. Vielleicht, so denke ich, schien es mir damals die einzige Möglichkeit, der lebenslangen Fron eines Arbeitslebens zu entkommen. Bildhauer, Musiker, Maler, Schriftsteller zu sein versprach meinem durch und durch von Romantik durchdrungenen Geist ein Leben in Freiheit und «Kreativität».
Ein Problem mit dem «Künstler»-Werden war auch, dass sich bei mir bis anhin kein Talent offenbart hatte. Zu nichts. Außer zum Tragen eines piefen Künstler-Berets. Wie auch immer. Ich schrieb Gedichte.
Im surrealen Dada-Art-brut-Rimbaud-Dylan-Style.
Da fanden sich Zeilen wie:
meine kleidung schmutzig starrt
gegen das geläut der nahen schafe.
höhnt mit ihnen das hohe gras
weisslich wie gedärme
wurzeln von künftigem fleisch.
So war es. Graswurzeln waren künftiges Fleisch. Welch schöner Einfall. Sehr stimmig. Ich bin noch heute stolz darauf.
Schreiben schien mir um so vieles einfacher, als das Handwerk eines Bildhauers zu erlernen. Schreiben konnte ich ja schon. Wie alle anderen auch. Außerdem war die Werkstatt eng und staubig und kalt und von Haschischrauchschwaden durchzogen, denn mein Lehrmeister war ein paranoider Dauerkiffer mit einer geilen Hündin, die ihre Muschi an jedem Schuh rieb, der ihr hingestreckt wurde.
Nachdem ich die Lehre abgebrochen hatte, arbeitete ich in einem Steinbruch, brach mächtige Blöcke Sandstein aus der Wand und zersägte sie zusammen mit Jock in schmale Platten, die dann von spanischen Steinmetzen zu Bruchstein verarbeitet wurden. Gefiel mir. Ich trank einen Kasten Bier pro Tag und kletterte im Sonnenschein auf dem Steinbruch herum und fühlte mich absolut Herr der Lage. Der König des Sandsteins. Es war, als gehörte der Steinbruch mir allein. Alles war überlebensgroß, mächtig und hart. Die Blöcke, die Keile, die Säge, die Bohrer und die Vorschlaghämmer, mit denen wir die Keile in die Bohrlöcher trieben und sie mit Wasser übergossen, damit sie aufquollen und den Block lossprengten.
Aber wie so oft, wenn etwas gut war, endete es abrupt. Man schickte mich mit den Spaniern auf Baustellen. Und der Herr des Steinbruchs verwandelte sich binnen Stunden in einen Subalternen, der für die Steinmetze Brötchen holen ging und mit dem Besen die Baustelle in Ordnung hielt.
Ich musste einsehen, dass meine Fertigkeiten in der Steinbearbeitung nicht an die der spanischen Steinmetze heranreichte. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, mit ihnen mitzuhalten.
In all der Zeit dachte ich nicht oft ans Schreiben, aber nachdem ich gekündigt hatte, war es gleich wieder da. Und später merkte ich, dass es eigentlich immer da gewesen war. Das Schreiben war immer da, und alles, was ich sonst tun musste, um mein Leben zu finanzieren, übertönte und überlagerte es nur mit seiner dummen Notwendigkeit.
So saß ich wieder an der Schreibmaschine, das Papier war da, ich konnte es befühlen, ich konnte es sehen, ich konnte es riechen, die Maschine war geölt. Aber ich schrieb nicht.
Warum nicht? Wie sollte man schreiben, wenn man für seinen Lebensunterhalt sorgen musste, eine Freundin hatte, die einen nicht mehr liebte, und alles um einen herum dem Politwahn verfallen war? Wie denn? Wie?
***
Mexx und ich verschwanden, nachdem die «Grabsteinentwürfe» gewissermaßen erschienen und an Bekannte und Interessierte in den einschlägigen Künstlerlokalen verkauft waren, nach Frankreich.
Es war Frühling, und alles war vorbei. Rea, die mich längst verlassen hatte, obschon wir noch zusammen wohnten, bereitete sich vor, nach Italien auszuwandern. Aber bis es so weit war, kam es zu letzten Kämpfen in der Agonie einer vier Jahre dauernden Beziehung. Geschrei, Tobsuchtsanfälle, Gekreische, Wohnungseinrichtung, die im Treppenhaus landete. Ich konnte gerade noch verhindern, dass Rea, einen Hammer schwingend, sich an meiner kleinen Reiseschreibmaschine abreagierte. Schlimm genug war, dass sie Henry Miller las, den ich damals nur dem Namen nach kannte. Aber noch schlimmer war, dass sie voller Verachtung von meinen «Gedichtchen» sprach. Ich nehme an, das hatte Henry Miller mit ihr angestellt, denn Henry Miller war einer, der, wie sie sagte: «gelebt hat». Was bedeutete, dass ich nicht lebte. Ich war nur ein piesliger Gedichteschreiberling.
Das schmerzte. Und es schmerzte umso mehr, weil ich selber der Meinung war, dass ich nicht lebte.
Was hatte ich schon vorzuweisen? Ich war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte eine Latte an verschiedenen Jobs. Das war’s. Und ich hatte gerade als Kranführer und Staplerfahrer gekündigt. Gekündigt, um schreiben zu können. Aber ich schrieb nicht. Natürlich nicht. Warum natürlich? Einfach. Weil es so nicht funktionierte. Das hatte ich schnell herausgefunden. Ich schlief lange und las alle Romane von Raymond Chandler und Albert Camus.
Dann fuhren wir los. Mexx, ich und noch zwei Typen. Ein jüdischer Arzt aus Zürich hatte uns angeheuert, um auf seinem eben erworbenen Anwesen in Südfrankreich die Basis für dessen Bewohnbarkeit zu legen.
Wir bekamen einen blauen VW-Bus und fuhren über Agen in einem Zug durch. Alles, was ich noch besaß, hatte ich auf dem Dachboden eines Bekannten zwischengelagert. Was war es schon? Ein paar Bücher, eine Schreibmaschine, ein paar mürbe Klamotten, ein paar Fotos, Briefe und Bilder. Nichts, was ich nicht ohne Bedauern zurücklassen konnte. Ich dachte nicht daran, wieder zurückzukehren. Ich war fertig mit dieser Stadt. Und ich war fertig mit diesem Land. Dieser Schweiz. Mit der war ich schon lange fertig. Es war einfach kein Land für mich. Ich wollte abhauen. Auf und davon. Never to come back.
Und jedes Mal, wenn ich irgendwohin aufbrach, war es für immer. Und jedes Mal kehrte ich zurück. Gedemütigt. Schon wieder nicht geschafft. Nicht in Griechenland, nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Jugoslawien. Vielleicht lag es daran, dass es mit dem Schreiben nicht klappte. Ja, vielleicht. Vermutlich ziemlich sicher.
Muss ich erwähnen, dass die Sache in Frankreich schiefging? Vielleicht. Also: Sie ging schief. Aber für einmal nicht für mich. Zwei von uns vier waren Desperados. Desperados mit dummen Träumen. Mexx war auf Abenteuer und eine gute Zeit aus. Ich hatte keine Wahl. Nichts mehr, wohin ich zurückkehren konnte.
Das Haus lag abgelegen in den Hügeln von Lot-et-Garonne. Die Welt bestand aus einem Ozean an Hügeln, und auf einigen der Kuppen gab es kleine Dörfer mit einem Bistro und einem Laden.
Der Doc hatte große Pläne. Er hatte einiges an Grundstücken zusammengekauft, um hier seinen Traum zu verwirklichen: ein Sanatorium. Der Ort war gut gewählt. Denn hier würde es niemals Ablenkung geben, hier war nichts, außer ein paar tausend Feldhasen und einer Million Kröten. Das Haus, in das wir einzogen, sollten wir so weit bewohnbar machen, dass es als Hauptquartier tauglich war und der Doktor die Arbeiten an seinem Sanatorium überwachen konnte.
Mit seinen Träumen glich der Doc den beiden Desperados. Der eine träumte von einer Werkstatt als Tischler, der andere, ein Ex-Junkie, träumte von einem ewigen Vorrat an Roquefortkäse und ein, zwei Tonnen Haschisch.
Der Einzige in dieser desperaten Bunch, der wusste, wie arbeiten ging, war ich. Und ich machte mich sogleich daran. Unter Mithilfe der Schlankheitspillen des verstorbenen Doc-Bruders, die dieser in großer Menge zurückgelassen hatte und die mir beim Durchstöbern der Räume in die Hände gefallen waren. Reines Beta-Amphetamin.
Der Doc fuhr fast jedes Wochenende von Zürich her, stieg aus seinem roten Sportwagen und brachte mit Nadeln zusammengehaltene Bündel farbiger Franc-Scheine. Er ließ uns die Stunden notieren, für die wir einen Satz ausgemacht hatten. Er übergab uns das Geld und überließ es uns, wieviel wir den schönen Bündeln entnahmen. So etwas kommt nicht gut. Nicht in der Regel. Zu groß die Verlockungen. Der Tischler-Desperado brachte in den Wochen, in denen wir da waren, nicht einmal seinen Arbeitstisch zusammen. Der Roquefort-Haschisch-Desperado verlegte einige elektrische Leitungen, und Mexx fuhr mit seinem Auto auf dem Gelände herum und riss mit Hilfe eines Seils, das er an die Stoßstange gebunden hatte, Sträucher aus dem Gelände. Er hatte etwas gegen sie.
Ich machte das, was der Doc auf die Prioritätenliste gesetzt hatte. Ich war den Arbeitsgehorsam gewohnt. Ich machte meine Arbeit. Ich machte die Arbeit, für die ich bezahlt wurde. Und wer mir nicht auf die Eier ging, kriegte gute Arbeit. Ich hatte ja die Pillen. Und die kleinen Flaschen Champagner zum Frühstück, das Rührei und den duftenden Jambon cru vom Dorfladen.
Das Haus war im Grunde unbewohnbar. Nur die Küche und das Bad waren in Ordnung. Der große Wohnraum – eine nackte Höhle mit imposantem Cheminée. Unter dem Dach zwei türlose Räume. Wir fanden vier klapprige Bettgestelle aus Metall, Matratzen und Bettzeug. Das war’s.
Die Abende verbrachten wir in der Küche. Meistens stritten wir herum. Ich hielt mich heraus, so gut es ging. Worum es ging? Den normalen Scheiß, wenn vier Typen ohne jede Ablenkung in einem Haus zusammenleben.
Das setzte den Desperados zu. Sie waren Einsamkeit nicht gewohnt. Als dann der Roquefortnachschub einbrach, das Haschisch ausging, der Hund des Tischler-Desperados allen auf die Nerven ging, war alles ganz schnell zu Ende.
Die Lügen und der Wahn der siebziger Jahre, die dummen Träume. Hier unten, in diesem Haus, auf dem Grund der Welt, ohne jede Ablenkung, gab es keinen Herdenschutz mehr. Wir waren mit einem Mal die einzigen Idioten. Und das steckten die drei nicht weg.
Für mich war es in Ordnung. Ich hatte die Pillen, die Arbeit, ein gebrochenes Herz, Henry Miller und Rimbaud.
Die Desperados ließen sich vom Doc ihr Geld für nichts geben und verschwanden einfach. Ich wusste nicht, womit, und ich wusste nicht, wohin. Und es war mir unendlich egal.
Ich blieb allein zurück.
Was hatten wir uns bloß gedacht?
***
Ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet hatte, kam aus Norden, und es kam und kam und hörte nicht mehr auf zu kommen.
Ich hatte schon von ihm gehört, ihm aber keine Bedeutung beigemessen, da ich in einer Gegend aufgewachsen war, die ein ähnliches Problem hatte. Dort hieß es Föhn. Hier war sein Nom de Guerre: Mistral. Un Salaud erster Güte, ein Quälprinz, ein Drecksack, ein stets angreifender Boxer, in der Art von Smoking Joe Frazier.
Tagsüber machte ich meine Arbeit. Ich baute ein Garagentor zusammen, fertigte Wassernasen für Türen und Fenster, schrägte die Steinsimse ab, damit das Wasser ablaufen konnte und nicht vom Wind an die Fensterrahmen gedrückt wurde. Ich leitete den französischen Bautrupp, der die handgearbeiteten Fliesen verlegte, verputzte die Wände oben in den Schlafzimmern, tötete zwei Mäusefamilien, marschierte täglich hoch ins Dorf, kaufte Babyflaschen Pommery, Eier, Grapefruits, Flûtes, Paté, Schinken und Cognac.
Zum Frühstück aß ich Rührei mit Schinken und trank Champagner, mit dem ich zwei Schlankheitspillen runterspülte. Sie waren nötig, um mir die richtige Geistesverfassung zu verpassen, sodass ich die Arbeiten in der Einsamkeit mit mahlendem Kiefer, unermüdlichem Eifer oder doch zumindest Elan verrichten konnte.
In der Nacht schrieb ich.
Ich hatte mir im Dorfladen ein paar Kladden besorgt, und nun schrieb ich mit meinem 0,5-mm-Rapidographen in schönen Majuskeln meinen ersten Roman. Es war natürlich kein Roman. Aber was hatte der Begriff Roman nach «Wendekreis des Krebses» von Henry Miller noch für eine Bedeutung? Ein Roman war alles, was länger als hundert Seiten war. So wie Gedichte Dinger waren, deren Zeilen nicht bis zum Rand gingen. Das war natürlich so falsch wie das Lächeln der Bistrowirtin oben im Dorf, aber ich ließ beides so stehen und kümmerte mich nicht weiter darum.
Während der Mistral unausgesetzt an allem Losen rüttelte, in den Kamin fuhr und Asche aufwirbelte und das nur am Freitagabend genutzte Wohnzimmer mit einem samtenen grauen Film überzog, saß ich unter der Neonleuchte in der Küche und schrieb. Draußen war die südfranzösische Frühlingsnacht mit ihrem Geruch nach feuchter Erde und dem Heulen und Zischen und ewigen Geklapper des Mistrals.
Es waren die Pillen, die mich den nie ruhenden Wind ertragen ließen. Die Pillen, das Geld, der Cognac, das Schreiben.
Mein «Roman» geriet zu einer surrealistischen Phantasmagorie, in der ich alle Personen mitspielen ließ, die mir im realen Leben und in der Literatur begegnet waren. Es war ein Mistral-Amphetamin-Cognac-Einsamkeitsroman, den nur eine einzige Person gelesen hat, und auch das nur auszugsweise. Was zu einer bemerkenswerten Reaktion geführt hat. Aber davon später.
Sie sind doch das, was man einen attraktiven Mann nennt. Fast ein Prototyp, sagte der Doc, der mit zwei jungen Studentinnen aus Zürich hergefahren war. Ich wundere mich nur, fuhr er fort, dass ich hier nie eine Frau antreffe.
Ich antwortete mit einem Schulterzucken. Ich denke, er machte sich so seine Gedanken.
Vor ein paar Tagen war eine Frau da gewesen. Sie war die tausend Kilometer mit Bahn und Bus gereist, um mich zu besuchen. Aber das erzählte ich nicht. Ich sagte dem Doc auch nicht, was wir in der Badewanne getan hatten, und auch nicht, was im Bett. Ich sagte auch nichts von meinem Roman und versteckte die Kladden unter meiner Matratze. Er sollte nicht zufällig auf sie stoßen. Und sie womöglich den Girls zeigen, mit denen ich ein bisschen durch die Frühlingshügel gestapft war und über Literatur gesprochen hatte. Ich fühlte mich dabei ein wenig wie Oliver Mellors, der Held von D. H. Lawrences «Lady Chatterley». Auch ich war eine Art Gärtner und Hausbesorger, ebenso urwüchsig und viril, und die Girls waren gut behütete Mädchen aus wohlhabenden Familien. So stellte ich mir das vor. Was sie sich vorstellten? Nicht dasselbe, denke ich. Aber was machte das schon.
***
Irgendwann, nach einigen Wochen, war es vorbei. Die beiden Kladden waren mit Majuskeln vollgeschrieben. Von den Pillen gab es noch reichlich, Arbeit auch, und ich hätte einfach bleiben können. Inzwischen kannte ich einige holländische und französische Aussteiger, die bei den hiesigen Bauern arbeiteten, um genug Geld für ein eigenes Ding zu verdienen, oder besser: um es abzuzahlen. Sie arbeiteten also nicht nur für die Bauern, sondern auch für ihr eigenes Ding. Sie führten ein hartes Leben, eines der härtesten, das ich je gesehen hatte, und wenn die böse Sonne in die Hügel sank, sanken sie mit ihr in ihre Betten, um gegen vier Uhr wieder aufzustehen, um die Stallarbeit zu machen. Bei sich zu Hause, und bei den Bauern.
Sie waren alle sparsam bis zum Geiz, sie gaben kein Geld aus, keinen Sou. Und so war ich mit einem Mal ein reiches Arschloch, der in einem großen luxuriösen Haus mit Bad, warmem Wasser und jeder Menge Platz lebte. Und es stimmte ja. Ich hatte Geld, und ich trug es hinauf in den Dorfladen und kaufte Bier und Wein und Cognac und Rindfleisch, denn am Freitagabend kamen alle zu mir und ich verheizte einige alte Eichenbalken aus der Garage im Cheminée und grillte die Steaks. Wir aßen und tranken, und ich improvisierte auf meiner Gitarre gefährlich kippelnde Riffs und Melodien, zu denen meine Nachbarn tanzten. Manchmal blieben sie so lange, dass sie direkt in die Ställe gingen, um die Kühe zu melken, während ich mich ordentlich betrunken ins Bett legte.
Gewohnt, selber hart zu arbeiten, fühlte ich mich mit der Zeit als nutzloser Außenseiter und verwöhnter Geck angesichts des harten Lebens dieser Aussteiger. Als ich noch allein mein Arbeitspensum am Hausumbau ablieferte und in der Nacht meine Kladden beschrieb, war alles in Ordnung gewesen. Das Schreiben glich der romantischen Beschäftigung eines einsamen, vom Mistral eingekerkerten Sonderlings. Das war in Ordnung. Aber jetzt, sozusagen im Angesicht der zähen Arbeiter, dieser Verzichtsorgiasten mit dem protestantischen Arbeitsethos, wirkte mein Leben wie das eines verschwenderischen, verwöhnten und leicht blasierten Jünglings, dem man seine Attitüde nur verzieh, weil er Bier, Steaks und Musik spendierte.
Ich hatte ihnen einmal, leicht betrunken, eröffnet, dass ich in Wahrheit ein Schriftsteller sei, was nach einem allgemeinen Augenbrauenheben zur ewig gleichen Frage führte, zu jener Frage, die mir noch tausendmal gestellt werden sollte: Was schreibst du denn?
Was schrieb ich denn? Wie sollte ich ihnen erklären, was da in den Kladden stand? Wenn ich sagen würde: ein Roman, wäre die nächste Frage: Worum geht’s in dem Roman?
Einige Monate später hatte ich selbst die Frage einem Schriftsteller gestellt und die Antwort erhalten: keine Ahnung.
Das hätte der Wahrheit entsprochen, aber ich kam gar nicht auf die Idee, die Wahrheit zu denken. Ich entschied mich für Herumdrucksen und bemerkte nach drei Sekunden, wie in ihren Gesichtern das Interesse erlosch.
Aber egal. Es war vorbei. Das Abenteuer Einsamkeit, Mistral, Kladden, Rapidograph, Amphetamin, Champagnerfrühstück und Remy Martin in der Badewanne, es war vorbei. Nächstes Kapitel.
***
Ich rechnete meine Arbeitsstunden zusammen und zählte die im Kuvert verbliebenen schönen französischen Scheine. Es sah nicht gut aus. Aber da ich im Allgemeinen schnell arbeitete, nur schon, um mich nicht während der Arbeit zu langweilen, kam ich zur Überzeugung, dass die Bemessung nach Arbeitsstunden kein geeignetes Umrechnungsmodell war, um meine tatsächliche Arbeit zu bewerten. Ich dachte an Mexx und die Desperados, die ihr Geld für gerade mal nichts bekommen hatten, aber sich dennoch im Recht gesehen hatten, dem Doc all ihre fruchtlosen und dummen Bemühungen in Rechnung zu stellen.
Aber auch ich schummelte bei der Abrechnung. Ich tat es mit Scham, der Doc war ein guter Mann, ich mochte ihn, seine Fleisch- und Lebensgier, seine Melancholie und seine schlecht verhohlene Einsamkeit. Aber doch, ich rechnete zu meinen Gunsten, und diese Rechnung belegte es: Ich hatte in der Abgeschiedenheit ein luxuriöses Leben geführt. Das war insofern etwas verrückt, als es ja nur den Dorfladen und das Bistro gab, das ich jeweils am Freitagabend besuchte, um Geld auszugeben. Ja, ich war spendabel gewesen, was die Wochenendfeste in «meinem» Haus anlangte. Ich hatte nicht gerechnet. Denn im Kuvert steckten immer Scheine. Sie gingen nie aus, es wurde nie leer. Und wenn es leer zu werden drohte, kam der Doc aus Zürich in seinem roten Sportwagen herangebraust und füllte es wieder auf. So hätte es weitergehen können. Arbeit gab es genug, der Doc hätte mich nie zum Aufbruch gedrängt, nichts von alledem. Aber was, fragte ich mich, hätte hier unten aus mir werden sollen? Mein «Roman» war fertig. Es wurde Sommer. Ich war einsam. Oben im Dorf gab es eine Ladenbesitzerin und eine Wirtin, die mich vielleicht vermissen würden. Zumindest mein Geld. Wer weiß, vielleicht auch die so hart arbeitenden holländischen Aussteiger.
Mit mir verließ auch das Beispiel für Müßiggang und Luxus die Gegend. Nur noch harte Arbeit, die böse Sonne, die Hasen, die Kröten und die Hügel, die auf nichts die Antwort waren.
Adieu, mes amis. Adieu, les collines, adieu, les lapins.
Fuck off, Mistral!
***
Ich gondelte also nach Südwesten, trampte herum, ließ mich mitnehmen, solange die Richtung halbwegs stimmte. Ich wollte nach Arles. Ich wollte in die Stadt, in der Van Gogh gelebt, gemalt, gelitten, durchgedreht hatte und sich ins Herz schießen wollte. Ins Herz. Nicht in den Kopf, wo die Kugel in einer Millisekunde das Licht gelöscht hätte. Aber er verfehlte das Herz, lebte noch zwei Tage, verblutete. Über so etwas vermochte ich lange und ergebnislos nachzudenken.
Montpellier war voller Studenten, und ich wollte schnell weiter. Ein rassistischer Schwuler, der die Schwarzen als «Poubelle», als Mistkübel bezeichnete, nahm mich mit nach Aigues-Mortes, lachte über meine Verehrung für Rabelais. Weiß der Teufel, warum ich von Rabelais sprach, von dem ich nur wenig mehr als den Namen kannte. Und das alles mit meinem schlechten Französisch. Natürlich wollte der Mann mehr, als über Rabelais lachen, aber es gelang mir, ihn zu versetzen und weiter zu trampen, weiter in meinen stinkenden Kleidern, Richtung Arles, zu meinem verehrten Selbstmörder.
Ich kam gegen Abend an und machte mich auf die Suche nach einem Zimmer. Aber mir wurde überall die Tür gewiesen. Niemand wollte den Tramp beherbergen, in diesem Arles, das von Van Gogh lebte, so wie Salzburg von Mozart lebt. Überall Van Gogh, überall, bis in die öffentlichen Toiletten, überall das Van-Gogh-Gelb, überall seine wuchtigen Sonnenblumen, sein Selbstbildnis nach dem abgeschnittenen Ohr, das Nachtcafé, die kreiselnden Sterne und Sonnen. Es war ekelhaft. Arles hatte mir «meinen» Van Gogh verhunzt. Ich wollte so schnell wie möglich wieder weg, aber es war bereits Nacht.
Und so irrte ich durch die schönen Platanenalleen und stand irgendwann vor der Jugendherberge. Tout complet, sagte die Rezeptionistin. Aber sie fand dann doch noch ein freies Bett. Im Zimmer mit einem deutschen Studenten und einem Australier, der mit seinem Rad unterwegs war, das er mit einer tonnenschweren Eisenkette sicherte.
Der deutsche Student sprach mich sogleich an und kam nach dem zweiten Satz zur Sache: Was machst du denn so?
Ich bin Schriftsteller, sagte ich.
Was schreibst du denn?
Essays, sagte ich, um nicht Roman sagen zu müssen. Und weil ich das Wort «Essay» mochte. Warum auch nicht? Essay ist französisch und bedeutet «Versuch». Hätte ich Roman gesagt, so hätte er mich gefragt, worum es denn in dem Roman gehe. «Essay» würde ihm die Fragerei nicht so leicht machen.
Kann ich was lesen?, fragte er.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Warum ich zusagte, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich einsam war, vielleicht, weil sich nach all den Monaten der nächtlichen Schreiberei jemand dafür interessierte? Also wühlte ich aus meiner Tasche eine der Kladden heraus und überreichte sie ihm. Er setze sich oben auf das Etagenbett und begann wirklich zu lesen.
Ich streckte mich auf dem Bett aus und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Der Blick des Lesers wanderte von der Kladde zu mir und zurück. Hin und her. Nach einer Weile veränderte sich dieser Blick. Es war ein Blick, mit dem man eine unberechenbare Person beobachtete. In diesen Ausdruck mischte sich Furcht, als könnte ich mit einem Mal aufspringen und irgendwas Gefährliches oder Verrücktes tun.
Nach ein oder zwei Stunden gab er mir die Kladde zurück.
Ich würde das nicht als Essays bezeichnen, sagte er.
Nun ja, er war ein deutscher Student, und musste vermutlich so etwas sagen. Aber er wusste, was ein Essay war. Und das Ding in meiner Kladde, das hatte er sogleich erkannt, war keiner.
Er ließ mich den ganzen Abend nicht mehr aus den Augen, sprach aber kein Wort. Er beobachtete mich, als wäre ich ein Irrer im Stile Van Goghs, als könnte ich unvermittelt ein Messer zücken und mein Ohr abschneiden. Oder seines.
Mein «Roman-Essay» hinterließ Eindruck.
Aber irgendwann und irgendwo, on the long run, gingen die Kladden verloren. Und der deutsche Student in der Jugendherberge von Arles blieb der einzige Mensch, der in meinem «ersten Roman» gelesen hat.
***
Nach Aix-en-Provence trampte ich vor allem wegen des Mont Sainte-Victoire, dieses zigfachen Motivs von Paul Cézanne. Dieser Berg war mein Van Gogh von Aix, nur dass Berge sich keine Kugel ins Herz schießen können, selbst wenn sie so deprimiert und einsam aussehen wie Vincent.
Als ich draußen vor der Stadt an einer dreckigen, vermüllten Autobahnausfahrt aus einem Auto stieg, stand ich dem Monolithen direkt gegenüber. Er war grandios und erhaben in seiner dunklen Einsamkeit. Er stand allein da, alles um ihn herum war flach, eine Einöde von niedrigem Gestrüpp und ausgedörrtem Unkraut. Gelber, sandiger Boden, und dann dieser Brocken. Aber vielleicht war es gar nicht so, und ich stellte mir nur vor, dass es so war, weil ich wollte, dass es so war.
Der Weg von der Autobahnausfahrt bis Aix war lang und staubig. Ich schleppte mich mit meiner Gitarre ab, die böse Sonne brannte herunter, und als ich endlich in der Stadt ankam, in der ich eine Bunch von Typen wie mich selber erwartet hatte, Tramper, die auf Treppen saßen und cool in die Gegend blickten, wurde ich mehr als enttäuscht: Ich wurde deprimiert.
Mein Plan war gewesen, mich in einer Allee unter einen Baum zu stellen und ein paar Songs von Bob Dylan zu spielen, damit ein bisschen Geld hereinkäme. Von den schönen Scheinen aus dem Kuvert waren nur noch wenige übrig. Ich hatte auch, wie ich mir nun eingestehen musste, damit gerechnet, dass man auf einen Tramp wie mich gewartet hat, einen Burschen mit staubigen, ausgetretenen Stiefeln, der ein paar Songs von Burschen mit staubigen, ausgetretenen Stiefeln in Petto hätte, die die Städter gerne hören würden.
Oh ja. Die Allee gab es. Sie war lang und breit, voller Platanen und jungem schicken Volk, das in den Straßencafés saß, Frappees und farbige Drinks süffelte. Sie sahen aus wie reiche Studenten, die hier eine gute, entspannte Zeit hatten, bevor sie ins Business ihrer Eltern einstiegen. Das allein wäre nichts Besonderes gewesen. Das Niederschmetternde war, dass beinahe unter jeder Platane ein Typ mit Gitarre stand. Niemand beachtete sie. Sie spielten ihr Zeug in die heiße Luft, die voller Gelächter und dem Knattern der Vespas war, die in langen Corsos langsam und lustig die Hauptallee rauf und runter gondelten, als wären es schaukelnde Boote auf dem Wasser einer Parkanlage.
Später schrieb ich eine Story über einen abgebrannten Tramp, der nach Aix-en-Provence kommt, um mit Straßenmusik etwas Geld zu machen. Er hat eigentlich nur einen einzigen Song drauf, den er wirklich gut kann. Er ist von Bob Dylan und heißt «Stuck Inside of Mobile, with the Memphis Blues Again». Als er sich anschickt, sich in der Allee unter eine Platane zu stellen, bemerkt er zu seinem heißen Entsetzen, dass unter jedem Baum schon ein Kerl mit Gitarre steht. Als er genauer hinsieht, entdeckt er, dass er selber es ist. Er, unter jeder Platane, bis ans Ende der Perspektive. Hunderte Kopien seiner selbst. Vom Grauen gepackt, flüchtet der Tramp und verschwindet aus der Stadt.
Er hatte recht. Etwas hatte zu einem Ende gefunden.
***
Und nun, mit buchstäblich nichts als dem, was ich auf dem gebräunten Leib trug, meiner Gitarre und dem dünnen Schlafsack in der Umhängetasche stand ich vor der Tür von Freunden, die vor einiger Zeit nach Basel gezogen waren. Mein «essayistischer Roman» in den Kladden hatte es nicht bis hierher geschafft. Ich musste irgendwann vergessen haben, ihn zurück in die Tasche zu stecken, oder ich hatte ihn einfach liegen lassen, was weiß ich. Mir war bewusst, dass der Welt durch diesen Verlust kein epochemachendes Werk vorenthalten wurde. Es war mir egal. Ich hatte andere Probleme.
Ich musste, wie man so sagt, wieder auf die Beine kommen.
Ich kannte das Prozedere. Wohnung, Arbeit. Wohnung gab’s nur mit Lohnnachweis, und Arbeit nur mit Adresse.
Im Nachhinein weiß ich nicht mehr, wie diese Dilemmata, in die ich immer wieder geriet, geknackt wurden. Es ist, als hätte ich sie einfach ausgesessen, als wären sie ohne mein Zutun einfach irgendwann verschwunden. So, wie ich auch von der Insel Korsika gekommen war. In Nizza hatte ich mit meinem letzten Geld eine Überfahrt nach Ajaccio gekauft, dann auf einem Campingplatz als «Übersetzer» gearbeitet, um danach völlig abgebrannt ganz im Süden in Bonifacio zu landen, ohne Idee, wie ich wieder von der Insel runterkommen konnte. Ich tat einfach nichts, außer mich ein wenig zu sorgen und den Fremdenlegionären beim Training zuzusehen. Und so lernte ich zwei deutsche Sozialarbeiter kennen, die mich von der Insel brachten und auf dem Weg nach Frankfurt in Basel stehen blieben, um mich aussteigen zu lassen.
Das schien das ganze Geheimnis zu sein. Der unentwirrbar scheinende Knoten löste sich in einem magischen Bad aus Nichtstun, Sorgen und Verachtung. Die Verzweiflung und die Bemühungen schienen auch in der Fruchtlosigkeit zu fruchten, aber nicht so, wie man es erwartete. Es war, als bemühte man sich erfolglos, eine Tomatenplantage anzulegen, nur um völlig unerwartet festzustellen, dass es eine reiche Ernte an Erdbeeren gab.
Es war ein Mysterium.
Und auf diese Art kam ich zu einer Wohnung im letzten Haus der Stadt und zu einem Job bei der Bahnpost. Nichts, was ich wirklich wollte. Ich wollte schreiben. Aber wie?
***
Schwer zu sagen, was sich in meiner Abwesenheit verändert hatte. Oberflächlich war es noch immer das kleine, spießige Land mit seinen schlanken, spießigen Bewohnern. Aber irgendetwas war nun anders. Die siebziger Jahre, dieses seltsame und schöne Jahrzehnt, das mit Hippies und Antivietnam-Demos begonnen hatte und in den Terror der RAF mündete, war vorbei.
Ich merkte es an der Polizei. Sie schien nervös zu sein. Als ahnte sie, dass sich etwas zusammenbraute.
Besetzte Häuser unten am Rhein. Sprayer, die in der Nacht unterwegs waren, um kryptische Botschaften an die Wände zu sprühen.
Eines Nachts griff ich mir auch eine Spraydose, ging mit klopfendem Herzen raus und schrieb «Wie ein Wal im Radar» auf einen der Autobahnpfeiler, die vor meinem Haus abrupt endende Autobahnstränge trugen. Alles überragende Betonstümpfe, wie Absprungplattformen für todesmutige Turmspringerriesen. Ja. Ein Wal. Bereits auf dem Radar des Walfängers. Keine Chance zu entkommen. Wenn er auftaucht, um zu atmen, kriegt er die Harpune. So fühlte ich mich. Und das sollte die Welt nun wissen.
Die Streifenpolizisten kontrollierten mich jede Nacht, wenn ich von der Schicht vom Bahnhof kam. Manchmal auch am Tag. Beine breit, Hände an die Wand. Tastende Hände. Jede Nacht. Ich hätte nur meinen Postausweis zücken müssen. Aber ich tat es nicht. Nie. Ich bestand auf mein verdammtes Recht, auf der Straße zu sein, wann immer es mir beliebte. Es ging die Bullen nichts an. Sie kriegten meinen Personalausweis, mein Schweigen und meine kalte Wut. Ich sprach kein Wort. Das ärgerte sie. Aber sie konnten nichts dagegen tun. Außer ihre hilflosen Sprüche loswerden.
Es kam auch vor, dass sie mich aus einer Menschenmenge herauspickten, um mich zu kontrollieren. Ich fiel auf. Warum? Ich hatte das falsche Tempo drauf. Es sah nicht aus, als wäre ich auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder in den Sportclub. Sie hatten ein Auge dafür. Das waren, so dachte ich voller Verachtung, die Schweizer mit ihrer Gleichmacher-Demokratie: Alle mussten zur selben Zeit dasselbe tun. Ich hasste dieses Land noch mehr als zuvor. Es war unerträglich, hier zu leben.
***
Matthyas Jenny war nicht groß und auch nicht klein, aber er wirkte kompakt und stark, und man glaubte ihm all die Geschichten von Prügeleien in Gefängnissen und auf den Trips nach Fernost und USA, über die er geschrieben hatte.
Nun lag er in seinem Sessel und sah aus, als würde er in den nächsten Sekunden einschlafen. Seine ausgestreckten Beine zeigten in Richtung des kleinen runden Tischs in der Mitte des Zimmers, auf dem eine massive Schreibmaschine stand. Um sie herum gruppiert die senkrecht gestellten Filter einer Menge heruntergerauchter Marlboros, so wie es seine Tochter Zoë viele Jahre später in ihrem ersten Roman «Das Blütenstaubzimmer» beschreiben würde. «Eine Armee kleiner Soldaten».
Während er mich schläfrig und ironisch musterte, las ich im Stehen die Seite, die auf der Walze der Maschine eingespannt war. Es waren einige Zeilen aus dem Roman «Postlagernd», der bald bei Maro herauskommen sollte. Ich machte eine Bemerkung zum «lyrischen Stil» seiner Prosa. Aber tatsächlich war ich beeindruckt und ein wenig schockiert. Es war das erste Mal, dass ich einen Blick auf das Typoskript eines richtigen Schriftstellers werfen konnte. Und das, was ich da las, war um so vieles besser als das, was ich schrieb. Es war schlicht und bildhaft, hart, direkt, und es ging um Leben und Tod.
Matthyas Jenny war gut zehn Jahre älter als ich, hatte einen seltsamen Humor, der sich um die Absurditäten und die Vergeblichkeiten des Daseins rankte, und er war sozusagen der Literaturhäuptling der Stadt.
Direkt unter uns, im Keller, befand sich Jennys «Nachtmaschine», die Druckmaschine, mit der er die Bücher seines «Nachtmaschine»-Verlags druckte. Und er hatte das von John Giorno erfundene Poesietelefon in die Schweiz, nach Basel, gebracht. Wer die richtige Nummer wählte, konnte sich gelesene Gedichte anhören. Außerdem pflanzte er jedes Jahr den Baum der Poesie und zog seine beiden Kinder allein groß.
Es war zwei Uhr morgens, und ich war leidlich betrunken. Ich hatte im «Wilden Mann» meine Entlassung gefeiert. Denn die Nacht zuvor hatte ich in einer Gefängniszelle verbracht.
Cops hatten mich um drei Uhr morgens beim Wildpinkeln aufgegriffen. Und da ich die Ich-will-Ihre-Dienstnummer-haben-Nummer zur Aufführung gebracht hatte, hatten sie mich in den Streifenwagen verfrachtet, auf dem Posten gefilzt, Gürtel und Schuhe abgenommen und erst am nächsten Morgen wieder entlassen. Nicht ohne mir zum Abschied einen Bußgeldbescheid wegen «ordnungswidrigem Verrichten der Notdurft» in die Hand zu drücken. Das war komisch. Denn die ganze Gegend, die Gehsteige, die Straßen, die Rinnsteine, alles war von Hundekot gerade zu gesprenkelt, wie von glitschigen Rostflecken überzogen.