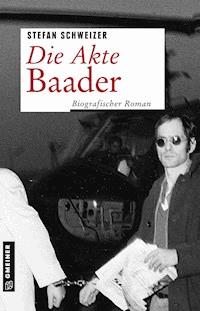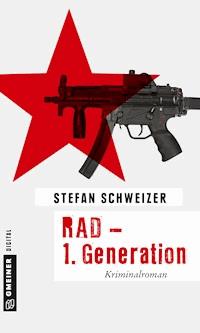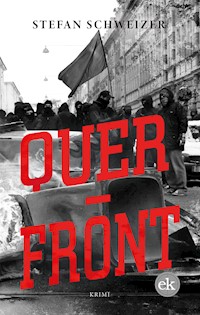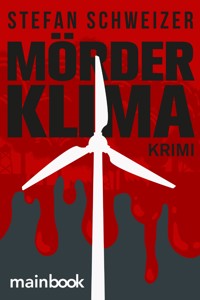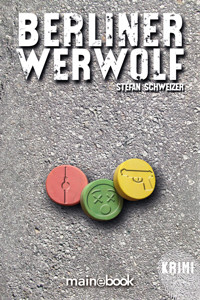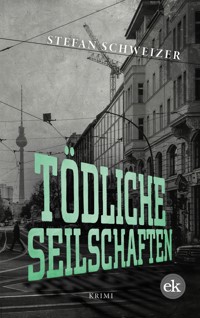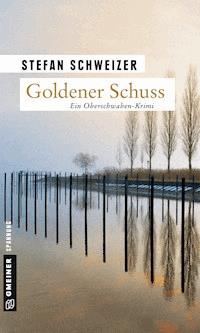
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Enzo Denz erhält von dem türkischen Unternehmer Mehmet Gül den Auftrag, dessen untergetauchte Tochter zu suchen. Er findet Canan in der Ravensburger Szenekneipe ›Räuberpistole‹. Aber sie ist tot! Gestorben an einem »Goldenen Schuss«. Für Denz weisen alle Indizien auf Mord hin. Ein Abgrund aus Drogen- und Menschenhandel tut sich auf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Schweizer
Goldener Schuss
Enzo Denz’ erster Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Peter Lippert / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4652-8
1. Kapitel
MMD
Make My Day.
Aber nicht so.
Nie im Leben.
Ich hasse nämlich Politik. Habe sie immer schon gehasst. In etwa so, wie Kleinkinder Wirsinggemüse lieben – die Wurst, die es dazu gibt, ist schon okay, aber das Grünzeug kriegen sie kaum runter. Probieren Sie es ruhig mal aus. Noch mehr als Politik hasse ich Politiker – beinahe so sehr, wie der Mailänder die Sizilianer mag – und umgekehrt. Und jetzt sah es so aus, als ob sich eine Begegnung mit der Politik und einem Politiker nicht vermeiden lassen würde. Die Chancen standen fifty-fifty. Ich wettete und setzte darauf, dass ich verlor.
Politiker sind Parasiten, die sich auf die Bevölkerung stürzen und sie aussaugen wie Moskitos einen verschwitzten und 200 Kilogramm schweren Mann im Regenwald. Mir reichten die höchstens eine Minute dauernden Statements in den Nachrichten, in denen die vom Volke demokratisch gewählten Mandatsträger formatgerecht und passend für den Adressaten die Welt in drei bis zehn Sätzen erklärten und dabei lächelten, als ob sie den Kontostand ihres Schweizer Bankkontos vor Augen hätten.
Die Anzugträger binden sich heute nicht immer einen Schlips um, manche tragen sogar einen Brillanten im Ohr und wiederum andere fahren mit dem Fahrrad zum Bundestag. Ihre Tattoos bedecken sie noch, aber seitdem die inzwischen geschiedene Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten das ihre öffentlichkeitswirksam in ihren – mit 38 Jahren erschienenen (!) – Memoiren zur Schau gestellt hatte, war ich der Überzeugung, das würde sich im Laufe der Zeit ändern. Und in 50 Jahren gäbe es sicherlich zahlreiche Abgeordnete mit einer Menge Blech im Gesicht und sonst wo. Gleichberechtigung in der Politik bedeutet, dass Frauen ebenso wie die Männer an der großen Ausbeutungssause teilnehmen dürfen – sich dafür aber manchmal einen dummen Spruch vom scheinbar starken Geschlecht einfangen, denn da ist die Politik nicht anders als der Rest der Gesellschaft.
Mode, Gender und Gebaren – all das ändert nichts an der Tatsache, dass die Politiker die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag aufs Neue einseifen – nicht zuletzt, um ihren Goldenen Schnitt dabei zu machen. Dabei geht es aber nicht immer nur ums schnöde Geld, sondern manchmal auch um geldwerte Vorteile wie ein kostenloses Upgrade in einem Luxushotel, Champagner und Kaviar bis zum Abwinken oder sexistische Witze in schlüpfrigen Hotelbars gegenüber Journalistinnen, die das ihrerseits in auflagenstarken Artikeln ausschlachten. Letztlich geht es immer um Macht und Geld ist nur ein Mittel, um Macht ausüben zu können – auch wenn mit Abstand das beste.
Die Luft war noch recht kalt. Der Wind peitschte unerbittlich über das Pflaster. Staub und Dreck wurden in der Luft herumgewirbelt, sodass ich froh war, meine Sonnenbrille zu tragen. Trotz der Kälte und des stürmischen Windes nahte der Frühling unaufhaltsam. Die ersten Sonnenstrahlen beschienen wohltuend den Marienplatz – wenn sie sich zwischen den Wolken hindurchkämpfen konnten. Das ständige Wechselspiel aus Licht und Schatten stellte die Sinne vor eine Herausforderung. Wer an Migräne litt oder wetterfühlig war, deckte sich jetzt am besten mit einer Hunderterpackung Schmerzmittel ein. Ein Blick in die Tageszeitungen verriet, dass alte Menschen bei dieser Witterung reihenweise starben.
Ich stand an einem Seiteneingang des rot gestrichenen Ravensburger Rathauses, im Rücken das weiße Waaghaus mit einem der vielen Türme. Etwas windgeschützt, aber immer noch kam ich mir vor wie bei einem Urlaub an der Nordsee zu Silvester.
Drei Meter entfernt von mir hing ein Hohlkammerwandplakat, das an einer Straßenlaterne befestigt war. Mir war übel. Ob das an den paar Bier von gestern Abend, der Currywurst, oberschwäbisch Geschlagene, zum Mittagessen oder dem Plakat lag, war schwer zu sagen.
MdB Dr. Herbert Schwarz
Unsere Heimat – Unsere Sicherheit – Unser Wohlstand
Drunterzuschreiben, von wem das Plakat stammte, hätte man sich sparen können. Das konnte sogar ein ambitionierter Dreijähriger mit dem politischen Sachverstand eines Siebenjährigen sagen – sprich ein Hochbegabter. Es stand natürlich dennoch da, wahrscheinlich, weil sich das so gehörte und damit auch der letzte Idiot wissen konnte, wem er alles Gute in seinem Leben zu verdanken hatte. Besonders groß und einprägsam.
Mein Zustand verschlimmerte sich. Es stieß mir auf. Eine ungesund schmeckende Geruchswolke aus Currywurst-Spezialsoße, ranzigem Fett und Kaffee stieg nach oben. Ich kämpfte, um alles drinzubehalten. Ein Underberg wäre nicht schlecht gewesen. Leider hatte ich meine Reserve bereits verbraucht.
Die Gestaltung des Plakats war das Beste. Es wirkte so altbacken wie eine Wohnzimmereinrichtung aus den 50er- Jahren. Lernte man bei den Konservativen nicht, was Modernität hieß, oder war der antiquierte Stil Teil der Botschaft? Schwarz versuchte, die gestalterische Scharte durch seinen Gesichtsausdruck auszubügeln, was ihm einen durchtriebenen Ausdruck verlieh. Geradezu herausfordernd, siegessicher und unberührbar blickte er in das Objektiv. ›Mir kann keiner was.‹ Die oberschwäbische Variante von Scarface:
The world is yours.
Und wenn’s die Welt bis nach Weißenau ist.
Der Blick von Schwarz sagte: ›Was ich will, das kriege ich. Und was ich nicht habe, das will ich nicht – zumindest nicht jetzt. Aber nehmt euch in Acht. Mit mir ist jederzeit zu rechnen.‹ Über den oberen rechten Plakatrand war ein weißer Papierstreifen geklebt, der den Anlass des Plakates bekanntgab.
MdB Dr. Herbert Schwarz, Mitglied des Verteidigungsausschusses, Stadtbibliothek Ravensburg, 18. März 2014: Die Afghanistan-Falle? Können wir die Taliban noch besiegen?
Für meinen Geschmack standen zu viele Informationen auf dem Papierstreifen. Das Ganze wirkte gequetscht und man musste die Augen zu sehr anstrengen, um es aus drei Metern Entfernung entziffern zu können. Nicht gerade professionell. Aber das passte ja zum Gesamteindruck. Heute wurde überall nur mit Wasser gekocht. Nur die Übermutti des Vereins machte (im metaphorischen Sinne) eine gute Figur, was auch nicht besonders schwierig war, wenn man sich den Rest der Kabinettsmannschaft anschaute.
Mein Job. Überwachung. Verdacht auf Untreue, Verletzung des Heiligen Sakraments der Ehe. Die knapp 40-jährige attraktive Frau stand 200 Meter weit von mir entfernt. Sie trug ein rotes Kostüm, das so unauffällig war wie ein Albino im Sahelgürtel. Der Kostümrock gewährte einen Blick auf ihre atemberaubenden Beine. Hätte sie meiner Geliebten nicht so ähnlich gesehen, dann hätte ich Regentänze aufgeführt, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Der rote Hut war abenteuerlich – mit einer riesigen Krempe, auf der eine Schwarzwälder Schlachtplatte spielend Platz gefunden hätte. Vermutlich der letzte Schrei in den Boutiquen Mailands, Zürichs und – nun ja, Ravensburgs. Über dem Kostüm trug sie einen beigen Trenchcoat, der vergleichsweise konservativ wirkte, aber ihre Taille gelungen zur Geltung brachte.
Die Signalfarbe des Kostüms hatte mir die Observierung erleichtert. Auch mit dumpfem Kopf war es unmöglich, sie aus den Augen zu verlieren. Ich betete ein kurzes Ave- Maria, dass sie nicht in die Stadtbücherei ging. Das wäre der Supergau, da ich dann gezwungen wäre, mir den Vortrag von MdB Schwarz anzuhören. Der Inhalt der Rede war so vorhersehbar wie die Karfreitagspredigt:
- das aufrechte Deutschland,
- wild gewordene Taliban, die ihre Frauen zwingen, verhüllt und nur in Begleitung eines männlichen Verwandten auf der Straße herumzulaufen und
- blindwütige al-Qaida-Terroristen, die sich in Großmannssucht übten.
Noch bestand ein wenig Hoffnung. Sie wirkte unentschlossen und holte ein Handy aus ihrer Tasche. Vielleicht rief sie den von ihrem Ehemann imaginierten Lover an.
Vor drei Tagen hatte ich von ihrem Mann, dem schwerreichen oberschwäbischen Wurst- und Fleisch-Tycoon Meier, den Auftrag erhalten, sie zu überwachen. Er war misstrauisch geworden, da sich seine Frau nicht mehr den ganzen Tag in der heimischen Villa langweilte, sondern so etwas wie ein soziales Eigenleben entdeckt hatte. Immer, wenn er sie anriefe, hielte sie sich irgendwo anders auf, manchmal ginge sogar nur die Mailbox ran.
Meier war mittlerweile außer sich. Wenn er sie dann an der Strippe habe, behaupte sie, bei Freundinnen, auf einer Vernissage, bei Lesungen und Ähnlichem zu sein.
Das könne doch nicht mit rechten Dingen zugehen, so der Unternehmer, der der beste Beweis dafür war, dass seine Produkte schmeckten. Seine rote Gesichtsfarbe wies aber zugleich auf die Gefahren eines zu hohen Fleisch- und Wurstkonsums hin. Zu viel Nitrit-Pökelsalz und Fett sind einfach ungesund.
Während er 24 Stunden am Tag das Geld heranschaffte, so fuhr er fort, vergnügte sie sich, so seine Fantasie, mit zahllosen Liebhabern auf wilden Sexorgien. Was ihm am meisten Angst einjagte, war, dass sie mit seinen Qualitäten als Liebhaber unzufrieden sein könnte und das herumerzählte. Unzufrieden betrachtete er seine kurzen, dicken Wurstfinger. Seine Stimme bekam einen weinerlichen Klang und die Worte zitterten wie Espenlaub im Herbststurm, als er sagte:
»Das habe ich nicht verdient. Finden Sie Beweise. Sie soll bluten. Keinen Cent kriegt die von mir.« Beim letzten Satz wurde er wieder selbstsicherer, da er wusste, dass ihm beim Geld niemand etwas vormachen konnte.
Selbstmitleid und Angriffslust in einem Atemzug – kaum auszuhalten. Aber ich dachte an mein leeres Bankkonto und daran, dass ich abends hin und wieder gerne ein paar Bier trank, dabei sinnlose Serien anschaute und die Seele baumeln ließ. Für Letzteres benötigte ich ab und zu ein gewisses Stimulans und das kostete noch mehr als Bier.
»Und wenn Ihre Frau treu ist und ich nichts finde?«, hatte ich vorsichtshalber eingewandt.
»Dann suchen Sie eben weiter«, gab er sich störrisch und von der Richtigkeit seines Verdachts überzeugt.
Den Auftrag hatte ich passenderweise meinem Vater zu verdanken, da er Duzfreund des Wurstfabrikanten war und sie hin und wieder gemeinsam golften oder bei einem Freimaurertreffen seltsame Rituale ausübten. Bei einem unserer nächsten Gespräche würde mein Vater mir sicherlich unter die Nase reiben, was ich ihm alles schuldete. Aber mein Vater ist ein Thema für sich, über das ich nicht gerne rede.
Die ersten zwei Tage der Ermittlungen waren ergebnislos verlaufen. Brunch, Mittagessen und Kaffeetrinken mit Freundinnen, ausgiebiges Shoppen, eine Lesung, ein Besuch im Fitnessstudio und weitere Harmlosigkeiten. Okay, sie war aktiv und ihren Freizeitterminkalender hätte ich nicht haben wollen. Von einem Liebhaber war aber weit und breit nichts zu sehen. Konspiratives Verhalten, Klandestinität? Keine Spur. Sie klappte das Handy zu und bewegte sich Richtung Stadtbibliothek. Ich schien meine Wette zu gewinnen. Und jetzt blühte mir vermutlich der öffentliche Vortrag eines Politikers über die deutsche Sicherheitspolitik in Afghanistan. Ich seufzte. Das war hart verdientes Geld. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen, da ich den Auftrag angenommen hatte und der Tag ohnehin schon versaut war. Noch herrschte das Prinzip Hoffnung, denn sie blieb wieder stehen.
In der Stadtbücherei Ravensburg finden regelmäßig Lesungen und Vorträge statt. Die Stadtbücherei befindet sich im Kornhaus, das 1451 bis 1452 erbaut worden war. Bis in das 20. Jahrhundert hinein diente es als Lager- und Handelshaus für Getreide aus ganz Oberschwaben. Von meinem Standpunkt aus sah ich die Vorderseite des weißen Gebäudes mit hässlichen braun-grünen Fensterläden. Es sah aus wie ein überproportioniertes Fachwerkhaus, nur dass die Holzbalken fehlten. Die Stadtbibliothek thronte majestätisch auf dem Marienplatz.
Die Wurstfabrikanten-Gattin klappte ihr Handy zusammen und blickte einen Moment lang auf die moderne Glaskonstruktion, die zur Tiefgarage führte. Wollte sie doch zu ihrem Auto? Hatte sie eine Verabredung in der Tiefgarage? Ihr Blick schweifte nach links zu den drei großen Fahnenmasten, die rechts neben dem ehemaligen Kornhaus flatterten und kulturelle Events in der Oberschwaben-Metropole bewarben. Plötzlich sah sie eine adrett gekleidete Blondine im modischen grünen Mantel und mit braunen Wildlederschuhen, deren Haare so wasserstoffblond waren, wie sie dies wohl in Träumen 15-Jähriger immer sind. Die Frauen begrüßten sich mit galantem Bussi-Bussi, einer flüchtigen Umarmung und gingen dann auf den Haupteingang der Stadtbibliothek zu.
Also doch der Vortrag. Ich war konsterniert, obwohl das Ergebnis absehbar gewesen war. Vielleicht entpuppte sich die Veranstaltung als konservatives Gangbang-Event inklusive verwackelter Handy-Filmchen und Internetvermarktung – dann hätte der Wurstfabrikant mit seinem Verdacht doch recht gehabt. Aber daran glaubte ich nicht.
Ich beschloss, heute noch die Ermittlungen fortzuführen und sie dann für eine Woche ruhen zu lassen und dabei das Honorar weiterzuberechnen, das die Fleischer-Portokasse kaum belasten dürfte – bei Tonnen von Wurst und Fleisch spielte es ja kaum eine Rolle, ob fünf Scheiben Lyoner fehlten oder nicht.
Das Publikum im Vortragssaal der Stadtbibliothek war gemischt, von Partei-Honoratioren über oberschwäbischen Geldadel bis hin zu gelangweilten Rentnern, die bedauerten, dass die Republikaner in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und sie für die NPD zu alt waren. Ich kam mir unpassend vor. Wie der Papst im Frankfurter Bahnhofsviertel, der eine Münze in einen Kondom-Automaten wirft. Die Fabrikanten-Gattin und ihre Freundin begrüßten Bekannte und setzten sich ziemlich weit vorne in die bestuhlten Reihen, direkt hinter die lokale Parteiprominenz.
Ich zog es vor, mich links in die letzte Reihe zu setzen. Kritische Blicke blieben mir dennoch nicht erspart. Das musste an meiner Aufmachung liegen. Dabei hatte ich mich für diesen Auftrag recht schick gekleidet, da ich geahnt hatte, dass die Observierung einer großbürgerlichen Dame mich zwangsläufig in gutbürgerliche Kreise führen würde. Mein weißes, leicht zerknittertes Hemd wies vielleicht einen roten Fleck von der mittäglichen Curry-Soße auf oder waren die Schwitzränder unter den Achseln inzwischen zu ausgeprägt, um bei einer konservativen Parteiveranstaltung unbeachtet durchgehen zu können? Lag es unter Umständen daran, dass meine braunen Lederschuhe staubig und abgenutzt aussahen? Konnten die grobe Missachtung ausdrückenden Blicke eventuell an meinem braunen Leinensakko liegen, das ich beinahe zehn Jahre nicht mehr getragen hatte und bei dem sich Taschen und Nähte in Auflösung befanden? Nur Gott ist allwissend, ein Ich-Erzähler hingegen muss sich manchmal auf Mutmaßungen stützen.
Nachdem der Obermufti des Kreisverbandes den Hauptredner angekündigt und seine Verdienste um die Stadt und den Landkreis in den schillerndsten Farben gepriesen hatte, kam Schwarz an die Reihe. Er erhob sich von seinem Platz in der ersten Reihe und bewegte sich dynamisch wie ein Athlet auf das Rednerpult zu, wobei er die wenigen Treppen wie ein Hürdenläufer nahm. Er trug einen sündhaft teuren grauen Anzug und darunter eine elegante Weste – à la englischer Gentleman. Die Fliege vervollständigte das großbürgerliche Aussehen.
Schwarz war Anfang 50 und machte einen sehr vitalen Eindruck, was nicht zuletzt an seiner nahtlosen Sonnenbankbräune lag. Ein dichter schwarzer Vollbart mit grauen Strähnen umrahmte ein kräftiges, rundes Gesicht mit markanten, stechenden grau-grünen Augen. Die Nase war ein wenig groß geraten. Trotz seines Alters hatte Schwarz volles Haar und auch hier waren nur vereinzelte graue Haarsträhnen zu sehen.
Der Applaus schien nicht enden zu wollen. Die Mitglieder des hiesigen Parteiverbandes verehrten Schwarz offensichtlich als einen, der es geschafft hatte, aus der Provinzpolitik den Schritt in die große, weite Welt nach Berlin zu tun. Dankend nickte Schwarz immer wieder ins Publikum und hob abwechselnd den linken und rechten Arm. Sein strahlendes Lächeln war dabei so falsch wie die Zähne eines 90-Jährigen, der sein Leben lang gerne Marmeladenbrote und Torte gegessen hat.
»Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, liebe Ravensburgerinnen und Ravensburger«, begann Schwarz sehr dynamisch, nachdem der Applaus endlich verebbt war, seine Rede, und es war sofort klar, dass dieser Mann ein Hobby besaß, nämlich sich selber reden zu hören.
Der oberschwäbische Akzent wirkte aufgesetzt. In Berlin kam er sicherlich gut an und hier in der Metropole Oberschwabens wirkte er kultiviert und weltmännisch. Lautsprecher sind bei mir in etwa so beliebt wie christliche Missionare in Saudi Arabien. Diese ganze Art der Selbstdarstellung war mir zuwider und bestätigte einmal mehr meine Vorurteile gegenüber der Politik und den Politikern.
»Die Sicherheitslage der NATO- und ISAF-Truppen in Afghanistan ist alles andere als unbedenklich«, fuhr Schwarz fort. »Die Frühjahrsoffensive der Taliban steht wieder einmal an, und es ist die Frage, ob wir auch dieses Mal in der Lage sind, sie erfolgreich zurückzuschlagen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind inzwischen deutlich weniger Truppen in Afghanistan stationiert …«
Meine Gedanken drifteten ab. Ich dachte kurz an meine eigenen Afghanistanerfahrungen, dann an die armen Teufel, die in Afghanistan stationiert waren und an die noch ärmeren Teufel, die in Afghanistan lebten und für die der Krieg seit Jahrzehnten zum Alltag gehörte.
»Zwei Strategien sind denkbar, da sind wir uns mit unseren amerikanischen Verbündeten einig. Entweder wir spüren die Taliban und die Mitglieder der al-Qaida in ihren Verstecken auf und vernichten sie. Oder wir gewinnen das Vertrauen der afghanischen Bevölkerung, sodass diese ihre Unterstützung für die Aufständischen zurückzieht und merkt, dass Demokratie und wirtschaftliches Wohlergehen …«
Aus reinem Selbstschutz folgte ich dem Vortrag nur mit einem Ohr. Das Publikum hingegen war gefesselt. Schwarz legte den Saal flach und alle hingen begeistert an seinen Lippen. Das rief ein bisschen Neid in mir hervor, denn ich war alles andere als ein begabter Redner, der seine Zuhörerschaft mir nichts, dir nichts um den Finger wickeln konnte.
GSB
Ganz schön beschissen.
Aber aus dieser Nummer kam ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Oder doch? Wer oder was sollte mich daran hindern, aufzustehen und die Veranstaltung zu verlassen? Vielleicht hatte der Fleischfabrikant einen Detektiv auf mich angesetzt, um zu überprüfen, ob ich meine Arbeit tatsächlich erledigte – oder ein Techtelmechtel mit seiner Gattin anfing.
»Wer mich kennt, weiß, dass ich …«
Diese Form der Selbstbeweihräucherung verursachte mir immer ernsthafte Bauchschmerzen.
»… nicht gerne einem Kollegen der Sozialdemokraten recht gebe, zumal, wenn es sich bei diesem um ein Nordlicht handelt …«
Das Publikum wieherte.
»… aber was Peter Struck, der erst vor Kurzem verstorbene ehemalige Verteidigungsminister …«
Gemischte Reaktionen des Publikums, vereinzeltes Klatschen und ein Bravo-Ruf zeugten von der geistigen Einstellung des Publikums.
»… gesagt hat, stimmt: Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt.«
Tosender Applaus war die Folge. Siegessicher und arrogant blickte Schwarz in die Zuhörerschaft. Jetzt hatte der Krieg in Afghanistan auch schon Oberschwaben erreicht. Es hätte nicht viel gefehlt und einige der Zuhörer wären aufgestanden, hätten den rechten Arm gehoben und irgendetwas von Sieg gebrüllt.
Ich hatte genug. Mein Fall war vorerst erledigt. Ich beschloss, dass ich mir mindestens ein Bier verdient hatte. Wer sich das freiwillig antat, war selber schuld.
2. Kapitel
Am nächsten Tag schienen Sonnenstrahlen freundlich durch mein Bürofenster. Der März ließ sich heute nicht so schlecht an. Mein Büro befand sich hinter dem Ravensburger Bahnhof, mitten in einem Wohngebiet, unweit der Schussen. Die Randlage spiegelte sich in der gut bezahlbaren Miete wider – zumal die anderthalb Zimmer auf knapp 20 Quadratmeter verteilt waren. Mein Vermieter war ein optimistischer Philanthrop und pensionierter Deutsch- und Gemeinschaftskundelehrer, der nicht unbedingt auf die Mieteinnahmen angewiesen war. Das erklärte, warum er manchmal ein Auge zudrückte, wenn ich mit der Zahlung im Verzug war. Erlassen hatte er mir aber noch nie auch nur einen Cent. So etwas gab es vermutlich in Schwaben nicht und schon gar nicht bei Vermietern.
›Privatermittlungen E. Denz‹ stand auf dem gut sichtbaren Türschild auf blau-weißem Grund. Die Farbwahl entsprach den Farben der Stadt Ravensburg. Ich hoffte, dass meine potenzielle Klientel das E. für Eberhard oder einen anderen soliden schwäbischen Vornamen hielt. Dass ich Enzo hieß, würde vielleicht doch so manchen Kunden davon abschrecken, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Das konnte ich mir nicht leisten.
Verschmitzt dachte ich an das leckere Sixpack Bier, das ich mir am Abend gegönnt hatte, während Fußball im Fernsehen lief. Der VfB Stuttgart hatte sich ganz wacker geschlagen. Glanz und Gloria vergangener Zeiten lagen allerdings in weiter Ferne. Es war auch nicht ersichtlich, wie der VfB an die goldenen Zeiten anknüpfen wollte. Guido Buchwald, Fritz Walther und Maurizio Gaudino – Meisterjahr 1984 mit Dinkelacker-Bier auf dem Trikot. Dann einige Jahre später das goldene Dreieck: Krassimir Balakow, Giovane Elber und Fredi Bobic. Nichts war davon mehr zu sehen.
Der VfB sorgte nicht nur für ausgelassene Freude.
Gedankenblitz. Switch. Ich schloss die Augen und begann zu träumen: von meinem nagelneuen Alfa Romeo Giulia. Ganz in Schwarz. Eine Verführung zu nicht unschuldigem Fahrverhalten. Vor ein paar Monaten hatte ich mir den lang gehegten Traum erfüllt. Man lebt schließlich nur einmal. Was meine Bank glücklich machte und mich mittelfristig hoch verschuldete. So what? Im Moment juckte mich das wenig, Hauptsache der Fahrspaß stimmte.
Allerdings: Ich hatte ein paar Jahre sparen müssen. Der letzte Urlaub lag lange zurück. Teneriffa. Ich war in die Vollen gegangen. Vier-Sterne-Hotel. AI. All inclusive. RIU. Beste Küche, bestes Essen. In der Nähe von Las Americas. Ehemaliges Sheratonhotel, immer noch nobel. Briten, Skandinavier, Franzosen und wenig Deutsche. Tolle Pool-Landschaften. Der Infinity-Pool – der Hammer. 14 Tage lang derselbe Ablauf. Englisches Frühstück mit Rührei, gebratenem Speck und Bohnen. Um 10.00 Uhr, mit dem Öffnen der Pool-Bar, das erste Bier. Cruzcampo. Super Stoff. Lecker gekühlt. Trinken, schwimmen, träumen, Frauen hinterherstarren und ansprechen. Mittagessen, kurzer Schlaf im Zimmer, dann zurück an den Pool. Sonne tanken. Zu Hause war beschissenes Wetter gewesen. Ein Traum. Gediegenes Abendessen mit mindestens fünf Gängen. Und spät am Abend ziemlich abgefüllt ebenso dichte Britinnen oder Skandinavierinnen abchecken. Ich seufzte. Damals war ich Single gewesen. Ein Superurlaub. Mit hohem Spaßfaktor. Aber auf was verzichtete man nicht alles, wenn man sich sein Traumauto kaufen wollte. Außerdem war ich ja in quasifesten Händen, was eine Wiederholung des Urlaubs ohnehin unmöglich gemacht hätte.
Aus der kleinen Stereoanlage, die im weißen Aktenregal stand, das von einem schwedischen Möbelhersteller stammte, wummerte der Bass. Die ›Massiven Töne‹ rappten über das Autofahren – passend zu meinem inneren Film.
Obwohl ich im Moment die Vorteile einer recht stabilen, wenngleich auch nicht ungefährlichen Beziehung genoss, teilte ich den Wunsch der ›Massiven‹ nach Bewunderung durch das weibliche Geschlecht – für mich, meine Fahrkünste und mein Auto.
Bevor der Refrain beendet war, dachte ich eine Sekunde lang an meinen Auftrag. An den furchtbaren Vortrag in der Stadtbücherei. An die – so hatte es zumindest im Moment den Anschein – treue Frau des Fleisch- und Wurstunternehmers, die nur ihre sozialen Kontakte auffrischen wollte, um zu Hause nicht in Bollinger zu ertrinken. Daran, dass dieser Auftrag half, die Schulden für Giulia abzubezahlen. Die ›Massiven‹ drängten zurück in mein Bewusstsein:
Die Hip-Hop-Band ›Die Massiven Töne‹ waren sicherlich nicht die intellektuellen Größen der Rapkultur. Die Rhymes aber waren witzig und der Groove lässig. Und sie stammten aus Stuttgart und waren nur wenig älter als ich. Stuttgart – die Raphochburg Deutschlands der 90er- Jahre. Die Kolchose ließ grüßen – gute alte Zeiten. In Gedanken drehte ich noch ein paar Runden Richtung Bodensee – mit meiner Geliebten Bettina. Ihr blondes, wallendes Haar duftete nach Frühling. Wir fuhren vorbei an endlosen Hopfenfeldern – Grundlage für unzählige Hektoliter Bier.
Ich hasste Scheidungssachen und Eifersuchtsaufträge. Alles sehr schmutzig, widerlich und klein-klein. Ein eifersüchtiger Partner war so unvoreingenommen wie ein Plagiatsjäger bei der Untersuchung der Dissertation eines konservativen Politikers. Wer suchte, der fand, und wer fand, der richtete und vernichtete. Meine Aufgabe bestand bei dieser Art von Auftrag darin, die bereits vorgefertigte Meinung zu stützen. Falls die Fakten das nicht hergaben, taugte der Detektiv nichts. Es gab wirklich nettere Dinge, als herauszufinden, wer mit wem was hatte, obwohl sie das eigentlich nicht haben sollten, oder wer wen unbegründet verdächtigte, mit jemand anderem etwas zu haben. Mir wurde schwindlig. Eindeutig Flüssigkeitsmangel.
Gerade als ich mir zu überlegen begann, was ich zu Mittag essen wollte,
a) Pizza
b) Currywurst, also hier Oberländer, mit Bahnschranke und Pommes frites (siehe gestern),
c) Döner Kebab oder
d) Leberkäsewecken mit Ketchup und Senf
schreckte mich die Türglocke aus meiner Grübelei. Ich verschob die Entscheidung, tendierte aber zu b) und c) oder a) und d).
Ein neuer Klient? Oder ein Überraschungsbesuch von Bettina? Ohne nachzufragen, wer da sei, drückte ich den Türöffner, öffnete die direkt in mein Büro führende Wohnungstür einen Spalt weit und setzte mich chefmäßig hinter meinen Schreibtisch, die Beine weit gespreizt und die Arme vor der Brust verschränkt. Es kostete mich Mühe, nicht wieder – alles ganz easy – die Beine auf den Schreibtisch hochzulegen. Zaghaft öffnete sich die Tür. Ein kleiner, untersetzter Mann mit olivbrauner Haut, einer Stirn- und Deckelglatze und einem adrett zurechtgestutzten Schnurrbart schaute unsicher herein. Er war ziemlich korpulent und wirkte wie ein putziger Teddybär, kaum größer als 1,60 Meter. Er trug ein grau-braunes kariertes Sakko und eine scharf gebügelte graue Stoffhose. Die braunen Lederschuhe waren poliert. Die Garderobe passte zwar nicht zusammen, machte aber einen sehr ordentlichen Eindruck. Irritiert blieb sein Blick auf meinem Schreibtisch haften, in dessen Mitte eine italienische und eine deutsche Flagge standen.
»Meine Mutter ist Italienerin«, murmelte ich mehr zu mir selber, was er geflissentlich überhörte.
»Herr Denz?«, fragte er schließlich zaghaft und blieb –immer noch halb in der Tür – stehen.
Ich nickte.
»Enzo Denz. Privatermittlungen. Nehmen Sie doch bitte Platz.«
Mein Vorname irritierte ihn trotz des Hinweises auf meine Mutter, er ließ sich aber immerhin dazu hinreißen, in das Büro einzutreten. Der Besucherstuhl war orange, aus Plastik und stammte aus den 70er- Jahren – frisch vom Sperrmüll, nicht vom Flohmarkt. Ich bin kein Freund unnötiger Ausgaben.
»Mehmet Gül«, stellte sich mein potenzieller Klient vor und reichte mir eine edle Visitenkarte.
Die Köfte hatten ihm offensichtlich immer gut geschmeckt. Sein Blick streifte irritiert durch mein Büro, als suche er etwas.
»Äh, die Musik …«, ließ er den Satz mit leicht oberschwäbischem Akzent in der Luft hängen, wie eine Rauchschwade in einer serbokroatischen Kneipe an einem Sonntagvormittag.
Die ›Massiven‹ waren gerade bei ›Wer‹ angelangt.
»Ich kann auch ›Azzuro‹ von den ›Toten Hosen‹ auflegen, ›Tarkan‹ habe ich leider nicht da«, stellte ich halb zufrieden und teils mit Bedauern fest, schaltete dann aber die Musik ab, während Gül nervös mit den Händen über seinen Bauch streichelte. »Bier?«, fragte ich, während ich voller Stolz auf meinen zwei Meter hohen weißen Kühlschrank deutete, der neben dem Aktenordnerregal stand.
Der Kühlschrank verlieh mir Integrität und bildete das Rückgrat meiner Selbstständigkeit.
»Nein, danke.«
Endlich hatte er Mut gefasst und sich auf den Besucherstuhl gesetzt. Ich hatte ihn an der Angel.
»Ich kann Ihnen auch ein Glas Leitungswasser bringen oder einen Kaffee machen, falls Ihnen das lieber ist.«
Der Türke schüttelte den Kopf. Er hielt den Kopf gesenkt, sodass sein Doppelkinn prominent hervortrat. Er faltete die Hände über seinem dicken Bauch und machte einen friedvollen, in sich ruhenden, aber auch bemitleidenswerten Eindruck. Ich schaffte es mit Mühe, ihn nicht in den Arm zu nehmen.
»Ich möchte, dass Sie …«
Verzweifelt brach er ab. Schnappatmung setzte ein. Obwohl es in meinem Büro nicht geheizt war, brach ihm der Schweiß auf der Stirn aus. Die Mundwinkel zitterten leicht. Ich ging zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Leibinger-Bier heraus und öffnete sie an der Schreibtischkante. Das erste Bier am Tag ist immer das beste.
»Ist das Ihre Arbeitskleidung?«, wechselte er abrupt das Thema und deutete auf meinen dunkelblauen Hoody mit weißen Streifen und danach auf meine türkisfarbene Jogginghose mit den drei Streifen.
»Nein, aber mein Credo«, entgegnete ich.
Das verstand er nicht.
»So etwas wie meine Lebenseinstellung«, fügte ich deshalb hinzu.
Ich nahm einen langen Schluck Bier und ließ den goldenen Stoff die Kehle hinunterlaufen.
»Was kann ich für Sie tun?«, versuchte ich dann, zum geschäftlichen Teil der Veranstaltung zurückzukommen.
Die Gesichtsfarbe Güls rötete sich um drei Nuancen. Eine Ader auf der Stirn pochte. Ich glaubte, sein Herz laut und schnell pumpen zu hören, aber wahrscheinlich bildete ich mir das nur ein. Er schien unter starkem Stress zu stehen.
»Meine Tochter Canan ist verschwunden«, brachte er schließlich mit heiserer Stimme hervor, während er die Handflächen aufeinanderpresste. »Sie müssen sie finden, bevor es zu spät ist.«
Eine Träne kullerte an seiner Wange herunter, dann noch eine. Es wurden immer mehr und das Schluchzen war herzzerreißend. Es gehörte nicht zu meinen Pflichten, Klienten die Hand zu halten. Aber es brach mir beinahe das Herz.
3. Kapitel
Ich hatte drei Möglichkeiten:
a) ihm ein Taschentuch zu reichen,
b) ihn in seiner türkischen Mannesehre zu beschämen, indem ich ihn fragte, warum er wegen einer verschwundenen Tochter weinte – das werde doch in seiner Heimat eher als Glücksfall angesehen, oder
c) ihn emotional aufzufangen, um endlich den Sachverhalt geschildert zu kriegen.
Ich entschied mich für c).
»Es ist gut, dass Sie Ihre Gefühle rauslassen, aber um Ihrer Tochter wirklich zu helfen, sollten Sie mir erzählen, was passiert ist.«
Er schnäuzte sich die Nase mit einem riesigen Stofftaschentuch und seine kleinen braunen Augen blickten verloren in meine Richtung. Ich tat, was ich immer tat, wenn ich mit einem Klienten nicht weiterwusste, und blickte rüber zu 2Pac, der stolz an der Wand hing. Natürlich ist es vielleicht nicht ganz altersangemessen, wenn ein über 30-jähriger Mann Poster seiner Musikidole an seinem Arbeitsplatz aufhängt. Aber ich hatte mich ja nicht umsonst für die Selbstständigkeit entschieden – und gegen einen Job in der Bank oder bei einer Versicherung.
»Ich kann Canan nicht finden, weiß nicht, wo sie ist …«, schluchzte Gül und wischte sich den Rotz aus dem Gesicht.
Vielleicht hatte Canan genug von ihrem Teddybären-Papa, der rumheulte wie ein Sechstklässler, dem man das nagelneue Fahrrad demoliert hatte.
»Ich weiß nicht, was ich machen soll …, ich bin sehr verzweifelt …«, ließ er erneut einen Satz unvollendet stehen und hob anklagend beide Arme in die Luft.
Ein weiterer Schluck Bier brachte Schwung in mein Gehirnstübchen.
»Am besten ist es, wenn Sie mir die Geschichte ganz von vorne erzählen«, sagte ich so ruhig und sachlich wie möglich.
Ein letzter Seufzer und dann sprudelte es aus ihm heraus.
»Ich bin kurz nach der deutschen Wiedervereinigung nach Deutschland gekommen. Mein Onkel hat meine Unterstützung in seinem florierenden Import-Export-Geschäft benötigt. Er brachte mir das Geschäft von der Pike auf bei. Mit türkischen Lebensmitteln und Waren lässt sich viel Geld verdienen – deutsche Luxuskarossen sind in der Türkei sehr beliebt. Das Geschäft meines Onkels versorgte den Bodenseeraum und Oberschwaben mit Oliven, Öl, Reis, Hirse, Tomaten, Käse und Brot. Später hat er seine Angebotspallette erweitert.«
Mehmet Gül hielt kurz inne, zog eine Marlboro-Schachtel aus der Anzugstasche und blickte mich fragend an. Ich nickte kurz, holte einen großen Aschenbecher aus der Schreibtischschublade und schob diesen zu ihm herüber. Er zündete die Zigarette an und inhalierte tief. Seine Gesichtszüge entspannten sich ein wenig.
»Meine Familie hat dann in der Türkei eine Hochzeit mit meiner Frau Hatice arrangiert. Ich weiß, was man hier über diese Art von Heirat denkt. Aber meine Frau war und ist meine ganz große Liebe. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Zwei Jahre nach der Hochzeit wurde Hatice schwanger und meine Tochter Selma wurde geboren. Exakt zwei Jahre später kam dann Canan auf die Welt. Wir waren eine glückliche Familie und wären es im Prinzip auch noch heute …«
Die Pause war vielsagend. Vermutlich hatte er sich einen Jungen gewünscht. Die Wärme, mit der von seiner Familie sprach, verriet mir aber, dass er sie liebte und nicht unzufrieden mit dem Erreichten war.
»Als Deutschland Fußballeuropameister wurde, starb mein Onkel.«
Dieser Satz erstaunte mich. Wie konnte ein türkischer Mitbürger, der nicht den Eindruck eines fanatischen Fußballfans machte, 1996 – nach beinahe 20 Jahren – mit diesem großartigen Sportereignis in Verbindung bringen? Vielleicht liebte er das Land, in dem er lebte, und seine Menschen so sehr, dass er sich mit ihnen über dessen nationale Erfolge freute.
»Da er kinderlos war, übernahm ich das Geschäft, das ich bis heute erfolgreich führe. Aber was bedeutet schon Geld, wenn das Herz in Trauer lebt? Meine Frau kümmerte sich um die Kinder. Selma und Canan waren gut in der Schule. Beide haben die Mittlere Reife sehr erfolgreich bestanden.«
Der Stolz über den Bildungserfolg seiner Töchter war dem Vater deutlich anzusehen. Ein Seufzer und ein Räusperer leiteten zu dem weniger angenehmen Teil seiner Erzählung über.
»Mit der Pubertät begannen aber auch die Probleme. Vor allem Canan wollte nicht mehr gehorchen und entwickelte ihren eigenen Kopf. Sie kam nicht mehr direkt nach der Schule nach Hause und war mit Leuten zusammen, die man allgemeinhin als ›falsche Freunde‹ bezeichnet. Wenn Hatice sie bat, ihr im Haushalt zu helfen, wurde sie ausfallend. Bei den geringsten Versuchen, sie zu erziehen, stellte sie auf stur. Sie brüllte uns an, war respektlos, knallte mit den Türen, schloss sich in ihrem Zimmer ein und hörte in einer Lautstärke Musik, dass die Wände wackelten. Kurzum, es war eine Katastrophe.«
Die Erziehungsprobleme Jugendlicher waren wohl überall gleich.
»Jungs?«, stellte ich die naheliegende Frage.
Die Gesichtszüge entglitten ihm beinahe. Heftig schüttelte er den Kopf.
»Natürlich hatte sie Jungs im Kopf – welches Mädchen hat das nicht in dem Alter? Aber da war nichts. Das schwöre ich.«
Zum Glück sagte er nicht: ›Auf den Kopf meiner Tochter‹. Ich fragte mich, woher er diese Gewissheit nahm.
»Sie brach das Berufskolleg ab und blieb zu Hause. Alles gute Zureden der Lehrer und von unserer Seite half nichts. Canan wollte nicht länger auf die Schule gehen. Meine Frau versuchte, ihr das Nötigste für die Haushaltsführung beizubringen.«
»Heirat?«, hakte ich nach.
»Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir uns das nicht überlegt hatten. Aber konkrete Pläne gab es keine.«
Irgendwie kaufte ich ihm das ab.
»Und die Ältere, Selma?«, wollte ich wissen.
Er winkte ab.
»Besser, aber auch nicht ganz einfach. In jedem Fall geriet Canan immer mehr in die falschen Kreise. Alle unsere Erziehungsmaßnahmen versagten. Seitdem sie volljährig ist, haben wir jegliche Kontrolle über sie verloren.«
Gül schluckte und fing wieder zu schluchzen an.
»Wenn sie volljährig ist, muss sie nicht mehr bei Ihnen zu Hause wohnen«, wies ich unbedarft auf den legalen Rahmen hin.
»Sie verstehen nicht«, entgegnete er dynamisch. »Canan wohnt schon lange nicht mehr zu Hause.«
Mein Gehirn ratterte.
»Ich soll sie überreden, nach Hause zurückzukehren?«
»Ja, aber vielleicht anders, als Sie denken. Ich habe immer gewusst, wo Canan sich aufgehalten hat. Auch wenn ich das, was sie tat, nicht gutheißen konnte. Jetzt ist sie aber komplett vom Bildschirm verschwunden.«
Ich atmete tief durch, schickte den Blick durch das Fenster nach draußen und schaute in den sonnigen Garten. Das Knarzen des orangefarbenen Plastiksessels signalisierte, dass Gül sich unruhig hin und her bewegte. Der Rest des Bieres war schon etwas angewärmt und abgestanden. Ich holte mir eine neue Flasche aus dem Kühlschrank, da ich vermutete, dass mein potenzieller Klient noch einiges erzählen würde, und überlegte, ob ich ihn um eine Zigarette bitten sollte. Dann fixierte ich seine Augen und er erwiderte meinen Blick wie ein geprügelter Hund.
»Ich fasse zusammen: Ihre Tochter wohnt seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause. Jetzt wissen Sie aber nicht mehr, wo sie sich aufhält. Ich soll sie suchen und finden. Richtig?«
Er nickte kurz.
»Sie hat bis vor Kurzem in so einer Art Wohngemeinschaft in Ravensburg gelebt. Jetzt ist sie nicht mehr da«, setzte er zu einer Erklärung an.
»Haben die Mitbewohner Ihnen das mitgeteilt?«
»Nein, vorgestern hat mich ein …«, er suchte lange nach dem richtigen Wort, »… Motorradfahrer aufgesucht.«
Meine Alarmglocken schrillten.
»Hell’s Angels?«
»So ähnlich. Er hat mir gesagt, dass Canan 50.000 Euro Schulden bei ihm habe und deshalb abgehauen sei.«
»Die nächste Frage ist nicht angenehm, liegt aber nahe: Hatte Canan etwas mit Drogen und Prostitution zu tun?«
Er fing wieder an zu weinen.
»Ich weiß es nicht. Aber der Mann hat gesagt, dass sie die Schulden bei ihm abarbeiten müsse. Und dass ich sie finden sollte, bevor er das tue. Denn wenn er sie fände, könnte er für nichts garantieren.«
Der Mann sank wieder in sich zusammen. Der Fall bot immer neue Überraschungen, bevor er richtig begonnen hatte.
»Können Sie die 50.000 nicht einfach bezahlen?«, wandte ich ein. »Ihr Unternehmen wirft doch sicherlich einiges ab.«
»Das ginge schon und das habe ich auch angeboten, aber der Mann hat gesagt, sie müsse sie bei ihm abarbeiten. Ich könne ihm auch das Doppelte bieten. Er dürfe sein Gesicht nicht verlieren. Punkt.«
»Hat er gesagt, wieso sie Schulden hat?«
»Für Service- und Cateringleistungen. Daraus bin ich nicht ganz schlau geworden.«
Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, entschied mich dann für erbarmungslose Offenheit. Die Heulerei hatte ich ohnehin im Ohr.
»Ich möchte jetzt Klartext mit Ihnen reden, Herr Gül. Ihre Tochter ist vermutlich drogensüchtig. Kokain, Heroin, Meth-Amphetamin, wer weiß das schon genau? Macht letztlich auch keinen großen Unterschied. Über die Sucht hat sie Schulden angehäuft und ist ins Prostitutionsmilieu abgerutscht. Und die modernen Zuhälter sind Motorradfahrer. Rocker. Kriminelle. Bandidos.«
Die Reaktion fiel wie erwartet aus. Mir klingelten die Ohren.
»Ich gebe Ihnen einen Tipp. Gehen Sie zur Polizei. Die kennt sich mit solchen Sachen aus. Die tritt dem Zuhälter mal kurz auf die Füße. Und die findet auch Canan. Garantiert.«
»Nein! Keine Polizei!«
Die Antwort war heftig und eindeutig. Kein Widerspruch möglich. Ich stockte. Ein weiterer Schluck Bier.
»Dann ist Canan tot, hat der Mann gesagt. Ich muss sie finden – mit Ihrer Hilfe. Aber keine Polizei. Unter keinen Umständen.«
Ich dachte an mein leeres Bankkonto. An Giulia. An Bier. An viele Dinge, die das Leben angenehmer machten. Sollte der Türke doch was springen lassen. Geld hatte er ja. Das hatte er oft genug durchblicken lassen.
»Was machen Sie mit Canan, wenn ich sie gefunden habe?«
»Ich bringe sie in Sicherheit. In die Türkei. Und sollte der Mann dann kommen und sein Geld wollen, werde ich ihn bezahlen.«
Das hörte sich vernünftig an. Beinahe zu vernünftig
»Okay. Ich nehme den Auftrag an. Versprechen kann ich nichts.«
Gül blickte auf. Lächelte. Strahlte. Griff in seine rechte Anzugtasche und legte ein dickes Geldbündel auf den Schreibtisch.
»10.000 Euro als Anzahlung. Und sobald Sie Canan gefunden haben, gibt es noch einmal dasselbe.«
Mein Herz machte einen Luftsprung. Ich war motiviert. Bis in die Haarspitzen. Auch wenn der Fall nach Ärger roch.
4. Kapitel
Gül war gegangen. Sein eigentümlicher Geruch hing noch im Zimmer. Mir tat der Mann nach wie vor leid. Auch wenn er sich zu sehr gehen ließ. Ungläubig nahm ich das Geldbündel von der Schreibtischplatte. Nicht, dass ich ihm misstraut hätte. Der Mann war grundsolide, keine Frage. Er wollte seine Tochter unbedingt retten, koste es, was es wolle. Aber das dicke Geldbündel auf dem Tisch war zu schön, als dass ich mir die Gelegenheit entgehen lassen wollte.
Das Geld raschelte verheißungsvoll zwischen meinen Fingern. Eins, zwei, drei … Die 500-Euro-Scheine landeten nacheinander wieder auf dem Schreibtisch: tack, tack, tack … 20 an der Zahl. Mit dieser Summe kam ich eine Zeit lang ganz gut über die Runden. Inklusive Raten für Giulia. Zwei Scheine steckte ich in den Geldbeutel. Den Rest verschloss ich in der Schreibtischschublade.
Ich betrachtete Canans Foto, das er mir dagelassen hatte. Ein Porträt-Foto mit hellem Hintergrund, vermutlich in einem Fotostudio aufgenommen. Die junge Frau war sehr hübsch, das ovale Gesicht wurde von vollen, langen pechschwarzen Haaren eingerahmt. Ihre glatte Haut hatte einen olivfarbenen Teint, die Nase war wohlproportioniert, die Ohren eher klein. Am meisten faszinierten mich ihre dunklen Augen. Sie zeigten ein hohes Maß an Intelligenz, aber auch Verletzlichkeit. Eine ungesunde Mischung. Die anfällig machte für Drogenkonsum. Die Intelligenten und Sensiblen hingen schneller an der Fixe, als ihnen und der Gesellschaft lieb sein konnte.
Canan sah unschuldig aus. Lichtjahre von harten Drogen und käuflichem Sex entfernt. Noch war alles heile Welt, das fürsorgliche Elternhaus, die Schule, die Freunde … Was einmal mehr der Beweis dafür war, wie schnell sich alles ändern kann. Nichts ist auf Dauer angelegt, stand in der Bibel. Hatte mir zumindest mein protestantischer Vater beigebracht. Was meine katholische Mutter immer mit Augenrollen quittiert hatte. Mein Vater wollte mir damit die Botschaft geben, dass man auf Erden den Arsch zusammenkneifen musste, um Punkte für das ewige Leben zu sammeln. Falls es dann mit der Gnade Gottes zusammentraf. Die Message meiner Mutter war denkbar einfacher. Es ist sowieso alles bald vorbei, darum nehmen wir mit, was geht. Sünder sind wir alle – so oder so. Gottes Liebe und Gnade sind so unendlich, dass sie alles auffangen können. Also konnte man es gleich darauf ankommen lassen. Die oberschwäbisch-protestantische und die italienisch-katholische Seele stritten in mir manchmal um die Vorherrschaft. Ausgang ungewiss. Mit leichten Vorteilen für den Katholizismus.
In diesem Sinne beschloss ich, dass es Zeit für ein üppiges Mittagessen war, und ich nahm meine Multiple-Choice-Aufgabe wieder auf. Das nötige Kleingeld hatte ich ja jetzt für A), B), C) und D). Nur mein Magen würde es mir nicht danken.