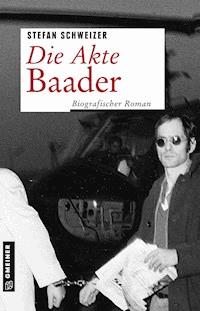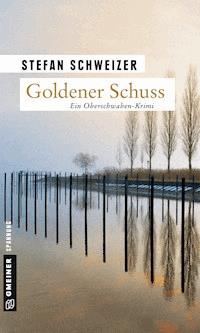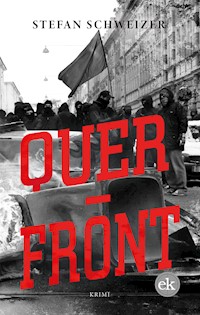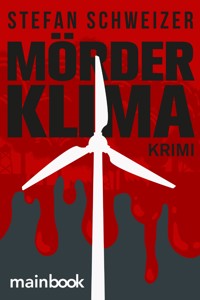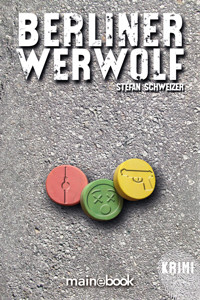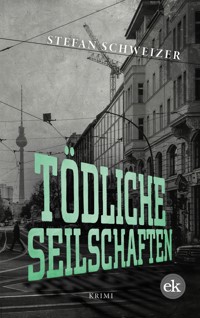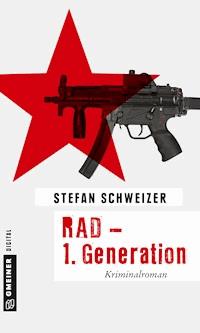
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Der Stuttgarter Staatsschützer Harald Grass ist der größten Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland auf der Spur. In den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts droht die linksterroristische RAD den Staat wegzubomben und eine kommunistische Diktatur zu errichten. Grass riskiert Leib und Leben, um die Terroristen zu stoppen. Aber auch der Ermittler hat seine dunklen Seiten, denn er ist drogensüchtig und neigt zu Gewalt. Der düstere Antiheld und die zu allem entschlossenen Terroristen liefern sich einen brutalen Kampf auf Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Schweizer
RAD – 1. Generation
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: unter Verwendung von © zim101 – fotolia.com
Umschlaggestaltung: Alexander Somogyi
ISBN 978-3-7349-9378-7
Widmung
In Liebe für Pia-Johanna
Prolog
Der 27-jährige Ben Sorglos verbrachte eine unruhige Nacht vom 2. auf den 3. Juni 1967. Das Gedankenkarussell drehte sich immer schneller und wollte nicht anhalten. Er dachte daran, dass er verheiratet war und an sein noch ungeborenes Kind. Er dachte daran, dass er Lehrer werden wollte oder eher musste.
Er konnte kaum atmen und lag leblos im Bett. Er spürte seine Frau neben sich. Sie träumte und schlief unruhig.
Sorglos stand leise auf und ging ans Fenster. Der Blick nach draußen beruhigte ihn nicht. Im Gegenteil. Die Weite des Horizonts ängstigte ihn. Staatsdiener – dabei wollte er doch Künstler werden.
Er dachte an seine Reise nach Afrika, Marokko. An den Haschischkuchen. Ihm war speiübel gewesen und er hatte sich übergeben müssen. Das war mehr als Gedankenkino gewesen, das war Sputnik; wumm, hinauf ins All.
Sorglos wandte sich vom Fenster ab und setzte sich auf einen Stuhl, der neben dem billigen Schlafzimmerschrank stand. Er war alles andere als einverstanden mit den politischen Verhältnissen in Deutschland. Seine aufrechte Gesinnung als Protestant verbot es ihm, dazu gänzlich zu schweigen. Die Verhältnisse zwangen ihn aber, sich anzupassen.
Er würde bald zum ersten Mal an einer Demonstration teilnehmen. Gegen den iranischen Herrscher, den Massenmörder. Sorglos seufzte gedankenschwer. Sorglos, Student der Germanistik und Mitglied der Evangelischen Studentengemeinde, alles andere als ein Scharfmacher, nicht einmal ein Mitläufer. Einer, der sich lediglich eine Demonstration anschauen wollte.
Der 3. Juni 1967 war für deutsche Verhältnisse relativ warm. Im Berliner Westteil brodelte es. Die Studenten waren auf Protest aus – Krawall, Happening. Endlich sollte mit dem braunen Erbe aufgeräumt werden. Die Weltrevolution lag in der Luft. Die Opposition der Jungen formierte sich außerhalb des institutionellen Rahmens. Die APO stand in den Startlöchern.
Der iranische Herrscher war zu Gast in der ehemaligen Reichshauptstadt. Für den Westen war er ein willkommener Bündnisgenosse. Die Linken sahen in ihm einen Despoten und Tyrannen, der sein Volk ausblutete. Er war jemand, der dem Imperialismus jede notwendige Gefälligkeit erwies, solange es ihm gut dabei ging. Und das tat es – da musste man nur die Berichte in den Magazinen lesen und die Hochglanzbilder anschauen.
Vor dem Schöneberger Rathaus war am frühen Nachmittag einiges los. Der Herrscher Persiens sollte sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin eintragen. Die Gegner hatten sich versammelt. Viele Studenten hatten nichts anderes zu tun. Sie warteten auf die Ankunft des Despoten und seiner Gattin. Endlich sollte es losgehen. Politisierung und der Versuch etwas gegen die tägliche Langeweile zu unternehmen, vermischten sich.
Die Schutzpolizisten klatschten ihre Schlagstöcke rhythmisch auf die Handfläche. Auch sie warteten darauf, dass etwas passierte. Ihre Vorgesetzten hatten sie scharfgemacht. Mit aller Härte gegen die Krawallbrüder vorgehen, um das internationale Ansehen Deutschlands zu retten. Die Polizisten waren ehemalige Offiziere der Wehrmacht. Sie verstanden sich als paramilitärische Gruppe. Der Feind stand im Osten. Alle, die die Kommunisten unterstützten, mussten bekämpft werden.
Kurz vor der Ankunft des iranischen Herrschers fahren zwei große doppelstöckige Busse vor. Die Demonstranten kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Was ist das denn? Hundert Jubelperser steigen aus. Was wollen die denn hier? Sie sind Agenten des iranischen Geheimdienstes. Die Agenten zeigen: Passt auf, gleich gibt’s Ärger. Im Iran haben sie Tausende von Regimegegnern gefoltert und ermordet.
Die Jubelperser beziehen Stellung. Sie sammeln sich vor dem Rathaus. Die Polizei hat ihnen dort eine Fläche freigehalten. Ein Schupo salutiert vor dem Alphageheimdienstmann. Die Iraner halten Jubeltransparente für den Herrscher Irans in die Höhe, die auf langen und soliden Eisenstangen und Holzlatten befestigt sind. »Hoch lebe unser Herrscher!«, rufen die Perser und schwenken Transparente mit stilisierten Bildern des Herrscherpaars.
»Freiheit für Persien«, antworten die Studenten lautstark. Zwischen den Iranern und den deutschen Gegnern gibt es eine acht Meter breite Zone, die von Hamburger Gittern gesichert wird. Die Metallbarrieren sind knapp über einen Meter hoch und rot-weiß gestreift. Plötzlich: Der Herrscher des Irans fährt in einem Mercedes 600 vor, flankiert von Begleitfahrzeugen. Leibwächter führen ihn und seine Frau in das Schöneberger Rathaus. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Die Sprechchöre der beiden Gruppen werden immer lauter und aggressiver.
Die iranischen Geheimagenten springen über die Absperrung und überqueren die neutrale Zone. Sie zücken Totschläger und holen mit den Transparentstangen aus. Die deutschen Demonstranten stecken schlimme Prügel ein. Die Geheimdienstleute haben das Szenario immer wieder an iranischen Oppositionellen und Gefangenen geübt. Einige waren dabei draufgegangen. Sie gehen brutal vor, ohne Mitleid. Studenten bluten. Studenten liegen am Boden. Schmerzensschreie hallen durch die Luft. Die deutsche Polizei unternimmt nichts. Einige Schupos können ihr Grinsen nicht verbergen. Endlich kriegen die Radikalinskis das, was sie verdienen. Eins aufs Maul. Endlich setzt sich die Berliner Polizei in Bewegung. Die Polizisten interessieren sich nur für die Gegner des persischen Herrschers. Sie bedrohen sie mit Schlagstöcken. Die Studenten werden verhaftet und abgeführt. Ihnen werden schwerwiegende Straftatbestände vorgehalten, z. B. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ein Iraner holt mit seiner Stange aus und lässt sie immer wieder auf den am Boden liegenden Studenten niedersausen. Der Student ist verletzt, am Ende. Ein Polizist klopft dem Geheimdienstiraner anerkennend auf den Rücken. Die Demonstranten ziehen ab. Für den Moment haben sie genug. Aber sie geben sich nicht geschlagen. Sie sind trotzig wie kleine Kinder, die den Frack vollgekriegt haben. »Wir treffen uns heute Abend vor der Oper!«, macht die Runde.
Die bundesdeutsche Presse ist begeistert. Schlagzeilen, Neuigkeiten über die linken Chaoten und anarchische Zustände verkaufen sich gut. Hysterie in der Bevölkerung hilft dem Absatz.
Die Journalisten wissen von den Plänen der Studenten am Abend vor der Oper. Am Mittag des 3. Juni sagt Bernd Herzl, Leiter der Presse- und Informationsstelle des Senats, einem befreundeten Journalisten: »Na, da können diese linken Studenten sich ja auf etwas gefasst machen: Heute gibt es richtig Dresche.«
Charly Grad nahm am frühen Nachmittag des 3. Juni 1967 einen Schluck Filterkaffee. Der Vierziger stand in der kleinen Küche seiner Wohnung und sinnierte. Das Leben war nicht einfach, denn er lebte auf einem schmalen Grat.
Als informeller Mitarbeiter Ottfried Wohl des Ministeriums für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik und Mitglied der Westberliner Polizei lebte er in ständiger Angst, aufzufliegen. Dabei war er vom Kommunismus überzeugt. Genauso verhasst wie die Kapitalisten waren ihm die »linken« Studenten, die für ihn nichts mit Kommunismus zu tun hatten. Dieses Pack breitete sich wie Parasiten in Westeuropa aus. Die Studentenrevolten halfen aber, den Kapitalismus zu schwächen.
Grad streichelte eine seiner Pistolen. Er liebte Waffen. Ein Schluck Kaffee machte ihn noch munterer. Er hatte einen langen Abend vor sich. Dann sollte er das Objekt Berliner Oper sichern und als ziviler Greifer agieren. Manchmal galt es, das Undenkbare zu denken … Was wäre wenn …? Die Stimmung in Westberlin war aggressiv. Wie würde sich alles entwickeln, wenn es Verletzte oder gar Tote gab? Würde sich der linke Protest wie ein Flächenbrand über Westdeutschland ausbreiten? Wäre das kapitalistische System dadurch gefährdet?
Er bedauerte, dieses Thema nicht beim letzten Treffen mit seinem Führungsoffizier besprochen zu haben. Grad seufzte. Es musste doch einen Weg geben, die Imperialisten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen …
Der Sommerabend des 3. Juni 1967 ist lau. Über 3.000 Berliner haben sich vor der Oper versammelt. Happening, endlich ist was los. Tod der langweiligen Konsumgesellschaft. Berlin ist wieder wichtig. In der Oper wird eine Galaaufführung von Mozarts Zauberflöte gegeben.
400 Demonstranten haben sich unter die Schaulustigen gemischt. Einige haben sich Papiertüten mit Karikaturen des iranischen Kaiserpaars über den Kopf gezogen. Der Herrscher sieht darauf übel aus.
Die Atmosphäre vor der Oper heizt sich auf. Plötzlich fährt eine Ente mit ein paar Clowns der Kommune KB, die das Kaiserpaar mit übergestülpten Papiertüten mimen, an den Demonstranten und Schaulustigen vorbei. Grölender Jubel ertönt. Andere schütteln empört den Kopf.
Die Agenten des iranischen Geheimdienstes lassen sich nicht unterkriegen und jubeln. »Hurra«, »Lang lebe der Kaiser«. Die Papiertüten skandieren »Mörder, Mörder«. Iraner und deutsche Studenten beschimpfen sich. Die Perser fackeln nicht lange. Sie schlagen mit Holzknüppeln und Totschlägern kräftig zu. Die Linken schmeißen Tomaten, Milchtüten, verfaulte Eier und Rauchkerzen. Daraufhin greift die Berliner Polizei ein. Greiftrupps machen Jagd auf die Rädelsführer der Demonstranten.
Der Gast aus dem Iran fährt vor. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Eier, Farbbeutel und Steine fliegen. Der Herrscher Persiens hat es eilig. Er flieht vom Wagen in die Oper. Er rettet seinen sündhaft teuren Anzug.
20.04 Uhr: Die Aktion Füchse jagen beginnt. Ohne Vorwarnung springen zivile und uniformierte Polizisten über Absperrgitter, schwingen die Gummiknüppel und schlagen erbarmungslos zu.
Mit aller Gewalt treiben sie einen Keil in die deutschen Demonstranten. Die Leberwurst-Taktik erklärte Polizeipräsident Dunst später so: »Nehmen wir die Demonstranten als eine prall gefüllte Leberwurst, dann stechen wir mit unseren Männern in die Mitte hinein, damit sie an den Enden auseinander platzt.«
Die Demonstranten werden auf einen Polizeikordon zugetrieben. Auch normale Schaulustige nehmen Reißaus, um sich vor der Polizeidresche zu schützen. Die Polizei teilt tüchtig aus, Koma-Hiebe. Greiftrupps der Polizei preschen vor und schlagen wahllos zu. Köpfe bluten. Menschen schreien. Verletzte wälzen sich am Boden. Einige Studenten haben sich in der Krummen Straße in einem Hinterhof verschanzt. Polizisten eilen herein. Sie haben Rädelsführer entdeckt. Es gibt üble Dresche.
Ben Sorglos trägt ein rotes Hemd und Sandalen. Er möchte sehen, was mit den Demonstranten passiert. Schockiert wendet er sich ab. Schnell möchte er den Hinterhof verlassen.
Drei Polizisten stellen ihn. Sie vermuten, dass er sich aus dem Staub machen möchte. Ein Polizist schlägt zu, auf den Hinterkopf. Sorglos stürzt auf den Boden. Die zwei anderen Polizisten prügeln weiter.
Dann stürzt Grad in Zivil herbei. Der Kriminalobermeister der Politischen Polizei hält seine Waffe in der Hand, den Finger am Abzug der Walther PKK, Kaliber 7,65 mm. Grad schießt Ohnesorg aus kurzer Entfernung in den Kopf. Eine Hinrichtung, ganz im GESTAPO-Stil.
»Bist du denn verrückt?«, schreit ein Uniformierter.
»Die ist mir doch nur losgegangen«, antwortet Grad ganz ruhig. Ein Obermufti rückt an. Er erkennt sofort den Ernst der Lage.
»Grad, verschwinde gleich nach hinten. Los. Schnell, hau ab!«, befiehlt er.
Alles soll vertuscht werden.
Das war die Explosion, welche die Verhältnisse zum Tanzen brachte. Die Republik war nicht mehr dieselbe.
Deutschland stand vor schweren Zeiten. Das Universum des Wohlstands und der friedlichen Demokratie kollabierte. Die bewaffnete, linksradikale Fundamentalopposition war geboren.
Kapitel 1
»Woran denkst du, Harry?«, fragte Monika Zürn.
Harald Grass blickte schläfrig auf das Neue Schloss. Die Sonne schien frühsommerlich warm und die Natur stand schon in voller Pracht. Auf der Königsstraße herrschte ein reges Treiben. Die Menschen liefen in sommerlicher Kleidung umher und schleppten ihre Einkäufe. Stuttgart galt zwar als Großstadt, besaß aber eher provinziellen Charme.
»An Berlin«, antwortete Grass, »an den armen Teufel, der bei der Demonstration getötet worden ist.«
Monika zog ihre flache Stirn in Falten und spitzte ihren Mund zu einem O. Das verlieh ihr das Aussehen eines kleinen Kindes. Ihren Körper konnte man als zierlich und dennoch kompakt bezeichnen. Sie wirkte sogar ein wenig androgyn, vermochte aber auch die wenigen Rundungen vorteilhaft zur Geltung zu bringen.
»Du meinst die Hinrichtung von Ben Sorglos durch dieses Nazi-Polizisten-Schwein«, sagte sie vehement.
»Hm, wenn du meinst …«
Grass wollte sich nicht mit seiner Freundin streiten. Politisieren schon gar nicht. Er legte den Arm um Monika und zog sie sanft auf die Schlosswiese. Das Gras duftete nach Sommer. Das Plätschern der großen Springbrunnen drang gedämpft an ihr Ohr. Er küsste sie sachte auf ihre schmalen Lippen und sagte:
»Ich liebe dich, Monika …« Monika kicherte.
»Ich dich auch, glaube ich …«, antwortete sie.
Kinder rannten auf den Wiesen der Schlossanlage. Sie spritzten sich mit dem Wasser der Brunnen nass. Grass küsste Monika erneut. Er sog ihren wunderbaren Duft ein und wünschte sich, dass alles für immer so bleiben mochte, wie es war. Ein wehmütiger Schmerz sagte ihm, dass das nicht sein konnte und durfte. Er war zu etwas Höherem berufen. Er wollte Geschichte schreiben, politische Bedeutung erlangen. Die Dinge lagen nicht so einfach, wie sie schienen.
Grass war Mitte 20, Undercoveragent und Agent Provokateur des Landesamts für Verfassungsschutz, Baden-Württemberg. Grass war Beamter und Staatsdiener. Seit Kurzem arbeitete er als verdeckter Ermittler in der Studentenszene.
Dazu hatte er eine Legende und eine konspirative Wohnung erhalten. Demnach hatte er ein kleines Vermögen geerbt und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Monika hatte er gleich zu Beginn seines Auftrags kennengelernt. Seit fünf Monaten war er mit ihr zusammen. Seine Wohnung hatte er nach zwei Monaten wieder aufgegeben, da er bei Monika eingezogen war.
Das schien eine perfekte Tarnung zu sein und entsprach seinen sexuellen und menschlichen Bedürfnissen. Grass war allerdings nicht klar, wie er die hauptsächlich auf Lügen basierende Beziehung zu Monika mittelfristig gestalten konnte. Irgendwann einmal musste das Lügengebäude zusammenbrechen, vielleicht wurde er enttarnt oder von seinem Auftrag abgezogen …
Der geheime Auftrag von Grass bestand darin, den Studenten Verbindungen zu schwerwiegenden Straftaten nachzuweisen oder sie möglicherweise zu verführen, diese Straftaten zu begehen. Dabei sollte er sein Augenmerk auf Vergehen mit Betäubungsmitteln legen. Irgendwann, so die Hoffnung seiner Vorgesetzten, werde sich dann ein Zusammenhang mit einer politischen Dimension ergeben. Das Ziel war die Kriminalisierung linkspolitischer Umtriebe. Und wer würde zugeknallten Köpfen lautere Motive für eine Revolution zutrauen?
Gesetzlich befand sich der Einsatz von Grass in einem Graubereich. Man konnte argumentieren, dass der Einsatz zur Gefahrenabwehr unabdingbar sei. Worin die Gefahr genau bestand, konnte allerdings niemand sagen.
Die Tarnung von Grass war alles andere als perfekt und vielleicht deshalb so überzeugend. Er galt zwar bei den Studenten als Praktiker mit Hauptschulabschluss, als Mann fürs Grobe, dennoch fiel es ihm nicht schwer, sich dem Studentenmilieu intellektuell anzupassen. Grass glänzte praktisch, verstand es aber auch zusehends, sich in die endlosen politischen Diskussionen einzubringen. Dabei galt er als charismatisch, zielorientiert und energiegeladen, ohne den Anspruch auf Führerschaft zu erheben.
Grass war ein attraktiver junger Mann. Er maß knapp 1,80 Meter und besaß einen kompakten Körper. Seine Muskeln waren von Natur aus recht ausgeprägt, sodass er Respekt einflößend wirkte.
Die Augen changierten zwischen Grau und Blau. Grass besaß einen festen Blick, den nichts und niemand leicht irritieren konnten. Das kam ihm bei seiner Ermittlungstätigkeit zugute, denn manchmal konnte ein Blinzeln zum falschen Zeitpunkt über die Glaubwürdigkeit einer Person entscheiden.
Das Haar war voll und dicht, die Farbe erinnerte an einen etwas zu lange gelagerten Mosel-Riesling. Nach bürgerlichen Maßstäben trug Grass das Haar zu lang – bis zum Schulteransatz. Natürlich wusste kaum jemand, dass das Teil seiner Tarnung war.
Der Tag ging zur Neige, doch die Sonne strahlte noch mit voller Kraft. Monika sprang voraus wie ein kleines Mädchen. Sie winkte Grass zu. Er sollte zu ihr kommen … Es war ein sexuelles Versprechen. Wenn du mich fängst, dann kriegst du mich … Die Studentin hatte ein einfaches, kindliches Gemüt. Sie war manchmal eigensinnig, was den Umgang mit ihr nicht immer vereinfachte.
Sie waren den weiten Weg von der Stuttgarter Innenstadt in den Süden der Stadt gelaufen. Das alte Schützenhaus lag beinahe schon in Stuttgart-Kaltental, eingerahmt von ausgeprägten Waldgebieten. Alte Häuser der Jahrhundertwende zierten die Straßen. Die Sonne tauchte die aus gelben Ziegelsteinen gebauten Häuserzeilen golden.
Monikas Wohngemeinschaft befand sich im Turmgebäude des Alten Schützenhauses. Die Dreizimmerwohnung war groß und geräumig; ein klassischer Altbau der Jahrhundertwende. Monika besaß das kleine Mittelzimmer, welches gegenüber dem Bad und neben der winzigen Küche lag.
Monika studierte Deutsch und Geschichte auf Magister ebenso wie ihre Mitbewohner Martin und Rudolf. Das geistes- und sozialwissenschaftliche Studium erfüllte Monika nicht, obwohl ihr der Abschluss Magister Artium die Befriedigung und Illusion von Freiheit vermittelte, nicht unbedingt in den Staatsdienst zu müssen. Monika spürte, dass es noch etwas Höheres geben musste als Studium und Broterwerb. Dabei dachte sie aber nicht an Familie und Kinder.
Monika verabscheute geradezu die professorale Strenge und das akademische Gebaren. Academia und die dort üblichen Gepflogenheiten fielen ihr in jeder Hinsicht schwer. Auch das Verwenden von fachwissenschaftlichem Vokabular und das Durchdringen komplexer Zusammenhänge bereiteten ihr Mühe.
Monika schloss die alte Turmtür auf. Sie zog Grass hinter sich die alten, knarzenden Treppen hinauf. Im ersten Stock schloss sie die Tür aus Glas und Sperrholz auf.
Die Wohnung wurde gelüftet, roch aber noch nach kaltem Rauch. Am großen Spiegel mit Goldrahmen war in der oberen linken Ecke ein Zettel angehängt. Der Spiegel war das Prunkstück des Flurs.
»Sind beim Jazz MuR«
Monika drehte sich herum und schlang ihre Arme leidenschaftlich um Grass. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf den Mund küssen zu können.
»Wir haben die Wohnung ganz alleine für uns …«, flüsterte sie. Grass schmunzelte und spürte eine leichte Erregung in sich hochsteigen, die er zu unterdrücken versuchte.
»Und das heißt?«, fragte er.
»Das heißt, dass wir die Wohnung für die nächsten paar Stunden zur freien Verfügung haben …, ohne irgendwie gestört zu werden.«
»Ich verstehe nicht ganz …«, stichelte Grass, konnte sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Na, dann werde ich dir das mal erklären.«
Monika nahm die Hände ihres Geliebten und führte ihn in ihr Zimmer.
Monika zeigte sich unersättlich. Für Grass artete es in Anstrengung aus. Er liebte ihren kompakten und dennoch zierlichen Körper. Ein ums andere Mal forderte Monika Grass heraus. Sie lebte für das Hier und Jetzt und genoss den Moment. Das war für sie keine freie Liebe, aber eine Vorstufe davon.
Martin und Rudolf kamen nach Hause und waren laut. Sie hatten offensichtlich ganz gut getankt.
Das Fenster stand offen und die laue Sommerluft wehte in das Zimmer, in welchem es nach dem Austausch menschlicher Körperflüssigkeiten roch. Monika hatte sich sanft an Grass’ Seite geschmiegt und schlief.
Grass lag ruhig da und starrte an die orange gestrichene Zimmerdecke. In ihm brodelte es, obwohl er viele Energien verbraucht hatte. Er lag hier in Stuttgart – klein und unbedeutend. Die Geschichte zog an ihm vorbei – er war ein Nichts.
Grass wünschte sich nichts sehnlicher, als bedeutend zu sein. Er wollte etwas darstellen. Seine Arbeit bedeutete ihm viel, aber er hatte es bisher zu nichts gebracht. Das musste sich ändern, sonst fraß dieser bohrende Schmerz ihn auf. Den Studenten musste er ein großes Ding anhängen. Vielleicht konnte er das Ganze wie gewünscht verbinden: Drogen und Politik.
Das würde seine Vorgesetzten begeistern und ihm eine Beförderung und Ansehen einbringen. Da musste doch etwas zu machen sein, um der Nichtigkeit des eigenen Seins zu entfliehen.
Grass spürte den gleichmäßigen, ruhigen Atem von Monika. Er spürte, dass er sie liebte – aber das reichte ihm offensichtlich nicht, das konnte doch nicht alles sein. Der an ihm nagende Widerspruch zerriss fast seine Brust. Grass vergoss eine Träne der Verzweiflung und seufzte tief.
Kapitel 2
Ende März 1968 war es kalt und nass. In Schwabing steppte aber der Bär. Die Kneipe war rauchgeschwängert. Die Jukebox spielte neue deutsche Schlager, Jimi Hendrix und die Beatles.
»Wir müssen etwas tun!«, schrie Lukas Arzt, um sich verständlich zu machen. »Die Schweine machen uns sonst fertig … Die Nazi-Schweine: Bombardieren Vietnam, als ob es Auschwitz wäre …« Die Zuhörer am Tisch schauten verständnislos drein, nickten aber. Arzt war attraktiv und charismatisch. Er besaß einen wohlgeformten Schädel, ein hübsches, männlich-markantes Gesicht und schwarzes Haar. Die Geheimratsecken waren nicht zu übersehen, schmälerten den angenehmen Gesamteindruck aber kaum.
Er war muskulös und besaß einen kräftigen Körperbau. Wie besessen kaute er Kaugummi, während er einen großen Schluck Bier nahm. Die Amphetamine hauten verdammt rein. Die Kehle war trocken und musste gespült werden.
»Das wird was ganz Besonderes!«, nuschelte Heidrun Gänslin.
»Wir müssen von der Agitation zur politischen Tat schreiten! Sonst sind wir nichts als dumme Schwätzer, so wie alle anderen auch. Die APO besteht doch nur aus Deppen, die durch verbale Radikalität auffallen.«
Die Pfarrerstochter aus dem Schwäbischen verdrehte die Augen. Sie reagierte anders auf Speed als ihr Liebhaber. Gänslin hatte ein längliches Gesicht mit faszinierenden Augen, die mehr als ein wenig irre wirkten. Sie war flachbrüstig und beinahe hager. Ihr war eine sehr starke Energie und Aura anzumerken. Man merkte, dass Gänslin einen unbändigen Ehrgeiz besaß. Wenn sie etwas erreichen wollte, dann konnte sie nichts und niemand daran hindern. Hatte sie sich einmal ein Ziel gesetzt und für richtig erachtet, dann musste sie es erreichen – ganz egal, was es kostete.
Tobi Holle nickte nur. Ihn hatte der Joint weggehauen. Der Kunststudent war zu platt vom Haschisch, um sich einzubringen. Paranoid nahm er einen Schluck Bier. Arzt plapperte, Gänslin nickte und Gänslin plapperte, während Arzt nickte. Manchmal schrien sich Arzt und Gänslin gleichzeitig an. Das wirkte beinahe liebevoll. Die Brille hing Holle schief im Gesicht. Er wirkte wie eine Schießbudenfigur.
Der Schauspieler Heinz Knäblein sah besser aus. Er hatte sich lange überlegt, den Trip zu schmeißen, es dann aber gelassen. Er hatte zu viel Angst. Das psychedelische Zeug machte einen fix und fertig.
Das war er sowieso. Fix, fertig, aus, eine Flasche. Eigentlich wollte er berühmt sein und von zahlreichen Plakatwänden herunter lächeln. Stattdessen trieb er sich mit einer Truppe pseudo-politisierter Volltrottel herum. Das war aber immer noch besser, als zu Hause rumzusitzen und sich von seiner Frau fertigmachen zu lassen. Er nahm einen großen Schluck aus seiner Halben und verkündete:
»Ihr wollt was machen, ich bin dabei.«
»Genau«, pflichtete Arzt bei, »das sag’ ich ja. In Frankfurt. Es gibt keinen besseren Platz dafür. Das ist der deutsche Ort des internationalen Finanzkapitals. Hier müssen wir ansetzen.«
»Aber nicht in einer Bank«, widersprach Gänslin leise, die gar nicht mitgekriegt hatte, dass es um die Wahl der Stadt ging.
»Genau. Ein Kaufhaus! Das ist es!«
Holle war aufgewacht und hatte sich erfolgreich eingebracht. Die Gruppe nickte. Das war der Plan.
»Vorher müssen wir noch bei meinen Eltern vorbei«, schrie Gänslin mit heiserer und schriller Stimme.
Sie wirkte hysterisch.
»Ich muss Lukas meinen Eltern vorstellen und vielleicht können wir ein bisschen Kohle auftreiben, für die Sache der Revolution … Sollten meine Alten nichts rausrücken, meine kleine Schwester hat erst vor Kurzem Geburtstag gehabt …«
Gänslin grinste bösartig. Ihre kleine Schwester hatte sie noch nie gemocht.
Aus den Lautsprecherboxen wummerte Jimi Hendrix’ Hey Joe.
»Where are you gonna go with that gun in your hand?«
Am 2. April 1968 regnete es in Frankfurt. Die Kälte kroch unangenehm am Körper hoch. Es wurde den ganzen Tag lang nicht hell.
Um kurz vor halb sieben herrschte wenig Betrieb auf der Zeil, der Einkaufsstraße in der Mainmetropole. Bereits von außen sah man dem sechsstöckigen Kaufhaus Schocken an, dass es für besser gestellte Kundschaft war. Einige Kunden verließen es kurz vor Ladenschluss mit eleganten Tüten. Feierabendstimmung lag in der Luft.
Wenige Meter vom Kaufhaus Schneider entfernt richtete Gänslin den Kragen an Arzts Schmuddeljacke auf, sodass das Gesicht ein wenig verdeckt wurde. Sie standen hinter einer Mauerecke, um nicht gesehen zu werden.
»Ruhig, Baby, ruhig«, flüsterte sie. Arzt atmete tief durch.
»Das ist Aktion, Fötzchen, das ist Politik …«, presste er leise und gestresst zwischen den Lippen hervor.
»Pst, pst«, machte Gänslin und strich Arzt sanft über die Wange.
»18.25 Uhr, los geht’s«, ermahnte sich Arzt.
Gänslin und Arzt gehen entschlossen los. Arzt öffnet die Glastür und hält sie für Gänslin auf. Arzt sieht, dass die Rolltreppen schon abgestellt sind, und flucht.
Im ersten Stock ist niemand zu sehen. Arzt und Gänslin gehen zu den Umkleidekabinen der Damenoberbekleidung. Arzt schaut sich um und legt eine präparierte Tüte auf einen Holzwandschrank. Beide atmen tief durch. Sie wollen sichergehen, dass das Ganze gelingt. Deshalb gehen sie weiter die Rolltreppen nach oben.
Im zweiten Stock kriegt Arzt einen Riesenschreck. Drei Verkäuferinnen holen ihre Taschen aus einem Fach und starren ihn und Gänslin an. Sie wollen Feierabend machen. Gänslins Gesicht wirkt maskenhaft, das Haar hängt ihr strähnig herunter und die Hosen passen eher zu einem Sit-in, als in ein feines Kaufhaus.
»Gammler sind das«, denkt eine Verkäuferin.
»Die wollen noch etwas mitgehen lassen«, sagt sie dann leise zu ihren Kolleginnen.
Die anderen nicken zustimmend.
»Jetzt müssen wir noch warten, bis die mit dem Klauen fertig sind«, fährt sie entnervt fort.
In der Möbelabteilung der dritten Etage schauen sich Arzt und Gänslin gehetzt um. Sie suchen ein geeignetes Objekt. Etwas, das schnell und sicher Feuer fängt.
»Da!«, zischt Gänslin und zeigt auf einen altdeutschen Kleiderschrank.
Arzt nimmt die Tüte, öffnet die Tür, schiebt sie in den Schrank und schließt hastig die Schranktür.
»O. k. Fertig«, befiehlt er und gibt mit den Augen einen Wink. Arzt und Gänslin spurten los. Sie merken, dass die Verkäuferinnen im zweiten Stock ihre Flucht beobachten. Arzt ist klar, dass sie prima Zeugen abgeben. Er hat Angst. Gänslin im Nacken zu spüren gibt ihm Kraft und Mut.
Arzt streckt Gänslin das Zigarettenpäckchen mit zitternder Hand hin und nimmt einen tiefen Zug. Sie waren zu Fuß aus dem Einkaufzentrum Frankfurts geflüchtet und standen an einer Straßenbahnhaltestelle.
»Kaufpalast und Schocken, wir haben heute Geschichte geschrieben, Baby.«
Arzt hat Tränen in den Augen. Er fühlt sich bedeutsam, politisch und geschichtlich. Gänslins Worte trafen seine Stimmung.
Die Journalistin Friederike Steinhoff schrieb wenig später in direkt, dass das Radikale der Kaufhausbrandstiftungen von Frankfurt weniger im Politischen als vielmehr in der Tat des Gesetzesbruchs lag: »Die Warenhausbrandstiftung ist leider keine antikapitalistische Aktion, sondern eher systemerhaltend und konterrevolutionär. Die Warenhausbrandstiftung besitzt aber ein wichtiges fortschrittliches Moment, welches nicht in der Vernichtung der Waren liegt, sondern in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch.« Steinhoff konnte nicht ahnen, dass die Anführer der Brandstiftungen sie später in einer Berliner Wohnung auf einem LSD-Trip dazu überreden würden, in den Untergrund zu gehen und bewaffnet zu kämpfen.
Kapitel 3
Grass war frustriert. Er glaubte nicht mehr an seine Mission. Ja, die Studenten politisierten, ja, die Studenten rauchten des Öfteren einen Joint. Ein wirklich schwerer Fall von Kriminalisierung politischer Aktivitäten ließ sich daraus aber kaum basteln. Damit war seine ambitionierte Karriere erstmals auf Eis gelegt.
Ganz zu schweigen von politisch-historischer Bedeutsamkeit. Davon war er Lichtjahre entfernt. Grass zweifelte an sich selber. Er befand sich in einer Identitätskrise.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!