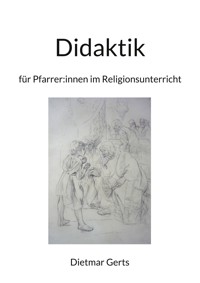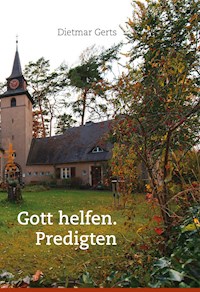Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dreißig Andachten legen die Bibel mit Legenden oder Märchen, Gemälden oder Grafiken, Gedichten oder Theaterstücken, Betrachtungen oder Nacherzählungen aus. Sie laden ein, sich selbst zu unterbrechen und im Tageslauf innezuhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Christian Witting
INHALT
Vorwort
Das Wort hören
Über dem Nebelmeer
Ruf zur Liebe
Schlüsselgeschichte
Gottes Wort heiligt
Anbetung der Hirten
Die fünfzigste Pforte
Das Gerechte tun
Liebe vor Recht
Schatzsuche
Vergebung statt Vergeltung
Zeit verschwenden
Eine Frage der Ehre
Lebendiger Glaube
Die Stimme erheben
Den Herrn befragen
Schläge ins Gesicht
Sprachschule der Liebe
Christusstreit
Abba, lieber Vater!
Sieh den Korb an
Im Leiden widerstehen
Lass mich in Ruhe
Sich wundern
Ein glücklicher Tag
Der Finger Gottes
Petrusmoment
Flügel anschnallen
Gott vertrauen
Nachthütte im Gurkenfeld
Briefe aus Babylon
Tolstoi’sche Augenblicke
Verlust ist Gewinn
In seinen Händen
Liebschaft Gottes
Bibelstellen
Biblische Personen
Biblisch-theologische Stichworte
Anmerkungen
VORWORT
Sie sind eingeladen, sich allein oder zusammen mit anderen eine kleine Auszeit zu gönnen und eine der dreißig Andachten dieses Bandes zu lesen oder zu hören. Dabei werden ausnahmslos biblische Gedanken aufgegriffen und ausgelegt. Berührt von wachsender Armut und Ungerechtigkeit, betroffen von fremdem und eigenem Leid, erschrocken über die Aggressivität der gesellschaftlichen und politischen Debatte und entsetzt über menschenverachtende, populistische Parolen, suchen die Andachten mit »hörendem Herzen« (1Kön 39 in der Einheitsübersetzung) nach weiterführenden und voranbringenden Gedanken und Worten.
Einerseits leihe ich mir mit dem Titel Gott verteilen eine Formulierung der deutschen Theologin und Dichterin Dorothee Sölle (1929-2003). Sie benutzt sie bei einem Plädoyer für mehr Poesie in der Theologie als Kurzformel für die Intention, »etwas zu sagen, was über die Alltagssprache hinausgeht«1. Dann und wann gelingt es, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden.
Andererseits knüpfe ich mit dem Titel dieses Buches an Gott helfen. Predigten2 an. Ähnlich wie dort habe ich auch hier Beispiele aus meiner Berufspraxis zusammengestellt.
Die dreißig Andachten sind in fünf Kategorien geordnet. Ich bin bei der Beschäftigung mit dem Leben und Werk des deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) auf sie gestoßen. Sowohl die Kategorien als auch die Zuordnungen sind hypothetische Konstrukte. Doch ihnen eignet eine gewisse Plausibilität als Spiegel dessen, was uns als Christinnen und Christen bewegt und aufgetragen ist.
Kategorien:
Das Wort hören
Das Gerechte tun
Die Stimme erheben
Im Leiden widerstehen
Gott vertrauen
Im Übrigen wollen die Verzeichnisse helfen, sich in der Andachtssammlung zurechtzufinden.
Ich bedanke mich herzlich bei den Mitgliedern meiner Familie und bei den Freundinnen und Freunden, die mich bei meiner Arbeit beraten und den Entwurf des Buches gelesen, korrigiert, kommentiert und damit vorangebracht haben.
Berlin 2024, Dietmar Gerts
DAS WORT HÖREN
Das Wort hören
Hesekiel 40
1-2a
Im fünfundzwanzigsten Jahr unserer Gefangenschaft, im Anfang des Jahres, am zehnten Tag des Monats, im vierzehnten Jahr, nachdem die Stadt eingenommen war, eben an diesem Tag kam die Hand des HERRN über mich und führte mich dorthin, – in göttlichen Gesichten führte er mich ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg.
ÜBER DEM NEBELMEER
Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer (um 1818)
Der Prophet wird »in göttlichen Gesichten […] auf einen sehr hohen Berg« geführt. Im Fortgang des 40. Kapitels des Hesekielbuches wird – wie es in der Überschrift heißt – die »künftige Gottesstadt« detailverliebt beschrieben. Ich überlasse die Beschreibung Ihrer Lektüre. Wir sind keine Propheten. Aber wünschen wir uns nicht auch manchmal, »in göttlichen Gesichten […] auf einen sehr hohen Berg« geführt zu werden? Ich habe zu diesem Motiv der Heiligen Schrift ein eindrückliches Bild gefunden. Der Maler heißt Caspar David Friedrich (1774-1840). Das Bild hat den Titel Der Wanderer über dem Nebelmeer3 und wurde etwa um 1818 gemalt.
Die erste Assoziation ist Fernweh. Man möchte alles stehen und liegen lassen und sich gerne – mal wieder? – auf den Weg machen. Aber vielleicht reicht es ja vorerst, sich in den Wanderer auf dem Gemälde – es soll sich um einen Herrn von Brincken handeln4 – hineinzudenken und seine Perspektive einzunehmen: Er steht auf einem Felsen, der wie ein Kegel von unten nach oben in das Bild ragt. Der Wanderweg ist an einem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Geradeaus geht es nicht weiter. Das Gewicht des Mannes ist auf das rechte Bein gelagert. Die Position scheint gefahrvoll. Stürzt er sich herab? Doch etwas hält ihn zurück. Kaum in der Reproduktion, wohl aber im Original zu erkennen: Vor dem linken Schuh des Wanderers befindet sich ein kleines rotes Pflänzchen, ein Zeichen blühenden Lebens inmitten einer lebensfeindlichen und undurchschaubaren Welt.
Die Niederungen der Berglandschaft sind mit Nebelschwaden gefüllt. Man meint, ihr Wabern wahrnehmen zu können. Obwohl von vergänglicher Beschaffenheit, verstellen sie dennoch den Blick, verbergen die Details der Landschaft, flackern zwischen uns und dem Ziel der nächsten Schritte, nehmen uns die Orientierung. In der Konstellation, die der Maler festgehalten hat, macht das Nebelmeer wenig Lust, vom Felsen im Vordergrund herabzusteigen und sich auf den Weg durch diese Landschaft zu machen. Der Nebel steht für vieles, was uns bedrückt. Nebel ist unbarmherzig: Er verschluckt Signale. Er wiegt einen in falscher Sicherheit. Er nimmt einem die Orientierung. Manchmal hat er die Gestalt von dunklen Gefühlen, von schlaflosen Nächten oder schlechten Tagen. Manchmal kommt er als Wortschwall daher, mit dem gerechtfertigt wird, was bei näherer Betrachtung nicht zu rechtfertigen ist. Manchmal ist es das Schweigen, das die Sicht nimmt. Und manchmal ist es einfach die Unverfrorenheit von Weggenossen, die den Atem stocken lässt und den Blick verstellt.
Doch der Wanderer sieht eine felsige und hügelige Berglandschaft, die in der Mitte durch eine ellipsenförmige Linie geteilt wird. Der Scheitelpunkt der Ellipse scheint der Spitze des Standort-Kegels zu korrespondieren. Doch diese Ellipse ist um vieles größer und weiter als ihr felsiges Gegenstück. Und sie ist nach oben hin – zur Unendlichkeit? – offen. Himmel und Erde sind nicht trennscharf unterschieden, sondern gehen fast ineinander über. Was der Wanderer nicht selbst sehen kann: Die beiden Fixpunkte im Hintergrund, rechts der gewaltige Steilfelsen, links der noch mächtigere Bergkegel, stehen in Beziehung zu ihm, dem Betrachter. Der Steilfelsen rechts ist wie eine Projektion seiner selbst. Der Bergkegel links fällt nach rechts parallel zu seiner rechten Schulter ab. »Die Verknüpfung der Figur mit der Landschaft […] deutet den Zustand des ewigen Lebens und die Gottesebenbildlichkeit des Menschen an.«5 Die Kopfhaltung des Wanderers legt nahe, dass er den Bergkegel links fixiert, fern und doch so nah erscheinend. Verbindet sich dieser Berg mit der Sehnsucht nach Gott?
Bibelleserinnen und Bibelleser haben eine Ahnung von der Verknüpfung von Berg und Gott. Sie kennen das Wort »Zion«, Name des Südost-Hügels Jerusalems. Zion steht in der Hebräischen Bibel für Jerusalem, für die »Stadt Gottes«, immer zugleich theokratisches und heilsgeschichtliches Zentrum Israels und der Welt. Zion steht aber auch für das »himmlische Jerusalem« der Offenbarung des Johannes (212). Hesekiel knüpft mit genauer Zeitangabe an die Einnahme »der Stadt« an und führt unsere Gedanken bis zur »künftigen Gottesstadt«. Ähnlich auch der Maler: Er führt uns auf ein Felsmassiv, wo wir – in meinem Alter atemlos und mit weichen Knien – einen Standort gewinnen, der uns über das Nebelmeer erhebt und Gottesberge erblicken lässt.6
Voller Sehnsucht sieht, wer einen Standort über dem Nebelmeer sucht, in der Ferne jene Bergkegel sich erheben, zu denen er ein Leben lang unterwegs ist. Das ist gewiss ein heiliger Moment. Der Körper entspannt sich. Die Gedanken kommen zur Ruhe. Das Herz ist ergriffen. Selbst sprachlos, fällt ein hoffnungsvolles Motto Hilde Domins (1909-2006) ein: »Ich setzte den Fuß in die Luft, / und sie trug.«7
Das Wort hören
Matthäus 5
1-3a
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, …
RUF ZUR LIEBE
Eugen Drewermann (*1940) beginnt sein Büchlein Worte der Freiheit. Die Seligpreisungen Jesu mit den Gedanken: »Die Worte der Seligpreisungen sind wie ein fein geschliffener Diamant inmitten der Überlieferung des Neuen Testamentes. Wenn wir uns selbst oder einem anderen verdeutlichen möchten, was Jesus uns gebracht und ermöglicht hat, so lässt es sich in der reinsten und besten Form nicht anders sagen als in diesen acht Preisungen, die all diejenigen glücklich nennen, die ihr Leben einzig gründen im Vertrauen auf Gott (vgl. Mt 5,1– 12). Eine Stimmung wie von Morgenfrühe und von Neubeginn liegt über dem Berg der Seligpreisungen bei diesen Worten Jesu, so als begönne die Geschichte Israels noch einmal ganz von vorn – ein neuer Auszug aus dem Land der Knechtschaft und der Unterdrückung sowie die Verkündigung eines neuen Gesetzes der Freiheit von einem neuen Gottesberg herab.«8
»Gesetz der Freiheit«? Die Wendung stammt aus dem Jakobusbrief (Jak 125) und wird dort mit derselben Verheißung verknüpft, mit der Jesus jede der Seligpreisungen einleitet: »Selig ist …« Doch benennt sie nicht ein Paradox? Gehen Gesetz und Freiheit zusammen? Werden positive Gefühle, die das Wort »Freiheit« auslöst, nicht von negativen Empfindungen, die sich bei dem Gedanken »Gesetz« einstellen, überlagert? Es gibt in der Bergpredigt, die von den Seligpreisungen eingeleitet werden, eine ganze Reihe Gedanken, die die Forschenden als »ureigenste Worte Jesu« (ipsissima vox Jesu) rühmen und die sehr hart klingen, zum Beispiel:
»Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig.« (Mt 5
22
)
»Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel.« (Mt 5
39
)
»Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.« (Mt 5
44
)
Wir hören solche Sätze und uns wird das Herz schwer, weil wir erfahren haben und wissen, dass die Welt nicht ohne Zorn und nicht ohne Übel, nicht ohne Feindschaft und nicht ohne Verfolgung ist. Und wir sind nicht einfach nur die Opfer. Nicht selten sind wir die Täter.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schrieb in seiner Ethik: »Die Bergpredigt selbst stellt Menschen in Verantwortung für andere und kennt keinen Einzelnen als Einzelnen. Sie begnügt sich auch nicht damit, den Einzelnen für seine Aufgabe in der Gemeinschaft vorzubereiten, sondern sie beansprucht den Einzelnen in seinem verantwortlichen Handeln selbst. Sie ruft ihn zu der Liebe, die sich im verantwortlichen Handeln am Nächsten bewährt und deren Ursprung die Liebe Gottes ist, die die ganze Wirklichkeit in sich schließt.«9
Bonhoeffer verweist also darauf, dass der Ruf zur Liebe nicht isoliert erfolgt. Wir sind nicht an und für sich zur Nächstenliebe aufgefordert. Jesu Ruf zur Liebe hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes. Damit sind wir bei den Seligpreisungen. Manchmal werden sie gelesen wie die übrigen Abschnitte der Bergpredigt: Seid geistlich arm! Seid sanftmütig! Seid barmherzig! Usw. Aber das steht da nicht! Dort steht »selig sind«. Die Seligpreisungen sind somit kein Katalog menschlicher Verhaltensweisen und also kein Gesetz. Sie geben den Grund, die Quelle oder eben den Ursprung der menschlichen Liebe an: Gottes Liebe zu einer zerrissenen Welt und ihren gequälten Kindern.
Es leuchtet unmittelbar ein, wer hier angesprochen wird: »Geistlich Arme«, »Leid-Tragende«, »Sanftmütige«, »Gerechtigkeits-Hungrige«, »Barmherzige«, Menschen »reinen Herzens«, »Friedfertige«, »Um-der-Gerechtigkeit-willen-Verfolgte«. Lässt man die Adressaten Revue passieren, fallen einem Gesichter und Geschichten ein. Und mit der einen oder der anderen Bezeichnung fühlt man sich selbst gemeint.
Was Gott seinen Kindern, was er uns in den Seligpreisungen zusagt, liegt weit außerhalb unserer Möglichkeiten: Himmel und Erde werden neu verteilt. Tränen werden getrocknet. Gerechtigkeitssatt wird man sein. Ja, sogar Gott wird man schauen. Wen erinnert das nicht an die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde in Offenbarung 21?
Weil wir diese unglaublich schöne Verheißung Gottes haben, weil ER sich uns liebevoll zusagt und unermüdlich um uns wirbt, weil wir IHM recht sind, lange bevor wir den ersten Handschlag getan haben, hören wir seinen Ruf zur Liebe.
Das Wort hören
Matthäus 16
19
Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein.
SCHLÜSSELGESCHICHTE
»Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr«, sagt man und bringt damit seine Skepsis zum Ausdruck, was die Lernfähigkeit Erwachsener angeht. Ich möchte von einem Hans erzählen, dessen Leben das Sprichwort Lügen straft.
Unser Hans ist verheiratet und hat einen harten, doch ehrbaren Beruf. Er und sein Bruder sind Fischer am See Genezareth. Üblicherweise fischen sie nachts, verkaufen ihren Fang und pflegen ihre Boote und die Netze tagsüber. Nach einer Nacht ohne Fang kommt ein Wanderprediger. Er verkündigt den Anbruch des Reiches Gottes. Aber er fordert unseren Hans und seinen Bruder auch auf, noch einmal hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Gegen alle Berufserfahrung folgen die Fischer der Aufforderung und fangen mehr Fische, als die Boote tragen und die Netze halten können. Zutiefst erschrocken und berührt vernimmt unser Hans: »›Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.‹ Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.« (Lk 510c-11) Unser Hans und sein Bruder geben also alle Sicherheit ihrer Existenz auf. Der Wanderprediger beruft noch zehn weitere Männer und zieht mit den Zwölfen durch das Land. Eine wunderbare Zeit beginnt. Menschen hören ihnen aufmerksam zu. In manchen Dörfern wartet man regelrecht auf sie und säumt die Straßen bei ihrer Ankunft. In anderen öffnet man ihnen die Häuser, beherbergt und versorgt sie. Menschen verändern unter dem Eindruck der Reich Gottes-Botschaft ihr Leben; andere dienen ihnen. Die Wanderer bekleiden keine Ämter und genießen doch höchstes Ansehen. Sie sind wohnungslos und haben doch jede Nacht ein Lager. Sie besitzen nichts und haben alles.
Später zeichnet der Wanderprediger unseren Hans in besonderer Weise aus. Hans bekommt die Schlüssel des Himmelreichs. Wieviel Vertrauen wird hier in den Fischer gesetzt! Welch große Verantwortung wird ihm übertragen! »Schlüssel des Himmelreiches« – das hat auch unheilige Entwicklungen in der Kirchengeschichte befördert. Denkt man diesen Gedanken aber nicht vertikal und damit hierarchisch, sondern horizontal und somit presbyterial weiter, kann man sagen, jede und jeder hat in der Gemeinde die Schlüssel des Himmelreiches für andere in Händen, für die, die Gemeinde sind, aber auch für alle, die Gemeinde werden wollen. Wieviel Vertrauen, welch große Verantwortung! Denn wie leicht ist ein Schlüssel verlegt oder geht verloren.