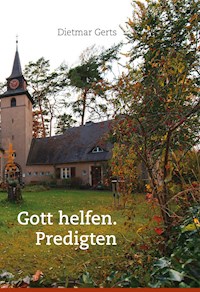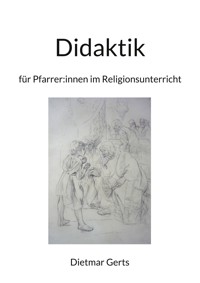
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wer als Pfarrerin oder Pfarrer im Religionsunterricht tätig wird, sieht sich mit einem Fachgebiet konfrontiert, das sie oder er nicht studiert hat. Die Didaktik für Pfarrer:innen im Religionsunterricht ist an der Ausbildungs- bzw. Weiterbildungspraxis orientiert: Schritt für Schritt wird entwickelt, Religionsunterricht zu analysieren, zu planen und auszuwerten. Dabei wer -den klassische Positionen referiert, aktuelle Betrachtungsweisen erörtert und vertiefende Veröffentlichungen benannt. Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer werden in die Lage versetzt, Unterrichtsentwürfe zu schreiben, die jeder religionspädagogischen Prüfung standhalten. Im Anhang ist die Methodenkartei WortSinn beigefügt. In ihr sind mehr als 50 Vorschläge gesammelt, Schülerinnen und Schüler mit biblischen Tex ten über Gott und die Welt, Glaube und Zweifel, Angst und Hoffnung in ein ergebnisoffenes Gespräch zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ralf Wüstenberg
INHALT
VORWORT
ÜBERBLICK
1 RELIGIONSUNTERRICHT ANALYSIEREN
1.1 Schülerinnen-und Schülerbeobachtung
1.2 Lehrerinnen-/Lehrerbeobachtung
1.3 Beobachtung der Interaktion
1.4 Beobachtungen zur Unterrichtsorganisation
1.5 Von Notizen zur Verlaufsskizze
2 RELIGIONSUNTERRICHT PLANEN
2.1 Lernausgangslage
2.1.1 Gesellschaft und Institution
2.1.2 Lernende
2.1.3 Lehrende
2.2 Didaktische Analyse
2.2.1 Thema
2.2.2 Inhalt
2.2.3 Ziel
2.3 Methodische Begründungen
2.3.1 Phase
2.3.2 Material/Medium
2.3.3 Arbeits- und Sozialform
2.4 Schriftliche Entwürfe
2.4.1 Verlaufsskizze(n)
2.4.2 Ausführlicher Unterrichtsentwurf
3 RELIGIONSUNTERRICHT AUSWERTEN
3.1 Leitfragen
3.1.1 Eingangssituation/Schwerpunkt/Motivation
3.1.2 Fragen
3.1.3 Interaktion
3.1.4 Mitarbeit
3.1.5 Arbeitsaufträge
3.1.6 Arbeitsergebnisse
3.1.7 Konflikte/Disziplin
3.1.8 Weitere Fragestellungen
3.2 »Freiwillige Selbstkontrolle«
3.2.1 Geplantes Lehrer:in-Verhalten
3.2.2 Erwartetes Schüler:innen-Verhalten
3.2.3 Ziel(e) erreicht?
LITERATUR
STICHWORTE
ANHANG
VORWORT
Als ich 1970 als frischordinierter Pfarrer in der Realschule einer Kleinstadt mit dem Unterrichten begann, bin ich erst einmal gescheitert. Die lange, siebenjährige Ausbildung hatte mich offensichtlich nicht in die Lage versetzt, vernünftigen Unterricht zu gestalten. Die 32 Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse machten, was sie wollten, spazierten von Bank zu Bank, unterhielten sich laut und beschäftigten sich mit allem Möglichen, nur nicht mit dem Religionsbuch, das ich sie aufzuschlagen gebeten hatte. Klar, dass ich meine Stimme erhob! Doch das bewirkte lediglich ein Anschwellen des Lärmpegels. Irgendwann habe ich entnervt aufgegeben, mich an den Tisch gesetzt und das Chaos sich selbst überlassen. Zwar war mir nach Rausrennen, doch ich war ja zur Aufsicht verpflichtet. Jedenfalls haben die zwölf-, dreizehnjährigen Mädchen und Jungen in dieser Stunde absolut nichts gelernt, was den hehren Zielen des Religionsunterrichts korrespondierte. Meine Konsequenz aus dieser bösen Erfahrung war, mich neben dem Pfarramt per Fernstudium und Fortbildung mit Didaktik zu beschäftigen.
»Die Didaktik (von altgriechisch didáskein, deutsch ›lehren‹) ist die ›Kunst‹ und die ›Wissenschaft‹ des Lernens und Lehrens.«1 Meine Spezialisierung auf diesem Gebiet wirkte sich so aus, dass ich nach fünf Jahren Pfarramt als Schulpfarrer und wiederrum fünf Jahre drauf als Studienleiter für Religionspädagogik in der Ausbildung von Vikar:innen und in der Weiterbildung von Pfarrer:innen tätig sein konnte. Noch später habe ich Lehramtsstudierende an einer Universität begleitet. Große Teile der hier vorgelegten Didaktik sind in diesen Kontexten entstanden.2 Manches in meiner Didaktik wirkt vielleicht etwas »aus der Zeit gefallen«. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass meine Überlegungen grundlegend und in sich stimmig sind und ich mit ihnen etwas Licht in die Blackbox »Religionsunterricht« bringe.
Der Aufbau des Buches folgt der Ausbildungs- bzw. Weiterbildungspraxis: Religionsunterricht beobachten und analysieren, ihn zunächst teilweise, später vollständig schriftlich planen und an entsprechenden Entwürfen orientierte Unterrichtsstunden halten und auswerten. Dabei kommt es nicht darauf an, sich an meinen Überlegungen abzuarbeiten. Aber die mit ihnen skizzierten didaktischen Aspekte müssen der Sache nach vorkommen. Es geht nicht an, Unterricht zu planen und zu halten, ohne z.B. vorhergehende entwicklungspsychologische Überlegungen anzustellen und sich und Dritten klarzumachen, mit welchen Kindern oder Jugendlichen man es zu tun hat.
Sternstunden des Religionsunterrichts zeichnen sich durch angeregte und spannende Gespräche der Beteiligten aus – der Lehrenden mit den Schülerinnen und Schülern ebenso wie auch der Schülerinnen untereinander. Ich habe dem Buch daher die Methodenkartei WortSinn angefügt: Sie finden 50 unaufwändige Vorschläge, mit Schüler:innen über biblische und andere Texte ins Gespräch zu kommen bzw. sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Durch Rede und Gegenrede soll sich »der Wortsinn«, »die Wahrheit«, »der Gehalt« oder »die Aussage« des Textes in einem gemeinsamen Verstehensprozess erschließen.
Dietmar Gerts, Berlin 2023
1 Art. Didaktik, Wikipedia.
2 Vgl. Gerts (2005) und Gerts (2017).
ÜBERBLICK
Zum Kapitel »1 Religionsunterricht analysieren«
Unterricht ist ein sehr komplexes Geschehen. Schon ein flüchtiger Blick auf die Beobachtungslisten (1.1 bis 1.4) zeigt eine Fülle von Variablen, die auf Unterricht einwirken und das Geschehen mitbestimmen. Kern des Geschehens ist jedoch die Interaktion von Lehrer:innen und Schüler:innen: Wie reagieren Schülerinnen und Schüler, wenn Lehrerin bzw. Lehrer dieses oder jenes sagt? Wie verhält sich Lehrerin bzw. Lehrer, wenn Schülerinnen und/oder Schüler sich so oder so äußern? Usw. Die Analyse des Unterrichts nimmt vor allen anderen wichtigen Gesichtspunkten dieses Wechselspiel in den Blick.
Zum Kapitel »2 Religionsunterricht planen«
Die Interaktion von Lehrenden und Lernenden so nahe wie möglich am tatsächlichen Verlauf vorauszusagen und zu beschreiben, ist Gegenstand und Ziel jeder Unterrichtsplanung. Dazu dienen eine Reflexion der Lernausgangslage, die didaktische Analyse der Unterrichtsinhalte, die Erörterung und Begründung der Methoden und schriftliche Entwürfe der Planung (2.1 bis 2.4). Schülerinnen und Schüler lassen es einen in der Regel wissen, wenn der Unterricht sie unter- oder überfordert, wenn sein Bildungsgehalt gegen null geht oder wenn die Methoden kontraproduktiv sind. Am Anfang gerät man öfter »ins Schwimmen«. Doch mit zunehmender Unterrichtserfahrung wachsen auch die Planungsgenauigkeit und -sicherheit.
Zum Abschnitt »2.1 Lernausgangslage«
Unterricht geschieht nicht im leeren Raum. Schülerinnen und Schüler bringen ihren sozio-kulturellen Hintergrund ebenso in den Klassenraum mit wie ihre lernpsychologischen Voraussetzungen. Im Religionsunterricht wird darüber hinaus wichtig, dass Schülerinnen und Schüler mit ihrem Glauben oder Unglauben immer schon irgendwo angesiedelt sind – nicht anders als die Lehrerinnen und Lehrer. Diese Zusammenhänge zu reflektieren und Sprache dafür zu haben, wo Schülerinnen und Schüler, aber auch man selbst als Lehrerin oder Lehrer religionspädagogisch seinen Ort hat, ist der erste Schritt jeder Unterrichtsplanung.
Zum Abschnitt »2.2 Didaktische Analyse«
Unterrichtliche Gegenstände haben – unabhängig davon, ob sie als Frage, Text, Bild, Lied u.a.m. eingebracht werden – einen Bildungsgehalt. Er lässt sich benennen und ... überprüfen. Ein grundsätzliches Ausschlusskriterium ist die Frage nach der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Bildungsgehalts für die Lernenden. Kann sie nicht befriedigend beantwortet werden, haben die Gegenstände nichts im Unterricht zu suchen. Unterrichtszeit ist zu kostbar, um sie sinnfrei zu verschwenden. Was also ist der tiefere Bildungsgehalt des unterrichtlichen Gegenstands? Die weitere Analyse knüpft daran an: Hat er vielleicht eine Struktur, die für sich spricht oder seiner Interpretation entgegenkommt? Usw.
Zum Abschnitt »2.3 Methodische Begründungen«
Methoden lehren mit, besonders dann, wenn sie gleichermaßen zu den Lehrenden, den Lernenden und dem Bildungsgehalt passen. Manchmal jedoch wirken Methoden absolut kontraproduktiv, vor allem, wenn sie »ex ärmelo« eingebracht worden sind. Das kann man vermeiden, indem man Methoden dieselbe analytische Sorgfalt angedeihen lässt wie Unterrichtsgegenständen. Zugespitzt formuliert: Methoden haben eine Geschichte, sind in der Regel im Blick auf ganz bestimmte Adressaten entwickelt worden und bedürfen einer zielgruppenorientierten Anwendung – durchaus der Exegese eines Bibeltextes vergleichbar.
Zum Abschnitt »2.4 Schriftliche Entwürfe«
Die Aufgabe, Unterricht zu verschriften, ist für manche(n) eine besondere Herausforderung. Ihr tieferer Sinn besteht darin, nicht nur sich selbst, sondern auch Dritten gegenüber auszuweisen, was im eigenen Unterricht geschehen soll. Damit macht man sich natürlich auch angreifbar: Im besten Fall wird man über den Klee gelobt, in der Regel wohlwollend kritisiert, im ungünstigsten Fall demontiert. Doch es bringt einen auf jeden Fall weiter, wenn man Unterricht nicht als seine Privatangelegenheit begreift, die niemanden etwas angeht, sondern sich mit einem schriftlichen Entwurf in mancher Hinsicht festlegt und der Kritik stellt.
Zum Kapitel »3 Religionsunterricht auswerten«
Die Auswertung selbst erteilten Religionsunterrichts dient vor allem der »Freiwilligen Selbstkontrolle« (3.1-3.2): Wie ist gelaufen, was ich arrangiert, inszeniert oder angeregt habe? Sind die Schülerinnen und Schüler auf meine Angebote »angesprungen«? Wie habe ich auf ihre Beiträge reagiert? Wen oder was habe ich übersehen? Usw. In einer Unterrichtsauswertung im engeren Sinne schließt sich der Kreis zum Kern jeden unterrichtlichen Geschehens: Es geht um das mehr oder weniger erfolgreiche Wechselspiel von Lehrenden und Lernenden.
1 RELIGIONSUNTERRICHT ANALYSIEREN
Aus der Praxis
Martina: Jesus hat viele Geschichten erzählt. Auch von Gott oder vor allem von Gott. Er ist ja Gottes Sohn. Und er hat das Samenkorn gesät oder so ähnlich.Jonathan: Wie ich vorhin gesagt habe: Der eine hat's gehört und weitererzählt und so weiter. Da wächst das Reich Gottes. Wie in der Geschichte mit dem Senf.L: Schön, dass du noch einmal daran erinnerst, was du vorhin gesagt hast. Cordula, du hast noch einen Gedanken.Cordula: Vielleicht kann man auch sagen: Jesus hat den Anfang gemacht, wie das kleine Senfkorn. Jetzt muss es weiterwachsen.Zu Matthäus 13,31-32
Im Mittelpunkt des Gesprächs steht ein Himmelreich-Gleichnis Jesu: »Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.« (Mt 1331-32) Der Protokollauszug3 gewährt einen Einblick in die Interaktion zwischen Lehrerin/Lehrer (»L.«), dem Schüler Jonathan und den Schülerinnen Martina und Cordula (abgekürzt »Sch.«). Bei einer Unterrichtsbeobachtung (und später -planung) geht es vor allem um dieses Geschehen zwischen L. einerseits und Sch. andererseits: Alle anderen Bedingungen und Faktoren, Konstanten und Variablen usw., die Unterricht ausmachen, zielen auf diesen »Kern«4:
Lehrer:in-Verhalten ↔ Schüler:innen-Verhalten
Die etwas steifen Begriffe »Lehrer:in-Verhalten« und »Schüler:innen-Verhalten« sind nicht beliebig austauschbar. Sie werden seit den 70-er Jahren in der Bildungsforschung in der Bedeutung verwandt, jede Minute des Unterrichts beschreiben zu können. Man konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Lehrer bzw. Lehrerin und Schülerinnen und Schülern und trägt damit der wechselseitigen Abhängigkeit des Verhaltens beider Seiten Rechnung. Angewandt auf das Beispiel »Aus der Praxis«:
L. hält sich zurück. ↔ Sch. deuten das Himmelreich-Gleichnis.
L. bestätigt einzelne Äußerung(en) ↔ ...
L. fordert Sch. auf, der/die bisher schwieg. ↔ Sch. fügt eine weitere Deutung hinzu.
Das wirkt nicht nur, das ist kleinteilig! Doch es ist alles andere als banal. Legt man bei der Beobachtung und Beschreibung von Unterricht den Fokus auf die Interaktion zwischen L. und Sch., erfasst man nicht nur das Handwerkliche unterrichtlicher Prozesse, sondern nähert sich auch dem Geheimnis, das aus einem normalen Ablauf eine »Sternstunde« werden lässt. Ich nehme diese Einschätzung für das Beispiel »Aus der Praxis« in Anspruch: Die selbstständigen Kinderäußerungen zu dem Himmelreich-Gleichnis sind schlicht beeindruckend.
Das hier deskriptiv angewandte Verfahren eignet sich aber auch hervorragend als Planungsinstrument für eigene Unterrichtsgestaltung, wenn man beim Entwerfen die Interaktion zwischen L. und Sch. so genau wie möglich vorhersieht und notiert. In der nicht-inklusiven Sprache der 70-er Jahre ist es in einer »klassischen« Form in die Theorie und die Praxis von Unterricht eingegangen:
Geplantes Lehrerverhalten ↔ Erwartetes Schülerverhalten
Unter dieser Überschrift sind alle Impulse, also die Aufgabenstellungen und Sätze, die z.B. eine Gruppenarbeit einleiten oder ein Gespräch eröffnen und voranbringen sollen, und alle vorauszusehenden Reaktionen notiert worden. Mit »Impulsen« sind jene elementaren Anregungsvariablen gemeint, die von der oder dem Unterrichtenden ausgehen, einen oder mehrere klassische Sinne der Unterrichteten ansprechen und den unterrichtlichen Prozess am Laufen halten wollen. Impulse können also akustischer, visueller, olfaktorischer, gustiöser oder taktiler Art sein. Sie können lautlich oder stumm, sprachlich oder non-verbal, gegenständlich oder stofflich sein und im Gespräch, an der Tafel, auf einem Arbeitsblatt, als Demonstration, als Körperhaltung, als Geste o.ä. angeboten werden. Impulse können zum Antworten, Begründen, Ergänzen, Fragen, Urteilen, Vergleichen, Vermuten und Ähnlichem auffordern. – Das Verfahren hat sich in der Praxis so bewährt, dass es mit einer kleinen Änderung in diesem Buch als das wichtigste Planungsinstrument überhaupt angesehen und empfohlen wird:
Geplantes Lehrer:in-Verhalten Erwartetes Schüler:innen-Verhalten
Doch zunächst ordnen wir die Hilfskonstruktion in die Intentionen eines schulischen Praktikums ein: Es geht bei den Hospitationen darum,
ein Verständnis davon zu entwickeln, wie in unserer Gesellschaft gelehrt und gelernt wird und welchen Anforderungen sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler täglich gerecht werden müssen;
sich auf den Rollenwechsel von der Schülerin zur Lehrerin, vom Schüler zum Lehrer einzustellen;
Unterricht als komplexes Geschehen, das sich aus vielen Einzelkomponenten zusammensetzt, in den Blick zu bekommen und analysieren zu lernen;
durch Beobachtung und Auswertung, Planung und Verwirklichung der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden ein Gespür für didaktisch-methodisch reflektiertes Reden und Handeln im Unterricht zu gewinnen.
1.1 Schülerinnen- und Schülerbeobachtung
Aktivitäten (Aussagen machen, erzählen, aufsagen, vorlesen, Fragen stellen, Stellung nehmen, zwischenrufen, spielen, schreiben, ...)
Allgemeine Arbeitshaltung (selbsttätige Mitarbeit, Mitarbeit nur nach Aufforderung, Mitarbeit einzelner Schülerinnen und Schüler, .)..
Beherrschung von Arbeitstechniken und -formen (Umgang mit Arbeitsbüchern, Gruppenarbeit, Geräte bedienen können, .)..
Arbeitstempo der Schülerinnen und Schüler (schreiben, lesen, ...)
Sprachniveau, Ausdrucksfähigkeit (Wortwahl, Satzlängen, Fachbezogenheit, ...)
Beherrschung demokratischer Umgangsformen (abstimmen, Mehrheitsbeschlüsse akzeptieren, sich zurücknehmen, .)..
Binnenkommunikation und Sozialverhalten (Gruppenbildung innerhalb der Klasse und die Einstellung der übrigen Schülerinnen und Schüler gegenüber den Gruppen; auch: Rivalität, Konkurrenzdenken, Solidarität, Cliquenbildung, ...)
Auffällige Schülerinnen und Schüler (durch Mitarbeit, Wissen, Störungen, ...); und die Einstellungen der übrigen Schülerinnen und Schüler ihnen gegenüber
Beobachtung einzelner Schülerinnen oder Schüler
1.2 Lehrerinnen-/Lehrerbeobachtung
Aktivitäten, die auf das Unterrichtsthema und-ziel bezogen sind
Stimme (Stimmlage, Modulationsfähigkeit, Artikulation, Geschwindigkeit, ...)
Sprache (Wortwahl, Satzbildung, bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, kindgemäß, distanziert, freundlich, kühl, abweisend, .)..
Gestik und Mimik (spärlich, linkisch, verkrampft, intensiv, unterstreichend, störend, hektisch, unverständlich, eindeutig, .)..
Unterrichtsstil (schülerinnen- und schülerbezogen, sachbezogen, ichbezogen, planungsoffen, planungslos, durchschaubar, systematisch, ...)
Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit (gefühlsbezogen, verstandesbezogen, ichbezogen, gruppenbezogen, zurückhaltend, steuernd, eindeutig, wechselhaft, verschwommen, klar, autoritär, partnerschaftlich, impulsiv, demokratisch, ...)
1.3 Beobachtung der Interaktion
Art der Lehrerinnen- und Lehrer-Äußerung (Fragen, Aussagen machen, bitten, befehlen, ermuntern, erklären, Wort abschneiden, kritisieren, bestätigen, ... und Reaktionen der Schülerinnen und Schüler darauf)
Fragen der Lehrerinnen und Lehrer (Beurteilungsfragen, Kontroll-, Suggestiv-, Entscheidungsfragen, .)
Impulse der Lehrerin, des Lehrers (verbal – nichtverbal, eindeutig – mehrdeutig, weiterführend – hemmend, einschüchternd – aufmunternd, zielgerichtet – zielindifferent, ...)
Arbeitsanweisungen und Steuerung des Unterrichts
Konflikte und Störungen (Ursachen, Beteiligte, Reaktionen, ...)
Ansprechbarkeit der Gesamtklasse (Themen, Methoden, Medien, ...)
1.4 Beobachtungen zur Unterrichtsorganisation
Sitzordnung (variabel, Wirkung auf den Beobachter, Stellung der Lehrerin, des Lehrers, .)
Das Entstehen eines Tafelbildes, Analyse des fertigen Tafelbildes
Zahl und Wechsel von Arbeits- und Organisationsformen
Zeitliche Länge einzelner Unterrichtsphasen (Phasenprotokoll, Wirkung von Aktionsformen auf Schülerinnen und Schüler, ...)
Dauer von organisatorischen Einzelheiten (Arbeitsbücher austeilen, Bücher aufschlagen, Gruppenbildung, ...)
Verlaufselemente (»Liturgie«) des Unterrichts (welche gibt es, Länge, Wirkung, ...)
1.5 Von Notizen zur Verlaufsskizze
Anfangs ist es eine gute Idee, sich bei der Hospitation einer Unterrichtsstunde auf einen Block der Liste zu beschränken oder auch nur auf ein, zwei Gesichtspunkte, die einer/einem besonders wichtig erscheinen. Man kann den Fokus weiter einengen, indem man sich auf eine Schülerinnen-/Schüler-Gruppe oder auf eine bestimmte Phase des Unterrichtsverlaufs konzentriert. Bitte notieren Sie Ihre Beobachtungen und besprechen Sie sie mit Ihrer Mentorin bzw. mit Ihrem Mentor!
Je eher Sie dann aber zu üben beginnen, Unterricht in Form einer »Verlaufsskizze« aufzuschreiben, desto besser! Wie Sie sehen, ist eine Verlaufsskizze eine knappe Beschreibung einer Unterrichtsphase oder -stunde mit den wichtigsten didaktisch-methodischen Parametern in Tabellenform. Eine Verlaufsskizze fasst alle Planungsüberlegungen zusammen, fungiert während des Unterrichts als Agenda für Reden und Handeln der/des Unterrichtenden und ist nach dem Unterricht Grundlage für mündliche und schriftliche Unterrichtsauswertung. Die Tabellenform für Unterrichtsbeschreibung hat sich in der Pädagogik als ausbildungsdidaktischer Standard etabliert: Die Vorschläge für Verlaufsskizzen sehen sich quer durch die Republik ähnlich. Differenzierungen ergeben sich aufgrund von Vorlieben und Schwerpunktsetzungen der Ausbilderinnen und Ausbilder oder der Auszubildenden. Niemand kann einen zwingen, das lebendige Geschehen »Unterricht« in Kästen zu sperren. Man kommt beim Aufschreiben auch ohne aus. Doch wenn man einen Parameter wie »Thema«, »Inhalt« oder »Ziel« modifiziert, bedarf es einer didaktisch-methodischen Begründung. Ihn einfach wegzulassen, wäre nicht angebracht. Wie auch immer: »Verlaufsskizze« kann man lernen. Also fangen Sie so früh wie möglich an, zunächst einzelne Phasen des Unterrichts von 10 bis 20 Minuten Dauer und später ganze Unterrichtsstunden in Form zu bringen!
Die Parameter einer Verlaufsskizze – ergänzt um die »Lernausgangslage« – werden im folgenden Kapitel »Religionsunterricht planen« (→ 2) erläutert.
3 Aus einem der Jahrbücher für Kindertheologie.
4 Nach Schulz 1972, S. 46 f.
2 RELIGIONSUNTERRICHT PLANEN
2.1 Lernausgangslage
2.1.1 Gesellschaft und Institution
Eine erste Fragenreihe zielt auf die gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, in denen die Lernenden (und Lehrenden!) leben und deren Probleme und Hoffnungen sie in den Unterricht mitbringen und eintragen, die Wohngegenden, ihre Menschen und Einrichtungen, die Elternhäuser und die Schule(n), die Vereine und die informellen Freizeittreffs, die gesellschaftlich bedingten Einstellungen und die Zukunftsaussichten und -perspektiven der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Alle Faktoren sind »Rahmenbedingungen« des Unterrichts.
2.1.1.1 Leitfragen
2.1.1.1.1 gesellschaftlich
Aktuelle gesellschaftliche Probleme, die vermutlich in den Unterricht hineinspielen?
Gesellschaftliche und/oder gesamtkirchliche Erwartungen im Blick auf Unterrichtsthemen?
...
Einfluss der gesellschaftlichen Lage auf ein Thema und auf die Art und Weise, wie es bearbeitet werden soll?
2.1.1.1.2 sozio-kulturell
Soziale Schichtungen der Einzugsbereiche?
Strukturen der Wohngegenden?
Lebensweise und Gebräuche?
Öffentliche Einrichtungen?
Soziale Probleme?
Inanspruchnahme durch Eltern, Vereine, Ausbildung?
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung?
Wort- und Meinungsführer?
Autoritäten?
Außenseiter und Minoritäten?
Gefährdungen Kinder und Jugendlicher?
Probleme, die einzelne Lernende in die Klasse tragen?
Inwieweit bestimmen diese Außenbedingungen das Arbeiten und Lernen während des Unterrichts?
2.1.1.1.3 institutionell
Selbstverständnis der Schule, d.h. welche Traditionen werden hochgehalten bzw. welche aktuellen pädagogischen Ziele werden angestrebt?
»Klima« an der Schule: Kommunikationsstil und Sprache der Lehrerinnen und der Lehrer untereinander, der Schülerinnen und der Schüler untereinander, der Lehrenden zu den Lernenden? Wird »atmosphärisch« auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingegangen? Umgang mit Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten?
Stellung des RUs und der Lehrerinnen und Lehrer an der Schule?
Kontakte zu den Eltern bzw. zu den Erziehungsberechtigten?
Schulorganisation und Schulrecht?
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, mit Geräten und Klassensätzen, mit ...?
Arbeits- und Sozialformen, die durch Mobiliar usw. möglich und eingeübt sind, und andere, die verhindert werden?
Außerschulische Beanspruchung der Schülerinnen und Schüler durch die Schule?
Außerunterrichtliche Angebote der Schule?
...
Behinderungen und Ermöglichungen für Unterrichtsvorhaben, die durch die »Arbeitsplatzanalyse« deutlich werden?
2.1.1.2 Sozialisationstheorie
Soziologen gehen von einem umfassenden, den Erziehungsbegriff integrierenden Sozialisationsverständnis aus:
»S(ozialisation) ist ein Prozess, der das ganze Leben hindurch andauert. Während
primäre
S. die Entwicklung zur sozialen Person bezeichnet – Ergebnis ist der in der gegebenen Gesellschaft sozial handlungsfähige Mensch –, werden unter
sekundäre
S. alle Vorgänge gefasst, die auf der Basis der primären S. die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen verändern, wobei es in der Phase des Heranwachsens schwierig ist, sekundäre von primärer S. zu trennen.
Erziehung
als Unterbegriff von S. bezeichnet alle Vorgänge, bei denen bewusst ein Handeln mit dem Ziel in Gang gesetzt wird, die Persönlichkeitsentwicklung positiv zu beeinflussen, d.h. bestimmte Verhaltensdispositionen zu entwickeln oder vorhandene zu verändern.«
5
»Der Begriff der Sozialisation ist also weiter gefasst und schließt vom Selbstverständnis der Sozialisationsforschung her den der Erziehung ein. Die Bedeutung der Sozialisationsforschung für die
Pädagogik
ist vor allem darin zu sehen, dass sie das empirische und theoretische Wissen über die Bedingungen menschlicher Entwicklung und Bildung wesentlich erweitert, und zwar auch in einer Weise, die die Pädagogik zu einer kritischen Revision mancher ihrer bisherigen Annahmen genötigt hat. Pädagogik lässt sich in ihrer spezifischen Aufgabenstellung jedoch nicht auf Sozialisationstheorie reduzieren.«
6
Die Sozialisationstheorie ist nicht auf das Verhältnis zwischen Erziehern und zu Erziehenden fokussiert, sondern setzt von vornherein weiter an und begreift Lehren und Lernen als einen in institutionelle und gesellschaftliche Zusammenhänge eingebetteten Prozess, der immer zugleich intentionale und nicht-intendierte Anteile hat. Bestimmte Absichten der