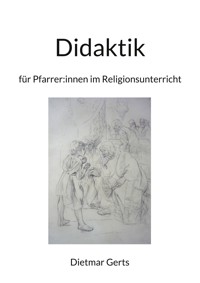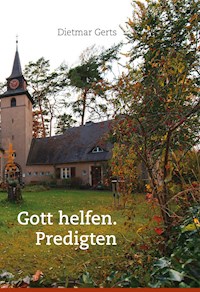
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Fünfzig Predigten verknüpfen die Bibel mit Romanauszügen, Erzählungen, Gedichten, Gemälden und Nachrichten und werben um Glaube und Hoffnung in einer zerrissenen und fragmentierten Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Andreas, Beatrix und Christina.
INHALT
Vorwort
Was hat Gott mit mir vor?
Unorthodox
Du lässt mich genesen
In seinem Wort mein Glück
Der Engel mit dem freien Wunsch
Dein Gott hat Humor
Der untere Weg
Fragen lieben lernen
Deine Güte ist besser denn Leben
Kampf und Kontemplation
Das Kreuz trägt mich
cum grano salis
Hilf meinem Unglauben!
Christus – sozusagen privat
Gott helfen, dass er uns nicht verlässt
Engeltage
Der Segnende Christus ringt um uns
Ich kann Barmherzigkeit
Dämonen vertreiben
An jenem Abend war ich Gott
Dem Geist Christi Gestalt geben
Das Herz aller Dinge
Der Himmel ist
kein
Taschenspieler
Gott erinnert sich
Das Jetzt ist der Mantel Gottes
Liebe hat seit Emmaus einen Namen
Der Himmel ist anders
Das erste Zeichen
Das ist dein Platz
Stirb und werde!
Ich habe den Herrn gesehen
Mein Zweifel wird aufgehoben
Die Freude des Rätselbildes
Du bist mein Atem
Dem Glauben gehorsam
Gott vergeben, weil er keine bessere Welt schuf
Das Aas kann schwimmen
Der Charme der Gemeinde
Allein durch Gnade
Alles beginnt mit der Sehnsucht
Nicht viel darüber klügeln!
Ein ander neu, rein Herz kriegen
Denn Christus ist mein Leben
Der Schuldbrief ist getilgt
Das bin ja ich!
Die Kraft in mir
Zutritt erlaubt!
Sunder warumbe
Du meine Seele, schwinge
Vertraut den neuen Wegen
Abbildungen
Kirchenjahr
Bibel und Gesangbuch
Anmerkungen
VORWORT
Die 50 Predigten dieses Sammelbandes verstehen sich als Einladung zum Diskurs über den christlichen Glauben in einer zerrissenen und fragmentierten Welt. Was können wir angesichts des Klimawandels und seiner furchtbaren Folgen, in Anbetracht einer weltweiten Pandemie mit inzwischen über sechs Millionen Toten und unter Berücksichtigung der aktuellen atomaren Bedrohung glauben und hoffen? Was lässt sich sagen, wenn uns das Entsetzen über Leid und Lügen lähmt und uns die Lippen verschließt? Wie lassen sich biblische Verheißungen und unsere desolate Lebenswirklichkeit miteinander versprechen (nach Ernst Lange)?
Die Predigten sind in der Reihenfolge der Predigttexte zusammengestellt. Die meisten Beispiele zeichnen sich durch ein Gespräch von Bibel und Dichtung1 und von Bibel und Malerei aus. Das gedankliche Experimentieren der Dichterinnen und Dichter, Künstlerinnen und Künstler mit der Bibel gibt eine Ahnung davon, dass das Weltenelend nicht Gottes letztes Wort ist. Es kratzt an den Rändern der Wirklichkeit im Blick auf eine bessere Welt. Dabei geht es nicht um eine neue Offenbarung. Es geht darum, dass die alte Offenbarung immer wieder neu utopische Energien weckt und Grenzen überwinden hilft. Biblisches in der Dichtung ist gedruckt, aber selten druckreif. Biblisches in der Malerei ist fixiert, aber meistens durchsichtig. Biblisches in Dichtung und Malerei ist manchmal fromm, aber fast nie rechtgläubig; es ist ab und an areligiös, aber selten gottlos; es ist immer fiktiv, aber nie unwahr. Gerade das Unabgeschlossene, das Fragmentarische und das Experimentelle machen das Gespräch zwischen Bibel und Dichtung und zwischen Bibel und Malerei so lohnend.2
Alle Predigten sind in der Evangelischen Kirchengemeinde Konradshöhe-Tegelort gehalten worden. Konradshöhe und Tegelort sind benachbarte Ortsteile im Bezirk Reinickendorf von Berlin und liegen am Tegeler Forst, an der Havel und am Tegeler See. Die ungleiche Verteilung der Predigten auf die Sonntage des Kirchenjahres ist dem Umstand geschuldet, dass ich als Pfarrer im Ruhestand in der Regel am 2. Sonntag im Monat Gottesdienst halte. Gelegentliche Bezüge auf lokale Besonderheiten oder tagespolitische Ereignisse habe ich nicht entfernt: Die Predigten sind weitgehend so gehalten worden, wie hier dargestellt. Und sie sind in der Gemeinde nach dem Gottesdienst nachbesprochen worden (außer während des Lockdowns). Es ist für mich ein unglaubliches Geschenk, wenn sich etwa die Hälfte der Gottesdienstbesucherinnen und -besucher nach dem Gottesdienst zusammensetzt, erste zustimmende oder widersprechende Assoziationen äußert, Fragen stellt und bespricht, biblische und/oder literarische Motive zu eigenen Erfahrungen in Beziehung setzt und nicht selten definiert, welche Aspekte in einer nächsten Predigt Berücksichtigung finden sollten.
Darüber hinaus wäre ohne die Unterstützung Dritter durch viele Gespräche über die Predigtentwürfe, durch Kommentare und Korrekturlesen das Buch nicht in der vorliegenden Form zustande gekommen. Vielen herzlichen Dank!
Berlin, im Frühjahr 2022, Dietmar Gerts
Psalm 103
20. Sonntag nach Trinitatis
WAS HAT GOTT MIT MIR VOR?
1896 wurde eine Gruppe von Bauern aus der schwedischen Gemeinde Nås in Dalarna von einer religiösen Erweckung ergriffen. Infolge dieser Erweckung wanderte sie nach Jerusalem aus, um sich dort einer amerikanischen Sekte anzuschließen. Die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf (1858-1940) war von diesem Ereignis so berührt, dass sie einen zweibändigen Roman über die Auswanderer schrieb. Die beiden Bände erschienen kurz nacheinander 1901 und 1902 und hatten den schlichten Titel Jerusalem3. Man merkt der Erzählerin ein fassungsloses Erstaunen darüber an, dass Bauern die Kette jahrhunderteralter Erbfolgen zerreißen und ihren Grund und Boden, ihre Häuser und Höfe und fast ihr gesamtes Hab und Gut verkaufen, um sich mit leichtem Gepäck auf den Weg nach Jerusalem zu machen. Wie kann man nur die wunderschöne schwedische Heimat einfach so hinter sich lassen? Aber Selma Lagerlöf ist klug und fair und geht den Motiven der Auswanderer sorgsam nach. In kaum einem anderen Roman der Weltliteratur begegnet uns eine derart intensive Auseinandersetzung der Protagonisten mit der Frage, was Gott mit ihnen vorhat, wie in Jerusalem.
»Was hat Gott mit mir vor?« Die Frage setzt voraus, dass es für das Denken und Handeln des Menschen einen Bezugspunkt außerhalb seiner selbst gibt, etwas oder jemand, das bzw. der größer ist als man selbst. Dieses »Außerhalb von uns«, lat. »extra nos«, hat einen Willen, ja, vielleicht sogar einen Plan, an dem sich der Mensch nicht nur orientiert, sondern der für ihn bindend ist. »Was hat Gott mit mir vor?« Die Frage setzt auch voraus, dass die oder der Fragende eine Zukunft hat, dass nicht alles schon determiniert, festgelegt, gelaufen ist, sondern dass die Zukunft offen ist. Kann man dann als Ältere oder als Älterer überhaupt noch so fragen oder ist »Was hat Gott mit mir vor?« nicht in erster Linie eine Frage Jüngerer, die das Leben noch vor sich haben?
Der Psalm 103, den wir gerade miteinander gebetet haben, ist ein Rückblick auf ein bewegtes Leben. Er setzt im ersten Teil mit einem Selbstgespräch des Ichs ein, überführt das Ich im zweiten Teil in ein Wir und mündet in einem dritten Teil in einer Anrufung der Engel.
Das Ich wird präzisiert: »meine Seele«. Johann Gramanns Nachdichtung des Psalms 103, die wir unter der Nummer 289 im Gesangbuch haben, paraphrasiert wie in einer Liebesbeziehung »o Herze mein«. Das Ich spricht also gleichsam liebkosend mit sich selbst und erinnert sich. Um diese Erinnerung nachzuempfinden, kann man sich prima an den Verben entlanghangeln, die im ersten Teil des Psalms 103 benutzt werden: Ich und Gott, das ist »vergeben«, »heilen«, »erlösen«, »krönen« und »erbarmen«. Das sind jetzt nur Beispiele. Sie werden weitere Verben entdecken. Aber schon die fünf Exempel lassen das Erstaunen nachvollziehen, das der Beter angesichts seiner Lebenserfahrung mit dem Zitat eines älteren Psalmwortes bündelt: »Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.« (V. 8)
Doch nicht genug damit: Der Beter überführt das Ich – also »meine Seele« und »o Herze mein« – in ein Wir, wobei es ihm offensichtlich vor allem darum geht, den unendlichen qualitativen Unterschied zwischen Mensch und Gott, zwischen dem eigenen Standort und dem »Fluchtpunkt«, zwischen dem Wir und dem »Extra nos« herauszustellen. »Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da« (V. 15 f.) versus »Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit« (V. 17). Der Mensch ist nichts; Gott ist alles. Spätestens am Grabe eines geliebten Menschen empfinden wir die absolute und letztlich trostlose Wahrheit dieser Gedanken. Dann fällt es unglaublich schwer, jene Resilienz auszubilden, von der Trostspenderinnen und -spender sprechen, also jene psychische Widerstandskraft, die einem hilft, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Wir sind Staub.
Daran ändern auch die Engel nichts, die sich der Beter des Psalms 103 schlussendlich zur Hilfe ruft. Die Heerscharen des Himmels werden als Garanten des Wortes Gottes auf Erden eingeführt. Was garantieren sie? Der Blick überfliegt noch einmal den Psalm und stößt auf einen Vers, der nicht erinnerungsschwer rückwärtsgewandt ist, sondern nach vorne weist: Der Psalm lobt IHN, »der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein Adler« (V. 5). »Wieder jung werden« – was für eine Verbkonstruktion! »Wie ein Adler« – was für ein Vergleich! Der Adler, so heißt es in einem mythologischen Lexikon, »verliere mit zunehmendem Alter das Augenlicht. Deshalb fliege er in die Nähe der Sonne, die den Schleier versenge, welcher ihm die Sicht trübe. Anschließend stürze er sich in ein Gewässer und tauche vollkommen erneuert daraus hervor.«4 Was bedeutet die Metapher? »Der Dichter«, so ist in einem alten, ehrwürdigen Kommentar zum Vers 5 unseres Psalms zu lesen, »der Dichter sieht die Möglichkeiten des Lebens vor sich liegen wie an einem Sonnentag in jungen Jahren; er darf es an sich selber erkennen, dass es immer Neuanfang bedeutet, wenn Gott in eines Menschen Leben tritt«5.
»Was hat Gott mit mir vor?« ist somit die Frage der Gottesbegegnung, sei es
beim Besuch eines Gottesdienstes,
beim Erleben einer Theateraufführung,
beim Lesen der Bibel,
beim Vernehmen eines Gedichtes,
beim Hören einer Predigt,
beim Lauschen auf einen Vortrag,
beim Singen eines Gesangbuchliedes,
beim Mitsummen eines Popsongs,
bei einer mystischen Versenkung,
bei einem Waldspaziergang und ...
bei der Begegnung mit einer oder einem Dritten.
Ich habe bei meinen Beispielen bewusst Geistliches und Weltliches gemischt: Gott begegnet dem Menschen, wo und wann er will. Er hält sich weder an spirituelle Regeln noch an fromme Erwartungen und schon gar nicht an bestimmte Lebensalter. Was also hat Gott mit mir vor?
Selma Lagerlöf erzählt von Gertrud. Gertrud hat großen Kummer: Ihr Liebster hat sie wegen einer Frau verlassen, die er zwar nicht liebt, die aber im Gegensatz zu Gertrud vermögend ist und ihm garantiert, den elterlichen Hof zurückkaufen zu können. Eines Tages ist Gertrud im Wald unterwegs und kommt an den schwarzen Bach, von dem man sich sonderbare Dinge erzählt. Ihr wird ganz bange. Doch ...
»Während Gertrud nun in der Mitte des Baches stand, sah sie auf der anderen Seite, drüben in der Tiefe des Waldes, sich etwas bewegen. [...] Es war ein einsamer Mann, der langsam auf die Wiese hinausgegangen kam.
Er war groß und jung und trug ein langes schwarzes Gewand, das ihm fast bis zu den Füßen reichte. Sein Gesicht war länglich und sehr schön, das Haupt war unbedeckt und die Haare hingen ihm in langen, dunklen Locken über die Schulter.
Der Fremde ging geradeswegs auf Gertrud zu. Seine Augen waren groß und strahlend, als entströme ihnen Licht, und als sein Blick auf Gertrud fiel, fühlte sie, dass er all ihren Kummer lesen konnte. Und sie sah, dass er Mitleid mit ihr hatte, deren Herz so erfüllt war von Angst um irdische Dinge, und deren Seele besudelt war von Rachlust und übersät von den Disteln und den Giftblumen des Kummers.
Als sein Blick Gertrud traf, fühlte sie sich durchströmt von Frieden und Seligkeit und sanfter, stiller Ruhe. Und als er an ihr vorübergegangen war, da war da nichts mehr von all ihrem Kummer und all ihrer Bitterkeit zurückgeblieben, alles Böse verschwand wie bei einer Krankheit, die geheilt war und Gesundheit und Stärke hinterlassen hatte.
Gertrud stand lange still.«6
Die moderne Leserin und der moderne Leser sind amüsiert: Unglaublich! Gleichwohl ist die Begegnung für Gertrud das Schlüsselerlebnis für ihren Entschluss, sich den Auswanderern nach Jerusalem anzuschließen.
Die nüchterne Analyse will die Begebenheit erden: Einer Frau in einer schrecklichen seelischen Verfassung begegnet ein Mann mit einem ungewöhnlichen Habitus. Er schaut sie empathisch an. Die Frau fühlt sich von ihrer seelischen Last befreit. Sie wagt einen Neuanfang in ihrem Leben.
Gleichwohl liegt eine solche Erfahrung biblischem Denken doch nicht fern: Hat uns Christus nicht darauf eingestimmt, dass er uns jederzeit im Hungrigen oder im Durstigen, im Nackten oder im Kranken, im Gefangenen oder im Fremdling begegnen kann? Die Begegnung mit dem Heiligen erfolgt nicht nur an besonderen, geheimnisvollen Orten wie an einem »schwarzen Bach«, sondern gänzlich unerwartet »wo und wann Gott will«7.
Was hat Gott mit mir vor? Für mich ist es die Kernkompetenz einer gläubigen Christin und eines gläubigen Christen, für diese Frage offen zu sein, welche Verhältnisse oder welche Bedingungen, welches Leid oder welcher Kummer, welche Stimmungen oder welche Gefühle sie oder ihn auch immer drücken mögen. So werden Münder fröhlich und sie oder er »wieder jung wie ein Adler«.
Jesaja 6,1-8
Trinitatis
UNORTHODOX
Jesaja, das prophetische Ich der Erzählung, die wir gerade gehört haben, – Jesaja mutet uns, seinen Hörerinnen und Hörern, seinen Leserinnen und Lesern, ein unglaubliches Bild zu. »Unglaublich« hat hier nicht nur die Bedeutung eines erstaunten Ausrufs, sondern ist wörtlich zu begreifen als: »Das glaube ich nicht!« Wer kann einem das verdenken, wenn von einem Thron erzählt wird, auf dem kein Geringerer als Gott selbst sitzt, und von Engeln mit sechs Flügeln, die den Thronenden ununterbrochen loben? Kann man sich die Heiligkeit Gottes so vorstellen? Eine ganze Reihe von Malern – selbst zeitgenössische – haben sich von den begründeten Zweifeln nicht abschrecken lassen, sondern das Geschilderte in Szene gesetzt. Von ihm geht also eine gewisse Faszination aus, die die Skepsis überdauert. Der Erzähler selbst gliedert, was er schildert, mit den Verben: hören, reden und sehen.
ich hörte
»Heilig, heilig, heilig«, hört der Prophet die Serafim rufen – einer zum anderen. Das Rufen erfüllt den himmlischen Tempel wie ein cantus firmus. Übrigens hat das Sanctus zu Beginn unserer Abendmahlsliturgie hier seinen Ursprung: »Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth, voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.« (EG 185,1) Doch der cantus firmus wird von einem gewaltigen Kontrapunkt unterbrochen. Gott selbst erhebt seine Stimme: »Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?« (V. 8b.8c)
ich sprach
»Hier bin ich, sende mich!« (V. 8e) – Jesaja antwortet auf die Frage Gottes und stellt sich als Bote zur Verfügung. Klar, was denn sonst? Die Erzählung ist in der Lutherbibel mit »Jesajas Berufung zum Propheten« überschrieben. Sie muss darauf hinauslaufen, dass das prophetische Ich zu Gebote steht. Diese Durchschaubarkeit ist für uns eine Falle: Etliche Auslegungen habe ich eingesehen, die das »Hier bin ich, sende mich!« aufgreifen und es eins zu eins weitergeben wollen an heutige Predigthörerinnen und Predigthörer. Aber, liebe Gemeinde, ich sag’s mal in der Ichform: Ich bin nicht Jesaja. Jesaja ist nicht mein Kumpel, mit dem ich auf Augenhöhe stehe. Jesaja ist der Prophet, der im Todesjahr des Königs Usija berufen worden ist. Ich bin einer unter vielen Christen 2755 Jahre später. Der zeitliche Abstand unterstreicht die qualitative Differenz: Jesaja hat Gott gesehen. Darauf erscheint nur eine Reaktion angemessen: »Weh mir, ich vergehe!« (V. 5b) Jesaja begegnet dem Heiligen und … erschrickt abgrundtief. Ich glaube, dass sich diese Erfahrung von dem frommen Schauder, der mir manchmal über den Rücken läuft, unterscheidet. Jesaja erfährt, dass Gott kein Kuschel- und Schmusegott ist. Gott ist Liebe. Aber Gott ist nicht der »liebe Gott«, den wir heutzutage gerne beschwören. »Weh mir, ich vergehe!« ist Ausdruck der Selbstauflösung des prophetischen Ichs im Angesicht Gottes. Nur Gott kann ihr Einhalt gebieten: »Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei.« (V. 6) Die glühende Kohle vom Altar des himmlischen Tempels verweist für uns Christinnen und Christen auf das Leiden und Sterben Jesu Christi: Nur der mit Gott versöhnte Mensch kann durch die Horizonte von Welt und Gegenwart die Zukunft Gottes sehen.
ich sah …
Jesaja sieht Gott, den Vater, Gott, den Sohn, und Gott, den Heiligen Geist. Wenn wir als Christinnen und Christen seinen Visionen nachgehen, behalten wir freilich im Sinn, dass wir uns damit auf die Schultern des Judentums stellen. Der Vater hat seine Versprechen für Israel nicht zurückgenommen. Der Sohn hat sie nicht einfach ein- und damit abgelöst. Der Geist ist Juden und Christen um alle Verheißungen, an die wir uns erinnern, voraus.
… den Vater
»Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: ›Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! […]‹ Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. […] Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.« (Jes 35,3-10 i.A.)
Ist Gott gegenwärtig,
sind Hände stark, Knie fest und Herzen unverzagt,
werden Augen sehen, Ohren hören, Beine springen und Zungen reden,
wird die Fauna gedeihen und die Flora blühen,
werden Natur und Kultur miteinander im Reinen sein,
werden die Erlösten auf »heiligen Wegen« zum Zion strömen.
Jesaja sieht durch die Horizonte von Welt und Gegenwart eine intakte Schöpfung.
… den Sohn
»Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn daher geht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. […]« (Jes 9,1-6 i.A.)
Wie konkret die Friedenshoffnung ist, die an die Geburt des Kindes geknüpft ist! Ich weiß ja nicht, wie fröhlich man ist, wenn Beute ausgeteilt wird. (Ist diese Vorstellung die religionsgeschichtliche Wurzel der Weihnachtsgeschenke?) Aber wie es sich anfühlen muss, wenn Jochstangen und Antreiber-Stecken zerbrochen werden, kann ich mir gut vorstellen. Zwar haben beide Metaphern für mich Gott sei Dank keine Gestalt mehr, gegen die ich mit anderen »Wir sind das Volk!« skandieren müsste. Aber von Bedrückung und Getrieben-Werden durch Dritte weiß ich dennoch ein Lied zu singen. Jesaja sieht durch die Horizonte seiner Gegenwart eine Welt, aus der Marschstiefel und Militärmäntel verbannt sind – auch im übertragenen Sinne.
… den Heiligen Geist
»Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. […] Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt.« (Jes 11,1-9 i.A.)
Die Wirkung des Geistes Gottes ist unglaublich: Sie stellt alles, was wir von dieser Welt und ihren Zusammenhängen wissen, auf den Kopf. Sie widerstrebt aller Lebenserfahrung, auf die wir uns manchmal doch etwas einbilden. Sie stellt die Schöpfung nicht nur wieder her; sie kreiert etwas ganz Neues – eine neue Erde und einen neuen Himmel. Jesaja sieht durch den Horizont seiner Gegenwart eine neue Welt: Morgen wird sein, was noch niemals war.
Was machen wir mit den wunderschönen Visionen Jesajas? Ich erlaube mir einen kleinen gedanklichen Ausflug: Sie ist jetzt 31 Jahre alt und lebt mit ihrem Sohn als freie Schriftstellerin in Berlin. In ihrem autobiografischen Debütroman mit dem Titel Unorthodox beschreibt sie ihre Kindheit und Jugend in einer jüdischen Glaubensgemeinschaft im New Yorker Stadtteil Williamsburg.8 Im Klappentext des Buches heißt es: »In der chassidischen Satmar Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Die Satmarer, wie sie sich seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg nennen, sehen im Holocaust eine von Gott verhängte Strafe. Um eine Wiederholung der Shoa zu vermeiden, führen sie ein abgeschirmtes Leben nach strengen Vorschriften. Sexualität ist ein Tabu, Ehen werden arrangiert, im Alltag wird Jiddisch gesprochen. Nach Schätzungen zählt die Gemeinde heute 120.000 Mitglieder, denen sie ein Netz an Sicherheit gewährt – ohne jegliche Freiheit.«9
Deborah Feldman hat sich Schritt für Schritt aus dieser Umgebung gelöst. Natürlich gerät sie dabei mit dem Glauben an Gott in Konflikt. Sie schreibt: »Ich beginne mich zu fragen, ob ich dabei bin, Atheistin zu werden. Ich habe einst an Gott geglaubt, dann habe ich zwar an ihn geglaubt, ihn aber zugleich verachtet, und jetzt frage ich mich, ob dies alles nur Zufall ist und letztlich keine Rolle spielt. Immerhin existieren da draußen all diese Leute, die keine Chassidim sind, die einfach ihr Leben leben, und die werden von niemandem bestraft.«10
Wir ahnen, wie schmerzlich der Ablöseprozess für Frau Feldman ist. Es kostet etwas, z.B.
getrost zu sein und sich nicht mehr zu fürchten (Jesajas 1. Vision),
den Stecken des Treibers zu zerbrechen (Jesajas 2. Vision),
dem Geist des Verstandes zu folgen (Jesajas 3. Vision).
Nein, Deborah Feldman ist darüber nicht zur Atheistin geworden. Gegen Ende ihrer Erzählung formuliert sie, wenn auch etwas vage: »Kann einer ohne Glauben, ganz gleich welcher Richtung, überleben? Wie auch immer man sein Leben lebt, man braucht scheinbar einen Glauben, um durchzukommen, um vorwärtszukommen.«11
Diese autobiografische Erzählung hat meines Erachtens exemplarischen Charakter. Welche Religion, welche Philosophie, welche Ideologie, welche Sitte, welche Gewohnheit auch immer den Menschen, egal ob Mann oder Frau, knechten, einengen oder bevormunden will, die Verwirklichung der Visionen Jesajas beginnt mit Deborah Feldmans Appell am Ende ihrer Erzählung: »Wenn irgendwer jemals versuchen sollte, Dir vorzuschreiben, etwas zu sein, was Du nicht bist, dann hoffe ich, dass auch Du den Mut findest, lautstark dagegen anzugehen.«12 – Damit beende ich den kleinen Gedankenausflug und komme noch einmal kurz auf Jesajas Visionen zurück.
»Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie!« (Jes 35,3; Jesajas 1. Vision) Ist es meins, mit Gott und seiner Zukunft zu rechnen, habe ich in einer missmutigen und larmoyanten Welt viel zu tun und zu sagen, um Zuversicht zu wecken.
»Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht.« (Jes 9,1a; Jesajas 2. Vision) Bin ich Christin oder Christ, glaube ich also an Jesus Christus, stehe ich angesichts der »Trumpisierung« (Siegmar Gabriel) unseres Lebens immer wieder neu für Jesu Liebesbotschaft ein.
»Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn wie Wasser das Meer bedeckt.« (Jes 11,9b; Jesajas 3. Vision) Bin ich SEINES Geistes Kind, bleibe ich nicht allein, weder in dieser noch in der künftigen Welt.
Jesaja 38,9-20
19. Sonntag nach Trinitatis
DU LÄSST MICH GENESEN
Hiskia, der Verfasser dieses Psalms, lebte von 750 bis 696 v. Chr. Er wurde mit 25 Jahren König von Jerusalem und regierte bis zu seinem Lebensende mit 54 Jahren. Während die Berichte über seine Politik gegenüber den herrschenden Assyrern, seine Arrangements, aber auch seine Aufstände, seine Reformen und seine Bautätigkeiten dicke Bücher füllen und Generationen von Bibel- und Religionswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern beschäftigen, erfahren wir nichts über die lebensbedrohliche Krankheit, die ihn – folgen wir einem bestimmten Hinweis (2Kön 20,6) – im Alter von 39 Jahren traf. Die Autoren des 1. und 2. Buches der Könige und des 1. und 2. Buches der Chronik, die ansonsten nicht müde werden, über Hiskia zu berichten und ihn zu loben, weil er ihrer Meinung nach alles richtig gemacht hat, haben offensichtlich kein Interesse, seine Krankheit und seine Genesung zu erwähnen. Das ist eine erstaunliche Kultur des Verschweigens, schonen dieselben Schriftsteller ihre Könige doch nicht, wenn es um deren menschliche Schwächen geht, wie die Erzählungen über Saul oder David zeigen. Um so dankbarer können wir sein, dass der Prophet Jesaja das Selbstzeugnis Hiskias aufbewahrt hat und uns mit dessen Psalm eine Innensicht vor Augen stellt. Diese Innensicht erfolgt meistens in der Perspektive eines auktorialen, allwissenden Erzählers.
Hiskia erzählt erst einmal, wie es ihm auf dem Höhepunkt der Krankheit ging und wie er sich verhielt:
»bis zum Morgen schreie ich um Hilfe« (V. 13a);
»meine Augen sehen verlangend nach oben« (V. 14b);
»ich leide Not« (V. 14c);
»entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis der Seele« (V. 15b);
»um Trost war mir sehr bange« (V. 17a);
bis hin zur Ratlosigkeit: »Was soll ich reden und was ihm sagen?« (V. 15 a).
Die Sprachlosigkeit führt Hiskia zu zwei ungewöhnlichen Vergleichen für sein Verhalten in der Not, die ich nicht deuten kann. Ich setze auf Ihre Fantasie im Nachgespräch:
»ich zwitschere wie eine Schwalbe« (V. 14a);
ich »gurre wie eine Taube« (V. 14b).
Demgegenüber findet Hiskia zahlreiche nachvollziehbare Metaphern für die Lebensbedrohung, der er sich ausgesetzt sah:
»zu des Totenreiches Pforten bin ich befohlen« (V. 10b);
»nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn« (V. 11b);
»Meine Hütte ist abgebrochen« (V. 12a);
»er schneidet mich ab vom Faden« (V. 12c);
»er zerbricht mir alle meine Knochen« (V. 13b);
»Tag und Nacht gibst du mich preis« (V. 12d und 13c).
Doch Hiskia ist genesen, genesen in der ursprünglichen Bedeutung des mittelhochdeutschen Wortes: Er überlebt. Nun darf er …
loben – »denn die Toten loben dich nicht« (V. 18a);
rühmen – »der Tod rühmt dich nicht« (V. 18b);
hoffen – »die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue« (V. 18c);
»singen und spielen« (V. 20b).
An einigen Stellen verlässt Hiskia die Perspektive des auktorialen, allwissenden Erzählers zugunsten von Gebetssätzen mit einer direkten Anrede Gottes. Das sind die stärksten Sätze des Psalms. Jahwe (= »der Herr«) verwandelt sich in den himmlischen Vater, dem sich Hiskia auch sprachlich gleichsam in die Arme geworfen hat und wirft:
»du lässt mich genesen und am Leben bleiben« (V. 16b);
»du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen« (V. 17b);
»du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück« (V. 17c);
»allein, die da leben, loben dich so wie ich heute« (V. 19a).
Die Geschichte einer Genesung erzählt auch die deutsche Schriftstellerin Kathrin Schmidt (*1958) in ihrem Roman Du stirbst nicht.13 Helene Wesendahl, 44 Jahre alt, ebenfalls Schriftstellerin, erwacht zwei Wochen nach einer Hirnblutung aus dem künstlichen Koma. Ein Hirnaneurysma, eine Arterienerweiterung im Gehirn, war geplatzt. Helene wurde zweimal operiert und anschließend in einen Tiefschlaf versetzt. Als sie wieder aufwacht, kann sie sich weder bewegen noch bemerkbar machen. Doch sie kann hören, was andere sprechen.
»Es klopft. ›Ihr Mann kommt, Frau Wesendahl.‹ Wesendahl … Ihr Mann kommt. Heißt er auch Wesendahl? Ehe sie darüber nachdenken kann, macht ihr Mann einen Schritt zum Waschbecken hin. Er zieht ein Pflaster ab und nimmt einen Verband vom rechten Auge. Nanu, was hat er denn? Sie würde ihn schon gerne fragen, wirklich. Als er ans Bett tritt, weint er. Hat sie etwa ein Kind bekommen? Das letzte Mal sah sie ihn weinen, als ihre jüngste Tochter geboren wurde. Das ist jetzt fünf Jahre her, und er stand genauso an ihrem Bett wie jetzt. Sie schaut vorsichtshalber nach, ob sie ein Kindsbündel an der Brust hat. Nein.«14
Nach einer Woche wird Helene in ein normales Krankenzimmer verlegt. Allmählich stellt sich die Erinnerung wieder ein. Mühsam rekonstruiert sie ihre Vergangenheit. Nach und nach wird sie sich ihrer Situation bewusst. Helene beginnt wieder zu sprechen. Manchmal fehlen ihr allerdings die Worte. Oder sie verwechselt Begriffe, sagt z.B. »Sand«, wenn sie »Quark« meint. Doch sie gibt nicht auf. »Silbe für Silbe, Satz für Satz sucht […] [Helene] nach ihrer verlorenen Sprache, ihrem verlorenen Gedächtnis. Mal lakonisch, mal spöttisch, mal unheimlich schildert der Roman die Innenwelt der Kranken und lässt daraus mit großer Sprachkraft die Geschichte ihrer Familie, ihrer Ehe und einer nicht vorgesehenen, unerhörten Liebe herauswachsen.«15Du stirbst nicht ist eine »Geschichte von der Wiedergewinnung der Welt«16 nach deren totalem Verlust.
Nach mehreren Wochen kann Helene sich mithilfe eines Rollstuhls frei auf dem Krankenhausgelände bewegen. Sie sucht die Krankenhauskirche auf und amüsiert sich über dessen naives Himmelchen mit Sternen. Dann heißt es: »Als sie aus der Kirche rollt, sieht sie Pfarrer Wittusch. Er kommt die Allee entlang, langsam, zu Fuß. Seine Ärmel flattern wie Fledermausflügel. Scheint nachzudenken? Erkennt sie nicht, natürlich. Woher kennt sie ihn? Ach ja: Gleich nachdem sie ihre erste Wohnung bezogen hatten, ein Dreivierteljahr nach der Hochzeit, Lissy war schon sechs Monate alt, besuchte er sie. Er war auf der Suche nach Kirchenmitgliedern, die sich in den eben aus dem Boden gestampften Plattenbauten hatten ansiedeln lassen. Sie luden ihn zu Tee und Gespräch, das war viel damals für einen wie ihn, der an der Mehrzahl der Türen abgewiesen wurde. Ihr fiel ein, dass sie getauft worden war, weil ihre christlichen Großeltern damals noch lebten und nicht vor den Kopf gestoßen werden durften. Diese Tatsache floss wie ein stilles Band um Wittusch und sie, während Matthes seinen atheistischen Zuschnitt deutlich herausstrich. Trotzdem hatten sich die Männer etwas zu sagen, glaubt sie sich zu erinnern. Sie sieht Wittusch lachend am Tisch in der Diele sitzen. Als er ging, war er froh, an diesem Tag doch noch irgendwo eingelassen worden zu sein. ›Gott … hörst du mich?‹«17
Hiskia und Helene – zwei sehr unterschiedliche Genesungsgeschichten. Hiskias Geschichte zeichnet sich durch Gottvertrauen aus. Er sagt: »Allein, die da leben, loben dich so wie ich heute.« (V. 19a) Helenes Geschichte berührt letzte Fragen. Sie denkt: »Was hat Gott vor, der das Unerforschliche so nahe neben das Offensichtliche packt, dass es kaum auseinanderzuhalten ist?«18 Und doch gibt es einen gemeinsamen Nenner, eine Schnittmenge dieser beiden Erzählungen: Beiden, Hiskia und Helene, verschlägt es die Sprache. Doch sie brechen aus dieser Einzelhaft aus. Sie überwinden die Sprachlosigkeit. Sie geben ihren Dämonen Namen. Sie finden Wörter für ihre Gefühle. Sie benennen ihren Schmerz. Sie gewinnen ihre Identität durch treffenden Ausdruck zurück. Dabei machen sie Privates öffentlich.
Obwohl wir uns dabei auf dünnem Eis bewegen, sei es erlaubt anzumerken: Ist es nicht eine Fehlentwicklung in unserer Gesellschaft, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gefragt werden dürfen, ob sie geimpft sind, um das Leben derer zu schützen, die nicht geimpft werden können? Ist es nicht eine Aporie, eine Ausweglosigkeit, wenn jemand, der wegen Depressionen eine Therapie macht, diese Tatsache an ihrem oder seinem Arbeitsplatz verschweigen muss, um ihr oder sein Ansehen nicht zu gefährden? Stellt es nicht jede Partner- und Freundschaft auf eine harte Probe, wenn wir der Partnerin oder dem Partner, der Freundin oder dem Freund verheimlichen, was uns wirklich bewegt?
Genesung, sei es von einer körperlichen, sei es von einer seelischen Krankheit, braucht Sprache. »Ich sprach«, setzt Hiskia mehrfach an. (Unklar: »Ich zwitschere« und »ich gurre«.) – »Ich habe doch meine Sprache verloren, ich muss doch erst sehen, wie weit sie sich wieder finden lässt«19, nimmt sich Helene vor. Die Sprache scheint für die Betroffenen elementarer Bestandteil ihrer Gesundung zu sein. Ist die Beobachtung richtig, gehört zu einer wirksamen Therapie, dass die oder der Kranke über ihr oder sein Leiden spricht.
Genesung, sei es von einer körperlichen, sei es von einer seelischen Krankheit, braucht Sprache. Subjekt jeder Genesung ist freilich Gott. Helenes Zweifel sind in Hiskias Gebet aufgehoben: »Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe.« (V. 17 a-c) Dabei begegnen uns manchmal Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die kein anderes Thema haben als ihre körperliche und/oder ihre seelische Befindlichkeit. Sie strapazieren uns bis an die Grenzen unserer Geduld, wenn sie uns zum x-ten Mal ihre Leidensgeschichte erzählen. Dann liegt die Versuchung nahe, sich dem zu entziehen. Doch vielleicht hat sie oder er keine andere Möglichkeit, mit ihrer oder seiner Versehrung fertigzuwerden, als zum x-ten Mal darüber zu reden. Unsere Rolle dabei ist eher passiv als aktiv. Es geht ja auch nicht z.B. ums Zurechtrücken, weder ums Korrigieren noch ums Rechthaben. Gehilfinnen oder Gehilfen einer Genesung sind eher Spiegel des Ausdrucks der oder des Genesenden. Im Gleichnis Vom Weltgericht hält Jesus dafür ein wunderschönes Bild bereit: Sie sind die Gesegneten, die die Kranke oder den Kranken besuchen und dabei Christus selbst auf der Spur sind (nach Mt 25,34b.36b).
Jesaja 50,4-9a
Palmarum
IN SEINEM WORT MEIN GLÜCK
»Irgendwann begann sie damit. Sie stand eine halbe Stunde vor dem Regal mit den Strümpfen, ging weg, kam zurück. Dann griff sie zu, Größe und Farbe egal. Sie stopfte die Packung unter den Mantel, zu hastig, die Strümpfe rutschten zu Boden, sie bückte sich, dann los. Ihr Herz raste, Puls im Hals, Flecken auf den Händen. Ihr ganzer Körper war nass, sie spürte die Beine nicht, zitterte, weitergehen, an der Kasse vorbei, einer rempelte sie an. Dann eiskalte Abendluft, Regen. Das Adrenalin überschwemmte sie, sie wollte schreien. Zwei Ecken weiter warf sie die Strümpfe in einen Mülleimer. Sie zog die Schuhe aus, rannte durch den Regen bis nach Hause. Vor ihrer Tür sah sie in den Himmel, das Wasser klatschte auf ihre Stirn, auf ihre Augen, auf ihren Mund. Sie lebte.«20
Die Szene stammt aus Ferdinand von Schirachs (*1964) Buch Schuld. Die Frau, von der der Autor erzählt, hatte es nicht nötig zu stehlen. Sie lebte mit Mann und Kindern in gutsituierten Verhältnissen. Als sie gestellt wurde, hatte sie 845,36 € in bar im Portemonnaie. Der Warenwert des gerade Gestohlenen betrug 12,99 €. Warum um alles in der Welt stiehlt die Frau? Sie war, von außen betrachtet, keineswegs auf den Diebstahl angewiesen. Unser Verständnis gerät an eine Grenze. Doch es gibt auch eine Innensicht des Vorfalls. Von Schirach deutet sie unmittelbar vor der Schilderung des Diebstahls an.
»Allmählich verschwand alles, bis sie nur noch eine Hülle war. Die Welt wurde ihr fremd, sie gehörte nicht mehr dazu. Die Kinder lachten, ihr Mann regte sich auf, ihre Freunde diskutierten – nichts berührte sie. Sie war ernst, lachte, weinte, tröstete – alles wie immer und je nach Bedarf. Aber wenn es still wurde, wenn sie anderen Menschen im Café und in der Straßenbahn zusah, dachte sie, es ginge sie nichts mehr an.«21
»Die Welt wurde ihr fremd, sie gehörte nicht mehr dazu.« Wenige Worte genügen, um ein Lebensgefühl anzudeuten, das wir alle kennen: Das Gespür, dass die »gutsituierten Verhältnisse« sinnfrei sind. Das Empfinden, in Anständigkeit, Gewohnheit und Langeweile zu ersticken. Die Ahnung, in einem goldenen Käfig gefangen zu sein. Das sind Lebensgefühle, die Todesahnungen gleichkommen. So erzählt jedenfalls von Schirach die Geschichte seiner Diebin. Doch dann überschreitet sie eine Grenze, die ein Gebot setzt, um sich zu vergewissern, dass sie noch nicht tot ist. Folgerichtig endet die Schilderung des Diebstahls mit zwei Worten, die uns klarmachen wollen, warum sie zur Diebin wird, was dabei innerlich bei ihr gelaufen ist und warum es überhaupt lohnt, sich mit dem doch im Grunde banalen Vorfall überhaupt zu beschäftigen: »Sie lebte.«
Weit davon entfernt, ihre Schuld zu bagatellisieren, würde ich, wenn ich der Frau begegnete, sie doch herzlich in der Gemeinschaft der Schuldigen begrüßen, zu der ich selbst gehöre. Zwar habe ich noch nie im Warenhaus geklaut; das siebte Gebot ist nicht mein Problem. Eher doch schon das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte und das sechste und das achte ... Ach! »Willkommen in der Gemeinschaft der Schuldigen!«, würde ich sagen, »Du bist in guter Gesellschaft.« Und ich würde sie loben, dass sie es nicht bei ihrer Todesahnung belassen hat, sondern einen Schritt auf das Leben zugegangen ist. Doch halt!!!
An dem Gedanken stimmt etwas nicht. Von Schirach erzählt uns den Fall nicht so, als habe die Frau eine Wahl gehabt. Sie ist nicht eines Morgens aufgewacht und sah sich vor die Entscheidung gestellt, in der Todesahnung zu verharren und sauber zu bleiben oder einen Schritt auf das Leben zuzugehen und zu klauen. Vielmehr hat das Leben sie überwältigt. So wie einem schnell mal eine respektlose Bemerkung über Gott über die Lippen kommt. So wie man am Sonntag unversehens einem unheiligen Geschäft nachgehen kann. So wie man im Umgang mit seinen Eltern dann und wann die Fassung verliert und ausrastet. So wie man mancher fiesen Zeitgenossin und manchem widerwärtigen Zeitgenossen die Pest an den Hals wünscht. So wie einen die Liebe überrollt. So wie einen ein Begehren fertigmacht.
Mein Lob für die Grenzüberschreitung ist somit nur die halbe Wahrheit. Martin Luther hatte das Ganze im Blick, als er einmal an Melanchthon schrieb: »Sei ein Sünder und sündige tapfer, aber glaube beherzter und freue dich in Christus.«22
Die Gemeinschaft der Schuldigen ist nicht nur die Gemeinschaft derer, die bewusst Grenzen überschreiten. Sie ist zugleich die Gemeinschaft derer, die sich lebendig fühlen wollen. Sie ist die Gemeinschaft derer, die keine Wahl haben. Sie ist die Gemeinschaft der Überwältigten. Gott selbst hat sich in der Gestalt des unschuldigen Jesus Christus in die Gemeinschaft der Schuldigen begeben.
Gerard van Honthorst, Verspottung Christi, ca. 1617
Der niederländische Maler Gerrit oder Gerard van Honthorst (1592-1656) schuf in der ihm eigenen Vorliebe für Szenen im Kerzen- oder Lampenlicht das Gemälde Verspottung Christi. Wir sehen rechts einen und links vier Männer, die offensichtlich ihren Spaß bei der Demütigung haben. Der Mann rechts hält einen Stab hoch, als wolle er gleich zuschlagen. Der Mann links vorne traktiert den Gequälten mit einer Keule. Die Männer auf Kopfhöhe links neben ihm und ganz links oben grinsen sich eins. Interessant ist die zweite Figur links oben: Mit der linken Hand hält sie die Fackel; doch die rechte Hand wird in die Blickachse geschoben, als blende den Mann das Licht oder … als wolle er nicht sehen, was er beleuchtet. Jedenfalls fällt der Schatten dieser Hand auf das Gesicht des Fackelträgers. Im krassen Gegensatz dazu erscheinen Gesicht und Oberkörper des zusammengesunkenen Geschundenen im hellen Licht der Fackel. Zu dem Gemälde passt:
Lesung von Jesaja 50,4-9a
Deutero-Jesajas Gottesknecht-Lied aus den Jahren 550 bis 540 vor Christus hat nichts mit der Person zu tun, nach der wir unsere Zeit berechnen. Die jüdische Messias-Hoffnung und der christliche Erlöser-Glaube sind grundsätzlich zwei Paar Schuhe. Doch seit dem Kirchenvater Augustin glauben Christinnen und Christen, sie können die jüdischen Schuhe anziehen und mit ihnen in den christlichen Spuren laufen. Es ist – so die Annahme Augustins – in der Hebräischen Bibel verborgen, was im Neuen Testament offenbar wird: Der geschundene Jesus ist der erlösende Christus. Ihm begegnen wir in der Gemeinschaft der Schuldigen.
Dort haben wir dann wirklich die Wahl. Noch einmal Martin Luther: »Die [Schuld]23 hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus [...]. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren; wenn sie aber auf Christus ruhet, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst.«24 Es ist nicht einfach, dem geschundenen Christus auch noch ihre/seine Last aufzubürden. Doch in dem Vorgang hängt das ganze Evangelium: Schulderfahrung, Schuldbewusstsein und Schuldanerkenntnis sind das eine, doch SEIN Wort ist das andere: »Er will, dass ich mich füge. / Ich gehe nicht zurück. / Hab nur in ihm Genüge, / in seinem Wort mein Glück. / Ich werde nicht zuschanden, / wenn ich nur ihn vernehm. / Gott löst mich aus den Banden. / Gott macht mich ihm genehm.« (EG 452,3)
Jesaja 63,19b
2. Advent
DER ENGEL MIT DEM FREIEN WUNSCH
Die Bitte aus dem Predigttext, »Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab« (Jes 63,19b), hat mich zu einer Erzählung angeregt. Dabei folge ich einem Einfall von Erich Kästner (1899-1974).25
»Da bin ich.« Der Mann ließ sich schwer auf die Parkbank neben mir fallen. Er sah aus wie ein Obdachloser. Würde er mich gleich ansprechen?
Ich war wie so oft am Wasser entlang zur Malche gelaufen und legte eine kurze Pause ein, bevor ich mich auf den Rückweg machen wollte. Trotz des grauen Winterwetters konnte ich den Fernmeldeturm auf dem Schäferberg in Wannsee herüberblinken sehen. Sehnsüchtig dachte ich an meinen letzten Spaziergang zu seinen Füßen.