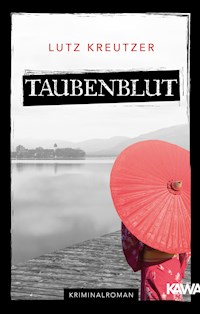0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Abgrund Irrfahrt in die Vergangenheit »Sie haben mich verurteilt, weil ich, Walter Landes, angeblich mich, Walter Landes, heimtückisch getötet habe. Mein Urteil lautet: lebenslänglich.« Ein Mann wird angeklagt, sich selbst heimtückisch ermordet zu haben … "Toll … Psychothriller von Lutz Kreutzer – sehr gut!" (Johannes Zum Winkel, xtme.de: Gute eBooks) Das Leben des Walter Landes ist von Bildung und Wohlstand geprägt. Ein Ereignis stellt alles auf den Kopf: Walters große Liebe Anna verschwindet spurlos, und plötzlich taucht ein Doppelgänger auf. Während einer Odyssee von Deutschland nach Brasilien erkennt er, dass in seinem Leben nichts mehr gilt: Wahrheiten entpuppen sich als Lügen, Sicherheiten als Trugschluss. Schließlich muss er sich einem mächtigen Gegner stellen. Kann er dessen perfiden Plan vereiteln? Schauplätze dieser spannenden Geschichte sind Italien (Rom, Alberobello), Deutschland (Aachen, Köln, Günzburg), Griechenland (Kreta, Karphatos), Brasilien (Londrina, Parana), Kuba und New York. "Rasante Spannung und eine ausgeklügelte Handlung. Lutz Kreutzer hat einen erstaunlich packenden und rasanten Thriller mit einer klaren und präzisen Sprache präsentiert." (Blücher Buch-Blog) "... die Geschichte ist perfekt konzipiert und umgesetzt, der Leserin fallen vor Aufregung manchmal die Augen raus." (Leserin, 5 Sterne) Kaufen Sie jetzt diesen Kriminalroman, der bereits zehntausende Leser(inn)en in seinen Bann zog - Nr.1 der amazon Bestsellerliste Belletristik, Nr. 1 der amazon Bestsellerliste Dramatik im Kindle Shop!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Lutz Kreutzer
Gott würfelt doch - Abgrund (Band 1)
Kriminalroman
Dieses eBook wurde erstellt bei
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch interessieren! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch finden Sie auf tolino-media.de - oder werden Sie selbst eBook-Autor bei tolino media.
- gekürzte Vorschau -
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Teil I: DIE BEGEGNUNG
Teil II: DIE VERSCHMELZUNG
Teil III: DER STURZ
Mehr vom Autor
Impressum tolino
Prolog
Vor sieben Tagen noch verwandelte das Weiß der Wand jeden Gedanken in meinem Kopf zu Schmerz. Nachdem sie mich endgültig eingesperrt hatten, schrie ich die Mauer sechseinhalb Stunden lang an, bis meine Stimme erstarb. Danach schlug ich meine Stirn dreimal dagegen, dorthin, von wo mich jetzt der Blutfleck erbleicht und fahl anstarrt. Nun stiere ich auf das Papier, das vor mir liegt, und ich habe beschlossen, es gleichgültig zu finden, ob ich in dieser Zelle stecke oder irgendwo anders dahinvegetiere. Ich habe inzwischen den Richterspruch akzeptiert, denn selbst wenn ich frei wäre, könnte ich all das, was geschehen ist, nicht mehr ungeschehen machen.
Sie haben mich verurteilt, weil ich, Walter Landes, am 16. Juli 1988, siebenundzwanzigjährig, angeblich mich, Walter Landes, heimtückisch getötet habe. Mein Urteil lautet: lebenslänglich. Sie haben sich - aus meiner Sicht - der Unfähigkeit preisgegeben, denn ich bin der einzige Mensch, der genau weiß, was vorgefallen ist. Menschen besitzen unterschiedliche Wahrheiten, und die meisten begreifen die große Wahrheit niemals; doch es reicht aus, wenn in diesem Fall nur ich der einen Wahrheit gerecht werde, denn sie wird nicht wahrer dadurch, dass mehr Menschen sie kennen; niemand will mir glauben, und ich bin keinem anderen mehr Rechenschaft schuldig.
Jetzt sitze ich auf einem zerkratzten Holzstuhl, an einem kleinen, schäbigen Resopaltisch, einen Bleistift in der Hand, den ich an seinem Ende zerkaut habe, verurteilt als Mörder; ein klares Fehlurteil! Denn wäre dem rechtens, so wäre ich der erste Selbstmörder, der verurteilt wurde.
Ich werde mir nicht die Qual bereiten, das Fehlurteil aufzuklären. Mein Fall scheint so glasklar, dass selbst meine Eltern erwägen, ich wäre mein Mörder. Und ich kann sie alle verstehen, dass sie das glauben. Im Grunde bin ich dankbar dafür, dass jetzt alles zu Ende gegangen ist, denn das Versteckspiel der letzten Jahre hat mich aufgefressen, und meine Seele ist dabei allmählich verbrannt.
Den Platz der Verzweiflung erkämpft sich mehr und mehr die Gleichgültigkeit in meinem Kopf. Ich werde aufschreiben, wie alles geschehen ist, nicht etwa um Recht zu erfahren. Nein, die Justiz interessiert mich nicht mehr, die Justiz ist - faktisch betrachtet - meiner nicht mehr würdig, denn ich habe ein Urteil provoziert, das es gar nicht geben kann und sie daher in die Absurdität geführt. Ich hause in dieser Zelle, vom Staatsanwalt angeprangert, von den Richtern verdammt, von den Menschen verteufelt, von den Medien ausgeweidet und von der Welt durch den Sumpf der Verachtung gezogen. Es ist im Grunde ein Segen für mich, gefangen gehalten zu werden, denn wenn ich wieder nach draußen käme, würde ich die Schmach, die über mich hereinbräche, nicht ertragen können. Und ich schreibe das alles nur deshalb auf, weil ich mir selbst ein Bild malen möchte; ein Bild - so schön, so grausam und so schmerzlich - wie es sich in dem Moment abzuzeichnen begann, als ich ihm zum ersten Mal begegnete.
Teil I: DIE BEGEGNUNG
Während der Jahre zwischen den beiden großen Kriegen lebte die Familie meines Vaters besser als die meisten anderen Menschen in Deutschland. Sie wohnte in Bremen und verdiente ihr Geld mit dem Kaffeehandel.
Bereits als Junge hatte Vater die Welt kennen gelernt, denn Großvater hatte seine Familie auf Geschäftsreisen zu den Hochländern der Anden und in die Städte der Türkei mitgenommen, dorthin, wo die Früchte der besten Kaffeeplantagen zu kaufen waren, und er hatte dies getan, um Deutschland zu entfliehen, wo sich die braune Pest breiter und breiter machte. Großvater habe die Nazis gehasst wie ein Frosch den Stiefel, sagte mir Vater immer wieder, weniger aus politischen Gründen, sondern weil er als Hanseat der Freiheit verpflichtet gewesen sei. Die Nazis hätten von ihm, dem Kaffeehändler, gestrenges Denken verlangt; er habe stets über sie gelacht und betont, Taugenichtse dürften sich nicht erdreisten, herrschen zu wollen.
Vater ging als Student nach Göttingen, studierte dort deutsche Geschichte und Philosophie und sah sich schon bald gezwungen, das Studienfach zu wechseln, weil die Professoren zunehmend begonnen hatten, Denker und Wissenschaftler wie Charles Darwin für die Ideen des neuen Regimes zu missbrauchen.
Vater wechselte also das Studienfach und entschied sich für Medizin. Er ging nach Frankfurt und spezialisierte sich auf Genetik, ohne zu ahnen, welchen Lehrern er seinen Intellekt anvertraute. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs schließlich, im Frühjahr 1945, musste er als junger Arzt an die Ostfront. Der Rückzug der deutschen Wehrmacht benötigte jede Menge Sanitäter und Mediziner, um die zerfetzten Leiber zusammenzuflicken und sie wieder als Kanonenfutter zur Verfügung stellen zu können.
Das Gemetzel und das Schlachten haben ihn wohl niemals mehr losgelassen. Das Leid, die Tränen, die Körper, die er frei von Narkotika zerschneiden musste, und der Tod. Die Granaten, die Einschläge rings um das Feldlazarett, die Risse in den Zeltplanen, wenn sich ein Splitter in den notdürftig eingerichteten Operationssaal verirrte und ein zweites Mal auf einen Verletzten einhackte.
Die Schreie, wenn Beine zerrissen wurden, das Winseln bei aufgeschlitzten Bäuchen und die Verzweiflung der Sanitäter und Ärzte, alles im Namen Deutschlands: von seinen Herren in die Fremde geschickt, verbrannt und verraten.
Vater kam zurück aus dem Krieg als ein anderer Mensch. Hoffnungslos und mit einem Herzen voller Entsetzen und Trauer machte er sich auf die Suche nach seinen Eltern, bemüht, all das, was er gesehen hatte, hinter sich zu lassen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass die Kraft eines Mannes niemals ausreichen würde, diese Epoche der Grausamkeit je vergessen zu können.
Er sah seine Eltern nie wieder. Sein Vater gelte als von der Gestapo verschleppt, seine Mutter sei vor Kummer gestorben, erzählte man ihm. Allein auf der Welt, in einem Deutschland in Trümmern, ging er nach Wien, so wie es viele Wissenschaftler nach dem Rückzug der Deutschen nach Wien verschlug. Als er dem Zug entstiegen und langsam durch die Stadt gegangen sei, habe er angesichts der Trümmer zum ersten Mal seit langem wieder geweint.
Der Stephansdom aber habe - wie wunderbar in dieser Ödnis der Zerstörung - das Inferno der entfesselten Kräfte aus Chemie und Physik überstanden. Vater meldete sich im Allgemeinen Krankenhaus, das von der Kaiserin Maria Theresia im 18. Jahrhundert zum Wohle des Riesenreichs Österreich gegründet worden war. Ausgezehrt und die Müdigkeit in den Augenhöhlen, einen zerlumpten Soldatenmantel über den Schultern, das Hakenkreuz abgerissen und mit einer von Schmutz starrenden Hose über den geborstenen Stiefeln, stand er vor einem Arzt von Autorität, der ihn musterte und an seinem Rangabzeichen mit der Schlange erkannte, dass auch er Arzt war. „Wir brauchen jeden Mann! Nehmen Sie ein Bad und melden Sie sich bei Schwester Rita. Sie wird Sie einkleiden.“
Der Chefarzt schilderte in warmem Tonfall aber knapp die Verzweiflung im Krankenhaus, bot ihm Kost und ein Bett an und verlangte gute und harte Arbeit. Es gebe wenig Medikamente und für Ärzte keine Privilegien, und Kranke seien ebenfalls genug da.
So lief mein Vater meiner Mutter in die Arme. Als sie ihn zum ersten Mal erblickte, wie er geschunden mit herabhängenden Armen und fettigen Haaren vor ihr stand, so erzählte sie mir einmal, habe ihr am meisten an ihm gefallen, dass er in diese Trostlosigkeit den Anflug eines Lächelns gestreut habe; diese Mundwinkel seien es gewesen, die sie trotz des jammervollen Äußeren einen guten Mann habe erkennen lassen.
Aus der Sicht meines Vaters stand eine weiß geschürzte Frau, eine Gestalt wie aus Licht vor ihm. Es war Schwester Rita. Ihre Augen seien so tief gewesen wie der Grund eines Bergsees, eingerahmt von einem rot funkelnden Herbstwald aus Haaren, über dem eine Haube aus gestärktem Stoff den Himmel gebildet habe. Ihr Leuchten sei atemberaubend gewesen; er habe in diesem Moment beschlossen, sich immer in ihrer Nähe wissen zu wollen. „Joi, Sie sehen ja aus!“ So habe sie ihn in ihrem herzerfrischenden ungarischen Akzent begrüßt. „Sie brauchen einen Besen und einen Kübel Schmierseife. Kommen Sie, Sie armer Tropf! Ich zeige Ihnen alles!“, habe sie gelacht. Vater, frei erzogen und nicht prüde wie er war, hängte sich gleich bei ihr ein und atmete einen Hauch ihres frischen Schweißes, dessen Duft irgendwo zwischen warmem Honig und jungen Orangenblüten gelegen habe; das hat er mal voller Heiterkeit gestanden, als beide ihren zwanzigsten Hochzeitstag feierten und er schon das siebte Glas Moselwein verkostet hatte. Mutter entgegnete ihm darauf lächelnd, er habe damals gestunken wie ein Mistkäfer.
Meine Eltern verliebten sich unsterblich ineinander. Vater war der Meinung: Warum sollte er auf eine andere Frau warten, wenn er doch gefühlt habe, der bestmöglichen Frau begegnet zu sein? Sie heirateten am 13. August 1948 und feierten ihre Hochzeit im Kreise von Freunden am Wiener Bisamberg, wo ein Kollege eine Laube mit eigenem Weingarten besaß. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger - und alle seien betrunken gewesen vom Marillenschnaps, den ein Freund meines Vaters in der Wachau brannte.
1950 übersiedelten meine Eltern nach Köln, wo Vater eine viel versprechende Assistentenstelle an der Universität bekommen hatte. Sie zogen in ein schönes kleines Haus in der Nähe des Kölner Stadtparks, und Mutter lernte rasch den Kölner Menschenschlag zu schätzen. Als rotblonde Ungarin besaß sie einen Charme, der ihr stets viele Freunde, aber auch eifersüchtige Rivalinnen bescherte, gegen die sie allerdings immer ein Mittel parat hatte: ihre direkte Art, die Ungereimtheiten des Lebens anzusprechen. „Mein Junge“, hat sie mir später beigebracht, „wenn eine Minute vergangen ist, ist es schon zu spät! Willst du einen Bären erlegen, so triff ihn genau zwischen die Augen!“ Ihr Temperament war sprichwörtlich, und Vater lag ihr zu Füßen. Und nicht nur er.
Deutschland erwachte in den Folgejahren aus seinem Schlaf, zumindest der Westen, sagte mir Vater einmal. Zahlreiche alte Nazis waren zwar wieder in entscheidenden Positionen, aber sie trauten sich längst nicht mehr, Menschen derart zu erniedrigen wie noch ein paar Jahre zuvor. Und so fielen sie nicht auf im Taumel des neuen Glücks, und es wollte auch niemand mehr an jene grauen Zeiten zurückdenken.
Auf Kinder wollten meine Eltern erst einmal verzichten. Sie hatten sich so geliebt, sagte Vater, dass sie noch warten konnten, bis sie wirtschaftlich unabhängiger wären. Erst dann wollten sie Kinder haben. Vater konzentrierte sich also auf seine Karriere als Arzt und Wissenschaftler, Mutter wurde eine leitende Krankenschwester, deren Autorität mehr auf Herzlichkeit gründete als auf Strenge.
Vater trug die Leidenschaft für das Reisen in seiner Natur, eingeimpft von meinem Großvater. Und so zeigte er von dem Geld, das die beiden zur Seite legen konnten, meiner Mutter die Welt. Sie fuhren mit dem Schiff nach New York, mit der Eisenbahn nach Belgrad, flogen nach Kairo und nach London. Sie wanderten durch die Schweiz, fuhren Ski in Österreich und saßen am Wochenende in den Weingärten an Mosel oder Rhein und dachten voller Sehnsucht an den Heurigen in Wien. Sie wurden von ihren Nachbarn und den Kollegen beneidet. Aber meine Eltern kümmerten sich nicht darum, denn sie wollten frei sein.
Nach über zehn Jahren, in denen sie ihre verratene Jugend nachgeholt hatten, stand Mutter an einem sonnigen Morgen mit strahlenden Augen vor Vater, nahm sanft seine rechte Hand und legte sie behutsam auf ihren Bauch. Er sah sie staunend an wie das Universum, Tränen voller Sehnsucht reinigten seinen Blick; dann küsste er sie zärtlich auf die Stirn, und beide spürten, dass ihnen noch weit mehr Glück bevorstünde, als sie es während ihrer gemeinsamen Zeit ohnehin schon erfahren hatten.
*
Vater war rasch zu einem gefragten Wissenschaftler geworden, Biomedizin war sein Spezialfach. Mit siebenunddreißig Jahren wurde er Ordinarius und war nun Leiter eines großen Forschungsprojekts, das sich zum Ziel gesetzt hatte, den Alterungsprozess des menschlichen Organismus zu klären.
An einem grauen Freitag - es war der 17. November 1960 - wollten meine Eltern nach Ostberlin (was vor dem Bau der Mauer noch nicht sonderlich schwierig war); und zwar deshalb, weil die Schwester meines Vaters, Sieglinde Landes, einen Parteifunktionär, Erwin Müller, heiraten wollte. Tante Sieglinde hatte es nach dem Krieg in die Nähe von Potsdam verschlagen; sie blieb dort, und ich habe sie bis heute niemals gesehen.
An jenem Tag im November fuhren meine Eltern in einem dunkelgrünen Opel Olympia über eine jener Straßen, wie sie damals in der DDR gang und gäbe waren: schmal und holprig, rechts und links von Eichen und Pappeln gesäumt, die an jenem Abend den Nebel zwischen ihren Ästen zäh hin- und herreichten.
Vater saß stolz auf dem grünen Stoffsitz seines Autos, umklammerte das Lenkrad, hatte die Augen zusammengekniffen und starrte in die Lichtkegel, die sich von den Scheinwerfern durch die Wand aus Wassertröpfchen fraßen, um ab und zu einen der Bäume einzufangen. Sein dunkles Haar klebte an seinem Gesicht, und seine Augen durchbohrten starr vor Anstrengung die Windschutzscheibe, die von der Spur der Wischerblätter verschmiert war. Mutter trug ein weites Kleid und hielt sich mit beiden Händen den kugeligen Bauch. Ihre Brüste wogten bei jedem Schlagloch auf und ab. Ihr Gesicht unter dem toupierten Haar ließ Furcht erraten. Sie beobachtete meinen Vater sorgenvoll von der Seite, wie er hoch konzentriert den Wagen steuerte. Vater, der ihren Blick spürte, als würde ihm ein Lufthauch das Nackenhaar emporheben, wandte sich ihr zu, lächelte, legte die rechte Hand auf ihr Knie und streichelte sanft ihren Oberschenkel. Mutter nickte fast unmerklich mit dem Kopf, lächelte zurück, streckte ihren Körper, spitzte zart den Mund und gab ihm flüchtig einen Kuss auf die Wange.
Er hatte ihn zu spät bemerkt, wie er dalag: diesen langen, schlanken Baum, den das Wetter gefällt und ihnen in den Weg geworfen hatte. Überrascht stieß Vater einen Schrei aus. Mutter hielt sich starr vor Schreck den linken Unterarm vor die Augen und schrie noch lauter als Vater, der jäh auf die Bremse trat. Er riss das schweißnasse Steuer nach links, der Wagen schleuderte und prallte mit dem rechten Kotflügel gegen einen Ast, dass der Scheinwerfer klirrend zerbarst und der Baum krachte. Mutter und Vater wurden nach vorn geschleudert. Das Lenkrad warf Vater zurück, nachdem es ihm die Unterlippe blutig geschlagen hatte, während Mutter mit ihrem Kopf durch die Windschutzscheibe schlug und mit ihrer rechten Hand noch immer den Bauch umfasste. Sie steckte jetzt mit ihrem Bauch fest und schrie, nein, sie brüllte. Meinem Vater fuhr Angst in die Knochen. Er öffnete die Fahrertür, strauchelte draußen um den Wagen herum und nahm ihre blutüberströmte Hand. „Oh Gott!“, schrie sie. „Was ist mit meinen Kindern?“
„Rita“, stammelte er, „Rita, es ist alles in Ordnung, es ist nichts passiert!“ Vater streichelte sie sanft mit Tränen in den Augen, doch er hatte den Verdacht, als er diese Worte sprach, dass er meiner Mutter vielleicht nicht die Wahrheit hatte sagen können.
*
Später lag Mutter auf einer Trage unbequem in dem stickigen Krankenwagen und wimmerte. Sie waren schnell dort gewesen; ein Bauer hatte den Unfall entdeckt und umgehend die Rettung alarmiert. Vater hatten die Sanitäter in ihren grauweißen Kitteln trotz seines Protestes, er sei Arzt, nur gestattet, vorn neben dem Fahrer Platz zu nehmen. Er drehte sich immer wieder um und beobachtete Mutter durch die schmale Glasscheibe, die Fahrerkabine und Krankenabteil voneinander trennte.
Wie sie dalag! Tränen liefen aus ihren rotglühenden Augen über ihre tropfende Stirn, die jetzt nach unten zeigte, da sie ihren Kopf nach hinten drückte, um Vater sehen zu können, so dass ihr Kinn grotesk nach oben wies. Ein Sanitäter saß neben ihr und beobachtete sie streng und stocksteif. Er tat dies weniger so, wie man einen Menschen ansieht, der leidet, sondern so wie man einen Wecker betrachtet, der nicht mehr klingelt. Er hatte ein eher technisches Interesse an meiner Mutter, deren blaues Kleid in Höhe ihres Bauches aufgerissen und mit Blut getränkt war, ohne dass die Haut nennenswerte Wunden davongetragen hatte. Für ihn war diese fremde Frau ein Objekt, das man studieren konnte, obwohl er sicherlich nicht dafür ausgebildet war, einen exakten medizinischen Befund zu erstellen.
Mutter aber stand kurz vor einer Panik, denn grenzenlose Angst nagte an ihrem Verstand. Es habe, so erzählte Mutter mir später, eine halbe Ewigkeit gedauert, bis sie im Krankenhaus angekommen seien. Und erst, nachdem Vater ein Druckmittel angewendet habe, sei sie rasch in den Kreißsaal gebracht worden: „Hören Sie, wir sind unterwegs zur Hochzeit meiner Schwester!“
Na und? Was er glaube, wie viele Leute täglich in der DDR heirateten? Glaube er etwa, das sei etwas Besonderes? Erst müssten sie ordnungsgemäß die Personalien aufnehmen. Sie habe nicht vor, Ausnahmen zu machen, habe die schnodderige Schwester bei der Anmeldung gezischt.
„Mein zukünftiger Schwager ist zweiter Vorsitzender der SED in Berlin. Was, glauben Sie, wird er sagen, wenn er erfährt, dass eine Krankenschwester dafür gesorgt hat, dass die Schwägerin seiner Braut eine Frühgeburt in der Empfangshalle eines Krankenhauses hatte?“ Daraufhin wurde Mutter gleich von zwei Helfern auf einen Rollstuhl gesetzt.
Vater verboten sie ganz einfach, meine Mutter zu begleiten. Das sei nichts für Männer, sagten sie ihm. Er sei aber Arzt, hatte er reklamiert. Das mache gar nichts. Hier dürften eben nur behandelnde Ärzte in den Kreißsaal.
Acht Minuten später kam ein Mann auf meinen Vater zu und wollte ihn wohl beruhigen nach all dem Ärger, den er gehabt hatte. Der Mann war mittelgroß, trug eine Nickelbrille, hatte schütteres Haar und versuchte freundlich zu wirken.
„Guten Tag, Sie heißen Landes, nicht wahr? Ich bin Doktor Böhler“, sagte der Arzt schmallippig in sächsischem Tonfall. Er wirkte sehr streng, und seine Mundwinkel zitterten, wenn er zu lächeln versuchte.
„Sie haben“, meinte Böhler, „in den Formularen angegeben, Sie sind Mediziner. Ist das richtig?“, fragte er meinen Vater und deutete mit seiner rechten Hand auf das Blatt, das er in der Linken hielt. „ Ja, das stimmt, Biomediziner.“
„Dann können Sie nur der Professor Ewald Landes sein, der sich mit dem Alterungsprozess des Menschen beschäftigt, nicht wahr?“ Dabei lag in seiner Stimme so etwas wie stille Bewunderung.
„Genau der bin ich“, sagte Vater.
Er habe einige Veröffentlichungen von meinem Vater gelesen. Es seien für seine jungen Jahre wirklich beneidenswert erkenntnisreiche Arbeiten, staunte Böhler.
Das könne ja sein, aber ihn interessiere jetzt einzig und alleine, was mit seiner Frau und den Kindern sei? Habe er „Kindern“ gesagt? Ja, es gebe wohl Zwillinge. Ob er zu ihr dürfe?
„Nein, leider ist das strikt gegen unsere Vorschriften. Aber ich will sehen, ob ich Ihrer Frau helfen kann.“ Der Arzt nickte meinem Vater freundlich zu und wandte sich zum Gehen.
„Sagen Sie, Professor Landes, Ihr zukünftiger Schwager heißt Erwin Müller, sagte mir die Schwester am Empfang?“, habe Böhler gefragt, nachdem er sich noch einmal umgedreht hatte.
Ja, antwortete Vater; der Arzt sah zu Boden und nickte, steckte dann die Hände wieder in seinen weißen Kittel und ging den Flur entlang.
Als Mutter nach tiefer Erschöpfung aufwachte, hielt mein Vater ihre Hand. Ihr Gesicht war bleich, und um die Lider lagen dunkle Schatten. Sie brauchte einige Zeit, um meinen Vater zu erkennen, dann lächelte sie dünn und versuchte zu sprechen. Vater hob einen Zeigefinger an die gespitzten Lippen, aber Mutter fragte gleich nach ihren Kindern. Vater machte ein trauriges Gesicht, küsste seine Frau voller Liebe und sprach so sanft, wie es seine tiefe Stimme gestattete. „Sie haben einen Kaiserschnitt gemacht. Rita, eines der Kinder ist tot.“ Mutter seufzte und begann leise zu weinen.
Vater nahm sie vorsichtig in den Arm und sprach beruhigende Worte zu ihr. „Das andere Kind lebt und ist gesund, es ist ein strammer Junge. Er braucht dich jetzt.“ Sie sah ihm schluchzend in die Augen. „Ich sage der Schwester Bescheid, dass du wach bist. Du sollst ihn gleich halten und wärmen!“ Vater wollte auf den Flur hinauslaufen, doch Mutter streckte sogleich die Hand nach ihm aus. „Warte! Lass mir Zeit, ich kann noch nicht.“ Sie ließ den Kopf hängen und fragte: „Warum nur? Warum?“ Vater drückte sie an sich, und beide weinten sich die Seele frei. „Rita, Rita, ich weiß es nicht. Es gibt keine Antwort darauf.“ Er ließ Mutter schluchzen und weinen, und sie wurde immer leiser. Sie fragte nach einem Taschentuch, putzte ihre Nase, fixierte ihn mit rot verquollenen Augen und bat ihn, jetzt die Schwester zu rufen. Er verließ den Raum, doch kurze Zeit später kam er zurück und lächelte sie auf eine Art an, dass Mutter das Herz schmelzen wollte. Sie hatte noch Tränen in den Augen, diesmal jedoch vor Freude, obwohl sie kurz zuvor erfahren hatte, dass eines ihrer Kinder tot auf die Welt gekommen war. Ihre Neugier und ihr Verlangen nach dem lebenden Kind waren jetzt größer als ihre Trauer. „Was genau ist passiert, Ewald?“, fragte sie und hielt meines Vaters Hand.
„Rita, es waren zweieiige Zwillinge. Ein Junge und ein Mädchen, sagten sie mir. Ich durfte das tote Kind bisher nicht sehen. Es tut mir Leid, Rita. Aber ich weiß, wir werden dem Jungen unsere ganze Liebe schenken“, hauchte Vater und küsste ihr eine Träne von der Wange.
Als die Krankenschwester hereinkam und mich in ihren Armen hielt, muss ich geschrien haben. Vater strahlte mich an. Mutter hat mir erzählt, dass der Anblick unserer beiden Gesichter damals so unterschiedlich gar nicht gewesen sein soll: er mit der Miene der Sanftmut und ich mit dem Gesicht der Schutzlosigkeit.
Die Schwester hatte die Bettdecke meiner Mutter zurückgeschlagen und legte mich zwischen den rechten Arm und ihren Oberkörper. „Er ist hungrig“, sagte die Schwester. Unsicher blickte Mutter auf, die Schwester nickte ihr zu, und Vater tat dasselbe, ohne genau zu wissen, warum. Mutter öffnete langsam das weiße Klinikhemd, das man ihr angelegt hatte, und versuchte noch ein wenig ungeschickt, mir ihre Brust zu geben. Mutter und Vater strahlten vor Glück, als ich gierig dalag und an ihr sog und trank und gluckste.
„Wie soll er denn heißen?“, fragte die Krankenschwester meinen Vater. „Ja, wie soll er denn heißen? Rita, was meinst du? Wir bleiben bei Walter, oder?“ Er wandte sich zu der Krankenschwester. „Wir wollten sie Walter und Konrad nennen, oder Cornelia und Sabine oder Walter und Cornelia, je nachdem, was herausgekommen wäre. Leider gibt es die kleine Cornelia ja nicht mehr.“ Er schluchzte auf.
„Walter, so wie unser neuer Staatsratsvorsitzender Ulbricht“, lächelte die Schwester unsicher. Meiner Mutter schien der Gedanke zu gefallen, denn sie lachte leise, und als sie lachte, zitterte ihr Busen; ich muss Schwierigkeiten gehabt haben, weiter zu trinken, denn Mutter weiß heute noch, dass ich nach Luft schnappte und dass meine Hände sich bei ihr festkrallen wollten. „Na, Walterchen, genug satt?“, fragte sie mich mit viel Honig in der Stimme. Vater lachte nun mit der Verklärtheit, die so typisch ist für junge Eltern, die ihr Kind als das schönste Naturereignis auf der ganzen Welt betrachten. Er hielt uns beide sicher im Arm, wobei seine rechte Hand sanft die linke Brust meiner Mutter nahm und sie behutsam streichelte. „Ich liebe dich, Rita, und ich werde alles tun, um dir Glück zu schenken!“
Das versprach er ihr damals, und ich kann sagen, dass er es bis heute jede Minute seines Lebens versucht hat, mein Vater. Ich glaube, er liebt Mutter heute noch genauso wie früher. Und Mutter lächelt ihn noch so an, wie sie es wahrscheinlich damals auch getan hat. Sie waren ein glückliches Ehepaar, ja, das waren sie - bis zu jenem Tag, als ich verschwand.
*
Nun war ich also auf der Welt, allein gelassen von meinem Zwilling, den ich nie zu sehen bekommen hatte. Mein Leben lang hat mich das bohrende Rätsel nie losgelassen, wie es gewesen sein muss, als wir nebeneinander, eng und umschlungen, im Fruchtwasser unserer Mutter gelegen haben, geborgen im Glück der Wärme und der Liebe und mit der Selbstverständlichkeit, nie allein gewesen zu sein, seit die Chromosomen sich zu teilen begonnen hatten.
Zu meinen frühesten Erinnerungen zählt, dass meine Eltern jeden zweiten Tag mit mir an das Grab meiner Zwillingsschwester gingen. Sie hatten das Kind nach meiner Geburt und ihrem Tod nach Westdeutschland überführen lassen (was sich damals als große Schwierigkeit erwies, aber Onkel Erwin hatte seinen Einfluss geltend gemacht). Sie hatten das Kind Cornelia genannt, und obwohl es nie getauft worden war, lag es in Köln auf einem katholischen Friedhof.
Mutter stand stets einige Minuten vor dem Grab und legte im Sommer eine Rose nieder, die sie in unserem Garten gepflückt hatte; und war sie auch sonst eine Persönlichkeit, stark und fröhlich, so hatte sie jedes Mal Tränen in den Augen, und wie selbstverständlich liefen sie auch mir, obwohl ich als kleines Kind sicher nicht wusste, warum sie liefen. Als ich sie einmal fragte, warum sie weine, sagte sie, sie sei auch ein Zwilling gewesen, und ihre Schwester sei ebenfalls gestorben. Mehr wollte sie mir damals nicht preisgeben, und ich konnte nicht ahnen, welche Wucht sich hinter ihrer Antwort verbarg.
Mein Zwilling, mit dem ich den Bauch meiner Mutter geteilt hatte, war zwar tot; aber er schien dennoch stets mit mir zu sein. Ich habe damals oft mit dem toten Zwilling geredet. Wenn ich heute darüber nachdenke, war dieses Kind für mich geschlechtslos; es war kein Junge oder Mädchen, sondern ein Kind wie ich, und es war mein Freund, dem ich morgens beim Waschen und Zähneputzen und abends vor dem Einschlafen Ereignisse anvertraute wie einem Tagebuch (vielleicht habe ich deshalb nie eines geschrieben).
Ich war gerade fünf Jahre alt, und es war Sommer. Wir waren in Italien, und Vater fuhr lustig pfeifend die holprige Straße hinauf und dem Hügel mit dem großen Bauernhaus entgegen, über dessen Dach die Morgensonne rötlich blinzelte und uns das grelle Licht und die Hitze des Tages ankündigte. Mutter hatte wie immer ihre Arme bedeckt, obwohl es bereits ziemlich warm war. Ihre rechte Hand umklammerte den Haltegriff über der Tür des VW Käfers, dessen Rolldach Vater so weit es ging nach hinten geschoben hatte. Sie trug ein leichtes Kopftuch, und mir hatte sie eine meiner geliebten englischen Kricket-Mützen aufgesetzt. Als Vater in eine Rechtskurve einbog, legte Mutter den linken Arm um seinen Sitz und sah mit glücklichem Lächeln aus dem Seitenfenster. Mir schoss ganz kurz der Gedanke durch den Kopf, ihr müsse viel zu heiß sein mit der Jacke. Also schob ich ihr den Ärmel nach oben. Mutter schrie, zog blitzschnell den Arm ein und versuchte seine Innenseite vor ihrer Brust zu verstecken; und auf ihrem Gesicht hatte sich der blanke Schrecken ausgebreitet. Sie sah mich an wie ein verängstigtes Kind. Da verfinsterte sich das Gesicht meines Vaters und er schrie mich zum ersten Mal an: „Mach das nie wieder, hörst du?“ Er bremste ab, packte mich am Arm und schüttelte mich: „Nie wieder, hast du gehört?“
Ich wusste nicht, dass sein Gesicht so böse sein konnte, schreckte zurück, verwirrt und verängstigt, was ich falsch gemacht hatte, und dann weinte und schluckte ich. Vater stieg aus und holte mich jetzt sanft aus dem Wagen. Wir setzten uns an den Rand der Straße. Er nahm mich in die Arme und tröstete mich. Er entschuldigte sich für seinen Ton, nahm mir die Mütze ab und streichelte mein Haar. Ich hob den Kopf und sah die Feuchte, die in die Augen meines Vaters drang.
Mutter saß neben uns, das Gesicht in ihren Händen verborgen. Als sie ihren Kopf hob, glänzten matte Tränen in ihren Augen, und sie biss sich auf die Unterlippe. Sie breitete die Arme aus, zog langsam ihren linken Ärmel hoch und zeigte mir die verblasste Narbe, von der ich nicht wusste, was sie zu bedeuten hatte. Ich fragte leise: „Was ist das?“ Sie fixierte mich und wisperte mit gebrochener Stimme: „Das hier, das haben sie mir angetan. Ich habe furchtbare Angst gehabt vor ihnen. Und eben, als du an meinem Ärmel gezogen hast, hatte ich wieder diese Angst.“
Sie schluckte und konnte nicht weitersprechen. Ich kroch hinüber zu ihr und wollte sie umarmen. Sie nahm mich und hielt mich fest. Mir war damals die gesamte Tragweite ihrer Erfahrungen nicht klar, denn als Kind denkt man anders: hungrig nach Erlebnissen überlegt man sich nur selten, dass Erlebnisse auch ein bitteres Ende haben können; als behütetes Kind glaubt man vielmehr an das Gute, und das Böse hat nur den Stellenwert einer Gespenstergeschichte. Als Erwachsener aber ist das anders: Erlebnisse bekommen zunehmend den Charakter von Lebenserfahrung - man kann sie in keinem Falle missen, aber man will sie auch nicht wiederholen müssen. Ich hatte an jenem Tag begriffen, dass diese Narbe am Arm meiner Mutter etwas Schwerwiegendes war; etwas, das wie ein Fluch über ihr hing, etwas, das sie nie würde abschütteln können, wie eine Klette, die sich in der Wolle ihrer Seele verfilzt hatte. So nah ich meiner Mutter auch stand, so sehr ich sie liebte, so sehr ich von ihr behütet wurde: die ganze Geschichte zu erfragen, die sich hinter der Narbe auf ihrem Arm verbarg, traute ich mich nie.
Es waren jedoch nicht nur leidvolle Dinge, die mich als Kind beschäftigten. Ich spürte oft den quirligen Drang in mir, so genannte unnütze Dinge auszuprobieren und sie so lange zu üben, bis ich sie beherrschte. Ich spürte, dass sie mit der Beherrschung meinerseits den Charakter der Nutzlosigkeit verloren. Damit konnte man die meisten Leute überraschen, sie zum Lachen und zum Staunen bringen. So trainierte ich, eine Münze um die Finger rollen zu lassen, bis sie zu tanzen schien, und ich wackelte mit den Ohren, bis meine Haare sich bewegten. Später blies ich Rauchringe in die Luft mit dem Ziel, die olympischen Ringe nachzuzeichnen.
In der Schule kam ich gut voran. Lernen fiel mir nicht schwer. So hatte ich viel Zeit für den Sport, wurde ein guter Schwimmer und spielte Schach. Schließlich wollte ich, wie Vater, Wissenschaftler werden. Im Wintersemester 1980 begann ich Biologie zu studieren und belegte außerdem einige Medizin-Vorlesungen, denn ich wollte auch die Dinge verstehen lernen, die Vater mir erzählt hatte, wenn er von seinem Beruf sprach (was er sehr zum Wohle unserer Familie nur tat, wenn man ihn darum bat). Mit dem Studium hatte ich kaum Probleme, und so plätscherte alles dahin. Wir waren Studenten, unternahmen billige, aber abenteuerliche Reisen, fuhren zum Sporturlaub, eroberten uns die Welt und studierten. Wir bauten Philosophien um das Nichts, und wir versuchten mit einer Flasche Wein in der Hand das Welträtsel zu lösen. Mädchen gab es wunderbare, und ich hatte einiges Geschick darin, sie für mich zu interessieren. Gemocht habe ich viele, aber keine war dabei, die mich dazu brachte, von Liebe sprechen zu wollen.
Das Einzige jedoch, das ich wirklich wollte, war herauszufinden, was in meiner Seele vorging. Wieso glaubte ich, dass noch jemand existierte, der so war wie ich? Ich beschäftigte mich zunehmend mit der vergleichenden modernen Zwillingsforschung, einem Zweig der Biologie, der verblüffende Erkenntnisse gesammelt hatte. Je mehr ich mich in dieses Thema hineinlas, desto besessener wurde ich von diesem Forschungszweig, sie wurde zu meiner Obsession.
Im Sommer 1983 lernte ich Anna kennen. Ihr Lachen erzeugte in mir eine Wärme, wie sie bis dahin niemand in mir geweckt hatte. So wie Anna hatte mich noch keine im Herzen berührt. Ihre Schultern waren kräftig und ihre Arme stark. Besonders aber fielen mir ihre Waden ins Auge, die ich sofort geliebt hatte, als ich Anna im Sommer in ihrem flatternden Rock und den halbhohen Schuhen zum ersten Mal sah; der Wind spielte mit ihren Haaren, und sie blinzelte mich an. Selbst ihre Hände waren nicht unbedingt zart, aber alles passte in einem hohen Maße zusammen.
Sie wirkte in sich so ruhig, so freundlich und so frei, und ihre dunklen Augen hielten so sicher stand, als könne sie nichts auf der Welt verletzen. Ich hatte sie bei einem fachübergreifenden Seminar kennengelernt. Sie sprach mich an, weil ich sie so unverschämt angesehen hätte, sagte sie lächelnd.
Einen Tag später trafen wir uns wieder. Ich saß in der Kölner Altstadt auf dem Rand der Hochwassersperre in der Nähe des Rheins, als sie mich begrüßte. Ihre Stimme war wie ein Strudel, in dem ich zu versinken begann. Diese Stimme war das, was man einen vollen Alt nennt, deutlich, selbstbewusst und von der Klangfarbe, auf die mein Ohr geeicht schien. Schauer und Liebe erstanden vor mir, Glück und Zuversicht, Vertrauen und Herzlichkeit. Und es sollte eine unendliche Leidenschaft daraus erwachsen.
Anna und ich wurden ein Paar. Sie war einundzwanzig und ich zweiundzwanzig Jahre. Es war eigenartig: Wohin wir kamen, lächelten uns die Menschen zu. Wir sprachen über alles, was uns begegnete, und Anna schien genauso durstig wie ich auf schöne Dinge, die auf der Welt waren und geschahen.
„Was ist das Wesen der Schönheit?“, fragte sie mich einmal. Ich überlegte lange, aber ich konnte ihr keine Antwort geben. „Weißt du es?“, fragte ich stattdessen zurück.
Sie hob ein wenig unsicher die Schultern, sagte aber dann: „Ist es nicht das Erhabene und Besondere, das herausragt aus dem Umliegenden, das Klare und Einfache, das sich den Menschen erschließt, das Unaufdringliche und Freundliche, das uns fasziniert, und ist es nicht auch das Kreative und Einzigartige, das die Menschen hervorbringen? Ist Schönheit nicht all das?“
Wir tranken den Wein, den wir uns leisten konnten, und aßen Speisen, die wir zuvor am eigenen Herd gemeinsam zubereitet hatten. Anna war eine exzellente Köchin; sie sagte, weil sie der Überzeugung sei, dass das, was man tue, mit Inbrunst geschehen müsse. Wir zelebrierten die Abende, blieben im Winter oft den ganzen Tag in der Wohnung und ließen das Wochenende einfach an uns vorüber gleiten.
Irgendwann - als ich allein zuhause war - fand ich den Schlüssel eines Schließfachs im Briefkasten in einem Briefumschlag mit meinem Namen darauf, aber ohne Absender. Ich nahm ein Taxi und fuhr zum Hauptbahnhof. Als ich das Schließfach öffnete, fand ich ein Flasche Barolo und eine rote Rose.
Anna war stark und sicher, und deshalb war ihr Geschenk für mich doppelt schön. Von ihr so etwas zu bekommen war wie eine Flutwelle der Wonne. Ich konnte mein Glück kaum fassen: War es möglich, dass das Liebesglück meiner Eltern sich auf mich übertragen sollte? All die Dinge, die meine Eltern von ihrer Liebe erzählt hatten, schienen in einer seltsamen Weise auf Anna und mich anwendbar.
Vielleicht war es nach dem Verlust meiner Zwillingsschwester eine glückliche Fügung des Schicksals - nämlich meine Begegnung mit Anna -, die Mutter für ihre Herzlichkeit belohnte. Seit Anna bei uns zuhause ein- und ausging, hatte ich Mutter nie wieder am Grabe meiner Zwillingsschwester Cornelia weinen sehen; nein, sie hatte seither - mehrmals habe ich sie unbemerkt beobachtet - ein gütiges Lächeln in ihren Zügen, wo früher Tränen und Trauer waren, wenn sie die Hände gefaltet und andächtig vor dem Grabstein gestanden und eine frische Blume gebracht hatte.
Jene Zeit ist vorbei, ich habe niemanden mehr, weil ich hier in dieser Zelle sitze. Aber ich habe Anna gehabt. Die meisten Menschen glauben, Liebe bis ans Ende ihres Lebens körperlich spüren zu müssen, um glücklich gewesen zu sein. Ich glaube, dass solche Menschen nie konsequent gefühlt haben. Wer einmal so geliebt hat wie ich und diese Liebe auch erwidert bekam, sehnt sich nicht danach, sie mit jemandem zu wiederholen. Liebe ist auf das Zusammenspiel von ganz besonders zueinander passenden Menschen beschränkt, in welcher Form auch immer: aber sie ist nicht wiederholbar. Der Schmerz aber, den man beim Verlust von Liebe verspürt, wandelt sich mehr und mehr zu Reichtum: zu Reichtum in Form von Erinnerung.
*
1986 hatte ich mein Studium beendet und bekam anschließend eine Stelle an der Universität zu Köln als Hochschulassistent. Vor lauter Freude und Euphorie hatte ich eine riesige Feier organisiert, um mein erstes Gehalt mit meinen Freunden zu versaufen. Das Leben als Wissenschaftler begann mir zu gefallen, die Biologie und die Genetik hatten sich mir erschlossen. Über Zwillinge und die Forschung hatte ich eine Menge gelernt. Ich stellte einen Projektantrag zur Erforschung von bestimmten Verhaltensweisen von Zwillingspaaren, die getrennt und unter sozial unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen waren.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Lutz Kreutzer GOTT WÜRFELT DOCH - Abgrund (Band 1) Kriminalroman vom Autor des Thrillers Schröders Verdacht (Platz 1 im amazon Kindle–Shop) www.schroedersverdacht.de Alle Rechte liegen beim Autor Copyright: © 2012 Lutz Kreutzer Neu überarbeitete Fassung von 2015 für tolino-media der gedruckten Originalfassung von 2009 (IL-Verlag, Basel) Impressum auf www.lutzkreutzer.de
Bildmaterialien © Copyright by Lutz Kreutzer
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7393-0272-0