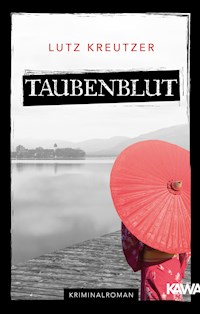Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schaurige Orte
- Sprache: Deutsch
Zwölf schaurige Geschichten von zwölf Autoren über zwölf reale Orte in Südtirol, angelehnt an Legenden und Ereignisse in Vergangenheit und Gegenwart. Welch ungewöhnliche Abenteuer ein Magier bestehen musste, um den Erzherzog Johann zu seiner Grablege im Schloss Schenna zu begleiten. Auf welche Weise der Paternkofel für die tragische Geschichte zweier Männer steht, deren Schicksal sie als Bergsteiger wie auch als Todfeinde verbindet. Und warum die Knappengeister vom Totensee immer noch ihr Unwesen treiben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lutz Kreutzer (Hrsg.)
Schaurige Orte in Südtirol
Unheimliche Geschichten
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Herstellung/E-Book: Mirjam HechtKarte auf S. 6/7: Katrin Lahmer
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Gaspar Janos / Shutterstock
ISBN 978-3-8392-7166-7
Inhalt
Impressum
Karte
01 Die bösen Engel
von Robert Preis
02 Tod am Paternkofel
von Lutz Kreutzer
03 Ein Kegelspiel
von Rut Bernardi
04 Gaulschlucht
von Ralph Neubauer
05 Annamirl
von Günter Neuwirth
06 Hexennacht mit Schuss
von Sigrid Neureiter
07 Der Fluch des Laurin
von Christof Weigold
08 Der schwarze Focke
von Christiane Omasreiter und Kathrin Scheck
09 Die verlorenen Seelen vom Totensee
von Heidi Troi
10 Die Hexe vom Blutenden Herz – Eloise
von Andrea Nagele
11 Schauer in der Nordwand
von Horst Jobstraibitzer
12 Heirat, Horror, Karersee
von Felix Leibrock
Die Autoren
Lesen Sie weiter …
Karte
01 Die bösen Engel
von Robert Preis
Mein Name ist Stephan Kowalski-Knapp, Buchhändler in Prag. Erst kürzlich fand ich das Tagebuch eines entfernten Vorfahren, Marek Baptist Knapp (1809–1869), der im Jahre 1859 von Seiner Majestät Kaiser Franz Joseph I. angeblich mit einer brisanten Aufgabe betraut worden sei. Einer Aufgabe, die ihn das Leben kosten sollte, ihn aber auch unsterblich machte.
Aus dem Büchlein geht hervor, wie sehr er als Lector1 unter der Ignoranz der Menschen zu leiden hatte. Und unter seinen besonderen Fähigkeiten. Kaum jemand glaubt den Lectoren so wie einst in früheren Zeiten, niemand schenkt ihnen Achtung oder gar Anerkennung. Vielleicht deshalb, weil Lectoren dazu neigen, ihre Eingebungen und seherischen Fähigkeiten allzu deutlich in die Wirklichkeit der anderen einzubringen. Aber, geschätzte Leser, bewerten Sie selbst, welch unglaublichen Gefahren und Nöten mein Vorfahr, Marek Baptist Knapp, gegenübergestanden haben mag.
*
Graz, 11. Mai 1859
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Uhren um 8.45 Uhr stehen geblieben waren. Ich weiß nur, dass es plötzlich still war. In meiner Erinnerung war es damals so leise, dass das Ticken keinen Platz hatte. Nicht einmal das Schluchzen und das Atmen der Umstehenden. Nichts hatte Platz außer der Tod. Johann hatte ausgeatmet und nicht wieder ein. Der Erzherzog, der Steirische Prinz, war tot.
Seit drei Uhr in der Früh hatte ich – angereist aus Ödenburg, wo ich als Offizier stationiert war – am Totenbett gesessen. Ich war sofort losgeritten, hatte ihn jedoch nur noch sterben sehen. Unsere Abschiedsworte, unser Flehen, Johann möge durchhalten und die Krise bewältigen, waren in seinem rasselnd schwachen Atem verklungen, ehe er schließlich mit einem Seufzen entschwand.
Die Kunde vom Ableben des Erzherzogs Johann verbreitete sich rasend schnell. Bereits während der Pfarrer den Leib segnete und die Gebete am Totenbett gemurmelt wurden, begannen die Glocken in Graz zu läuten. Die Leonhardkirche, die Leechkirche, der Dom, alles bewegte die Glocken. Nur die Leute waren unbeweglich, denn was in der Stadt zu dieser Morgenstunde auf den Beinen war, hielt inne und bekreuzigte sich. Der von vielen so sehr geliebte Erzherzog hatte das Zeitliche gesegnet. Das von vielen so sehr verdrängte Sterben war ins Bewusstsein des Alltags getreten. Ein unglaublich trauriger Moment.
Nur ich hatte keine Zeit für Trauer. Ich musste eilen, um Schlimmeres zu verhindern. Schlimmeres als den Tod.
Mir war bewusst, dass mich die anderen argwöhnisch betrachteten, ich spürte ihre Blicke auf meinem Rücken, und doch eilte ich aus dem Haus hinaus auf die gepflasterten Straßen, ohne mich ein einziges Mal umzudrehen. So traurig mich Johanns Tod machte, Zeit zu trauern blieb mir nicht.
Graz, 15. Juni 1869
Ausgerechnet auf Tiroler Erde. Das war Johanns Wunsch gewesen, dort wollte er begraben werden. Das hat mich zehn Jahre gekostet.
Johanns Ende war mein Anfang gewesen. Vom Kaiser persönlich mit der Überstellung des ehrwürdigen Leichnams beauftragt, hatte ich damals schnell und gewissenhaft gehandelt und noch im Monat, in dem Johann gestorben war, eine Reise durch Wälder und Schluchten, über Pässe und Felshänge begonnen, wie ich sie nie für möglich gehalten hätte. Ich war in Gegenden gewesen, die ich nur durch die kaum bekannten Pläne des Augustinermönchs Johannes Clobucciarich gefunden hatte. Vor mehr als 250 Jahren hatte er in aller Eile eine Karte der Region angefertigt, damit sich die Habsburger den immer wieder einfallenden Ungarn und Türken besser hatten erwehren können. Schon damals war diese Gegend so voller Geschichten und Gerüchte gewesen, die weit in die Vorzeit hineinragten, dass es nicht wundern darf, wenn auch ich Karantanien auf wahrlich märchenhaften Pfaden durchwanderte.
Es bedurfte intensiver Vorbereitung, Johanns letzte Reise anzutreten, ich musste Gefahren überwinden, unendlich lange Gespräche führen und mich durch Bibliotheken wühlen, ehe ich die seltensten Bücher über die seltensten Kreaturen fand. Die Zeit verstrich und mehr als einmal kämpfte ich ums Überleben, doch ich arrangierte mich, schloss Bündnisse und Pakte und holte mir Versprechungen ein, von denen ich wusste, dass sie manchmal nicht mehr wert waren als der Wind, in den sie gesprochen wurden. So dauerte es sage und schreibe zehn Jahre, bis wir das Wagnis eingehen konnten, Johanns Leichnam zu überstellen. Ein Wagnis freilich, das von den hohen Herren eingefordert worden war, denn ich selbst hätte es nie erlaubt. Nur ich wusste, wie viel Glück wir benötigen würden und wie wenig Zeit wir für die Überstellung seines Leichnams hatten.
Und nur ich ahnte meinen nahenden Tod.
Ziel unserer Reise war eine Grabkapelle nahe der Burg Schenna bei Meran. Johann hatte diese Burg lange vor seinem Ableben gekauft und sich in das beschauliche Bauwerk verliebt, das ein Relikt aus der sagenhaften Zeit der Margarete Maultasch war.
Franz Graf von Meran, Johanns Sohn, hatte den Wiener Architekten Moritz Wappler beauftragt, ein Mausoleum in Schenna zu planen. Der Meraner Polier Anton Kluibenschedl führte den Bau aus, ein neugotisches Meisterwerk, dessen Gruftaltar aus Laaser Marmor bestand und der Sarkophag aus Sandstein aus Mezzocorona in der Provinz Trient.
Und mich hatte der Kaiser damit beauftragt, den Leichenzug zu organisieren. Wen sonst?
Der einbalsamierte Leichnam Johanns sollte durch Graz chauffiert werden – in einem mitreißenden Trauerzug, damit er noch ein letztes Mal von jedem beweint werden konnte. Herz und Organe wurden, wie es üblich war, in separaten Urnen nach Wien transportiert – eine Methode, die mehr denn je von Nöten war, wenn es in die tiefen Berge des Westens ging. Die Wesen der Anderswelt sollten nie alles bekommen. Niemals alles von einem Menschen.
Johanns Sarg war bedeckt mit einer Decke, die seine Witwe Anna neun Jahre lang bestickt hatte. Jene Anna, um die der Kaiserbruder so lange gekämpft hatte, die ihm Spott, Häme und Verachtung seiner Familie brachte, weil sie ihm von Standes her nicht ebenbürtig war. So war es eine Trauung der linken Hand gewesen, wie man sagte. Johann war Getuschel am Hof egal gewesen, er hatte seine Anna geliebt. Hatte sie niemals aufgegeben. Jetzt war sie allein.
Ich selbst saß vorne am Kutschbock an der Seite eines verschlossenen Kerls, den ich Edmund nannte. Die bis an die Zähne bewaffneten zehn Husaren auf ihren zehn Schlachtrössern begleiteten uns steif und starr blickend wie Zinnsoldaten. Sie waren imposant anzusehen mit ihren bunten Uniformen und den hohen Mützen, den Quasten und Manschettenknöpfen, den blank polierten Säbeln und den gezwirbelten Schnauzern. Mir kam ihr Auftritt nur zupass, so beachtete niemand die weiteren Details unserer Ausrüstung – den gewaltigen schwarzen Koffer, der fast größer als der Sarg war, das Rohr, das unter der hinteren Achse hervorlugte, und die seltsame Apparatur, die spiralförmig am Ende der Kutsche angebracht war und in einer Kurbel mündete.
Die Hufe klackerten über den Hauptwachplatz, begleitet Klang eines einzelnen Glockenschlags der Liesl. Doch kaum hatte der Sarg die alten Grazer Stadtmauern verlassen, kaum dass wir die Murvorstadt und die Weinberge des Plabutsch hinter uns gelassen hatten und in die bewaldeten Ebenen vor der Pack eingetaucht waren, begannen die Probleme.
Das Rad der Kutsche brach und der Sarg rutschte seitlich von der Ladefläche. Annas Decke landete am Wegesrand. Ein Kichern im Wald kurz vor Beginn der Passstraße verriet mir, dass der Unfall nicht durch Zufall passiert war. Ich herrschte die Soldaten an, den Schaden so schnell wie möglich zu reparieren, und befahl den Wachen, die Augen offen zu halten. Tatsächlich fielen ein, zwei Schüsse, weil die Männer gemeint hatten, zwischen den Bäumen eine vermummte Gestalt umherspringen zu sehen. Es wurde Abend, wie ich befürchtet hatte. In dieser Nacht starb der erste meiner Männer.
Er schob Wache, doch in der Früh starrte er uns mit offenen Augen von einer Linde hängend an. An seinen Wimpern hatte sich Morgentau gebildet, trotz des Juni war es kalt heroben. Nein, ich war überzeugt, dass er sich nicht freiwillig das Leben genommen hatte.
Es war ganz einfach: Niemand, schon gar nicht all die Elfen, Kobolde und Zwerge der Mark, wollte den Erzherzog ziehen lassen. Johann bedeutete den Steirern alles, er hatte Dinge in die Wege geleitet, die das Leben bis in weite Zukunft verändern würden, er hatte den Menschen Arbeit gegeben, Museen, Fabriken, Vereine gegründet, dem ganzen Land ein neues Selbstwertgefühl verschafft. Er hatte eine einfache Frau geheiratet und aus der Steiermark ein prosperierendes Land gemacht. Niemand wollte ihn verlieren. Nicht einmal die Geisterwelt.
Zehn Jahre lang hatte ich mit den Wesen verhandelt und die ärgsten Probleme beiseitegeschafft. Und doch war mir klar, dass diese Reise eine Angelegenheit war, die schnell gehen musste. Und Glück benötigte. Das so früh gebrochene Rad hätte mir Warnung genug sein müssen. Ich hatte nicht alle überzeugt. Die Zeit war zu knapp gewesen.
Nachdem wir das Rad ersetzt hatten, brachen wir unverrichteter Dinge auf. Auf der anderen Seite der Pack in den Urlanden Karantaniens wurde es schlimmer. Die Kobolde hielten sich zwar an die mit mir getroffene Vereinbarung, doch die Habergoaß2 ließ sich nicht besänftigen. Ich betätigte zum ersten Mal die Kurbel, ließ mir die Genugtuung über das Staunen der Husaren nicht anmerken und lauschte fasziniert, wie unsere Kutsche Dampf spuckend und ratternd in einen immerwährenden Takt überlief. Ich ließ die Pferde abspannen, schraubte ein Lenkrad in die Deichsel und trat ein Pedal. Der Wagen raste jetzt durchs Land, die Pferde mussten in wilden Galopp übergehen und Edmund duckte sich noch tiefer in seine hängenden Schultern, seiner Bestimmung als Kutscher verlustig gegangen.
Doch die Habergoaß war schlau. Ich versuchte es mit allerlei trickreichen Täuschungen, ließ einen Trupp in die falsche Richtung reiten, errichtete Nachtlager, die wir dann schnell wieder verließen, und einmal opferten wir sogar einen der Husaren, der sich mit aufgestecktem Bajonett dem sagenhaften Wesen entgegenstellte. Nichts nützte. Wie so viele andere Kreaturen ihrer Art wollte sich auch die Habergoaß die Gelegenheit nicht entgehen lassen, uns zu demütigen. Dass wir einen Sarg durchs Land karrten, war schlimm genug, dass es sich dazu um einen so berühmten Leichnam handelte, war einfach zu verlockend. Könnte uns eines der Wesen den Erzherzog abspenstig machen, bevor er in seine Gruft gelangte, wäre ihm der Ruhm in der Anderswelt für alle Zeit gewiss.
Es war südlich der Nockberge, als unser Tross nach vier Tagen Reise zum Stehen kam. Die Maschine dampfte, sie musste auskühlen. Wir brauchten mehr Zeit, doch die hatten wir nicht.
Es blieb gerade so viel davon, meine zu Lichtmess geweihte schwarze Kerze auf dem Sarg zu platzieren, ehe die erste Hexe zwischen den Bäumen auftauchte. Wir hielten sie mit Fackeln auf Distanz. Die zitternden Soldaten machten Geräusche, als wollten sie Hunde verjagen, und alle wussten, dass es nur an dieser einen Kerze lag, dass die Hexe noch nicht über uns hergefallen war.
Sie war ein altes, ausgemergeltes Scheusal, das, das war ganz deutlich zu sehen, an Hunger und Durst litt. Aber ich bläute den Männern ein, sie nicht zu unterschätzen. So ausgefranst und armselig Kreaturen wie diese auch erscheinen mochten, sie waren schnell, heimtückisch und unmenschlich stark. Ihr Zauber konnte nur durch einen Gegenzauber gebannt werden. Nur durch mich.
Ich öffnete den Koffer.
Die Hydraulik ließ den Deckel mit Leichtigkeit hochschnappen. Ich nahm die Armbrust heraus, suchte Deckung hinter dem Deckel, spannte mit einem Hebel den ersten silbernen Pfeil und richtete ihn auf die Hexe aus. In diesem Moment blies ein Wind, der sich wie unheimlicher Atem anfühlte, das Licht der Kerze aus, und über uns brandete die Sturzflut der Hölle.
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass eine weitere Hexe auf dem ersten Soldaten saß und ihn mit bloßen Händen erwürgte. Nein, sie erwürgte ihn nicht nur, sie riss ihm mit ihren krallenartigen Fingernägeln den Kehlkopf regelrecht aus dem Hals. Ich wollte wieder zielen, doch die Hexe, die ich gerade eben noch anvisiert hatte, war fort. Hastig drehte ich mich im Kreis, erfasste eine weitere der Kreaturen und drückte ab. Das silberne Geschoss riss das Biest von den Beinen und spießte es an einen Baum. Als die Hexe starb, quoll Blut, schwarz wie Ruß, aus ihrem Mund.
Ich spannte einen weiteren Pfeil ein und suchte hastig ein neues Ziel. Rundherum hatte tosendes Geschrei eingesetzt. Nun war auch die Habergoaß aufgetaucht und trampelte völlig außer sich zwischen die Reihen der Soldaten. Wieder fielen Schüsse. Einer traf einen Husaren am Knie, der sich furchtbar schreiend am Boden wälzte. Ich nahm die Habergoaß ins Visier, die ein vermeintlich einfacheres Ziel darstellte, da bemerkte ich, dass die Schreie der Männer weitere Hexen angelockt hatten. Die Weiber krochen aus dem Unterholz, gackernd und krächzend, mit gierigen Blicken, ihr Gestank breitete sich über die Wiese aus wie der von Latrinen einer ganzen kaiserlichen Armee.
Ich sah mich um. Die Husaren kämpften tapfer, doch es war aussichtslos. Niemand, der hierblieb, würde überleben. Ich nickte Edmund zu, gemeinsam spannten wir die Pferde an die Deichsel, er setzte sich auf den Kutschbock und drosch auf die Tiere ein, die sogleich wie von Sinnen loshetzten. Ich begleitete ihn auf einem freien Ross. Einige Husaren versuchten, uns zu folgen, doch ich sah, wie einer nach dem andern vom Sattel geholt wurde. Die Hexen sprangen wie Grashüpfer, langten von Bäumen nach ihnen oder warfen Steine mit nie gesehener Wucht. Ich stieg im vollen Galopp zurück, spießte mit der Armbrust eine weitere Hexe im Flug auf und rettete so dem einzigen Husaren, der uns folgen konnte, das Leben.
Wir galoppierten in einem wilden Ritt durch die Nacht und passierten die Täler südlich des Großglockners. Ich war froh, weit weg von den Drei Zinnen zu sein, deren Berggeister kein Buch bannen konnte, doch bald waren die Pferde am Ende und wir auch. Nichtsdestotrotz baten uns die Bewohner des nächsten Dorfes, so schnell wie möglich weiterzuziehen. Ein Tross mit einem Leichnam, noch dazu mit einem so wertvollen wie diesem, war nirgendwo gern gesehen. Zu groß war die Angst vor den Kreaturen. Und wohl auch, das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, vor mir.
Ich versuchte während unseres kurzen Aufenthalts zu schreiben. Ich hatte zuvor zehn Jahre lang nichts anderes getan, als in Büchern zu blättern und zu verhandeln. Doch es gelang mir kaum, namhafte Gegenwehr, Bannsprüche und Grenzverse zu erschaffen. Uns Lectoren werden große Fähigkeiten nachgesagt, die Finsterwelt zu bannen und sich gegen ihre Kreaturen zur Wehr zu setzen. Manche behaupteten, wir hätten magische Fähigkeiten, könnten Hexern gleich die Physik außer Kraft setzen, fliegen, tote Gegenstände bewegen oder es mit ganzen Armeen aufnehmen. Die Wahrheit aber war, dass es für mich schon eine immense Herausforderung dargestellt hatte, die Gefahren auszuloten, die Wesen zu finden und zu erforschen. Und auch wenn die meisten der boshaften Kerle einst von Lectoren selbst erfunden worden waren, um die Menschheit in die Schranken zu weisen, so gelang es heutzutage kaum noch, Neues in die Welt zu setzen. Gegenzauber waren eine alte Kunst, die ich selbst nur marginal beherrschte. Wesen zu erschaffen war unsereins schon lange verboten worden. Alles, womit sich Lectoren heutzutage rühmen konnten, war, herauszufinden, wo sich Kreaturen befanden, was sie wollten und wie sie in Schach zu halten waren. Viel mehr konnte man nicht erhoffen. Auch ich nicht.
Im Schein des Mondlichts betrachtete ich den Sarg und bat den Erzherzog um Verzeihung. Sein Ansinnen, quer durchs Reich gekarrt zu werden, war nicht anders zu bewerkstelligen als auf diese unwürdige Art – in wilder Flucht, einer Treibjagd gleich.
Sollte alles umsonst gewesen sein? Die nächsten beiden Tage würden entscheidend sein. Johann antwortete nicht. Natürlich nicht.
Als wir im Morgengrauen aufbrachen, schüttete es in Strömen. Die Maschine lief wieder, wenn auch nur stockend. Einen ganzen Tag lang tuckerten wir vorbei an Burgen, durch Schluchten und an steilen Felswänden entlang. Wir begegneten kaum einer Menschenseele, und wenn, dann bekreuzigte sie sich, blieb am Wegesrand stehen und riss sich den Hut vom Kopf.
Anna Plochls Decke war völlig durchnässt, Johanns Sarg zerkratzt und schmutzig und wir drei hingen gebeugt im Sattel und am Kutschbock. Doch ich dachte gar nicht an die Unbill der Reise, meine Gedanken hingen nur an dem, was kommen mochte. Und es kam. Unweigerlich.
Schenna, 20. Juni 1869
Wir verdeckten den Sarg mit Heu, falteten Anna Plochls Sargdecke und steckten sie in eine Truhe. Obendrein verkleideten wir uns als einfache Marktfahrer und Bauern. Ich deckte auch meine Armbrust mit den silbernen Pfeilen ab, denn ich wusste, dass diese Waffe nun wirkungslos war. Das Rohr unterhalb des Wagens hatte ich abmontiert und am Wegesrand liegen gelassen. Bei der wilden Flucht vor den Hexen musste etwas an der Maschine Schaden genommen haben, jedenfalls ließ sie sich nicht mehr ankurbeln.
Auf diese Weise versuchte ich, die Märchenwelt zu täuschen. Doch ich selbst war es, der sich getäuscht hatte.
In der Nacht auf den letzten Tag unserer Reise krochen die bösen Geister von den Ästen der Bäume. Ein Gackern wie von den seltsamen Affen, die am Hof in Schönbrunn dem Kaiser vorgeführt worden waren, wechselte sich mit einem grässlichen Knurren ab. Zweige knackten. Es zischte hässlich um unsere Ohren. Als mir der erste der grauenhaften Norgge über die Schulter kratzte, hob ich mein Kreuz und sprach den ersten Bannfluch. Wehklagend rollte sich der Engel von der Kutsche und ich hörte fortan nicht mehr auf, meine Flüche zu sprechen.
Immer wenn ich Luft holte, wenn ich um Atem rang, griffen sie an. Sie sprangen von den Bäumen auf uns zu und zerrten an dem Sarg, ärgerten die Pferde, griffen uns an, wann immer es nur ging. Einmal erwischten sie den Husaren am Hemdsärmel, zerrten ihn vom Pferd, und beim Versuch, sich zu befreien, geriet dieser unter die Hufe. Mit einem furchtbaren Geräusch trat ihm das Pferd auf den Kopf.
Wir mussten weiter. Konnten uns nicht einmal umdrehen zu dem armen Mann.
Vor den Norgge hatte mir am meisten gegraut, da ich sie am wenigsten kannte. Es handelte sich dabei um böse Engel, die in Baumhöhlen hausten, und das war nicht etwa eine angstvolle Umschreibung – sie waren böse Engel.
Norgge nahmen den Menschen deren Fähigkeit zu sterben übel, weil sie es selbst nicht konnten. Einst hatten sie sich von Luzifers Reden einlullen lassen und waren mit ihm gezogen. Das war ihnen nicht verziehen worden, und als Luzifer und seine Gefolgschaft in die Tiefen der Hölle verbannt wurden, hatten sich die Norgge in den Ästen der Welt verheddert. Seither sind sie in der Zwischenwelt gefangen – zwischen Himmel und Hölle. In den Bäumen der Erde. Und jedes Mal, wenn jemand starb, waren sie fuchsteufelswild vor Neid.
Ihre Unsterblichkeit machte sie zu gefährlichen Wesen. Zu griesgrämigen, neidvollen Kreaturen. Und eine bessere Gelegenheit, ihren Zorn auszuleben, als die Beisetzung eines berühmten Menschen zu verhindern, eines Erzherzogs gar, bot sich selten. Ich wusste also, was mich erwartete.
Am 20. Juni 1869 erreichte der Trauerzug schließlich die Ortschaft Schenna. Wir hetzten wie vom Teufel gejagt über die schmale Brücke durchs Tor in die Burg, wo uns sogleich beim Versorgen der Pferde geholfen wurde. Erst als wir den Sarg in die Gemächer gebracht hatten, waren wir vor den Norgge sicher. Die Bestien fluchten draußen im Hof und trieben allerhand Unfug. Tags darauf war der halbe Ort auf den Beinen, und die Nörggelen, wie sie hierzulande genannt wurden, wagten sich nicht näher heran. Dennoch war die Zeremonie nur von kurzer Dauer. Schützenkompanien waren anwesend, dazu Musikkapellen, der Bischof, viele ranghohe Militärs und Erzherzog Ludwig, der Taufpate von Johanns Sohn Franz, sowie Erzherzog Ferdinand als Vertreter der kaiserlichen Familie. Erst als wir das Tor zum Mausoleum schlossen und den Sarg in die Stille seines Inneren trugen, verstummte das unsägliche Geschrei der Norgge.
Wir stiegen die steinernen Treppen hinab und hoben den Sarg auf den Sarkophag. Der Priester murmelte seine Gebete, ein paar Tiroler, die ich nicht kannte, standen misstrauisch herum, und Ferdinand beobachtete jeden meiner Schritte argwöhnisch. Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, was ihn erwartete, aber einem Mitglied der kaiserlichen Familie war alles zuzutrauen. Auch das Wissen um die schrecklichsten Geheimnisse. Ich bat sie alle hinaus. Nur Edmund und Ferdinand blieben. Gemeinsam öffneten wir den Sarg, den wir aus Graz herbeigeschleppt hatten. Er war leer.
Verblüfft atmete Ferdinand aus, doch ehe er in seinem herrischen Tonfall, der allen Habsburgern gemein war und den ich nicht ausstehen konnte, etwas sagen konnte, hob ich die Hand und gebot ihm zu schweigen. Ich weiß, welche Wirkung ich manchmal habe. Das mag an meinem klobigen Äußeren liegen, meiner zotteligen pelztierhaften Erscheinung. Oder an den Geschichten, die über mich verbreitet werden. Einerlei. Ich hob die Hand und verneigte mich. Vor Edmund.
Nun war Ferdinand völlig verwirrt. Warum verneigte sich der Troll vor einem Kutscher, einem einfachen Mann, mochte er bei sich denken. Ich mutmaße aber, dass ihm bald ganz heiß wurde. Und das Blut stockte auch, so weiß, wie er wurde. Denn Edmund stieg jetzt schweigend in den Sarg, legte sich hinein und nickte mir zu. Er sprach nichts. Nur dieses Nicken, das mir zu verstehen geben sollte, dass ich alles richtig gemacht, meinen Auftrag erfüllt hätte. Dass meine List gelungen wäre. Und dass jetzt Schluss sei. Ende.
*
Ich stand noch lange vor dem Mausoleum, starrte über den Friedhof hinweg auf die Berge und die Ortschaft Schenna hinunter, als ich auf einem Felsen eine Gestalt wahrnahm. Einen der Norgge. Er musterte mich, und selbst auf die Entfernung hin konnte ich sehen, wie übel er mir nahm, dass wir einen Leichnam durch sein Reich geführt hatten. Und mit welcher List noch dazu, denn der tote Erzherzog hatte in Wahrheit ja stets an meiner Seite gesessen. Ich weiß nicht wie, aber dieser Norgg musste es herausgefunden haben. Warum sonst saß er dort und starrte mich an? Ein Norgg hasst den Tod, weil er ihn vermisst. Er fürchtet ihn also genauso wenig wie ich. Wohl deshalb neigte der Norgg leicht den Kopf, als nickte er mir zu, drehte sich um und verschwand. Da wusste ich es zum ersten Mal. Ich würde sterben.
Auf meiner Rückreise verzichtete ich auf Geleitschutz. Für die Wesen der Finsterwelt gab es schließlich keinen Grund mehr zu kämpfen. Der Sarg war ja in sicherer Obhut. Doch womit ich nicht gerechnet hatte, war der Hass dieses einen Norgg. Als er über mich herfiel, rettete mir meine Geschicklichkeit das Leben. Vorerst. Ich zog meinen Degen und verletzte die Kreatur. Aus einer Apparatur an meinem Unterarm feuerte ich eine Kugel ab. Wir wälzten uns im Dreck. Und auch wenn ich wusste, dass dieses Wesen unbesiegbar war, unsterblich, so konnte ich mein Glück kaum fassen, als ihn meine Gegenwehr vertrieb.
Im Wasser eines Gebirgsbachs liegend, erhob ich mich mühsam, trottete klitschnass zurück zum Pferd, ritt ein Stück, machte mir ein Feuer, um mich zu wärmen, und ritt weiter. Doch nun, eine Woche später, merke ich, warum der Norgg mich ziehen ließ. Er spürte, dass ich mich nicht wieder erholen würde. Die Kälte bringt mich um. Die Lunge ist krank. Ich bekomme kaum noch Luft. Deshalb noch diese eine Geschichte hier. Sie wird vielleicht zeigen, wie wichtig die Arbeit der Lectoren ist. Ohne uns wäre der Erzherzog nie zu seiner geweihten Erde gelangt. Niemals.
*
Marek Baptist Knapp starb Ende Juni 1869 im Heuboden eines Bauernhofs nahe Lienz. Ein aus der Stadt herbeigerufener Feldscher konnte nichts mehr für ihn tun. Weil seine Arbeit beim Bauernvolk verpönt war, wurde Knapps Leichnam verbrannt und seine Asche in einem der Wälder verstreut. Sein letzter Brief blieb jedoch erhalten und erreichte über Graz und Wien seine Verwandten in Prag. Seine Majestät der Kaiser verweigerte seiner Familie einen Gedenkgottesdienst und stritt auch sein Engagement für die Überstellung des Erzherzogs ab. Die Lectoren bewegen sich am Rand der Welt. Ich als Buchhändler behandle Zeugnisse wie dieses als Reliquien, als streng gehütete Geheimnisse. Lectoren werden nur noch selten gern gesehen, meist verleugnet und doch stets erhofft. Bis heute leben sie im Verborgenen, angeblich, um die Menschheit zu beschützen. Dabei sind sie stets darauf bedacht, sich selbst vor der Menschheit zu schützen.
Stephan Kowalski-Knapp, Buchhändler, Prag, 1920
1Magier, die mit zufällig ausgewählten, jedoch existierenden Texten arbeiten.
2 Kinderraubende Schreckgestalt mit Ziegenkopf und Pferdehufen.
02 Tod am Paternkofel
von Lutz Kreutzer
Hoch über dem Fischleintal, im Herzen der Sextner Dolomiten, gegenüber den einzigartigen Drei Zinnen, ragt der Paternkofel in den Himmel, der als einer der schönsten Aussichtsberge Südtirols gilt. Vor allem aber steht er für die tragische Verbindung zweier verfeindeter Männer, so unglücklich und unselig, wie es nur die Wirklichkeit hervorzubringen vermag.
*
Am Grab
Lange Jahre der Überwindung hat es mich gekostet, bis ich es geschafft habe, an sein Grab zu kommen. Ich bin hier, um mich in Stille zu bedanken. Es ist kühl und ich zittere leicht. Nicht nur der Kälte wegen, sondern auch vor Ehrfurcht und in Erinnerung an diesen großartigen Mann.
Heute ist der 4. Juli 1955. 40 Jahre und zwei Kriege hat es gedauert, meinen Frieden zu machen mit dieser Geschichte. Nur wenige Kilometer entfernt von diesem Kirchhof verlief damals die Grenze zwischen Österreich und Italien, allerdings war es kein friedlicher Pass, denn dort oben am Kreuzberg verlief die Front.
Ich war dabei, als der Sepp in seinen schaurig schönen Bergen zu Tode kam. Und bis heute weiß niemand, wie es wirklich passiert ist. Dass ich jenen Tag überlebt habe, ist wohl dem Herrgott und einem Gespenst zu verdanken, einer Erscheinung, die jeder Bergsteiger fürchtet wie der Teufel das Weihwasser: das Brockengespenst, das jedem, dem es zuerst im Gebirg auf der Nebelwand erscheint, mit dem Tode droht. Ich habe es damals gesehen, oben am Grat des Paternkofel, der von unten ausschaut wie der gezackte Rücken eines rot-gelben Drachens. Mir aber brachte es nicht den Tod, sondern es schenkte uns das Leben, meinem Feind und mir. Bis heute danke ich jeden Tag unserem Herrgott, dass er es vielleicht war, der damals so entschieden hat.
Mein Name ist Niki Kompeiter. Jedenfalls nennen mich die Tiroler so. Uns Ladinern blieb zwei Jahrhunderte nichts anderes übrig, als uns von ihren Beamten unsere Namen stehlen zu lassen, die sie dumpf eindeutschten, die Silbe er dranhängten und uns mit diesen dahergeplappert klingenden Namen für immer abstempelten. Niki Kompeiter. Punkt. In Wahrheit heiße ich Micurá Ciampëi. Aufgewachsen bin ich in Urtijëi, das die Tiroler St. Ulrich nennen, also in Gherdëina, dem Grödnertal. Dass ich dort einer der besten Bergsteiger und hoffnungsvollsten Jungbergführer war, das wusste damals jeder. Ja, den Niki Kompeiter, den kannten auch die Kollegen im 100 Kilometer entfernten Sexten, wo der Sepp zu Hause war und wo ich jetzt an seiner Grabstätte stehe.
Sein ältester Sohn, der Gottfried, und ich, wir hatten uns ein Jahr vor dem tragischen Tag als 18-jährige Draufgänger im Rahmen einer Führung auf der Drei-Zinnen-Hütte angefreundet, deren Wirt der Sepp damals gewesen war. Dann, im Mai 1915, erklärte Italien der österreichischen k. u. k Monarchie den Krieg. Und so wurde mir die – so habe ich es damals empfunden – unendliche Ehre zuteil, gemeinsam mit meinem Freund Gottfried einer 40 Mann starken Abteilung zugeordnet zu werden, die für besonders schwierige bergsteigerische Kriegsoperationen eingesetzt werden sollte. Das war eine ausgewählte Truppe unter dem allseits geachteten Standschützenoberjäger Sepp Innerkofler, dem tüchtigen Hüttenwirt, dem bewunderten Bergführer und Gottfrieds Vater. Und ihm wurde die mörderische Aufgabe übertragen, mit einer Handvoll Männer den Gipfel des Paternkofel zu erobern, der von italienischen Alpini besetzt war. Und das kam so …
Der Neue
»Der neue Hauptmann, er ist …«
»Wie heißt er?«, unterbrach ich.
Gottfried sah mich länger an, wandte seinen Blick ab und blinzelte in die Nachmittagssonne, die westlich über dem Massiv der Drei Zinnen ihre letzten Strahlen zu uns herüberschickte. »Hauptmann von Wellean«, antwortete er sehr langsam mit einem Unterton der stillen Verachtung. »Jedenfalls ist er zum ersten Mal hier oben«, flüsterte der Gottfried mir zu. »Er soll sich freiwillig gemeldet haben, um das Zinnenplateau hier zu verteidigen.«
»Und?«, fragte ich. »Gebirgserfahrung?«
Gottfried schüttelte den Kopf. »Angeblich hat er keine Ahnung vom Gebirgskrieg und keine Kenntnis des Geländes hier.«
»Gott steh uns bei!«, presste ich hervor. »Und der will uns hier oben sagen, wie es in den Bergen läuft?« Ich machte drei Kreuzzeichen. »Wieder einer, der nur den Plan auf dem grünen Tisch kennt und keinen blassen Schimmer davon hat, wie es aussieht, wenn man in die Wirklichkeit hinter der Geländekarte eintaucht und im Gebirg wieder aufwacht.«
»Bin gespannt, was da rauskommt«, zischte der Gottfried. »So einer glaubt doch, nur mit Befehlen und Appellen an die Ehre alle Schwierigkeiten lösen zu können.«
Eine unglückliche Geschichte bahnte sich an, denn als der Innerkofler Sepp vom Hauptmann von Wellean geholt und um Hilfe gebeten wurde, wusste er nichts von seinem Himmelfahrtskommando. Doch die Militärs brauchten den bereits 50-jährigen Mann aus Sexten unbedingt, weil er nicht nur als solidester Kenner des Drei-Zinnen-Gebietes und bester Bergführer galt, sondern aufgrund seiner intensiven Jagdtätigkeit obendrein über außerordentliche Treffsicherheit verfügte. Er war Tiroler Standschütze, aber ohne jede militärische Ausbildung, nicht ungewöhnlich zu dieser Zeit. Er schoss mit einem Mannlicher-Schönauer Stutzen, der vor allem im Hochgebirge als zuverlässige Jagdwaffe diente, beim Militär jedoch nur sehr selten eingesetzt wurde.
Der Gottfried gehörte neben weiteren Bergführern seit einiger Zeit der legendären Patrouille seines Vaters an. Diese Patrouille bestieg regelmäßig die höchsten Gipfel der Region und sorgte bei den feindlichen Italienern stets für Verwirrung. Dergestalt, dass der Feind glaubte, alle Gipfel wären von österreichischen Kampftruppen besetzt. Bald staunte ganz Tirol darüber, wie oft der Sepp und seine Männer, die man bald in größter Bewunderung »Die fliegende Standschützenpatrouille« nannte, den Feind schon an der Nase herumgeführt hatten. Dafür hatte der Sepp, ihr leibhaftiger Anführer, hohe Auszeichnungen erhalten.
Unsere Stellung am Gipsjoch, westlich des Toblinger Knotens, wir nannten sie den Gipsgraben, war nur behelfsmäßig angelegt. Wie so vieles im Krieg. Als der Hauptmann von Wellean vor der Einsatzbesprechung in die Mitte trat, begann er gleich damit, geschwollenes Zeug zu reden. Von Ruhm und Ehre und so weiter. Und dass er den Sepp ausgesucht habe, auch diese Patrouille zu führen, er sei der Einzige, der dazu imstande sei. Und alle nickten ohne jeden Zweifel.
Der Gottfried und ich, wir hockten im Hintergrund. »Honig hat er ihm gestern ums Maul geschmiert, mit einem guten Essen, mit dem er ihn empfangen hat, und der Vater wusste noch von gar nichts, was er hier tatsächlich tun soll.«
»Pssst«, mahnte ich. »Lass uns hören, was er genau vorhat.«
Dann rückte der Hauptmann mit seinem Plan heraus.
Der Innerkofler Sepp war außer sich. Er geriet mit dem Forcher Hans aneinander, einem Bergführerfreund, der auch dabei sein sollte.
»Was mault der Forcher denn da?«, fragte Gottfried und spitzte die Ohren.
Ich bemühte mich, mehr zu verstehen. »Der Forcher hat wohl … dem Hauptmann empfohlen, mit einer kleinen Truppe den Gipfel des Paternkofel zu erobern, über den Nordnordwestgrat, mit nur sechs Mann. Und das scheint deinem Vater gar nicht zu gefallen.«
Der Gottfried starrte mich an. »Was? Bist du sicher? Das hat er gesagt? Eine kleine Gruppe über diesen Grat auf den Gipfel?«
»Hab ich so verstanden«, flüsterte ich ein wenig verunsichert und versuchte, weiter zuzuhören, was der Hans und der Sepp dort so furios austauschten.
»Die Route kennt kaum jemand, und auch für meinen Vater ist das äußerst riskant, äußerst schwer zu besteigen. Und dann mit Sturmgepäck?« Der Gottfried sah zu Boden und schüttelte den Kopf.
Ich spürte die Ungeduld, die in ihm aufstieg. Er sprang auf und trat vor.
Mit stolzer Brust bat er darum, seinen Vater auf dieser heiklen Mission begleiten zu dürfen. Das wurde allerdings nach einem weiteren Wortgefecht zwischen dem Sepp und Hauptmann Wellean abgelehnt.
»Es reicht, wenn nur einer nicht zurückkommt«, hörte ich den Sepp raunen, als er den Gottfried bei der Schulter packte. Doch ich sah auch die Entschlossenheit in seinem Blick − und die Enttäuschung in Gottfrieds Augen. Da spürte ich, dass ich handeln musste. Nach dieser Befehlserteilung wartete ich einen unauffälligen Moment ab, schlich mich bebenden Herzens zum Hauptmann und trug ihm leise meinen Wunsch vor: »Herr Hauptmann von Wellean, wenn der Gottfried schon nicht darf, dann lassen Sie mich bei meinem Oberjäger Sepp Innerkofler bleiben.«
»Wie?«, fragte der Hauptmann etwas gespreizt und machte einen fast beleidigten Eindruck, dass ich ihn überhaupt angesprochen hatte.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und antwortete: »Ich bin Bergführer und kann dem Sepp und seinen Männern viele Lasten abnehmen und werd mich brav und tapfer verhalten. Ich kenne die Route«, log ich. »Außerdem bin ich treffsicher.« Unsicher schielte ich ganz kurz zum Sepp hinüber, der mich aus einiger Entfernung skeptisch beobachtete und mit Verwunderung zuhörte.
Der Hauptmann stützte seine Hände in die Hüften und musterte mich von oben bis unten.
Mir gefror das Blut. Doch nun konnte ich nicht mehr zurück mit meinem Wunsch. »Ein guter Schütze, Herr Hauptmann!«, fügte ich hinzu.
»Wie heißt er?«
Ich schlug die Hacken zusammen. »Unterjäger Niki Kompeiter, Standschützen-Bataillon Gröden, 1. Kompanie Urtijëi.«
Der Hauptmann machte ein Gesicht, als hätte ich ihn angepinkelt.
»Äh, also, St. Ulrich, Herr Hauptmann.« Ich muss rot angelaufen sein.
»Er ist … also … ein Ladiner«, sagte der Hauptmann bedrohlich langsam und zog eine Braue hoch. »Man sagt euch nach, ihr hättet mehr Herz als Verstand. Aber das, Kom…pei…ter, wird ihm hier nicht viel nutzen!«, schloss er, schob seine Braue noch höher und presste die Lippen zusammen. Dann zögerte er, gab sich väterlich sinnierend, hob seine Hand ans Kinn und musterte mich erneut der Länge nach. »Außerdem, sagte der Forcher mir, sei es für mehr als sechs Mann dort oben zu eng. Hat er das verstanden … Unterjäger?«