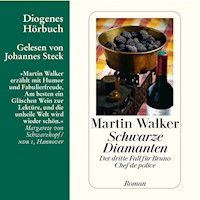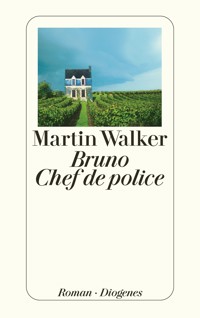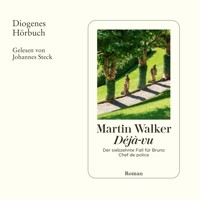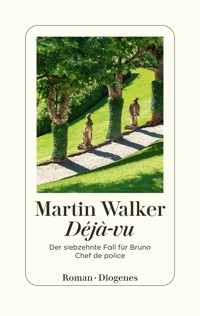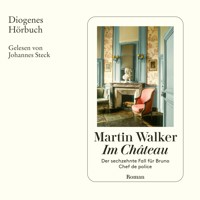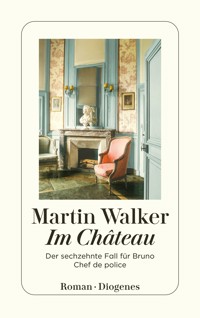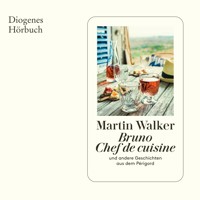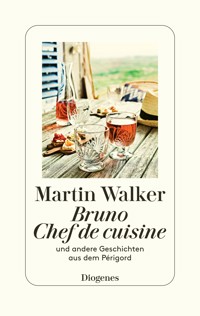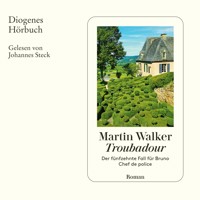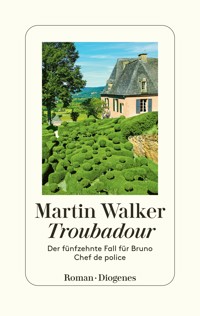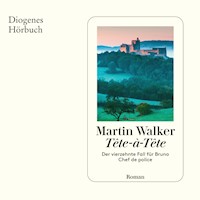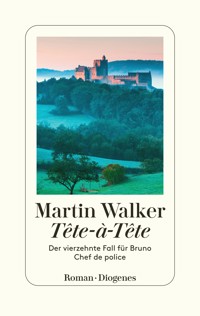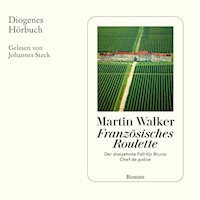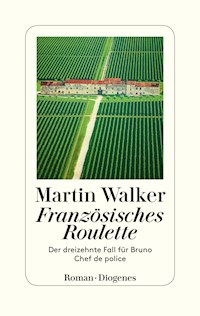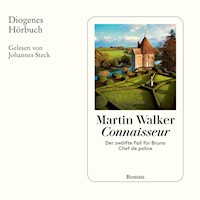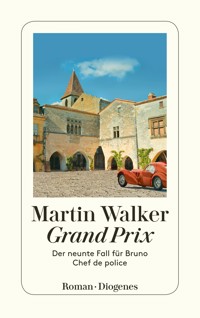
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Es ist Hochsommer im Périgord und Hochsaison für ausgedehnte Gaumenfreuden und Fahrten mit offenem Verdeck. Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno, Chef de police, organisiert, bringt auch zwei besessene junge Sammler nach Saint-Denis. Sie sind auf der Jagd nach dem wertvollsten Auto aller Zeiten: dem letzten von nur vier je gebauten Bugattis Typ 57 SC Atlantic, dessen Spur sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs im Périgord verlor. Ein halsbrecherisches Wettrennen um den großen Preis beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Martin Walker
Grand Prix
Der neunte Fall für Bruno, Chef de police
Roman
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Meinen Freunden und Mitkonsuln vom Consulat de la Vinée de Bergerac, einer 1254 vom englischen König Heinrich III. ins Leben gerufenen Institution, deren Aufgabe es ist, die Qualität der Bergerac-Weine sicherzustellen bzw. aufrechtzuerhalten. Sie wurde 1322 durch König Karl IV. unter französisches Recht gestellt und schließlich 1954 von der Assemblée der französischen Republik (Nationalversammlung) bestätigt.
1
Dem Mondkalender zufolge war heute ein besonders guter Tag, um Brokkoli, Kopfsalat und Blumenkohl zu pflanzen. So wie die Tage davor, bei abnehmendem Mond, besonders geeignet gewesen waren, um Unkraut zu jäten und einen neuen Komposthaufen anzulegen. Bruno Courrèges fragte sich, ob das nicht alles in Wirklichkeit Hokuspokus sei, während er die Setzlinge, die er in seinem Treibhaus vorgezogen hatte, in die Erde steckte. Andere Hobbygärtner, die Bruno kannte und denen er vertraute, nahmen die Ratschläge des Mondkalenders jedenfalls ernst, allen voran der Bürgermeister der französischen Kleinstadt Saint-Denis, in der Bruno Chef de police war. Die Qualität der Produkte, die sie ernteten, gab ihnen recht. Darum wollte es auch Bruno auf einen Versuch ankommen lassen. Sein kleiner Hund Balzac, ein Basset, kauerte auf der anderen Seite des Gemüsebeetes, beobachtete sein Herrchen neugierig und schien sich zu fragen, warum er in diesem Teil des Gartens nicht spielen durfte.
»Das ist wissenschaftlich belegt«, hatte Bürgermeister Gérard Mangin beteuert. »Denken Sie nur an die Gezeiten des Meeres. Die Anziehungskraft des Mondes wirkt sich auf die Feuchtigkeit im Boden aus, mal mehr, mal weniger. Also pflanzt man Blattgemüse bei zunehmendem und Wurzelgemüse bei abnehmendem Mond. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.«
Als alle Setzlinge Reihe um Reihe gepflanzt waren, wässerte Bruno die zarten grünen Sprossen mit der Gießkanne. Dann reckte er sich, um den Rücken zu entspannen, und wandte sein Gesicht der Morgensonne zu. Wie vom Mondkalender empfohlen, hatte er das letzte Wintergemüse geerntet. Am Vorabend hatte er aus zwei geviertelten Hühnchen, Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln ein einfaches, aber wohlschmeckendes Mahl für seine Freunde zubereitet. Jetzt wollte er die Reste mit einer weiteren Portion Gemüse, Knoblauch und grünen Linsen zu einem herzhaften Eintopf verlängern, der ihn und seinen Hund über die nächste Woche bringen würde.
Als er dann in der Küche stand, hörte Bruno seinen Besuch im neu ausgebauten Gästezimmer unterm Dach hin- und hergehen. Er steckte noch ein paar Scheite in den Herd, schloss die Klappe und öffnete sie dann wieder einen Spaltbreit, damit der Eintopf wie gewünscht den ganzen Tag still vor sich hin köcheln konnte. Zum Schluss goss er noch den vom Vorabend übriggebliebenen Rotwein und etwas heißes Wasser in den großen Suppentopf.
Bruno wollte seinen Landrover waschen und schon früh zum Tennisclub fahren, um an dem verabredeten Treffen und der anschließenden Oldtimer-Parade teilzunehmen, einer neuen Attraktion im Veranstaltungskalender von Saint-Denis. Seine Gäste würden im eigenen Wagen nachkommen. Bruno hatte viel Arbeit in die Vorbereitung der Parade gesteckt, konnte sich selbst aber nicht wirklich für Autos begeistern. Weder las er einschlägige Magazine, noch erkannte er auf Anhieb die neuesten Automodelle. Bei Bedarf füllte er Treibstoff und Wasser in die dafür vorgesehenen Tanks und verließ sich ansonsten darauf, dass Autos funktionierten. Sie waren für ihn nichts weiter als Transportmittel für Personen und Güter. Reparatur und Wartung vertraute er Experten an. Er hatte schon viele verschiedene Fahrzeuge gesteuert, zivile und militärische. Heute fuhr er hauptsächlich seinen alten, von einem Jagdfreund geerbten Landrover sowie den Polizeitransporter, der ihm von seinem Arbeitgeber, dem Bürgermeister und Stadtrat von Saint-Denis, zur Verfügung gestellt wurde.
Zu seiner eigenen Überraschung hatte er fast so etwas wie Zuneigung zu seinem Landrover entwickelt. Der Wagen war fast zwanzig Jahre älter als er selbst, so dass er offiziell als Oldtimer galt. Er stammte noch aus einer Zeit vor der standardmäßigen Ausstattung von Kraftfahrzeugen mit verstellbaren Sitzen, Servolenkung oder Antiblockiersystem und war alles andere als bequem. Aber dafür war er geländegängig. Bruno konnte mit ihm Bachläufe durchqueren, steile, lehmige Anstiege bewältigen und holprige, von Felsbrocken übersäte Pfade in den wildreichen Wäldern, seinem Jagdrevier. Und der Wagen hatte ihn noch nie im Stich gelassen. Das konnte man von den schicken Autos seiner Freunde nicht behaupten, die kaum mehr von normalen Kfz-Mechanikern zu reparieren waren, sondern von der Expertise von Computerfachleuten abhingen. Während seiner Dienstjahre beim französischen Militär hatte Bruno Jeeps, Lastwagen, Motorräder, manchmal sogar Kettenfahrzeuge gefahren. In schrecklicher Erinnerung war ihm eine Testfahrt in einem AMX-30, dem ehemals wichtigsten Kampfpanzer des französischen Heeres, eine ohrenbetäubende und markerschütternde Erfahrung auf dem Truppenübungsgelände bei Saumur. Vierzig Tonnen waren ihm einfach zu viel gewesen, zumal der Ausbilder die Luken geschlossen hatte, so dass der Blick nach draußen auf zwei enge Schlitze und ein eingegrenztes Prismensichtfeld reduziert war.
Bruno hielt sich auch nicht für einen besonders guten Fahrer. Es machte ihm keinen Spaß, aufs Gas zu treten, und er war schon zu häufig an Unfallorte gerufen worden, als dass er seine Fahrkünste überstrapazieren mochte. Einmal hatte ihn eine erfahrene Rallye-Pilotin – seine Freundin Annette, eine Staatsanwältin aus Sarlat – auf eine halsbrecherische Fahrt über einen Waldparcours mitgenommen. Sie waren durch enge Kurven geschlittert, haarscharf an Baumstämmen vorbeigesaust und über Bodenwellen gesprungen. Immer wieder war Bruno dabei mit dem Kopf gegen den Himmel ihres getunten Peugeot geprallt, so heftig, dass ihn, wie er glaubte, nur der von ihr zur Verfügung gestellte Sturzhelm davor bewahrt hatte, bewusstlos zu werden. Solche Fahrten waren nicht nach seinem Geschmack. Sein einziger Ehrgeiz am Steuer bestand darin, zuverlässig und sicher das Ziel zu erreichen.
Bruno beschloss, seine allmorgendliche Jogging-Runde ausfallen zu lassen, um stattdessen den Landrover waschen und polieren zu können. Zuerst kratzte er den festgebackenen Lehm aus den Radkästen und übermalte die tieferen Schrammen im leicht ausgeblichenen grünen Lack mit einem Lackstift. Dann wischte er den Stoffbezug der Sitze ab, putzte die Fenster innen und außen und saugte den Fußraum. Auch im Heck räumte er auf, steckte seine Tennisausrüstung in einen Beutel, Rugbystiefel und Trainingsanzug in einen anderen und seine Regensachen sowie die Jagdmontur in einen dritten.
Zwischen die Beutel legte er eine frisch gewaschene Hundedecke für Balzac. Auch ein Napf und eine Flasche Wasser lagen für ihn bereit. Wenn Bruno am Steuer saß, machte es sich Balzac meist auf dem Beifahrersitz gemütlich, von wo er auf die Straße und die Landschaft hinausblicken und Bruno zuhören konnte, der in Ermangelung eines Autoradios gern vor sich hin sang. Von gelegentlichen Kirchenbesuchen oder geselligen Abenden im Rugbyclub abgesehen, ließ Bruno seine Singstimme ausschließlich in seinem Landrover oder unter der Dusche erklingen.
Auf der Fahrt in die Stadt schien Balzac allerdings an Herrchens Version von Que reste-t-il de nos amours durchaus Gefallen zu finden. Bruno versuchte, Charles Trenets beiläufige Gesangsstimme in der Originalaufnahme von 1943 zu imitieren. Eine andere Version kam für ihn nicht in Frage, denn die Interpretationen, wie sie fast alle französischen Chansonniers im Repertoire hatten, waren ihm entweder zu langsam oder zu traurig. Wenn er an seine vergangenen Liebesgeschichten zurückdachte, wurde ihm warm ums Herz, statt dass er unter dem Verlust litt. Seine Erinnerungen machten ihn vielmehr dankbar. Und so freute es ihn auch jetzt, als er mit seinem auf Hochglanz polierten Wagen auf den Parkplatz des Tennisclubs einbog und dort Pamelas alten Citroën 2CV entdeckte.
Sie selbst stand in der Nähe und bewunderte den altehrwürdigen Citroën DS des Barons, eine Limousine, die immer noch moderner aussah als die meisten Autos auf der Straße. Ihr Besitzer lehnte an seinem Auto, mit einem am Wagendach abgestützten Ellbogen, und machte Pamela voller Stolz auf seinen zweiten Oldtimer aufmerksam, einen französischen Militärjeep, den er für die Jagd nutzte und an dessen Steuer heute Sergeant Jules von der Gendarmerie saß. Pamela winkte Bruno zu sich. Er winkte nur kurz zurück, ließ Balzac aus dem Wagen springen, der geradewegs auf sie zurannte. Er selbst aber wartete, bis seine Gäste, die hinter ihm hergefahren waren, ausgestiegen waren, um gemeinsam mit ihnen seine Freunde zu begrüßen.
Es hatten sich überraschend viele Besucher zum Oldtimer-Treffen eingefunden, wie Bruno zufrieden feststellte; und obendrein war die Zusammensetzung recht international. Sein englischer Freund Jack Crimson saß am Steuer seines Jaguar Mark 2, neben ihm auf dem Beifahrersitz seine Tochter Miranda. Horst, ein deutscher Archäologe, der zur Feier des Tages weiße Handschuhe und eine flache Schirmmütze trug, half seiner Partnerin Clothilde, der Kuratorin des Prähistorischen Museums, aus ihrem Porsche 356 Speedster. Ein holländischer Architekt im Ruhestand hatte seinen eckigen DAF66 Variomatic mitgebracht, jemand anders einen Saab älteren Baujahrs. Lespinasse von der örtlichen Kfz-Werkstatt fuhr mit einem Staubtuch über seinen perfekt restaurierten Citroën Traction Avant von 1938, den ältesten Wagen der hiesigen Oldtimer-Parade. Das auffälligste Fahrzeug war für Bruno ein weißer Jaguar E. Auf dem Beifahrersitz saß Annette, die ihm zuwinkte, am Steuer ein gutaussehender Unbekannter mit blonden Haaren.
Annette legte ihre Hand auf den Arm des jungen Mannes, als Bruno auf sie zukam, und sagte: »Darf ich vorstellen … George Young, ein Freund aus London. Er führt ein Unternehmen, das britische Fahrer als Teilnehmer an französische Rallye-Veranstalter vermittelt. Ich habe ihn bei der Rallye Circuit des Remparts in Angoulême kennengelernt und dazu überredet, mit seinem Jaguar zu uns nach Saint-Denis zu kommen. Beim Rennen morgen wird er mein Beifahrer sein.«
Ihre Stimme klang beschwingt, wie Bruno bemerkte, fast überdreht. Die beiden Männer gaben sich die Hand, und Bruno stellte seine beiden Gäste aus dem Elsass vor. Es wurde auch langsam Zeit, dass sich Annette einen Freund zulegte, dachte er. Der Engländer schien durchaus gut zu ihr zu passen. Er war ungefähr so groß wie Bruno, schlank, hatte kräftige Schultern und ein freundliches Lächeln. Als er hörte, dass die beiden Elsässer in der Nähe von Mulhouse lebten, berichtete er in akzentfreiem Französisch von seinem jüngsten Besuch – einer Pilgerreise, wie er sagte – ins dortige Musée National de l’Automobile, dessen Bugatti-Sammlung ihn sehr beeindruckt habe.
Aus den Augenwinkeln heraus sah Bruno eine Bewegung im Wald hinter dem Gelände des Tennisclubs und entdeckte Félix, der sich zwischen den Bäumen versteckt hatte. Félix war ein etwas zu klein geratener mürrischer Teenager, der die Tennis- und Rugbystunden, die Bruno den Schülern des städtischen collège anbot, geflissentlich mied. Er war das jüngste Kind seiner Eltern, die inzwischen auf die sechzig zugingen, und seine älteren Geschwister waren längst von zu Hause ausgezogen. Sein Vater war seit Jahren arbeitslos, seine Mutter, die von einer französischen Karibikinsel stammte, arbeitete als Reinigungskraft in der Schule. Ihr verdankte der Sohn eine Hautfarbe, die etwas dunkler war als Café au lait, weshalb er von manchen Mitschülern als métis gehänselt wurde. Wegen Ladendiebstahls, Vandalismus in einem minder schweren Fall und einer Spritztour in einem gestohlenen Auto hatte er schon Bekanntschaft mit der Justiz gemacht. Bruno erinnerte sich daran, dass er das Alter des Jungen feststellen wollte. Wenn er inzwischen sechzehn war, würde er bei einem weiteren Delikt womöglich in Jugendhaft kommen. Bruno bedauerte es, dem Jungen nie wirklich geholfen und in seinem Fall sogar versagt zu haben.
»Der schon wieder«, sagte Yveline, die Kommandantin der kleinen Gendarmerie von Saint-Denis, die plötzlich neben Bruno aufgetaucht war. Sie trug Uniform. »Mit dem werden wir noch einigen Ärger bekommen.«
»Den haben wir bereits«, entgegnete Bruno und bedachte Félix mit einem strengen Blick, ehe er die Freunde an den langen Biertisch vor dem Eingang des Tennisclubs führte, wo sich etliche Besucher versammelt hatten. Eine der Kellnerinnen von Fauquets Café servierte Croissants und Petits pains au chocolat und schenkte aus zwei großen Thermoskannen Kaffee aus.
Bruno hatte den Parkplatz des Clubs als Treffpunkt ausgewählt, weil er abseits der Hauptstraße und außer Sichtweite der vielen Zuschauer lag, die zur Parade erwartet wurden. Er hatte seinen Kaffee schon fast ausgetrunken, als zwei unübersehbar moderne Autos aufkreuzten. Fabiola saß am Steuer ihres neuen Renault ZOE, eines Elektrofahrzeugs; ihr folgte Alphonse, das einzige Ratsmitglied der Grünen, in einem ebenfalls mit Elektroantrieb ausgestatteten Kangoo Z.E. Alphonse hatte den Bürgermeister gebeten, der Umwelt einen Gefallen zu tun und auch Elektroautos zum ersten Concours d’Élégance von Saint-Denis willkommen zu heißen. Diese Bezeichnung stammte von Annette. Ursprünglich war nur von einer Oldtimer-Parade die Rede gewesen, die einer der Höhepunkte zur Feier des Namenstags des Stadtpatrons von Saint-Denis sein sollte.
Die eigentliche Idee zu dieser Veranstaltung ging auf den Baron zurück, der im Vorjahr während eines Abendessens im Rugbyverein darauf gekommen war. Der Bürgermeister hatte die Frage aufgeworfen, womit sich auch in der Nach- und Nebensaison Touristen nach Saint-Denis locken ließen. Als Erstes war ein Tag der offenen Tür in der städtischen Weinkellerei vorgeschlagen worden. Stéphane hatte ein besonderes Rugbymatch ins Spiel gebracht, bevor Lespinasse anregte, eine Rallye zu veranstalten. Der Baron, der immer schon gern mit seinem prächtigen Citroën angegeben hatte, meinte daraufhin, dass sich eine solche Rallye bestens mit einer Oldtimer-Parade verbinden ließe. Bruno hatte sich zurückgehalten, denn er wusste genau, welcher Plan auch immer gefasst wurde, dass er derjenige war, den der Bürgermeister mit der Durchführung beauftragen würde.
Xavier, der tüchtige Stellvertreter des Bürgermeisters, hatte unterdessen seinen Terminkalender aufgeschlagen und erinnerte die Tischrunde daran, dass an dem Wochenende, das man gerade verplanen wollte, eine Delegation der Partnerstadt von Saint-Denis aus dem Elsass erwartet werde. Wie in jedem Jahr gedachte man gemeinsam der Ankunft der Flüchtlinge aus dem Elsass in den Jahren 1939 und 1940. Die ersten waren kurz nach Kriegsausbruch im September 1939 gekommen, als die französische Regierung die Regionen nahe der deutschen Grenze evakuiert und ihre Bewohner ins Périgord verschickt hatte. Im Jahr darauf, nach der Kapitulation Frankreichs und der Besetzung von Elsass und Lothringen durch deutsche Truppen, waren zahllose Elsässer französischer Abstammung ausgewiesen worden, um Platz für deutsche Siedler zu machen. Die meisten Ausgewiesenen gelangten ins Périgord. In den vier Jahren vor der Invasion durch die Alliierten und der Befreiung Frankreichs kam es zwischen den Flüchtlingen und ihren Gastgebern natürlich zu vielen Freundschaften, und so manche Ehe wurde geschlossen. Nach dem Krieg bildeten sich etliche Partnerschaften zwischen Städten im Elsass und im Périgord.
Der Namenstag des heiligen Denis sollte also nun um einen Spezialitätenmarkt mit Händlern aus dem Elsass bereichert werden, außerdem um ein Rugbymatch zwischen der Stadtmannschaft und einem Team aus Marckolsheim und einen Besuchertag der Weinkellerei, gefolgt von einem großen Fest. Lespinasse hatte dafür gesorgt, dass Saint-Denis zur selben Zeit Austragungsort der regionalen Ausscheidungsrennen für die französische Rallye-Meisterschaft sein sollte. Pater Sentout, der Priester von Saint-Denis, wollte einen Chorgottesdienst feiern, an dem auch der Kirchenchor der Partnergemeinde beteiligt sein sollte, und Antoine, der Bootsverleiher, plante ein Wettangeln. All das hatte Bruno zu koordinieren, und zu guter Letzt sollte er auch noch für ein Feuerwerk sorgen. Dafür war er auf der Polizeiakademie natürlich nicht ausgebildet worden, doch machte ihm die Rolle eines Organisators bei solchen Veranstaltungen durchaus Spaß. Außerdem hatte er sich mit Thomas, einem elsässischen Kollegen, angefreundet, der mit seiner Frau über das Wochenende bei ihm wohnte. Bruno war seinerseits bei den Partnerstadttreffen immer deren Gast im Elsass.
»Ich sehe Sylvestre nirgends«, sagte Thomas mit besorgter Miene. »Er ist ein Freund aus Marckolsheim, und wir rechnen damit, dass er etwas ganz Besonderes für die Parade mitbringt. Hoffentlich hat er sich nicht verfahren.«
Thomas und seine Frau wanderten leidenschaftlich gern. An fast jedem Wochenende zog es sie hinaus in die Vogesen, und die Sommerferien verbrachten sie immer in den Alpen. Mit Respekt erinnerte sich Bruno an das Tempo, das sie vorgelegt hatten, als er sie bei seinem letzten Besuch auf einer Tagestour von Colmar nach Mulhouse begleitet hatte. Thomas war ein paar Jahre älter und etwas größer als Bruno, schlank und fit, und seine Frau Ingrid sah nicht weniger gesund aus, trotz der Flaschen Elsässer Weins, die sie beim Abendessen an Brunos Tisch geleert hatten.
»Ich muss noch die Fahrer instruieren«, sagte Bruno mit Blick auf seine Armbanduhr. »Es geht gleich los.«
Thomas zog sein Handy aus der Tasche, um Sylvestre anzurufen, während Ingrid Fabiola und Pamela begrüßte, die am Vorabend mit an Brunos Tisch gesessen hatten. Bruno zog einen Stoß Fotokopien aus seiner Schultertasche, auf denen der Parcours durch die Stadt eingetragen war, den die Fahrer zurückzulegen hatten. Die Kopien waren durchnummeriert gemäß der Startreihenfolge der Fahrer.
»Wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf …«, rief er laut und vernehmlich. »Der Streckenverlauf unserer Autokolonne ist auf Ihren Karten deutlich eingetragen. Er geht über alle Hauptstraßen unserer Stadt. Am Ende halten wir auf dem geraden Stück der Uferstraße vor der Brücke. Parken Sie bitte so, wie ich es Ihnen vormache: mit der Schnauze in Richtung Steinmauer und dem Heck zum Fluss hin. Lassen Sie genügend Abstand, damit die Zuschauer um die Fahrzeuge herumgehen können. Und achten Sie bitte darauf, dass sich keine vorwitzigen Kinder ans Steuer setzen. Ich fahre voraus, damit niemand verlorengeht. Der Baron bildet mit seinem Citroën den Schluss. Und bitte halten Sie zwei Wagenlängen Abstand. Danke.«
In diesem Augenblick bog hupend ein Lastwagen um die Ecke, eine Art Möbeltransporter, der viel zu groß war, um auf dem bereits überfüllten Parkplatz wenden zu können. Zwei Männer in weißen Overalls und mit weißen Schirmmützen und Schutzbrillen sprangen aus dem Fahrerhaus, winkten der Menge zu und eilten ans Heck des Transporters, wo sie zwei große Flügeltüren öffneten und eine lange Rampe hervorzogen, über die sie den Laderaum bestiegen. Wenig später hörte Bruno einen großvolumigen Motor anspringen, der nach mehreren Fehlzündungen allerdings bald wieder verstummte. Bei einem zweiten Startversuch qualmte es aus dem Laderaum heraus, und dann rollte langsam ein hellblauer offener Rennwagen aus einer anderen Zeit über die Rampe.
Die Windschutzscheibe war nur eine Handbreit hoch, und die Motorhaube machte nicht weniger als zwei Drittel der gesamten Wagenlänge aus. Die Vorderräder ragten über den flachen, hufeisenförmigen Kühler hinaus. Nach hinten lief die Karosserie keilförmig zusammen und bildete eine Heckflosse so scharf wie ein Beil. Kotflügel gab es keine. Ein Reserverad war seitlich mit Lederriemen befestigt. Der Motor ließ ein mächtiges Brüllen vernehmen, als der Pilot kurz das Gaspedal durchdrückte und den Wagen wendete, so dass er mit der Schnauze vor den Zuschauern zu stehen kam. Jetzt konnte Bruno auch den roten Schriftzug am oberen Rand des Kühlers entziffern: Bugatti.
»Sylvestre liebt solche spektakulären Auftritte«, bemerkte Ingrid trocken, als der Motorenlärm zu einem kehligen Grummeln abebbte. »Den hat er sich letztes Jahr zugelegt, für siebenhunderttausend Euro. Und das sei noch ein Schnäppchen gewesen, sagt er.«
»Ein Typ 35 aus dem Jahr 1928, der Wagen, der den Namen Bugatti berühmt gemacht hat«, erklärte Thomas fast ehrfürchtig. »Es war seinerzeit eins der wenigen Autos, die sowohl auf öffentlichen Straßen als auch auf Rennstrecken gefahren wurden. Trotz seines italienischen Namens ist es ein französisches Auto, entworfen und gebaut im Elsass.«
»Es hat jedes Rennen gewonnen«, schwärmte George Young, Annettes Freund. »Allein die Targa Florio fünfmal hintereinander.« Er trat vor, um dem Fahrer aus dem Cockpit zu helfen, und sofort kam Bewegung in die Menge, die sich neugierig um den Oldtimer scharte.
»Willkommen«, grüßte Bruno und reichte dem Fahrer eine fotokopierte Straßenkarte. »Es ehrt uns, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug gekommen sind. Es trägt die Nummer 19 und ist das vorletzte der Parade. Sie fahren vor der DS und folgen der Traction Avant.«
»Danke, und bitte nennen Sie mich Sylvestre«, sagte der Mann in Weiß und schob seine Schutzbrille in die Stirn. Er hatte hellblaue Augen, eine markante Nase und ein kräftiges Kinn. Sein Händedruck war übertrieben kräftig, sein Lächeln aber sehr freundlich. Bruno schätzte ihn auf Mitte dreißig.
»Das ist mein Freund Freddy, er ist aus Indien«, stellte Sylvestre seinen Begleiter vor. »Wir freuen uns, hier zu sein. Meine Großmutter hat viel von Saint-Denis erzählt. Sie wurde ganz in der Nähe geboren, und ich will die Gelegenheit nutzen, das Häuschen in Augenschein zu nehmen, das sie mir hinterlassen hat.« Mit leicht überheblicher Miene ließ er seinen Blick über die Menge schweifen und fragte laut: »Und welche dieser charmanten Damen würde gern neben mir im Bugatti sitzen?« Er entdeckte Fabiola, die allein stand. »Wie wär’s mit Ihnen, Mademoiselle?«
»Nein danke, ich fahre meinen eigenen Wagen«, erwiderte sie kühl. »Es ist der neue Renault. An der Parade nehmen auch Elektrofahrzeuge teil.«
»Wunderbar«, sagte Sylvestre und schaute Bruno an. »Wäre vielleicht Platz für einen weiteren Teilnehmer? Ich habe noch einen zweiten Wagen mitgebracht, einen Tesla, den Freddy steuern könnte.«
Von allen unbeachtet, war Félix näher gekommen und stand jetzt bewundernd neben dem Bugatti.
»Na, junger Mann?«, fragte Sylvestre, »hättest du Lust, eine Runde mit mir zu drehen?«
Félix ließ sich nicht zweimal bitten, stieg freudestrahlend in den Wagen und schaute, als er Platz nahm, respektvoll zu dessen Besitzer auf.
Bruno hatte von Tesla gehört, dem amerikanischen Hersteller von Elektroautos, deren Motoren von revolutionären neuen Batterien gespeist wurden. Gesehen hatte er ein solches Fahrzeug aber noch nie. Freddy eilte über die Rampe zurück in den großen Möbeltransporter und rangierte einen schnittigen blauen Sportwagen ans Licht. Als Sylvestre den Bugatti-Motor abstellte, bemerkte Bruno, wie gespenstisch leise dieser Tesla war.
2
Als die Parade zu Ende war und die Fahrzeuge vor der Ufermauer Aufstellung genommen hatten, spürte Bruno sein Handy vibrieren. Im Lärm der Menge, die die Steinstufen herabgeeilt kam, um die Oldtimer zu bestaunen, war es ihm kaum möglich, Dr. Gelletreau zu verstehen, der ihm einen Todesfall meldete. Eilig entfernte sich Bruno von dem Tumult und fragte noch einmal nach.
Der Arzt berichtete ihm, dass ein älterer Mann aus Savignac-de-Miremont von seiner Frau nach deren Rückkehr von einem Besuch bei ihrer Schwester leblos aufgefunden worden war. Sie hatte Gelletreau sofort verständigt, der als wahrscheinliche Todesursache einen Herzinfarkt vermutete. Savignac-de-Miremont gehörte zwar nicht zu Saint-Denis, doch kümmerte sich Bruno, wenn er darum gebeten wurde, auch um die Erfassung von Geburten und Todesfällen aus umliegenden Kommunen. Er suchte in der Menge nach dem Bürgermeister, um sich bei ihm zu entschuldigen, und fand ihn vor dem Bugatti, den er wie ein kleiner Junge mit großen Augen bestaunte. Bruno vertraute Thomas und Ingrid seinen Hund an und ging zur Gendarmerie, wo er seinen Polizeitransporter geparkt hatte.
Die Kommune von Savignac bestand hauptsächlich aus Bauernhöfen, Wäldern und Heideland. Einschließlich des winzigen Dorfs lebten in ihr knapp hundert Personen. Henri-Pierre Hugon, der nun tot war, war zum dritten Mal in den Gemeinderat gewählt worden. Seinen Wohnsitz hatte Bruno schnell gefunden. In ländlichen Gegenden errichten Freunde und Nachbarn vor dem Haus eines jeden neugewählten Ratsmitglieds einen Pfahl, geschmückt mit Trikolore, Lorbeerkranz und einem Schild mit der Aufschrift »Ehre denen, die wir wählen«. Bruno folgte Dr. Gelletreaus Wegbeschreibung, bis er einen solchen Pfahl entdeckte, an dem eine verblichene französische Fahne hing. Am Straßenrand parkte der alte Citroën des Arztes. Er kam selbst zur Tür, als Bruno vorfuhr.
»Wie läuft’s mit der Oldtimer-Parade?«, fragte Gelletreau und reichte Bruno die Hand. »Allzu lange werden wir hier wohl nicht bleiben müssen. Madame Hugon trägt den Tod ihres Mannes mit Fassung. Sie macht uns gerade Kaffee. Sobald wir hier fertig sind, rufe ich den Bestatter.«
»Wie lange ist er tot?«, erkundigte sich Bruno.
»Er starb in seinem Arbeitszimmer, das Licht brannte noch. Ich schätze, es war irgendwann gestern Abend. Die Zentralheizung war eingeschaltet, deshalb verrät uns die Körpertemperatur nicht viel. Er hatte Herzprobleme und war seit einigen Jahren bei mir in Behandlung, weil er in Périgueux gearbeitet hat. Er nahm Betablocker und war, solange ich ihn kannte, sehr übergewichtig, mehr noch als ich. Sie kannten ihn, nicht wahr?«
»Nur flüchtig, eigentlich nur über die SHAP. Und ich habe ein Exemplar seines Buches bei mir zu Hause«, antwortete Bruno. »Ich weiß, dass er von seiner Arbeit als Forscher gelebt hat. Seine Frau kenne ich gar nicht.«
Mit SHAP meinte Bruno die Gesellschaft für Geschichte und Archäologie im Périgord, einen Verein begeisterter Lokalhistoriker, die einmal im Monat in einem prächtigen, über vierhundert Jahre alten Stadthaus nahe dem Zentrum von Périgueux zusammenkamen und zu Vorträgen einluden. Bürgermeister Mangin war seit Jahren Mitglied und hatte Bruno überredet, dem Verein beizutreten, wofür er dankbar war. Bruno versuchte, keine Sitzung zu versäumen, und erinnerte sich gern an einzelne Vorträge, zum Beispiel über die Ernährung der prähistorischen Bewohner der Region, die Entwicklung mittelalterlicher Burganlagen und über die kurze Phase im 16. Jahrhundert, als Bergerac die Hauptstadt Frankreichs gewesen war oder zumindest die der Protestanten unter König Heinrich IV. Von dem nun Verstorbenen hatte Bruno einen denkwürdig trockenen Vortrag über die Stadt Périgueux zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gehört, eine so langweilige Abhandlung, dass viele Zuhörer darüber eingeschlafen waren. Die SHAP hatte Hugon auch geholfen, sein Buch, eine Enzyklopädie über die Mitglieder der Résistance im Périgord, zu veröffentlichen. Vor seiner Pensionierung war er zeit seines Berufslebens Archivar des Départements gewesen, und auch in seiner Rolle als freier Historiker und Forscher hatte er von seinen alten Quellen immer wieder Gebrauch gemacht. Stets akkurat gekleidet, war er, wie Bruno gehört hatte, ein überaus gewissenhafter und akribischer Sachbearbeiter gewesen, der bei den Anwälten und Notaren der Gegend in hohem Ansehen stand.
»Wie alt war er?«, fragte Bruno.
»Nächsten Monat wäre er fünfundsiebzig geworden. Er hat sich kaum bewegt, hockte meist in diesen düsteren Archiven und hat auch noch geraucht.«
Bruno sprach Madame Hugon sein Beileid aus, nahm ihr Angebot einer Tasse Kaffee dankend an und fragte, wann sie ihren toten Mann aufgefunden habe.
»Vor ungefähr einer Stunde, als ich zurückgekommen bin; es kann auch ein bisschen länger her sein«, antwortete sie. Madame Hugon war sehr gefasst und verriet weder Schock noch Trauer. Dem Anschein nach ebenfalls Mitte siebzig, machte sie einen recht gesunden Eindruck. Sie hatte schlohweiße Haare, war klein und schlank, trug flache Schnürschuhe, einen dunklen Rock und eine hellblaue Bluse.
»Ich war ein paar Tage bei meiner Schwester in Sarlat«, erklärte sie. »Sie hat ein neues Enkelkind. Mein Neffe hat mich abgeholt, weil er die Oldtimer-Parade sehen wollte und Henri unser Auto brauchte. Er hatte einen größeren Forschungsauftrag und musste immer wieder nach Périgueux und Bordeaux fahren. Ich habe Mahlzeiten im Voraus für ihn gekocht und eingefroren.«
Ihr Neffe hatte sie vor dem Haus abgesetzt. Die Eingangstür, berichtete sie, sei nicht verschlossen gewesen. Sie habe vergeblich nach ihrem Mann gerufen und ihn dann tot auf dem Boden neben seinem Schreibtisch liegen sehen. Sie habe seine Wange berührt, festgestellt, dass sie kalt war, und sofort Dr. Gelletreau angerufen.
»Und nicht die urgences?«, fragte Bruno. Die Feuerwehr von Saint-Denis sorgte auch für Krankentransporte.
»Das hatte keinen Sinn mehr. Er war offenbar schon seit Stunden tot. Der Doktor hatte ihn immer wieder gewarnt, dass so etwas passieren könnte, aber Henri wollte einfach nicht hören.« Sie zuckte mit den Schultern und sah Gelletreau an. »Mein vorgekochtes Essen hat er nicht angerührt, und dem schmutzigen Geschirr in der Spüle nach zu urteilen hat er nur von Steaks und Bratkartoffeln gelebt, wovon Sie ihm ausdrücklich abgeraten haben.«
»Ich würde gern einen Blick in sein Arbeitszimmer werfen«, sagte Bruno. »Was war das für ein Forschungsprojekt, an dem er gearbeitet hat?«
»Seit über zwei Monaten hat er daran gesessen, fünf Tage in der Woche. Worum es dabei ging, weiß ich nicht. Es muss irgendetwas mit dem Krieg und der Résistance zu tun gehabt haben. Und er sagte, er werde einiges daran verdienen, so viel, dass wir im kommenden Winter Urlaub in der Sonne machen könnten. Für seine Forschungsarbeit bekam er normalerweise hundertfünfzig Euro am Tag. Ich habe schon immer nach Marokko reisen wollen und mich richtig darauf gefreut.«
»Wissen Sie, wer ihm den Auftrag gegeben hat?«, fragte Bruno. Sie schüttelte den Kopf, und Bruno rechnete im Stillen nach, als Gelletreau ihn ins Arbeitszimmer führte, wo immer noch die Schreibtischlampe brannte. Wenn Hugon seit zwei Monaten an dem Forschungsprojekt gearbeitet hatte, würde er inzwischen an die sechstausend Euro verdient haben, eine hübsche Summe.
Hugons massiger Körper lag neben einem umgekippten Stuhl. Ein ausgestrecktes Bein verschwand unter dem Schreibtisch. Die rechte Hand umklammerte die Knopfleiste seines Hemdes. Der Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass er unter Schmerzen gestorben war: Die Lippen spannten sich über gebleckten Zähnen. Auf dem Schreibtisch befanden sich eine Lampe, ein altmodischer Telefonapparat, ein Notizblock samt Kuli sowie ein zugeklappter Laptop. Auf einem kleinen Beistelltisch stand ein Drucker, ausgeschaltet und ohne Papier.
Hinweise auf Hugons Forschungsarbeit fanden sich nicht. Die Schubladen zweier Rollcontainer, die vor der Wand standen, waren geschlossen. Bruno streifte sich ein Paar Latexhandschuhe über und öffnete eine Schublade nach der anderen. Die meisten der darin enthaltenen Akten waren alphabetisch geordnet; es handelte sich offenbar um ein Namensregister der in seiner Enzyklopädie aufgeführten Personen. Eine Akte mit der Aufschrift »Laufende Projekte« war leer. Die Kontoauszüge zeigten keine ungewöhnlichen Bewegungen, nur den Eingang der Rentenbezüge, Erstattungen der Krankenversicherung und ein paar bescheidene Überweisungen von Anwälten, die damit wahrscheinlich irgendwelche Recherchen vergütet hatten. Auf annähernd sechstausend Euro summierten sie sich jedenfalls nicht. Bruno fragte sich, in welchem Aktenordner Hugon wohl seine Steuerunterlagen aufbewahrt hatte.
In dem Bücherschrank, der eine Reihe stark abgegriffener Nachschlagewerke enthielt, gab es zwei Regalbretter voller Kladden, die in schwarzes Leder eingebunden waren. Bruno blätterte mehrere durch. Hugons Handschrift war sauber und akkurat, jeder Eintrag datiert. Er hatte die einzelnen Hefte offenbar chronologisch geordnet. Das letzte endete mit einem Eintrag vom 30. Juli des laufenden Jahres. Ein jüngeres fand Bruno nicht, nur zwei, in die noch kein Wort geschrieben war.
Im Papierkorb lag nichts als ein leerer Umschlag von einer Telefongesellschaft, abgestempelt vor zwei Tagen, was vermuten ließ, dass er am Vortag zugestellt worden war. Nach einem Ordner für die Telefonrechnungen brauchte Bruno nicht lange zu suchen. In den vergangenen zwei Monaten hatte Hugon sehr viel häufiger telefoniert als sonst, unter anderem mit einer Mobilfunknummer, die in früheren Rechnungen nicht auftauchte. Bruno zog sein eigenes Handy aus der Tasche, wählte die Nummer und hörte eine automatische Stimme sagen, dass diese Rufnummer nicht vergeben sei. Seltsam. Über die Telefonauskunft erfuhr er, dass sie zu einer Prepaid-Handykarte gehörte.
Bruno ging zu Madame Hugon und fragte, ob sie das Passwort für den Laptop kannte, was sie verneinte. Auch mit der Rufnummer wusste sie nichts anzufangen. Sie fügte hinzu, dass ihr Mann sein Tagebuch und seine Sparbücher in der Schreibtischschublade aufbewahrt, sie aber, wenn er ins Archiv gefahren sei, immer in seiner Aktentasche mitgenommen habe.
»In der Schublade sind sie nicht«, sagte Bruno. »Und wo könnte die Aktentasche sein?«
»Im Auto vielleicht«, antwortete sie schulterzuckend.
So war es, doch enthielt sie nichts außer einem Notizblock, mehreren Stiften, einem Exemplar der Sud Ouest vom Vortag und einer halbleeren Zigarettenschachtel der Marke Royale. Bruno kehrte ins Arbeitszimmer zurück, wo er die Kleidung des Toten durchsuchte und ein Portemonnaie in der Gesäßtasche von dessen Hose fand, darin das Übliche: Personalausweis, Karten der Krankenversicherung und seiner Bank sowie fünf nagelneue 200-Euro-Scheine. Von der Witwe ließ er sich zum gemeinsam genutzten Kleiderschrank im Schlafzimmer führen, wo er sämtliche Jacketttaschen durchsuchte und schließlich auch die Schublade des Nachttischchens. Zu finden war nichts.
»Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass in Ihrer Abwesenheit jemand Fremdes im Haus war?«, fragte Bruno.
Sie dachte einen Moment lang nach. »Mir ist nichts aufgefallen. Abgesehen von meiner Schwester haben wir nur selten Gäste.«
»Hatten Sie in den vergangenen Tagen ungewöhnlichen Besuch?« Sie schüttelte den Kopf. »Schien Ihr Mann besorgt zu sein?«
»Ganz und gar nicht. Er war froh, an diesem neuen Forschungsprojekt arbeiten zu können. Beschäftigt zu sein ging ihm über alles. Faulenzen kam für ihn gar nicht erst in Frage, nicht einmal fernsehen mochte er. Am liebsten kramte er in alten Archiven herum, und wenn er dafür noch bezahlt wurde – umso besser.«
»Hat er sich womöglich übernommen?«, fragte Gelletreau.
»In letzter Zeit hat er jedenfalls mehr gearbeitet als sonst, bis tief in die Nacht hinein, und das Tag für Tag. Aber das war nicht ungewöhnlich. Wenn er sich in irgendwas verbissen hatte, so wie in dieses Buch, gab es für ihn nichts anderes. Unter Stress schien er jedenfalls nicht gelitten zu haben. Er hat seine Arbeit geliebt. Es hat ihn aufgemuntert, wenn er einer Sache auf der Spur war.«
»Hat er am Laptop gearbeitet oder mit der Hand geschrieben?«
»Sowohl als auch. Er hatte immer eine schwarze Kladde auf dem Schreibtisch liegen.«
»Im Bücherschrank steht eine mit der Aufschrift ›Laufende Projekte‹, doch in der steht nichts drin. Der letzte Eintrag in der jüngsten Kladde datiert auf einen Tag im Juli. Wo könnten die Notizen sein, die er sich im August und September gemacht hat?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat er sie im Archiv in Périgueux liegenlassen. Da fühlte er sich ja wie zu Hause.«
Bruno ging in die Küche und musterte das schmutzige Geschirr in der Spüle und auf dem Abtropfbrett. Offenbar hatte Hugon seiner Frau den Abwasch überlassen wollen. Da waren vier oder fünf Teller mit Schmierflecken, mehrere Weingläser und eine Schale, in der Suppe oder Müsli gewesen sein mochte.
»Merkwürdig. Er nahm sonst immer nur die guten Kaffeetassen«, sagte seine Frau, die nun zum ersten Mal seit seiner Ankunft überrascht klang. Neben der Spüle standen drei gebrauchte Kaffeetassen, ineinandergestapelt, als wären sie gleichzeitig benutzt worden.
»Hat er viel getrunken?«, fragte Bruno mit Blick auf drei leere Rotweinflaschen einer gewöhnlichen Marke, die Bruno vom Supermarkt her kannte.
»Vorm Abendessen hat er sich gern einen Ricard genehmigt und zu den Mahlzeiten ein oder auch zwei Gläser Rotwein. Dr. Gelletreau hat ihm geraten, weniger zu trinken.«
»Wie lange waren Sie fort?«
»Drei Nächte.«
»Dann hat er also in drei Tagen drei Flaschen geleert. Das ist nicht wenig.«
Sie runzelte angewidert die Stirn. »Normalerweise hat er mehr getrunken, wenn ich nicht da war, und Steaks gegessen, anstatt aufzutauen, was ich für ihn gekocht und eingefroren habe.«
Dr. Gelletreau nickte. »Ja, er war nicht gerade das, was man einen gehorsamen Patienten nennt. Meine Ratschläge hat er wohl nicht besonders ernst genommen.«
Bruno bedankte sich bei Madame Hugon und fragte, ob er für sie irgendjemanden anrufen solle, ihre Schwester vielleicht oder einen Priester? Sie schüttelte den Kopf. Die Schwester habe sie bereits verständigt, sagte sie, und ihr Mann sei kein Kirchgänger gewesen. Sobald der Bestatter den Leichnam abgeholt habe, werde sie wieder nach Sarlat fahren und bei ihrer Schwester bleiben.
»Das Haus werde ich wahrscheinlich verkaufen«, fügte sie hinzu.
Im Garten fragte Bruno Dr. Gelletreau, ob er die Sterbeurkunde schon unterschrieben habe.
»Nein, ich wollte damit warten, bis Sie kommen«, antwortete der Arzt ein wenig steif. Es war schon vorgekommen, dass er, zu einer Leiche gerufen, eine natürliche Todesursache attestiert und Bruno wenig später entdeckt hatte, dass die Person ermordet worden war.
»Ich fürchte, da stimmt was nicht«, sagte Bruno. »All das Bargeld in seiner Brieftasche, die verschwundenen Dokumente und diese Telefonanrufe …«
»Und die drei Kaffeetassen«, fügte Gelletreau hinzu. »Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass er an einer Herzattacke gestorben ist. Sie haben ja die Hand an der Brust gesehen. Für mich sieht das nicht nach einem Tötungsdelikt aus. Hugon war in hohem Maße infarktgefährdet.«
»Wenn also seine Schwägerin bestätigen kann, dass seine Frau bei ihr in Sarlat war …«, dachte Bruno laut nach.
»Glauben Sie etwa an ein Fremdverschulden?«
Bruno warf einen Blick zurück auf das Haus, holte sein Handy aus der Tasche und rief seinen Freund Jean-Jacques, den Chefermittler des Départements, an, um ihm von seinem Verdacht zu berichten.
»Was sagt der Doktor?«, fragte Jean-Jacques.
»Natürliche Todesursache. Sieht alles nach Herzinfarkt aus.«
»Und seine Frau? Ist sie derselben Meinung?«
»Ja. Sie war ein paar Tage bei ihrer Schwester in Sarlat und hat ihn bei ihrer Rückkehr in seinem Arbeitszimmer leblos vorgefunden. Etwas anderes als eine natürliche Todesursache scheint ihr nicht in den Sinn gekommen zu sein. Ich bin offenbar der Einzige, der glaubt, dass an der Sache etwas faul sein könnte.«
»Merde, es gibt keinerlei Anzeichen eines Kampfes, Arzt und Witwe gehen von einem natürlichen Tod aus, und Sie wissen genau, was eine Autopsie kostet und dass wir uns das nicht leisten können. Jedem anderen als Ihnen, Bruno, der auf einen bloßen Verdacht hin …« Jean-Jacques unterbrach sich. »Wer ist der Arzt? Fabiola?«
»Dr. Gelletreau. Er wäre bereit, die Sterbeurkunde zu unterzeichnen und als Todesursache Herzinfarkt zu attestieren.«
Jean-Jacques seufzte. »Holen wir uns eine zweite Meinung ein. Soll sich Fabiola den Toten ansehen, bevor der Bestatter kommt. Wenn sie eine Autopsie für angemessen hält, bin ich einverstanden. Übrigens, haben Sie irgendwas von Isabelle gehört?«
»Schon länger nicht«, antwortete Bruno vorsichtig. Jean-Jacques war Isabelle auf seine etwas väterliche Art fast ebenso zugetan wie Bruno und behauptete, sie sei die beste Polizistin, die er je ausgebildet habe. Er hoffte immer noch, dass sie auf eine Fortsetzung ihrer bislang kometenhaften Karriere verzichtete und ins Périgord zurückkehrte, um seine Nachfolgerin als Chefermittler zu werden. Bruno, der immer noch von ihr träumte und den leidenschaftlichen Sommer mit ihr nicht vergessen konnte, betrachtete sie als die große, aber verlorene Liebe seines Lebens. Über eine mögliche Rückkehr ins beschauliche Périgord gab er sich keinen Illusionen hin.
»Aus Paris ist zu hören, dass sie wegen einer größeren Operation in Luxemburg in Schwierigkeiten geraten ist und ein paar Diplomaten verärgert hat.«
»Davon weiß ich nichts«, erwiderte Bruno, bemüht, einen neutralen Ton anzuschlagen. Ihm war klar, dass er nie aufhören würde, sich um sie zu sorgen. »Aber Sie kennen ja Isabelle, sie schafft es bestimmt, auch daraus ihren Vorteil zu ziehen.«
»Ich dachte, vielleicht hat der brigadier das ein oder andere Wort fallenlassen«, hakte Jean-Jacques nach. »Er meldet sich schließlich häufiger bei Ihnen als bei mir, wofür ich ihm im Prinzip dankbar bin. Wo er ist, gibt’s meist Scherereien.«
»Auch von ihm habe ich eine Weile nichts gehört.« Der brigadier, ein hochrangiger Funktionär im Innenministerium mit weitgefächerten Aufgaben in Sicherheitsangelegenheiten, war Isabelles Vorgesetzter gewesen, bevor sie sich von Eurojust in Den Haag hatte anheuern lassen. »Und diplomatische Probleme liegen wohl deutlich über meiner Gehaltsklasse.«
»Über meiner auch. Wie dem auch sei, Isabelle hat Ihrem Urteil immer vertraut, und auch mir ist inzwischen klar, dass viele Ihrer Ahnungen nicht von ungefähr sind«, sagte Jean-Jacques. »Wenn Fabiola meint, dass ein genauerer Blick nötig ist, werde ich einer Autopsie zustimmen.«
3
»Ein Erfolg auf der ganzen Linie«, sagte der Bürgermeister. Mit einem Glas Wein in der Hand lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück und blickte zufrieden über die vollbesetzten Tische in der Winzerei von Saint-Denis. »Dank dieses alten Bugatti haben es unsere Oldtimer bis in die Fernsehnachrichten geschafft, und Fauquet hatte in seinem Café den ganzen Tag über Hochbetrieb. Und was da an Geld zusammengekommen ist! Das müssen wir jetzt jedes Jahr machen.«
Bruno sah wieder mehr Arbeit auf sich zukommen, war aber auch froh über den großen Anklang, den die Oldtimer-Parade gefunden hatte, und stieß mit dem Bürgermeister an. Mauricette hatte ihm freudestrahlend berichtet, dass ihr Hotel zu dieser Jahreszeit noch nie so gut belegt gewesen sei. Mit einem Spezialangebot für das Wochenende hatte sie viele Gäste angelockt, die nach dem Abendessen in der Winzerei nicht noch nach Hause fahren und riskieren wollten, in eine Alkoholkontrolle zu geraten. Zur Rallye am nächsten Tag wurden noch sehr viel mehr Besucher erwartet, zumal die lokalen Rundfunkanstalten Werbung für den Concours machten. Bruno hatte fast den ganzen Freitag darauf verwendet, die Sicherheitsbarrieren an der Rennstrecke zu überprüfen. Nach dem Rennen würde er den Bauern helfen müssen, die Strohballen, die an jeder Kurve aufgestapelt waren, wegzuschaffen.
Auf ein Zeichen von Julien, dem Geschäftsführer der städtischen Winzerei, erhob sich der Bürgermeister nun von seinem Platz und bestieg das Podest vor den am Ende des Raums aufgereihten Weinfässern. Für die Band mit Schlagzeug, Gitarren und Keyboard blieb nicht viel Platz, geschweige denn fürs Tanzen, da auch die anderen Wände mit Fässern vollgestellt waren. Dazwischen verteilten sich lange Tischreihen und Stühle, alle besetzt mit Gästen, von denen jeder zwanzig Euro bezahlt hatte für das dîner, bestehend aus Suppe, pâté, Entenbraten, Käse mit Salat und einem Stück Walnusstorte. Im Preis eingeschlossen war selbstgekelterter Wein, soviel man trinken mochte. Die meisten Gäste hatten auch Lose für die Tombola gekauft. Sechs Stück kosteten fünf Euro.
Der Bürgermeister bat um Ruhe, indem er mit einer Gabel an eine leere Flasche schlug, und kündigte die Ziehung der Lose an. Der erste Preis war eine Kiste des hiesigen Weins, der zweite sechs Flaschen. Außerdem gab es mehrere dritte Preise zu je zwei Flaschen.
»Darf ich unsere bezaubernden Damen jetzt nach vorn bitten, damit sie die Gewinnerlose ziehen?«, sagte der Bürgermeister, worauf Fabiola, Annette und Florence zu ihm auf die Bühne kamen. Fabiola schüttelte grinsend den Kopf über Mangin und seine altmodische Art, sie und die beiden anderen Frauen vorzustellen: Fabiola als eine der Ärztinnen der Stadt, Annette als Staatsanwältin und erfolgreiche Rallye-Fahrerin sowie Florence als Naturkundelehrerin des örtlichen Gymnasiums.
»Solche Lehrer, Ärzte oder Staatsanwälte gab es nicht, als ich noch ein Junge war«, sagte der Bürgermeister. »Weil wir alle Annette viel Glück für die morgige Rallye wünschen, soll sie das Los für den ersten Preis ziehen. Damit wird sie sich noch ein Weilchen gedulden müssen, denn ich möchte Florence bitten, zunächst mit der Ziehung der dritten Preise zu beginnen. Jeder Gewinner bekommt eine Flasche unseres exzellenten roten Vézère und eine Flasche unseres ebenfalls sehr köstlichen trockenen Weißweins. Anschließend zieht Fabiola das Los, das den zweiten Preis gewinnt.«
Dieser und die dritten Preise gingen an Fremde, was gut war, wie Bruno fand, der hoffte, dass auch den ersten Preis ein Tourist gewinnen würde. Die einzelnen Gewinner wurden von ihren jeweiligen Tischnachbarn mit großem Hallo gefeiert, doch dann wurde es still, als Annette wieder in den Eimer griff, um das Siegerlos zu ziehen. Sie las die Nummer laut vor.
»Das bin ich«, rief eine Männerstimme, und Bruno sah, wie sich Sylvestre, der Eigentümer des Bugatti, von seinem Platz erhob und die Hände in Siegerpose über dem Kopf zusammenführte. Über die Tische hinweg rief er dem Bürgermeister zu: »Lassen Sie noch einmal ziehen. Ich verzichte auf meinen Gewinn.« Er schaute sich grinsend im Weinkeller um. »Ich darf nicht trinken, ich muss noch ans Steuer.«
Unter Beifallsbekundungen nahm er wieder Platz. Annette zog ein weiteres Los, und diesmal applaudierte auch Bruno, als seine Freundin Ingrid aufstand, um sich als Gewinnerin zu erkennen zu geben. Der Bürgermeister betonte, wie sehr er sich darüber freute, dass der Preis an jemanden aus der Partnerstadt im Elsass ging, und fügte hinzu, dass die Besucherdelegation am nächsten Morgen auf dem Markt ihre Weine, Kunstgewerbe und Spezialitäten anbieten wolle.
»Nach dem Rennen werden dann unsere Gastronomen und Erzeuger auf dem Platz vor dem Rathaus ihre Spezialitäten anbieten wie an jedem Dienstagabend im Juli und August«, fuhr er fort. »Grillhähnchen, frisch aus der Rotisserie, auf offenem Feuer gegrillten Speck, Weinbergschnecken, moules frites, dazu Salate, Pizza, Apfeltarte und Wein aus unserer Kellerei. Wir sehen uns also hoffentlich morgen wieder. Aber jetzt wird erst einmal getanzt.«
Der Bürgermeister überließ das Podium nun der Rockband von Saint-Denis. Lespinasse von der Kfz-Werkstatt startete mit einem Trommelwirbel. Sein Sohn Éduard war am Bass. Robert, der singende Architekt, spielte Rhythmusgitarre, Patrice vom Maison de la Presse die Leadgitarre. Jean-Paul, der Organist und Klavierlehrer von Saint-Denis, hatte sich sein Akkordeon umgehängt und ließ das Thema von Mon Amant de Saint-Jean erklingen. Diesen Klassiker aus den bal-musette-Tanzhäusern der 1930er Jahre kannten alle, zumal er, jüngst wieder aufgelegt, eine der bestverkauften CDs in Frankreich war. Bruno führte Florence aufs Parkett. Ihnen folgten Fabiola und ihr Partner Gilles, Thomas und Ingrid wie auch Annette und ihr Engländer, und plötzlich war die Tanzfläche voll. Unter lautem Beifall gesellten sich auch Bürgermeister Mangin und seine Freundin Jacqueline dazu, als Robert davon sang, wie sehr das Mädchen den jungen Mann liebte, obwohl sie wusste, dass er ihr etwas vormachte.
Die Band spielte ihr übliches Repertoire, einen Mix aus Chansons von Edith Piaf, Hits der Sechziger sowie Songs von Johnny Cash und Francis Cabrel. Florence und Annette sagten schließlich, dass sie Durst hätten, und zogen die beiden Männer zurück an ihren Tisch, um sich erneut Wein einzuschenken. Annette und Young hielten sich bei der Hand, als sie Platz genommen hatten, und Bruno fragte sich, ob Young wusste, dass Annette die Tochter eines extrem reichen und zwielichtigen Finanziers war.
»Ich bin so froh, dass Sylvestre seinen Bugatti mitgebracht hat. Was für ein Schmuckstück!«, rief Annette über die Musik hinweg und schaute Young liebevoll in die Augen. »Wie haben Sie ihn dazu überreden können?«
»Er musste erst gar nicht lange überredet werden«, antwortete Young. »Er wollte ohnehin hierher, um sich ein Familienanwesen anzusehen, und die Chance, den Concours d’Élégance zu gewinnen, war einfach zu verlockend für ihn. Mag sein, dass außerhalb des Périgord kaum jemand von dieser Rallye in Saint-Denis gehört hat, aber er glaubt, dass sein Bugatti durch den Titel noch an Wert gewinnen wird.«
»Wenn ich so einen Wagen hätte, würde ich ihn nie hergeben«, sagte Florence so entschieden, dass Bruno und die anderen sie verwundert anschauten. »Eigentlich bin ich kein Fan von Autos, und mir gefällt auch nicht, unter welchen Gesichtspunkten sie üblicherweise betrachtet werden, nämlich vor allem als Kraftmaschinen. Das ist mir einfach zu schlicht. Diesen Bugatti hingegen finde ich ausgesprochen schön.« Sie stockte, warf dann ihren Kopf in den Nacken und lachte, um die plötzlich allzu ernst gewordene Stimmung wieder aufzulockern. »Wie dem auch sei, ich würde mich gar nicht trauen, so ein Ding zu steuern. Aber zugegeben, der Sound des Motors hat was Verführerisches.«
»Schlappe siebenhunderttausend, und er gehört Ihnen«, grinste Bruno. »Wenn ich richtig verstanden habe, war das der Kaufpreis. Ich hatte keine Ahnung, wie teuer so ein Auto ist. Wie viel müsste ich für Ihren Jaguar E hinblättern?«, fragte er Young.
»Ich habe ihn vor vielen Jahren als Wrack für achttausend Euro erstanden und selbst restauriert. Heute könnte ich an die hundert Riesen dafür verlangen«, antwortete Young. »Da stecken Jahre Arbeit drin. Nur so konnte ich ihn mir leisten. Der alte Porsche, der an der Parade teilgenommen hat, wird wahrscheinlich einen ähnlichen Preis haben. Wenn Sie Ihren Landrover herausputzen, könnten Sie auch eine schöne Summe dafür bekommen. Wie alt ist er?«
»Baujahr 1954«, antwortete Bruno. Er erinnerte sich, von Hercule, dem Freund, der ihm den Wagen vermacht hatte, gehört zu haben, dass er als französischer Soldat im Indochinakrieg gekämpft habe, als sein Landrover gebaut worden sei. Bruno wusste, dass das Jahr 1954, das Jahr der Niederlage der Franzosen bei Dien Bien Phu, für seinen Freund von besonderer Bedeutung gewesen war. Hercule hatte den Wagen Jahrzehnte später gekauft, als er sich im Périgord zur Ruhe gesetzt hatte, um nur noch zu jagen und Trüffel anzubauen.
»Wenn er wieder voll in Schuss wäre, könnten Sie fünfzig- bis sechzigtausend dafür bekommen«, sagte Young. »Die Preise steigen, seit die Araber und die Chinesen in Oldtimer investieren. Deshalb macht Sylvestre mit seinen Auktionen so gute Geschäfte. Er hat eine Niederlassung in Dubai und will auch eine in Shanghai eröffnen. Für seinen Bugatti erhofft er sich, wie ich weiß, mindestens eine Million. Damit will er sein Engagement in China vorfinanzieren.«
Florence verdrehte die Augen, und Bruno schüttelte den Kopf über die Zahlen, die er hörte.
»Haben Sie Sylvestre über solche Oldtimer-Auktionen kennengelernt?«, wollte Florence von Young wissen.
»Ja, das erste Mal sind wir uns vor ein paar Jahren auf einer Auktion in England begegnet, danach trafen wir uns immer wieder auf verschiedenen Rallyes. Er ist ein sehr guter Fahrer und hat im Unterschied zu mir das nötige Geld, um sein Hobby ernsthaft zu betreiben.«
Young berichtete von seiner ersten Begegnung mit Sylvestre, als der einen Ferrari Modena Spider ersteigert hatte. Er selbst war bei einem Preis von hunderttausend Pfund, umgerechnet etwa hundertdreißigtausend Euro, ausgestiegen. Die Auktion hatte an der alten Rennstrecke von Goodwood stattgefunden und war in die Geschichte eingegangen, weil ein Mercedes-Formel-1-Bolide von 1954 knapp dreißig Millionen Dollar eingebracht hatte, eine noch immer unübertroffene Rekordsumme.
»Richtig viel Geld scheint nur auf privaten Auktionen umgesetzt zu werden«, fügte Young hinzu. »Auf einer Auktion in Italien sollen für einen Ferrari 250GTO sage und schreibe dreißig Millionen gezahlt worden sein, aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Zu solchen Veranstaltungen wird man eingeladen, und ich hatte bislang noch nicht das Vergnügen. Sylvestre schon, vielleicht wegen seiner Dubai-Connection.«
»Dagegen ist mein Landrover geradezu billig«, meinte Bruno. »Hat Sylvestre mit dem Handel von Oldtimern sein Geld gemacht?«
»Nein, um in diesem Geschäft Erfolg zu haben, muss man schon Geld mitbringen. Seine Familie im Elsass handelt mit Immobilien und scheint sehr reich zu sein. Soviel ich weiß, gehören ihr mehrere Einkaufszentren und Bürohochhäuser. Genaueres ist mir nicht bekannt. Wir, Sylvestre und ich, sind befreundet und stoßen, wenn sich die Gelegenheit bietet, gern miteinander an, stehen uns aber nicht besonders nahe. Er ist manchmal ein bisschen arrogant und heikel, aber ein absoluter Fachmann, was Autos angeht.«
»Ist von unserem Nachbarn Sylvestre die Rede?«, meldete sich die Stimme von Brunos Freund Thomas, der mit Ingrid am Arm näher kam.
»Wir haben gerade etwas über seinen Autohandel gehört«, antwortete Bruno und rückte auf der Bank zur Seite, um für die beiden Platz zu machen.
»Seine Familie hatte großes Glück«, erklärte Thomas. Seine Großeltern waren Bauern gewesen und hatten große Acker- und Weideflächen zwischen Marckolsheim und Straßburg bewirtschaftet. Kurz vor Ausbruch des Krieges kaufte die französische Regierung 1939 einen Teil der Ländereien auf, um einen Militärflugplatz darauf zu errichten. Sylvestres Vater hatte, weil er zum Verkauf gezwungen worden war, gegen die Regierung geklagt und mehr Geld verlangt. Nach dem Krieg wollte die französische Luftwaffe an dem Stützpunkt festhalten und bot der ehemaligen Eigentümerfamilie an, das Flugfeld, wenn es schließlich doch geräumt werden sollte, zum ursprünglichen Verkaufspreis zurückzukaufen. Als de Gaulle in den 1960er Jahren auf nukleare Abschreckung setzte, wurde an den konventionellen Streitkräften gespart. Sylvestres Familie bekam das Land billig zurück – mitsamt einer Start- und Landebahn, Hangars, unterirdischen Treibstofftanks, Verwaltungsgebäuden und Kasernen.
»Straßburg wurde eines der Zentren der Europäischen Gemeinschaft und brauchte einen zivilen Flughafen«, fuhr Thomas fort. »Sylvestres Vater verkaufte den alten Luftwaffenstützpunkt für ein Vielfaches des Rückkaufpreises. Den Rest der Ländereien behielt er in der Aussicht darauf, dass sie an Wert gewinnen würden.«
»Was natürlich der Fall war«, schaltete sich Ingrid ein. »Er vererbte ein Riesenvermögen. Darum kann es sich Sylvestre auch erlauben, siebenhunderttausend Euro für einen Bugatti auszugeben.«
»Und das ist noch gar nichts«, sagte Young, der nun ein Smartphone aus der Hemdtasche zog, ein paar Wischbewegungen darauf vollführte und das Display für alle sichtbar in die Höhe hob. Es zeigte einen glänzenden schwarzen Sportwagen mit den schnittigen aerodynamischen Linien der 1930er Jahre und einer überlangen Motorhaube.
»Mon dieu, ist der schön«, sagte Florence.
»Der teuerste Wagen aller Zeiten. Was glauben Sie, wie viel ein solches Modell kostet?«, fragte Young.
»Zwanzig Millionen?«, spekulierte Bruno ins Blaue. Unter solchen Summen konnte er sich nicht wirklich etwas vorstellen. Er dachte einfach nur an die Preise, die für manche Châteaux, die er kannte, geboten wurden. Für eine Million stand ein hübsches, bewohnbares Schlösschen aus dem 17. Jahrhundert zum Verkauf, nur wenige Kilometer außerhalb von Saint-Denis. Ingrid tippte auf fünf Millionen, und Annette sagte kopfschüttelnd, sie kenne den Preis; die Schätzungen lägen viel zu niedrig.
»Dreißig Millionen«, erhöhte Florence und lachte.
»Auch das reicht nicht wirklich«, erwiderte Young, der nun eine ernste, geschäftsmäßige Miene aufsetzte.
»Was ist das für ein Wagen?«, fragte Bruno.
»Wieder ein Bugatti, und zwar vom Typ Atlantic, genauer gesagt: Type 57 SC. Gebaut wurde er 1936. Ein Exemplar wurde für eine ungenannte Summe an das kalifornische Mullin Automotive Museum verkauft. Man munkelt, dass siebenunddreißig Millionen dafür gezahlt worden seien. Es ist jedenfalls das wertvollste Auto aller Zeiten.«
»Verrückt«, sagte Bruno, dem fast das Wort obszön herausgerutscht wäre. »Wie kann das sein?«
»Es wurden nur vier Exemplare gebaut. Eines gehört Ralph Lauren, ein zweites dem Museum, ein drittes wurde an einem Bahnübergang von einem Zug überrollt, und das vierte ging während des Krieges in Frankreich verloren, als man es aus Sicherheitsgründen von der Fabrik im Elsass nach Bordeaux hatte überführen lassen. Niemand weiß, was unterwegs passiert ist.«
»Florence hat recht«, sagte Bruno, der sich das Foto auf dem Smartphone genauer ansah. »Er ist wunderschön. Handelt es sich um das Exemplar des Museums?«
»Nein, es ist das von Ralph Lauren.« Young öffnete ein weiteres Foto, das dasselbe Modell in Silberblau zeigte. »Das ist das Museumsstück.«
Bruno wollte sich nach dem Fahrzeug erkundigen, das im Krieg verlorengegangen war, als Fabiola und Gilles alle, die am Tisch saßen, auf die Tanzfläche zurückholten.
4
A