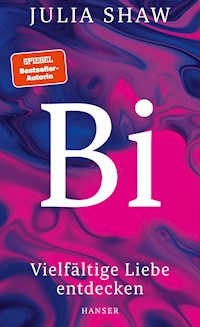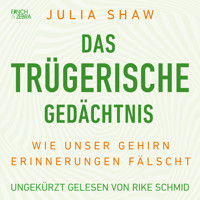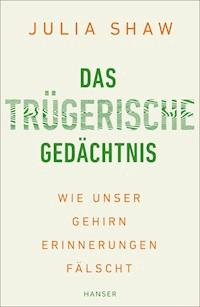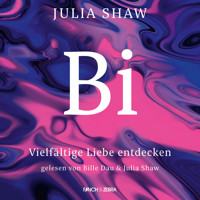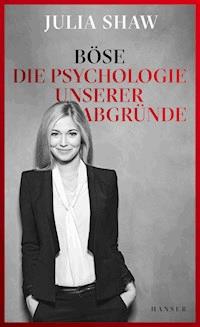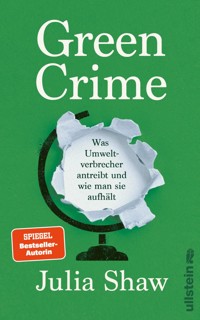
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Tatort Erde – die größten Umweltverbrechen unserer Zeit Morde im Regenwald, Abgasbetrug in der Autobranche, Wilderer-Syndikate in Afrika – Bestsellerautorin und Kriminalpsychologin Julia Shaw enthüllt die Mechanismen ökologischer Verbrechen. Eine fesselnde Reise in kriminelle Abgründe, die uns alle angehen. Wer steckt hinter der Umweltzerstörung, die unsere Zukunft bedroht? Wie rechtfertigen die Täter ihr Handeln? Und vor allem: Was können wir dagegen tun? Julia Shaw taucht ein in die Welt der Umweltkriminalität und zeigt, dass verbrannte Wälder, vergiftete Ozeane und Schadstoffe in der Luft oft ungeahndet bleiben. Anhand großer Umweltverbrechen untersucht sie die Psyche der Täter, erklärt, wie Menschen zu Umweltzerstörern werden, und beleuchtet die Dynamiken, die dies Verbrechen ermöglichen. Untermauert von brisantem Insiderwissen engagierter Ermittler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt zeigt sie eindrucksvoll, dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe mehr erfordert als gute Absichten. Sie legt konkret dar, wie Umweltverbrechen im Vorfeld verhindert und Täter konsequent zur Rechenschaft gezogen werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Green Crime
Julia Shaw, 1987 in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen, ist Bestsellerautorin, internationale Referentin und forscht als promovierte Rechtspsychologin am University College London. Außerdem arbeitet sie als True-Crime-Expertin für die BBC und zahlreiche TV-Produktionen. Ihre Bücher Das trügerische Gedächtnis und Böse.Die Psychologie unserer Abgründe waren Bestseller.Ingrid Ickler übersetzt aus dem Italienischen, Französischen und Englischen, und ist Autorin und Moderatorin. Sie wohnt und arbeitet in der Nähe von Frankfurt am Main.
Wer steckt hinter der Umweltzerstörung, die unsere Zukunft bedroht? Wie rechtfertigen die Täter ihr Handeln? Und vor allem: Was können wir dagegen tun?Julia Shaw taucht ein in die Welt der Umweltkriminalität und zeigt, dass verbrannte Wälder, vergiftete Ozeane und Schadstoffe in der Luft oft ungeahndet bleiben. Anhand großer Umweltverbrechen untersucht sie die Psyche der Täter, erklärt, wie Menschen zu Umweltzerstörern werden, und beleuchtet die Dynamiken, die diese Verbrechen ermöglichen. Untermauert von brisantem Insiderwissen engagierter Ermittler und Wissenschaftlerinnen aus aller Welt zeigt sie eindrucksvoll, dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe mehr erfordert als gute Absichten. Sie legt konkret dar, wie Umweltverbrechen im Vorfeld verhindert und Täter konsequent zur Rechenschaft gezogen werden können.
Julia Shaw
Green Crime
Was Umweltverbrecher antreibt und wie man sie aufhält
Aus dem Englischen von Ingrid Ickler
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erscheint zeitgleich unter dem Titel Green Crime bei Canongate Books, Edinburgh.© 2025 by Julia Shaw© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: zero-media.net, München nach einer Vorlage von Canon Gate Books und James JonesFoto der Autorin: © Boris BreuerE-Book by pepyrusISBN 978-3-8437-3667-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
1 | Die Lügner Abgasbetrug in den
USA
und wie Täter sich Umweltverbrechen schönreden
Was tagtägliche Tests uns nicht erzählen
Massenmord durch Luftverschmutzung
Die unsichtbare Gefahr
Ein skandalöses Déjà-vu
Die Macht der Klimawut
Geheimtreffen und gefährliche Loyalität
Toxische Unternehmenskultur
Greenwashing
Die höchste Strafe
Illusion der Unverwundbarkeit
Wegweisende Urteile
Das Gesetz gilt für alle
Das Sechs-Säulen-Modell der Emissionskriminalität
Unsichtbare Helden
2 | Die Mörder Tote im Amazonas und die Frage, ob die Natur eigene Rechte braucht
Maskierte Auftragskiller
Wer besitzt den Wald?
Hotspots der Biodiversität
Wenn Besitzanspruch zum Verhängnis wird
Eine Utopie, die Leben kostet
Schutzengel des Regenwalds
Die Psychologie der Straffreiheit
Bedroht im Zeugenstand
Die letzte grüne Grenze
Das Sechs-Säulen-Modell der Verbrechen gegen Umweltschützer
Die Rechte der Natur
Der Kampf um Ökozid
Unterstützung für den Kampf
3 | Die Schwarzhändler Wildererbanden aus China und die komplexe Beziehung von Mensch und Tier
Dunkle Familiengeschäfte
Pionierinnen der Naturschutzbewegung
Undercover-Einsatz für die Tiere
Leere Wälder
Detektei für Umweltverbrechen
Militärische Ausrüstung im Kampf für die Tiere
Die Wilderer und ihre Bosse
Die Psychologie der Verhaltensänderung
Sturm der Razzien
Das Sechs-Säulen-Modell der Wildtierkriminalität
Illegale Geschäfte trockenlegen
4 | Die Gesetzlosen Piratenfischerei in der Antarktis und wie wir uns verhalten, wenn niemand hinsieht
110 Tage auf der Jagd
Die Illusion der Freiheit
Die dunkle Seite der Fischerei
Ein perfekter Tag zum Untergang
Das Erbe der Gesetzlosen
Es sind nur Pinguine
Öko-Influencer
Der Prozess im pinken Gericht
Wächter der Meere
Der Tycoon aus Galicien
Das Sechs-Säulen-Modell des illegalen Fischfangs
Zeugen der Meere
5 | Die Diebe Die Zama Zamas in Südafrika und wie die Narrative von Umweltverbrechern verzerrt werden
Illegaler Insider
Tanzende Katzen und verseuchtes Wasser
Zwischen Existenzsicherung und Umweltzerstörung
Das doppelte Spiel in der Lily-Mine
Bestechlichkeit
Der Preis der Ehrlichkeit
Zwölf Sekunden bis zum Abgrund
Das Sechs-Säulen-Modell des illegalen Bergbaus
Falsche Narrative
Krieg unter Tage
6 | Die Fahrlässigen Die Ölpest im Golf von Mexiko und warum es so schwer ist, unsere Meinung zu ändern
Im Rausch des Rohöls
Wie Öl unsere Welt veränderte
Umdenken
Ölteppiche und unbequeme Wahrheiten
Ökologische Trauer
Trügerische Wunschvorstellungen
Verantwortung für Fahrlässigkeit
Das Sechs-Säulen-Modell der Ölpest
Dystopische Träume
Der Kampf gegen die Kampagne des Nichtwissens
Hüter unserer Erde – ein Nachwort
Dank
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Widmung
Für Annette. Meine Insel im Sturm.Motto
Dear future generations: Please accept our apologies.We were rolling drunk on petroleum.Kurt VonnegutVorwort
Noch nie zuvor habe ich mehr Hoffnung für die Zukunft unseres Planeten geschöpft als ausgerechnet während der intensiven Beschäftigung mit einigen der gravierendsten Umweltverbrechen unserer Zeit. Es war ein unerwarteter Perspektivwechsel, fast schon paradox. Über Jahre hinweg hatte mich die Klimakrise vor allem wütend gemacht. Ich fühlte mich, als stünden wir am Rand eines schwarzen Lochs, das uns unaufhaltsam in die Tiefe zog – und als wüsste die Welt um diese zerstörerische Kraft, ohne wirklich zu handeln.
Und dann, eines Tages, wurde mir etwas Entscheidendes klar: Die Zerstörung unseres Planeten ist nicht nur eine Tragödie – und erst recht kein unausweichliches Schicksal. Sie ist ein Verbrechen. Und mit Verbrechen kenne ich mich aus.
In meiner täglichen Arbeit als Kriminalpsychologin versuche ich zu verstehen, warum Menschen Böses tun. Ich schreibe über die dunkelsten Seiten menschlichen Verhaltens und arbeite als Sachverständige in Fällen schlimmster Gewaltverbrechen: Ich durchforste Akten, analysiere Bildmaterial, rekonstruiere Taten. Irgendwann wurde mir klar: Mein Wissen über die menschliche Psyche könnte auch dabei helfen, Umweltverbrecher besser zu durchschauen – und Wege zu finden, wie man sie aufhalten kann.
Außerdem wurde mir klar, warum ich mich der Klimakrise oft so ausgeliefert fühlte: Ich hörte ständig von Umweltzerstörern, aber kaum etwas von denjenigen, die für unsere Zukunft kämpfen. Über sie wird viel zu selten gesprochen. Mit diesem Buch möchte ich das ändern.
Ich möchte Ihnen diese Menschen vorstellen: Umweltaktivisten, investigative Journalisten und Wissenschaftler, die Umweltverbrechen sichtbar machen und sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Verdeckte Ermittler, internationale Polizeibehörden, Aufsichtsorgane und Umweltjuristen, die Täter verfolgen und zur Rechenschaft ziehen. Und nicht zuletzt die Wissenschaftler bei den Vereinten Nationen und an Universitäten weltweit, die daran arbeiten, die komplexen Zusammenhänge hinter den Umweltkrisen verständlich zu machen – damit wir begreifen, womit wir es wirklich zu tun haben.
Ein weiterer Grund, warum sich die Klimakrise für viele so überwältigend anfühlt, liegt in der Schwierigkeit, ihre wissenschaftlichen Grundlagen wirklich zu erfassen. Was wir nicht verstehen, macht uns Angst.
Deshalb möchte ich Ihnen ein Gegenmittel zur Angst anbieten. Ich habe verborgene Umweltgeschichten ans Licht geholt und mit Experten gesprochen, die sich mit den größten Bedrohungen für die Zukunft der Menschheit auseinandersetzen: Luftverschmutzung, Abholzung, Artensterben, Überfischung, giftige Abfälle und die Risiken durch die Öl- und Gasindustrie. Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie die wissenschaftlichen Zusammenhänge besser verstehen und in der Lage sein, sich fundiert und selbstbewusst an Gesprächen über diese existenziellen Fragen zu beteiligen.
Es ist faszinierend zu beobachten, dass wir derzeit einen fundamentalen Wandel darin erleben, wie wir über unseren Planeten denken und wie Umweltzerstörung zunehmend als Straftat erkannt wird. Begriffe wie »Ökozid« gewinnen an Bedeutung, um der Natur ähnliche Rechte einzuräumen wie den grundlegenden Menschenrechten.1 Und vielerorts wird die Missachtung von Umweltgesetzen nicht länger nur mit Geldstrafen, sondern mit Freiheitsentzug geahndet.
Etwas als Verbrechen zu benennen und entsprechend zu bestrafen, stellt Umweltvergehen auch psychologisch auf die gleiche Ebene wie andere schwere Delikte. Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der Umweltverbrecher mit der gleichen moralischen Schärfe betrachtet werden wie Mörder? Das wäre ein radikaler Wandel und ein klares Zeichen dafür, dass wir endlich verstanden haben, worauf es wirklich ankommt.
In diesem Buch geht es nicht nur um Menschen, die der Umwelt Schaden zufügen, sondern auch um jene, die dabei Gesetze brechen. Um eine Form von True Crime, in der das Opfer die gesamte Menschheit ist.
Green Crime, ein Begriff, der vor allem von Sozialwissenschaftlern benutzt wird, ist ein Synonym für Umweltkriminalität. Meine juristischen Ansprechpartner hingegen sprechen lieber von Umweltkriminalität, einem Begriff, der 2024 vom Europäischen Parlament in bemerkenswerter Klarheit definiert wurde. In der neuen Richtlinie sind die zentralen Elemente aufgeführt, die nach langen Verhandlungen in die sogenannte Environmental Crime Directive aufgenommen wurden.2
Ein Umweltverbrechen ist ein illegaler, vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Akt, der die Erde schädigt, aber auch das Unterlassen einer Handlung, die ihren Schutz bewirken würde. Es muss entweder Menschen nachhaltig schädigen oder gar töten oder signifikante Schäden an der Qualität von Luft, Boden und Wasser, an Flora und Fauna verursachen. Auch eine erhebliche Belastung eines gesamten Ökosystems zählt dazu.
Dieses komplexe Konzept mag auf den ersten Blick möglicherweise technisch wirken. Deshalb beleuchte ich in diesem Buch sechs ebenso erschreckende wie faszinierende Umweltverbrechen, um immer wieder auf die zentrale Frage zurückzukommen: Warum wollen Menschen die Natur zerstören? Um eine Antwort darauf zu finden, erstelle ich ein Täterprofil und versuche, die Denkmuster zu entschlüsseln, die ihr Handeln antreiben.
Dabei greife ich auf psychologische Konzepte zurück, wie unethisches prosoziales Verhalten, Disconfirmation Bias, Zeitpräferenz, Korrumpierbarkeit und das Feedback-Paradox. Zudem nutze ich Begriffe aus der »grünen Psychologie«, die uns helfen, die Auswirkungen der Umweltzerstörung auf uns besser zu verstehen – etwa Umweltwut, Umwelttrauer und die Bedeutung biosphärischer Werte.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Frage, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Indem wir Geschichte und Sozialwissenschaften miteinander verbinden, können wir nachvollziehen, warum wir uns für den Schutz des Planeten entscheiden – oder eben nicht. Ein Beispiel dafür ist, wie das Konzept des psychologischen Eigentums dazu führen kann, dass ein alter Wald nicht verbrannt, sondern als schützenswerte Ressource anerkannt wird.
Auch wenn jedes Kapitel dieses Buches eine Geschichte von Helden und Schurken erzählt, geht es immer auch um die unendlich vielen Graustufen dazwischen. Der Versuch, das Denken von Umweltkriminellen zu verstehen, führt letztlich dazu, dass wir uns selbst besser begreifen.
Wissenschaft ist der Versuch, Wissen von Illusionen zu befreien. Und genau dieses Streben liegt all meinem Tun als Wissenschaftlerin zugrunde. Ich bin ein Mensch, der gerne die Denkmuster anderer erkennt. Ohne dieses Verständnis fühlt sich mein Gehirn im stürmischen Meer der Informationsflut verloren, besonders bei den großen, komplexen Themen, die dieses Buch thematisiert. Es liegt in meiner Natur, Ideen, Fakten und Fragen nach Gefühl und Struktur zu ordnen und das Chaos in etwas Sinnvolles und Nützliches zu verwandeln.
Im Laufe der Jahre, in denen ich dieses Buch geschrieben habe, ist mir tatsächlich ein Muster aufgefallen, ein Modell, das ich das Sechs-Säulen-Modell nenne. Es beschreibt die psychologischen Faktoren, die Umweltkriminelle antreiben: Bequemlichkeit, Straffreiheit, Gier, Rationalisierung, Konformität und Verzweiflung.
Ich werde in jedem Kapitel immer wieder auf diese sechs Säulen zurückkommen, jedoch ohne den Anspruch, dass sie stets alle gleichermaßen relevant sind. Ich hoffe, sie dienen Ihnen als ordnendes Prinzip für das Wissen, das Sie beim Lesen gewinnen. Ein Gerüst, in dem Ihre Gedanken Wurzeln schlagen, wachsen und sich dem Licht neuer Erkenntnis entgegenstrecken können.
Die erste Säule ist Bequemlichkeit. Der Mensch neigt dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Wenn Lügen, Umweltverschmutzung oder -zerstörung als schnellere oder einfachere Wege zum Ziel erscheinen – im Vergleich zur nachhaltigen Alternative –, entscheiden sich viele für den bequemeren Pfad.
Die zweite Säule ist Straffreiheit. Damit meine ich die Überzeugung oder das Wissen, dass man für sein Handeln nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Ob auf hoher See, tief im Amazonas-Regenwald oder in den Vorstandsetagen großer Konzerne: Viele gehen davon aus, dass niemand hinschaut und schon gar nicht sie aufhält.
Die dritte Säule ist Gier. Menschen sind bereit, Allgemeingut zu opfern, um sich persönlich zu bereichern. Ein Anführer einer kriminellen Organisation nimmt die Ausrottung einer Tierart in Kauf, nur um sich ein luxuriöses Leben zu ermöglichen. Oder ein CEO kürzt aus Profitgier an allen Ecken, verursacht massive Umweltschäden und lässt die Gesellschaft den Preis zahlen.
Die vierte Säule ist Rationalisierung. Menschen erzählen sich selbst Geschichten, um ihr Handeln vor sich und anderen zu rechtfertigen – und es harmloser wirken zu lassen, als es ist. So behauptet etwa ein Anführer von Wilderern, er tue Gutes, weil er Arbeitsplätze schaffe. Oder ein Ingenieur argumentiert, dass seine umweltschädliche Technologie angesichts der globalen Umweltkrise ohnehin keinen Unterschied mache.
Die fünfte Säule ist Konformität. Tatsächlicher oder wahrgenommener Gruppendruck spielt eine große Rolle dabei, ein gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, in dem Umweltkriminalität normalisiert wird. Büroangestellte betreiben Greenwashing, weil sie annehmen, dass alle anderen es ebenfalls tun. Und in Dörfern, in denen illegale Fischerei zum Alltag gehört, wird die Arbeit auf See nicht als Verbrechen, sondern als ganz normaler Job angesehen.
Die sechste Säule ist Verzweiflung. In vielen Teilen der Welt gäbe es Green Crime ohne extreme Armut kaum. Doch Armut ist nur eine von vielen Formen der Verzweiflung. Menschen greifen immer dann zu drastischen Mitteln, wenn sie sich gefangen fühlen, und sehen im Gesetzesbruch oft den einzigen Ausweg aus ihrer Situation.
Betrachten wir die ausgewählten Fälle durch das Sechs-Säulen-Modell, erkennen wir, dass Umweltverbrecher oft leichter zu durchschauen und uns erstaunlich ähnlicher sind, als es zunächst den Anschein hat. Das öffnet die Tür, dieses globale Verbrechen zu bekämpfen. Es ist höchste Zeit, die Mörder der Erde zu identifizieren und zu entlarven.
1 | Die Lügner Abgasbetrug in den USA und wie Täter sich Umweltverbrechen schönreden
Sie wussten, dass die Verschwörung irgendwann auffliegen würde. Die Fassade begann zu bröckeln, als Chefermittler Alberto Ayala und sein Team anfingen, Fragen zu stellen. Natürlich antworteten sie mit einem Haufen Lügen, aber angesichts der vernichtenden Beweise, die auf dem Tisch lagen, wussten alle, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Täter entlarvt würden.
Deshalb befand sich der VW-Mitarbeiter im August 2015 an einem entscheidenden Wendepunkt. Sollte er weiter lügen oder endlich die Wahrheit sagen? Als ranghohe Führungskraft von Volkswagen Nordamerika hatte er sich entschlossen, an einer der größten Technikkonferenzen in Kalifornien teilzunehmen. Er wusste, dass auch Ayala anwesend sein würde.
Sie waren zwar keine engen Freunde, aber die jahrelange Zusammenarbeit hatte einen gegenseitigen Respekt wachsen lassen. Oft wird angenommen, dass zwischen Behörden und Unternehmen eine Art Kriegszustand herrscht, in ihrem Fall jedoch war das Verhältnis von Wertschätzung und einer sachlichen Zusammenarbeit geprägt. Schließlich waren sie Ingenieure mit einem gemeinsamen Ziel: Autos zu entwickeln, die weder Menschen gefährden noch der Natur schaden. Und trotzdem hatte der VW-Mitarbeiter Ayala in diesem sterilen Konferenzraum ins Gesicht gelogen. Er war ein Feigling gewesen. Aber jetzt war er bereit, sich zu entscheiden, auf welcher Seite er stehen wollte.
Nach einem der Konferenzdinner ließ der VW-Mitarbeiter zur verabredeten Zeit seinen Blick über die lebhafte Menge schweifen, ein Meer aus dunklen Anzügen, die ineinander verschwammen. Es war nicht leicht, den Ermittler dort auszumachen. Dann sah er ihn.
Der VW-Mitarbeiter atmete flach, ein Bier in der Hand, und lächelnd ging er auf ihn zu. Sie tauschten einstudierte Floskeln aus und suchten sich anschließend ein abgelegenes Plätzchen. Das Geplauder der anderen Konferenzteilnehmer ebbte ab und wurde von der Schwere dessen ersetzt, was gesagt werden musste. Der VW-Mitarbeiter gestand Ayala, dass er gelogen hatte. Dass sie alle gelogen hatten, jahrelang. Fast ein Jahrzehnt lang. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Anfangs war Ayalas Blick wie versteinert, er konnte es nicht glauben. Er hatte etwas Ähnliches erwartet, aber auf einen solchen Schlag hatte ihn niemand vorbereitet. Wie hatten sie so etwas tun können? Und dann kam die Wut, roh und unbeherrscht, die Worte sprudelten aus ihm heraus. Der Betrug traf ihn wie eine Ohrfeige. Sie hatten jahrelang mit falschen Karten gespielt, all die öffentlichen Mittel waren weg. Das Unternehmen hatte ihn, sein Team und einen Großteil der Welt für dumm verkauft.
Die beiden Männer entfernten sich weiter von der Menge und nippten an ihrem Bier. Gewissensbisse trafen auf Wut, Furcht auf Verrat. Noch wussten die beiden nichts über das Ausmaß dessen, was gerade ans Licht gekommen war.
Was bringt Menschen dazu, die Umweltschäden ihrer eigenen Firma zu leugnen? Dieses Kapitel seziert die psychologischen Mechanismen hinter einem der größten Unternehmensskandale der Geschichte – und erzählt, wie die Welt darauf reagierte. Mehr als zehn Jahre lang berichtete die internationale Presse über die strafrechtlichen Konsequenzen, die Auseinandersetzungen vor Gericht, die anhängigen Klagen rund um den internationalen Abgasskandal, der als Dieselgate bekannt wurde. Die Ermittlungen gingen zwischen den USA und Deutschland hin und her und verbreiteten sich dann über die ganze Welt. Doch nur wenige kannten die ganze Geschichte. Ich konnte mit Alberto Ayala sprechen, dem Mann, der für die Aufdeckung der Lügen des VW-Konzerns zuständig war. Er verschaffte mir einen Überblick über den Fall. Während der vielen Jahre, die er mit den ermittelnden Beamten zusammenarbeitete, musste er Stillschweigen bewahren. »Erst jetzt kann ich offen darüber sprechen«, sagte er.
Grundlage für die von mir geschilderte Anfangsszene war der Schlüsselmoment, der alles zum Einsturz brachte, wie Ayala sagte. Er arbeitete von 2011 bis 2017 als Chefermittler der kalifornischen Umweltbehörde California Air Resources Board (CARB), die für saubere Luft und Klimaschutzmaßnahmen zuständig ist. Für ihn war es kein reiner Schreibtischjob. »Wir sind der Widerstand«, erklärte er mir. Ayala und seine Kollegen auf der ganzen Welt sind maßgeblich daran beteiligt, die Qualität der Luft, die wir atmen, gegen Unternehmen und Politiker zu verteidigen, die durchaus bereit sind, uns zu vergiften.
Der Dieselgate-Fall ist gleichermaßen empörend und erschütternd. Vor diesem Hintergrund habe ich mich auch mit der Psychologie der Umweltwut beschäftigt, bei der skrupellose Unternehmen uns zu Komplizen ihrer Verbrechen machen und eine Umgebung voller Greenwashing-Fallen schaffen. All das wirft wichtige Fragen auf: Wer ist überhaupt in der Lage, den Umweltbetrug eines Unternehmens zu erkennen? Und: Wie wollen wir mit den Tätern umgehen, wenn sie gefasst sind? Gefängnisstrafen sind nur eine mögliche Antwort.
Der VW-Abgasskandal ist die Geschichte einer umfangreichen Werbekampagne für etwas, das nie existierte, einer Branche in der Krise und einer Gruppe von Führungskräften, die nach der öffentlichen Fahndung auf der Flucht waren. Hier haben Menschen Lügen mit weiteren Lügen überdeckt und sich schließlich entschieden, noch mehr zu lügen. Warum haben so viele Mitarbeiter mitgemacht, und warum sind sie zum Wohle des Unternehmens sogar das Risiko eingegangen, ins Gefängnis zu kommen?
Dieser Fall von Unternehmensbetrug zählt zu den größten seiner Art – und die Reaktion darauf war in vielerlei Hinsicht geradezu ein Wunder. Er hat auch gezeigt, wie sehr sich Menschen um ihre Umwelt kümmern und wie ihre Wut in eine treibende Kraft für positive Veränderungen weltweit verwandelt werden kann. Und aufgedeckt wurde das Ganze von einem Ingenieur, der von seinen Kollegen beeindruckt war.
Was tagtägliche Tests uns nicht erzählen
»Wenn es um Effizienz und niedrige CO2-Emissionen geht, dann kommt einem als Erstes ein Dieselmotor in den Sinn«, sagte Alberto Ayala. »So sind wir überhaupt erst darauf aufmerksam geworden, wir waren einfach neugierig auf diesen sauberen Diesel.« Natürlich konnte er nicht ahnen, in welche dunklen Ecken ihn seine Neugier führen würde. Teil seines Jobs war es, »jeden Autohersteller der Welt zu verstehen«. Und als Chefermittler hatte er tagtäglich mit ihnen zu tun, Volkswagen eingeschlossen.
Als ich mich im Winter 2024 mit ihm online getroffen habe, hatte Ayala die CARB bereits verlassen und war Geschäftsführer des Sacramento Metropolitan Air Quality District. Außerdem schrieb er gerade ein Buch über den Volkswagenskandal mit dem Titel 3 Forks in the Road, Dieselgate: The Volkswagen Cheating Scandal. Es ist sein berühmtester Fall und größter Erfolg, der ihm viel abverlangte. Sein wichtigstes Anliegen aber ist, dass die Menschen die bedeutende Rolle der Behörden beim Schutz der Umwelt anerkennen und wertschätzen – heute ebenso wie in Zukunft. »Jeder, der den Hahn aufdreht, erwartet sauberes Wasser. Wenn man nach draußen geht, dann erwartet man saubere Luft. Man erwartet Nahrungsmittel, die einen nicht vergiften, ein Handy, das nicht explodiert. Wie soll das gehen? Wenn man über die Annehmlichkeiten des modernen Lebens nachdenkt, dann sind strikte Vorschriften die nötigen Leitplanken.«
Wenn alles reibungslos funktioniert, bleibt es oft unbemerkt. Und selbst wenn wir feststellen, dass etwas nicht stimmt, richten wir unseren Blick selten auf diejenigen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles läuft. Das ist die Tragödie der unsichtbaren Armee der Regelgebenden. »Die tagtäglichen Tests, die wir durchführen, werden meist nicht wahrgenommen, denn wenn alles gut ist, muss man auch nicht darüber berichten«, erklärte Ayala.
Natürlich können Vorschriften lästig sein. Sie zwingen Unternehmen, mehr Kontrollläufe durchzuführen, als sie es aus eigenem Antrieb tun würden. Und sie müssen sich bei der Herstellung und beim Verkauf an Regeln halten. Dazu kommt der Papierkram, den keiner gerne macht. Manchmal können Regeln vereinfacht werden, aber sie ganz abzuschaffen, ist keine gute Idee. »Ohne Vorschriften haben die Verbraucher keine Ahnung, ob das, was sie bekommen, gut oder schlecht ist. So einfach ist das. Und das wäre ziemlich beängstigend«, meinte Ayala.
Zwei weitere sich widersprechende Missverständnisse empfindet er als irritierend. Das erste ist, dass die Behörden den Unternehmen im Weg stehen. Doch laut Ayala sind sie auf der gleichen Seite. »Wir probieren aus, verbringen viel Zeit im Labor und testen die Technologie, nehmen sie auseinander, sprechen mit den Herstellern und Experten, um zu verstehen, wie wir die Vorschriften gestalten sollen, damit alle Eigenschaften der wunderbaren Fahrzeuge, die heute auf der Straße unterwegs sind, erhalten werden und wir die Umweltschäden auf ein Mindestmaß beschränken können.« Das zweite Missverständnis besteht in der Annahme, dass Unternehmen und Behörden gemeinsame Sache machen. Dass er zu Mitarbeitern mancher Unternehmen, die er überprüft, eine freundliche Beziehung aufgebaut hat, ist ein Nebenprodukt der Tatsache, dass sie viel Zeit miteinander verbringen. Doch ein »Kontrolleur, der Vorschriften entwirft, wird das Auto nie so gut verstehen wie sein Hersteller«. Der Wille zur Zusammenarbeit und ein gewisses Maß an Respekt sind grundlegend für diese Arbeit.
Bevor Volkswagen seine sauberen Dieselautos 2007 in den USA auf den Markt gebracht hat, hatte Ayala sich nur wenig mit Dieselfahrzeugen beschäftigt. »Diesel-Pkws waren nie wirklich wichtig für uns, es gab fast keine. Auf jeden Diesel kamen etwa tausend Benziner. Als wir davon erfuhren, dass die Deutschen Diesel-Pkws in die USA importierten, schauten wir uns die saubere Dieseltechnologie von VW näher an und dachten: Wow, nett. Aber wirklich darum gekümmert haben wir uns nicht«, sagte Ayala. Die Mittel der Behörde waren begrenzt, deshalb nahmen sie zuerst die größten Verursacher von Umweltschäden ins Visier – die Benzinmotoren.
Mit der steigenden Zahl der Dieselfahrzeuge wuchs auch das Behördeninteresse. Als 2012 in Kalifornien strengere Abgasregelungen in Kraft traten, wollten Ayala und seine Kollegen herausfinden, wie es um die Umweltfreundlichkeit der Dieselmotoren tatsächlich stand. Sie wandten sich an VW, in Erwartung einer freundlichen Antwort. Doch die Reaktion des Unternehmens war irritierend. »Sie versuchten, uns Erklärungen zu geben. Allerdings ergaben die mit der Zeit immer weniger Sinn.« Drei volle Jahre ließen Ayala und sein Team die VW-Leute gewähren. Schließlich reichte es. »Irgendwann kamen wir zu dem Schluss, dass die einzig noch bleibende Erklärung Betrug war.«
Die große Frage, die Ayala und seine Kollegen noch ein weiteres Jahr lang beschäftigen sollte, war: Wie hatten sie es gemacht, und wer steckte dahinter? Erst später, als sie mit den ermittelnden Bundesbeamten zusammenarbeiteten, kamen sie hinter das Geheimnis der berühmten »Abschaltvorrichtung«.
Bevor wir näher auf die Hintergründe dieser Lügen und die Psychologie derjenigen eingehen, die daran beteiligt waren, möchte ich Ihnen einen Überblick über die Geschichte der Luftverschmutzung geben, denn Unternehmen haben bereits seit Jahrzehnten die Sauberkeit der Luft aufs Spiel gesetzt.
Weltweit entwickelte sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Bewusstsein dafür, was Luftverschmutzung für die Gesundheit der Menschen und der Natur bedeutet. Die USA und Großbritannien waren die ersten großen Industrienationen, die nationale Gesetze zur Eindämmung der Luftverschmutzung verabschiedeten. Es bedurfte jedoch großer Katastrophen wie der »Smog-Katastrophe von Donora«, um ein echtes Umdenken zu bewirken.3
Massenmord durch Luftverschmutzung
Im Oktober 1948 wurden die Städte Donora und Webster in Pennsylvania von einer dicken Smog-Wolke eingehüllt. Die Einwohner waren an den Rauch der nahen Stahl- und Zinkindustrie gewohnt. Luftverschmutzung wurde als Zeichen des Wohlstands und nicht als Belastung betrachtet.4 Ein blauer Himmel hingegen bedeutete ein Problem.
Als der Smog am 27. Oktober die Stadt einzuhüllen begann, hielten die Einwohner das für ganz normal. Kinder trugen Halloween-Verkleidungen und gingen die neblige Hauptstraße hinunter. Die örtliche Footballmannschaft spielte weiter, obwohl die Spieler den Ball nicht mehr sehen konnten. Schon bald spitzte sich die Situation zu. Passanten wurde übel, sie schnappten nach Luft, bei den Ärzten klingelte ununterbrochen das Telefon. Rettungskräfte brachen auf, doch im dichten Smog konnten sie sich kaum orientieren. Krankenwagen krochen durch die Nebelsuppe, ein Mann mit Taschenlampe ging vorneweg und leuchtete ihnen den Weg. Feuerwehrleute zogen mit Sauerstoffgeräten von Haus zu Haus. Die Ausfallstraßen waren unpassierbar, die Bevölkerung saß in der giftigen Wolke fest.
Bis zum 30. Oktober starben 17 Menschen, die meisten von ihnen waren um die 60.5 Als der Smog sich endlich lichtete, stieg die Zahl der Todesopfer auf 20 und mehr als 5000 Menschen, die Hälfte der Bevölkerung, war leicht bis schwer erkrankt. Eine öffentliche Gesundheitskrise.
25 Wissenschaftler wurden vor Ort geschickt, um zu untersuchen, was geschehen war. Sie fanden heraus, dass der Smog aus einer Mischung des Rauchs der nah gelegenen Fabriken entstanden war, der aufgrund einer sogenannten Inversionswetterlage nicht nach oben entweichen konnte.6 Der Tag, an dem der Smog begann, wurde »S-Day« genannt, die Krankheit nannte man »Smog-Krankheit«7. Die Symptome reichten von entzündeten Augen über Husten bis zu schwerem Sauerstoffmangel, die Betroffenen fielen in Ohnmacht oder ihre Haut lief blau an. Damals wurde die Untersuchung als die »umfassendste zum Thema Luftverschmutzung überhaupt« gelobt. »Die Welt muss etwas gegen diese neue Dimension tun«,8 hieß es.
Laut Clarence Mills, der die erste unabhängige Untersuchung zu diesem Fall durchführte, war das der »erste Massenmord durch industrielle Luftverschmutzung in den USA«9. Nicht nur Menschenleben waren zu beklagen, auch die Erde war auf »schreckliche Weise zerstört«, und nahezu die gesamte Flora im Umkreis von einer Meile um die Fabriken war vernichtet. Mills erkannte zudem, dass neben den unmittelbaren Todesfällen auch die langfristigen Gesundheitsschäden durch das Einatmen verschmutzter Luft in den Fokus rücken müssten. Dadurch würde der größere gesellschaftliche Schaden angerichtet, eine Erkenntnis, die auch heute noch gilt. Sein Artikel von 1950 endet mit einer klaren Botschaft: »Hoffen wir, dass die Katastrophe von Donora weltweit auf die Gefahren der Luftverschmutzung hinweist. Es geht um die Luft, die wir alle atmen.«10 Aber die Menschen wachten nicht auf. Jedenfalls nicht gleich.
Nur zwei Jahre später kam es im Dezember 1952 auf der anderen Seite des Atlantiks zu einer weiteren tödlichen Smog-Katastrophe, dem »Great Smog« in London, ein Ereignis, das fünf Tage dauerte und durch giftige Abgase ausgelöst worden war. Der Rauch aus den Kohlekraftwerken verwandelte die Luft in ein dickes, erbsensuppenfarbiges Gemisch, das nach faulen Eiern stank. Man konnte nur noch wenige Meter weit sehen, London war wie gelähmt, und Tausende starben, Hunderttausende trugen bleibende Gesundheitsschäden davon. Der »Große Smog« bleibt bis heute eine der schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte Großbritanniens.11 Er führte 1956 zum Clean Air Act, einem grundlegenden Maßnahmenpaket, das sowohl die Industrie als auch die Haushalte in Städten zwang, zu saubereren Technologien zu wechseln. Wie jedes vom Parlament des Vereinigten Königreichs beschlossene Gesetz beginnt es typisch britisch: »In Kraft gesetzt von Ihrer hochwürdigsten Majestät der Queen.« Es enthält als erste Vorschrift: »Aus keinem Schornstein eines Gebäudes soll dunkler Rauch ausgestoßen werden, und wenn doch, werden die Bewohner dafür belangt.«12 Es legte auch fest, dass keine neuen Öfen in Betrieb genommen werden durften, es sei denn, sie »können dauerhaft ohne schädliche Rauchentwicklung betrieben werden«.
Rauch war der neue Feind. Die Stadtverwaltungen wurden angewiesen, Zonen festzulegen, in denen nur Brennstoffe verwendet werden, die keinen Rauch erzeugten. Fabriken mussten die Verschmutzung auf ein Minimum reduzieren, und Inspektoren setzten die Vorschriften durch. Bei Zuwiderhandlung verhängten sie Geldstrafen.
Um die Smogbekämpfung zu unterstützen, wurde im Warren Spring Laboratory wissenschaftliche Forschung betrieben.13 Ein Schwerpunkt lag auf dem »Auftreten von Stickoxiden« (NOx), einem Thema, das Jahrzehnte später eine zentrale Rolle im Dieselgate-Skandal spielen sollte.
Die Luftverschmutzung per Gesetz als Straftat einzustufen und mit rechtlichen Konsequenzen zu ahnden, war ein grundlegender Schritt, doch die erhofften Veränderungen setzten deutlich langsamer ein als erwartet. Fast ein Jahrzehnt nach dem »Great Smog« wurde London 1962 erneut von einer giftigen Smogwolke heimgesucht, wieder im Dezember. Fünf Menschen starben.14 Das führte zu einer Nachbesserung des Clean Air Act, denn offensichtlich hatte die erste Version nicht die gewünschte Wirkung.15
Im gleichen Jahr stellte Rachel Carson mit ihrem Buch Silent Spring die Auffassung infrage, dass Technologie zwangsläufig Fortschritt bedeutet. Die verheerende Wirkung des Pestizids DDT auf Flora und Fauna zeige, dass Innovation auch schädlich sein kann. Ihr Buch wurde zum Meilenstein der weltweiten Umweltbewegung.
Weitere Smog-Katastrophen in den USA und in Großbritannien führten 1963 dazu, dass die USA ihren eigenen Clean Air Act erließen. Unterstützt wurden diese Bestrebungen von der neuen Umweltbewegung. In den nächsten zwei Jahrzehnten folgten viele Länder weltweit diesem Beispiel.
Wie zu erwarten war, begann die Industrie sofort, sich gegen die Strategien zur Luftreinhaltung zu wehren.16 Während der Debatte zur Anpassung des Clean Air Act war vor allem die Unvereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und Umweltschutz strittig gewesen. Der Bürgermeister einer kleinen amerikanischen Stadt wurde mit den Worten zitiert: »Wenn diese Stadt wachsen soll, muss sie stinken.« Auch für viele andere war Umweltverschmutzung unvermeidlich – der Preis für den Fortschritt. Großunternehmen und Politiker setzten ihren Widerstand gegen Umweltstandards fort, und manche tun dies bis heute.
Doch schon bald wurden die Vorteile der sauberen Luft offenkundig. Die Smogwerte in Großstädten sanken, und der Bevölkerung wurde klar, wie viel besser das Leben ohne die giftigen Wolken über ihren Köpfen war. »Los Angeles wurde sowohl zum Epizentrum des Problems als auch zum Ausgangspunkt der Lösung. Dort war der Smog so schlimm, dass die Menschen etwas dagegen unternehmen wollten und man bereits 1947 die erste Behörde zur Kontrolle der Luftverschmutzung gründete«, erklärte Ayala. »Der Los Angeles County Air Pollution Control District wurde mit der Überwachung und der Analyse der Luftverschmutzung betraut. Diese regionale Behörde war Vorreiterin für andere in ganz Kalifornien. So wurde beispielsweise 1959 der Sacramento Metropolitan Air Quality Management District ins Leben gerufen, dessen Leitung ich heute innehabe. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.«
1967 wurde die CARB gegründet, um sich mit der Luftverschmutzung in Kalifornien zu befassen. Sie erhielt die Befugnis, strengere Vorschriften als in anderen Staaten durchzusetzen. Die CARB etablierte sich schnell als eine Autorität, vor der sich Autobauer weltweit fürchteten. Und wie Ayala mir sagte: »Der Weg, um auf dem US-Automarkt Fuß zu fassen, führt zwangsläufig über Kalifornien.«
Kalifornien war bei den Emissionswerten so streng, weil die Luftverschmutzung über Los Angeles, der sogenannte photochemische Smog, eingedämmt werden musste. Die Hauptverursacher waren dabei nicht Fabriken oder Öfen, sondern Autos.
Die unsichtbare Gefahr
Photochemischer Smog bildet sich, wenn flüchtige organische Teilchen (VOCs) und Stickoxide (NOx) in Kontakt mit Sonnenlicht kommen, relevante Begriffe in der Welt der Emissionsverbrechen.
VOCs sind in vielen Industrie- und Haushaltsprodukten enthalten, darunter Farben, Reinigungsmittel und Klebstoffe, und verschmutzen die Luft. Die Stickoxide stammen meist aus Verbrennungsprozessen, und je heißer diese Prozesse ablaufen, desto mehr schädliches NOx entsteht. Aber in Großstädten wie Los Angeles werden sie häufig von Kraftwerken, Fabriken – und, wie erwähnt, von Autos verursacht.
Stickoxide, die Pkws und Lkws ausstoßen, sind das Ergebnis ineffektiver Verbrennung fossiler Brennstoffe in Motoren. Vereinfacht gesagt, sind sie die Überreste von Zündungsvorgängen, durch die sich das Auto bewegt. Gegenüber Benzinmotoren sind die NOx-Emissionen bei Dieselmotoren deutlich höher, was hauptsächlich mit den höheren Verbrennungstemperaturen und höherem Druck zu tun hat. Dadurch erzeugen Dieselmotoren aber auch ein höheres Drehmoment, wodurch sie besonders gut für die Beförderung schwerer Lasten geeignet sind. Von 1970 an wurden dem US Clean Air Act die NOx-Emissionsnormen hinzugefügt.
Bei der Donora-Katastrophe hatten Wissenschaftler festgestellt, dass das Einatmen von Luft mit einer hohen NOx-Konzentration besonders schädlich ist und zu einer Verschlimmerung von Atemwegserkrankungen und vermehrten Symptomen wie Husten und Atemnot führen kann.17 An Tagen mit hoher Stickoxidbelastung werden mehr Menschen in Notaufnahmen eingeliefert. Und selbst für diejenigen, die eine gesunde und leistungsfähige Lunge haben, gibt es schlechte Nachrichten: Langfristige Stickoxidbelastung kann Asthma verursachen und macht anfällig für Atemwegsinfektionen wie Erkältungen oder Grippe.18 Deshalb sind Stickoxide auch so gefährlich für Kinder und ältere Menschen.
Um die Eigenschaften der Stickstoffoxide besser zu verstehen, sprach ich mit Harald Frey von der Forschungsstelle für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der TU Wien. Er erklärte mir, dass »Stickoxide für die Versauerung von Boden und Wasser verantwortlich sind«, das heißt zum sauren Regen beitragen, der wiederum Pflanzen und Ökosysteme schädigt. Zudem seien Stickoxide »die Vorläufer für Feinstaub und Ozon« und trügen damit indirekt zu großflächigen Umweltverschmutzungen bei. Das Ozon hoch oben aus der Stratosphäre schützt uns vor der UV-Strahlung aus dem Weltraum. Bodennahes Ozon allerdings, das troposphärische Ozon, trägt zur globalen Erwärmung und Smogbelastung bei.19
Eines der häufigsten Stickoxide ist Stickstoffdioxid (NO2), das in Abgasen von Dieselmotoren enthalten ist. »Die direkte Wirkung von Stickstoffdioxid auf den Menschen ist besonders schädlich«, sagte Frey und erklärte, dass der Stickstoffausstoß von Fahrzeugen am schlimmsten sei, denn »im Gegensatz zu den Industrieemissionen werden die Abgase direkt über den Boden ausgestoßen«. Also dort, wo Menschen sie direkt einatmen. Jüngste Studien, so Frey, zeigten, »dass es keinen Schwellenwert für Stickoxide gibt, unter dem Gesundheitsschäden ausgeschlossen werden können«. In anderen Worten: Selbst sehr niedrige Werte können gesundheitsgefährdend sein. »Dieselfahrzeuge sind die Hauptursache für die Stickoxid-Emissionen in Städten, sie verursachen 65 Prozent aller direkten NOx-Emissionen im Straßenverkehr«, ergänzte er und betonte, dass alte Dieselfahrzeuge, deren Baujahr vor 2022 liegt, häufig wesentlich schädlicher seien als neue. Angesichts der Tatsache, dass weniger als jedes fünfte Auto über einen Dieselmotor verfügt, sind die Emissionswerte völlig unverhältnismäßig. Und das hat in Teilen damit zu tun, dass man ihnen eine sogenannte Abschaltvorrichtung eingebaut hatte.
Ein skandalöses Déjà-vu
Ayala erklärte mir, dass eine Abschaltvorrichtung »nicht notwendigerweise ein physisches Gerät sein muss, das man in das Auto einbaut. Es handelt sich eher um die Manipulation der Software, die sagt, gut, das Auto wird getestet, also sorgen wir dafür, dass es sauber ist.« Nach dem Test wird sie wieder abgeschaltet, und die Emissionswerte werden schlechter.
Bei der Abgasmessung werden die Autos auf ein großes Laufband gestellt und dann die Abgase gemessen, die aus dem Auspuff kommen. Der spezifische Test, den Volkswagen in den USA zu absolvieren hatte, simulierte eine Fahrt in Los Angeles. Die programmierte Strecke enthielt Straßen in der Stadt, eine Autobahnauffahrt und eine Fahrt bergauf. Die Autobauer wussten das, denn die Strecke wurde online veröffentlicht. Und so programmierten die Entwickler des »defeat device« das Profil der virtuellen Strecke und andere Testspezifika, wie zum Beispiel fehlende Lenkradbewegungen.20 Dadurch stellten sie sicher, dass das Auto in den schadstoffarmen Modus schaltete. So geschehen, glichen die Ergebnisse einem Wunder.
Eine Abschaltvorrichtung beeinflusst die Emissionen, indem sie das Fahrverhalten des Autos verändert. Das kann über einen kurzen Zeitraum geschehen, doch wenn sie die ganze Zeit aktiv sein soll, muss das Auto entsprechend konstruiert sein. Und das kostet Geld. Ayala erklärte: »Ein Unternehmen wie Volkswagen versuchte, das Abgaskontrollsystem auf ein Minimum zu reduzieren, es funktionierte gerade mal beim Test im Labor. Aber auf der Straße? Vergiss es.«
Ich fragte ihn, ob Volkswagen in der Lage gewesen wäre, Dieselautos so sauber zu bauen, wie es in der Werbung behauptet wurde. Seine Antwort: »Ja, natürlich. Es war kein Problem des Know-hows, sie wollten einfach den leichteren Weg gehen.« Saubere Autos zu bauen, die die Vorgaben erfüllten, wäre deutlich teurer gewesen und hätte das Budget überschritten.
Zwei Gründe führten zur Entscheidung für eine Abschaltvorrichtung. Erstens waren die Vorschriften in den USA strenger als in Europa, sodass es für Volkswagen schwer war, ein Auto zu konstruieren, das den nötigen Standards entsprach, ohne das Budget zu sprengen. Zweitens spielte das Marketing eine entscheidende Rolle. In den USA galten Diesel als schmutzig. Volkswagen wollte dieses Vorurteil widerlegen und die Amerikaner mit der neuen sauberen Dieseltechnologie beeindrucken.
Und es funktionierte unglaublich gut. Nachdem sie die Emissionstests bestanden hatten, wurden 600.000 saubere Diesel allein in den USA verkauft, weltweit waren es geschätzte 11 Millionen.21
Als Ayala und sein Team der CARB begannen, die Funktionsweise näher zu untersuchen, tauchten immer neue Fragen auf. 2013 schaltete Ayala zwei weitere Teams ein, um die Werte zu überprüfen, seine langjährigen Kollegen vom Center for Alternative Fuels, Engines und Emissions (CAFEE) an der West Virginia University und ihre Geldgeber vom International Council on Clean Transportation (ICCT). Sie testeten die Autos im CARB-Labor, wo die Ergebnisse gut ausfielen. Aber auf der Straße? Da waren sie schockierend. Die Stickstoffoxidwerte überstiegen die gesetzlichen Grenzwerte durchschnittlich um das Vierzigfache.22
Volkswagen gelang es noch für kurze Zeit, die Aufsichtsbehörden weiter hinzuhalten. In Meetings behaupteten sie, es handele sich um ein technisches Problem, und gleichzeitig versuchten sie, den Betrug an einer anderen Stelle im Code zu verstecken. Doch Ayala verlor langsam die Geduld. 2015 legte der VW-Mitarbeiter auf der Konferenz in Kalifornien schließlich ein Geständnis ab. Mit einem Bier in der Hand.
Irgendetwas an der ganzen Sache kam Ayala merkwürdig vor. »Wahrscheinlich wollte ich mehr als jeder andere einfach nicht glauben, dass sie die Unwahrheit sagten. Denn in meiner Karriere bei der CARB hatte ich bereits einen anderen großen Betrugsskandal erlebt … Ich konnte einfach nicht fassen, dass mir all das noch einmal begegnet.«
Nicht nur Ayala hatte das Gefühl, in einem Déjà-vu gefangen zu sein. Daniel Carder, einer der CAFEE-Forscher, die der VW-Stickoxidtrickserei auf die Spur gekommen waren, hatte bereits in den 1990er-Jahren mobile Abgastests entwickelt.23 Seine vor Ort einsetzbaren Messgeräte hatten Abschaltvorrichtungen in schweren Dieselmotoren entdeckt, die oft in Traktoren oder Baufahrzeugen verbaut werden.
»Volkswagen wiederholte das auf fast identische Weise«, erzählte Ayala, der die Unverfrorenheit noch immer nicht fassen kann. Er habe Schuldgefühle, das Vorgehen von VW nicht früher erkannt zu haben. Doch die Lügen des Konzerns waren so dreist, dass er nicht mal auf die Idee gekommen war, dass so etwas möglich wäre.
Der 1998 aus dem Skandal resultierende Vergleich, das Cummins Engine Company Settlement, zwischen dem US-Justizministerium und sieben großen Motorenherstellern stellte die höchste zivilrechtliche Strafe dar, die bis dato für ein Umweltvergehen fällig wurde.24 Die Verursacher mussten 83,4 Millionen US-Dollar zahlen. Die meisten wurden danach erneut erwischt.25 Seitdem hat Cummins zwei weitere Vergleiche geschlossen, um angebliche Verstöße gegen den Clean Air Act zu regeln. Beim bisher letzten Vergleich, der 2024 vereinbart wurde, musste das Unternehmen 1,675 Milliarden US-Dollar zahlen – die bislang höchste zivilrechtliche Strafe im Zusammenhang mit dem Clean Air Act.26
Wenn man weiter in die Vergangenheit blickt, stößt man auf eine lange Geschichte von Abschaltvorrichtungen bei Benzinern und Dieseln. Bereits 1973 waren, laut EPA, u. a. Chrysler, Toyota und General Motors in den USA in Schwierigkeiten geraten, weil sie bei einer Abschaltvorrichtung Temperatursensoren entfernt hatten.27 Und 1974 kam auch Volkswagen dazu, als das Unternehmen es versäumte, »zwei Einrichtungen zur Manipulation von Abgaskontrollen« bei etwa 25.000 Autos offenzulegen.28 Anstatt aus Fehlern zu lernen, scheint es, als hätten viele Unternehmen Jahrzehnte damit verbracht, die Lügengebilde der jeweils anderen zu übernehmen. Es war ungeheuerlich. Ayala hatte die Nase voll.
Am 18. September 2015 stellten die CARB und die Environmental Protection Agency eine Rechtsverletzung fest, die durch die »Entwicklung und den Einbau einer Abschaltvorrichtung in bestimmten Fahrzeugen« verursacht wurde. Dies führte zu Stickstoffoxidemissionen, die die gesetzlichen Grenzwerte »um das 10- bis 40-Fache« überstiegen. Betroffen waren auch die Diesel-Spitzenmodelle Jetta, Golf, Käfer und Passat. Zudem seien auch mit 2,0-Liter-Dieselmotoren ausgestattete A3-Modell von Audi, Teil der Volkswagengruppe, betroffen gewesen.
Die internationale Presse schlug sofort Alarm. Und die Menschen waren wütend. Ich auch.
Vielleicht liegt es daran, dass ich Deutsche bin oder selbst einen VW besessen habe und Teile meiner Familie immer noch VW fahren. Vielleicht daran, dass ich immer in Städten gelebt habe und Volkswagen es zugelassen hat, dass mein Partner, der an Asthma leidet, und ich all die Jahre das Stickstoffoxid einatmeten. Oder es könnte auch daran liegen, dass all diese klugen Ingenieure ihre Intelligenz dazu missbraucht haben, der Erde zu schaden, anstatt sie zu schützen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich bin stinksauer. Und bevor ich die Verantwortlichen vorstelle, möchte ich noch einen Moment bei der Wut verweilen, denn manchmal ist Wut nicht etwa das Problem, sondern genau das, was wir brauchen.