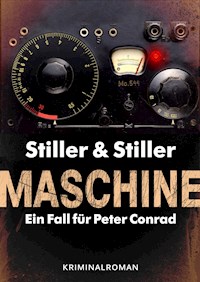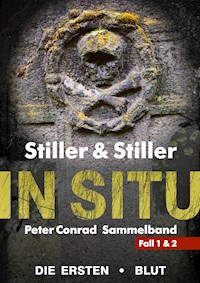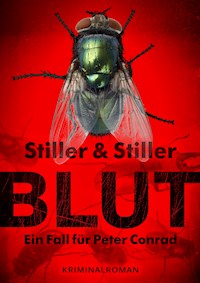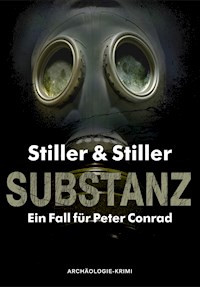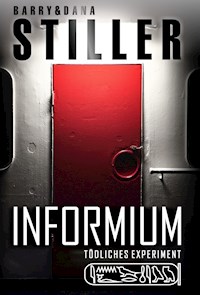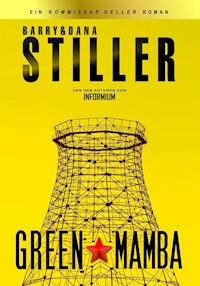
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
DDR, Februar 1974: Soldaten machen im militärischen Sperrgebiet Jagd auf Kinder. In einer psychiatrischen Klinik tötet ein Patient seinen Arzt. Ich bin nicht verrückt lautet die Nachricht des Mörders, die im Kopf des Toten gefunden wird. Bevor Josef Keller, Ermittler der Volkspolizei, den Täter Kaltenbrunn befragen kann, stirbt dieser bei einer mysteriösen Operation. Als ein traumatisierter russischer Junge im Polizeipräsidium auftaucht und ein weiteres Kind tot aus einem Fluss gezogen wird, beschlagnahmen die Sowjets die Leiche und schalten den KGB ein. Bei ihren Untersuchungen entdecken Oberleutnant Keller und sein neuer Partner Kosminsky verstörende Botschaften in den Zeichnungen Kaltenbrunns, die sie auf die Spur einer tödlichen Bedrohung führen. Ohne es zu ahnen, kommen sie den Spionen der Hauptverwaltung-Aufklärung gefährlich nahe und geraten ins Fadenkreuz der Stasi. Denn das Ministerium für Staatssicherheit wird mit allen Mitteln die Aufdeckung des gefährlichsten Geheimnisses der DDR verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G R E E NM A M B A
STILLER&STILLER
Dana widmet dieses Buch Papa, Lolo und Chilla.
GREEN MAMBA
Dienstag, 12. Februar 1974
07:37 uhr
»Nun mach schon, mir wird kalt!« Der Junge, etwa zwölf Jahre alt, trat von einem Fuß auf den anderen und rieb die Finger gegeneinander, was kaum half.
Alexejs schlaksiger Schatten tauchte hinter dem Baumstamm auf. »Jetzt stell dich nicht so an«, gab er zurück, während er seinen Hosenstall schloss.
Obwohl die Jungen fast gleich alt waren, wirkte Alexej wie der große Bruder. »Weiter geht's. Stell die Träger enger, sonst tun dir nachher die Schultern weh«, wies er Sascha mit fachmännischem Blick auf seinen Rucksack an. Alexejs Vater verstand keinen Spaß bei fehlerhafter oder nachlässiger Ausrüstung. Er war ein fanatischer Naturfreund, der mit seinen Söhnen manchmal wochenlang in den Wäldern verschwand. Während Alexejs Schulfreunde Urlaub an der See machten oder in der Laubenkolonie mit Freunden Tischtennis spielten, lernten er und seine zwei Brüder, wie man auch unter schwierigen Bedingungen überleben konnte.
Sascha hingegen fuhr mit seinen Eltern immer zur Großmutter in die Stadt. Am liebsten aß er dann Eiscreme im Freibad. Alexejs Leben schien ihm anders und interessant. Er machte aus seiner grenzenlosen Bewunderung für den neuen Freund keinen Hehl, und so war dem letztlich nichts anderes übrig geblieben, als für ein echtes Abenteuer zu sorgen. Ein Abenteuer, das für Sascha zu einem großen Teil aus Frieren zu bestehen schien. Alexejs Jacke mochte der Herausforderung eines frostigen Februarmorgens gewachsen sein, Saschas Kaufhaus-Parka war es nicht. Bei den Vorbereitungen für ihre geheime Exkursion hatte Alexej kurz überlegt, die daunengestopfte Jacke von seinem Bruder Dmitri mitzunehmen, aber das wäre zu Hause gleich aufgefallen und hätte ihm unglaublichen Ärger mit seinen Eltern eingebracht.
»Gut, wir haben noch ungefähr zwei Stunden«, sagte Alexej im Tonfall eines Kommandanten, der seinen Generälen die Strategie erklärt.
»Zwei Stunden?«
»Bevor wir umkehren müssen.«
Sascha hielt sich im Windschatten des Freundes, während sie eine kleine Steigung erklommen. »Wo gehen wir genau hin? Du warst doch schon mal hier, oder?«
Alexej grinste kurz und blieb auf dem höchsten Punkt des Hügels stehen. Der Blick über die vor ihnen liegende Ebene war weit und wurde nur durch kleine Gruppen von dürren Bäumen unterbrochen. »Niemand geht hier hin, Sascha«, murmelte er mit bösartig verstellter Stimme.
Einen Moment starrten die Jungen einander an, dann fing Alexej an zu lachen und Sascha boxte ihn in die Rippen.
»Jetzt komm schon, wir sind am ersten Zaun«, rief Alexej und lief los.
Am Fuß des Hanges hing ein Maschendrahtzaun schlapp zwischen eisernen Pfosten. Gefrorenes Laub klebte an den Maschen und türmte sich an den betonierten Fundamentklötzen. Ein verrostetes Schild mit kaum lesbarer Beschriftung ließ noch erahnen, dass es sich einmal um eine militärische Absperrung gehandelt hatte – oder noch handelte? Saschas Herzschlag beruhigte sich, als ihm klar wurde, dass das, was sie taten, seine Mutter zwar sicherlich in Aufregung versetzen würde, aber nichts so richtig Verbotenes war. Jedenfalls redete er sich das ein.
Es war nicht so, als würde er Alexej nichts anderes zutrauen. Der hat Schneid. Das hat der von seinem Vater, hatte Saschas Mutter gesagt, und sie hatte das nicht freundlich gemeint, schien es Sascha. Seine Mutter mochte keine Soldaten und schon gar keine wie Alexejs Vater.
»Hier, nimm.« Sascha nahm ein Päckchen entgegen, das er nach einem Augenblick als ein in Papier gewickeltes Butterbrot erkannte. »Du hast bestimmt nicht gefrühstückt.«
»Du bist ja schlimmer als meine Mutter.«
»Klar, die will ja auch, dass du noch groß und stark wirst«, stichelte Alexej, der selbst ständig mit Essen vollgestopft wurde, in der Hoffnung, dass er nicht wie eine Bohnenstange immer weiter nur in die Höhe schießen würde.
Sascha schnaubte und biss in die buttrige Stulle. Die musste Alexej selbst für ihn geschmiert haben. Er grinste bei der Vorstellung. In seinem eigenen Rucksack waren nur eine Tüte harte Zuckerbonbons und Kekse, in einem unbeobachteten Moment aus dem Küchenkabuff entwendet. Und natürlich die Trinkflasche. Sie war aus Aluminium und sah aus, als hätte sie schon einiges mitgemacht. Wasser dabei zu haben war das Allerwichtigste, hatte sein Freund ihm erklärt. Und weil Sascha überhaupt nichts besaß, was für ein solches Abenteuer nützlich war, hatte er ihm seine alte Trinkflasche geschenkt.
Ein Stück hinter dem alten Zaun trafen die beiden Jungen auf einen überwachsenen Weg aus Betonplatten. Selbst Sascha erkannte die typisch militärische Bauweise gleich. Das Kribbeln in seinem Magen nahm wieder zu und er fragte sich, ob das hier eine gute Idee war, egal wie zerfallen der Zaun ausgesehen hatte. Hundert Meter hinter der alten Panzerstraße mussten sie einen zweiten, in einem breiten Streifen aus Nadelgehölz verborgenen Maschendrahtzaun überwinden – der wesentlich besser in Schuss war.
Sie gingen immer weiter durch die kalte Landschaft, in der es nicht viel zu sehen gab. Zumindest nicht für Sascha, weil für ihn alle Bäume gleich aussahen und er auch noch nie irgendetwas gejagt oder sich je dafür interessiert hatte. Nachdem er das zweite Mal ausglitt und beinahe lang hinschlug, hielt er seinen Blick die meiste Zeit auf den Boden unmittelbar vor seinen Füßen gerichtet. Wäre er nicht mit Alexej unterwegs gewesen, Sascha wäre längst umgekehrt.
Nach einer gefühlten Ewigkeit zeigte Alexej ihm Abdrücke im Boden und behauptete, dass die von einem Wolf stammten. Sie folgten der Spur ein Stück weit. Sein Freund zeigte stolz das Jagdmesser vor, das sein Vater ihm zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, als wolle er sie damit gegen wilde Tiere verteidigen.
Doch Sascha vermisste das erhoffte Abenteuer. Leise Enttäuschung breitete sich in ihm aus, und insgeheim sehnte er sich nach seiner warmen Bettdecke.
»Wie krass! Guck dir das an.« Alexej hielt einen Stock in der Hand und stocherte auf dem Boden vor sich herum. Zunächst war nicht zu erkennen, was er da tat.
Sascha trat neben den Freund – und machte einen Satz zurück. »Igitt, das ist eklig!«
»Das ist nur ein toter Biber.« Alexej fasste nach dem Messer in der seitlichen Tasche seiner Hose. »Eigentlich sieht er noch frisch aus. Wenn ich meinem Vater nicht erklären müsste, wie ich an den Pelz gekommen bin...«
Sascha wurde kreidebleich und wagte nicht, sich zu rühren. Er sagte auch nichts. Im wurde übel.
Alexej ging neben dem verendeten Tier in die Hocke und musterte den feucht glänzenden Pelz. Als er den massigen Kadaver unter beträchtlichem Krafteinsatz mit dem Stock umgedreht hatte, verzog er enttäuscht das Gesicht. »Sowieso nicht zu gebrauchen. Der Pelz ist hier völlig kaputt.«
»Hm-hm.« Sascha kämpfte mit dem Brechreiz.
»Na hier! Da, siehst du das?« Er wies auf eine Stelle, an der sich etwas Unebenes, Dunkles von der weißlichen Haut abhob; das Haarkleid fehlte hier fast völlig.
»Ja doch.«
Alexej bemerkte erst jetzt, dass sein Freund sich unwohl fühlte. »Man könnte immer noch tolle Handschuhe daraus machen. Oder einen Pelzkragen.« Es klang wie eine Verteidigung.
»War das der Wolf?«
Alexej betrachtete das zerstörte Gewebe näher. »So eine Verletzung habe ich noch nicht gesehen. Von einem Wolf ist die sicher nicht.« Er schüttelte den Kopf. »Sieht eher aus, als wäre der Biber krank gewesen.«
»Lass uns einfach weitergehen, ja?«
Nach dem Fund des Bibers war Alexej schweigsamer und bewegte sich rascher durch die buckelige Landschaft als zuvor. Sascha hatte das Gefühl, den Freund verärgert zu haben. Unglücklich versuchte er, weiter Schritt zu halten.
Die Sonne löste endlich den Hochnebel über ihnen auf und spiegelte sich hell in den vereisten Senken überall um sie herum. Überhaupt war das Gelände irgendwie anders geworden, bemerkte Sascha, als er den Blick für einige Momente vom Erdboden vor seinen Füßen löste. Als hätte jemand eine Decke nur nachlässig über ein Bett gebreitet, hob und senkte sich die Erdoberfläche hier auf engem Raum. Überall lagen kleine Tümpel verstreut, aus denen gefrorenes Gras stak.
»Ich hab's doch gewusst«, rief Alexej plötzlich und blieb stehen. »Siehst du das?«, fragte er mit ausgestrecktem Arm.
Sascha kniff die Augen zusammen. »Was ist das denn?«
»Lass uns nachgucken.«
Mit neuer Energie marschierten sie los in Richtung des dunklen, schroffen Schattens, der sich in gut hundert Metern Entfernung mannshoch über den Boden erhob. Nach wenigen Schritten trafen sie erneut auf einen Militärweg aus standardisierten Betonelementen. Keinem der Jungen fiel auf, dass dieser hier weniger verfallen war als der in der Nähe des Sperrzauns.
Der Plattenweg führte genau in die Richtung des Bauwerks, das immer mehr Ähnlichkeit mit einem Bunker aufwies, je näher sie kamen. Endlich wurde es spannend, dachte Sascha. Er hatte eigentlich keine Ahnung, was man dort finden konnte. Trotzdem besaß die Vorstellung, einen verlassenen Bunker zu erforschen, einen unerwartet hohen Reiz, der ihm die Handflächen schwitzig werden ließ. Während er wartete, schlich Alexej sich aufwendig an das ominöse Gebäude an, was Sascha mit einer Mischung aus Belustigung und Bewunderung beobachtete. Er hatte den Auftrag bekommen, aus der Deckung eines kahlen Holunderstrauchs heraus Wache zu halten. Alexej duckte sich alle paar Schritte tief in das Gras und umrundete den Bau zweimal in einer enger werdenden Spirale. Er sah nicht so aus, als mache er das zum ersten Mal. Erneut wunderte sich Sascha über seinen Freund. Er dachte an die Gerüchte, die über Alexejs Vater kursierten. Am liebsten hätte er ihn einfach gefragt, aber jedes Mal, wenn der Zeitpunkt geeignet erschien, brachte er es nicht über sich. Vielleicht würde er sich heute endlich überwinden, wenn sie sich auf den langen Weg zurück nach Hause machten.
Es waren vielleicht fünf Minuten vergangen, ehe Sascha einen seltsamen Pfiff hörte. So klang dann wohl ein Wiesenpieper, dachte er, denn das war das vereinbarte Signal für ihn nachzukommen. Er schlang sich den einen Riemen seiner Tasche über die Schulter und stakste durch den zunehmend matschigen Boden.
Minuten später war die Enttäuschung der beiden Abenteurer grenzenlos. »Verdammt nochmal, so eine Kacke.« Alexej trat gegen die Stahltür, die ihnen den Zugang verwehrte.
Er sah richtig wütend aus, fand Sascha. Jetzt, wo sie bloß herumstanden und auf den versiegelten Eingang starrten, wurde ihm wieder kalt und seine Zähne klapperten hinter den zusammengepressten Lippen.
»Ich sehe nach, ob es noch andere Wege da rein gibt«, erklärte Alexej und erklomm behände das kleine Bauwerk. Vielleicht verbarg sich darunter tatsächlich ein unterirdischer Bau – und dies war nur ein oberirdischer Zugang zu einem viel größeren Bauwerk. So mitten im Nirgendwo schien das Sascha unwahrscheinlich, aber was wusste er schon von Bunkern?
Alexej verschwand aus seinem Blickfeld, und Sascha ging auf dem freien und relativ ebenen Platz vor dem kleinen Gebäude einige Schritte umher. Eigentlich könnte man hier gut ein Feuerchen machen. Er und Alexej sollten im Sommer noch einmal herkommen, dann wäre es hier bestimmt prima, überlegte er, und trat auf den flachen kleinen Moorsee zu, dessen schilfbestandenes Ufer sich einen Steinwurf vom Bunker entfernt befand.
Vor Erstaunen blieb der Junge wie angewurzelt stehen. »Alexej!« Der Freund hatte ihn scheinbar nicht gehört, und zu sehen war er auch nicht. Ein kurzes Schaudern durchlief ihn.
»Alexej! Ich habe etwas gefunden!«
Es dauerte nochmal zwanzig Sekunden, bis Sascha Rascheln und die Schritte seines Freundes im hohen Gras hinter sich hörte.
»Was schreist du denn hier so–« Alexejs Mahnung blieb unvollendet. Er blickte voller Erstaunen auf das, was Sascha entdeckt hatte, und dann grinste er den Freund breit an. »Das ist verrückt! Sowas habe ich ja noch nie gesehen.«
Sie hockten sich vor die stabile Konstruktion aus Metallrohren, an der eine Reihe eckiger, verschiedenfarbiger Kästen befestigt war. Die kleinen eingeprägten Buchstaben und Ziffern waren im Gegenlicht nicht lesbar. Alexejs Finger fuhren prüfend an ihnen entlang, und dann schnappte an dem dunkelbraunen Gerät die Abdeckung empor.
»Sieh dir das an«, murmelte Alexej, nachdem er einem leisen Pfiff ausgestoßen hatte. Sascha kam näher und betrachtete die nun sichtbaren Bedienelemente und Anzeigen, den großen Drehknopf auf der rechten Seite. Die Beschriftungen waren deutlich erkennbar, für ihn aber völlig unverständlich.
Alexej schloss die Klappe wieder und wandte sich dem nächsten Kasten zu, aus dem stabile Kunststoffschläuche zu kleineren, länglichen Apparaten führten.
»Was machst du denn da?«
»Wonach sieht es denn aus, Sascha?« Alexej hatte seine grünen Wollhandschuhe ausgezogen und zwischen die knochigen Knie geklemmt. Nun schob er seine Finger unter die Halterung und löste die etwa handlangen, röhrenförmigen Endstücke heraus, dann drehte er sie, bis sich die Anschlüsse lockerten. »Wir nehmen uns ein paar Andenken mit.«
Sascha nahm die kleine Trophäe entgegen. Es rumorte in seinem Magen, denn das war jetzt garantiert verboten. Er hatte noch nie etwas genommen, was ihm nicht gehörte. Er hatte noch nie gestohlen.
Das Geräusch eines Motors war plötzlich da.
Sein Herz blieb für einen Moment stehen, alles Blut wich ihm aus dem Kopf. Er und sein Freund starrten einander an und konnten sich nicht rühren. Dann tauchte ein dunkelgrüner Wagen aus dem Nichts zwischen den fernen Buckeln der Landschaft auf und ratterte wie ein Schnellzug den Plattenweg entlang. Er war vielleicht fünfhundert Meter entfernt, dann vierhundert. Dreihundert. Als sie endlich aufsprangen, um zu ihren Rucksäcken zu rennen, wurden sie von den Männern im Geländewagen entdeckt. Das Auto wurde einen Augenblick langsamer – dann trat der Fahrer aufs Gas.
»Scheiße, sie haben uns gesehen.« Die Stimme seines Freundes zitterte. Er war schon bei ihrem Gepäck angekommen und warf Sascha seinen Rucksack hart entgegen. »Renn.«
»Aber wohin denn?«
»Zurück. Ab hier kommt der Sumpf«, schrie er ihn an. »Jetzt renn endlich los!«
Sie überquerten den betonierten Panzerweg so knapp vor dem heranpreschenden Militärfahrzeug, dass sie die Gesichter der zwei Insassen erkennen konnten. Wie die Hasen wetzten die Jungen im Zickzack über Grasbuckel und matschige Senken; einfach nur weg. Der lose sitzende Rucksack schlug Sascha bei jedem Schritt hart aufs Rückgrat, aber er bemerkte es in seiner Panik kaum.
Der Wagen war mit Knirschen und grellem Quietschen zum Stehen gekommen. Jetzt war Fluchen zu hören. Dann hallte ein lauter Knall durch die Luft. Er erstarrte und drehte sich um. Wieder war er unfähig, sich von der Stelle rühren, obwohl Alexej sich immer weiter entfernte. Die zwei Soldaten setzten ihnen nach, und der eine hob erneut sein Gewehr an die Schulter. Ruhig legte er an. Aber nicht auf ihn.
Sascha wollte schreien und öffnete den Mund, doch die notwendige Luft blieb irgendwo in seinem Hals stecken. Zum Glück, denn hätte sein Freund sich umgedreht, hätte die nächste Kugel nicht den Rucksack getroffen, sondern seinen Brustkorb. Die Projektile zerfetzten den groben Stoff der Tasche an der Seite. Als klar wurde, dass Alexej offenbar unverletzt weiterrannte, konnte er sich aus seiner Starre lösen. Sascha rannte los. Die Richtung war gleichgültig, die Landschaft bot in keiner Richtungen eine erkennbare Deckung. Dem Freund weiter zu folgen, kam ihm nicht in den Sinn – er wäre unweigerlich in die Schussbahn geraten.
Er bahnte sich einen Weg zwischen Birken und niedrigen Buchen. Die kahlen Bäume warfen feine Schattenmuster auf den Boden, weil die Sonne fahl, aber kräftig durch den morgendlichen Dunst schien. Überall schillerten flache Pfützen und kleine Tümpel wie poliertes Silber. Panisch realisierte er, dass es nirgendwo Verstecke gab. Das Gebiet war nicht vollkommen flach, doch die dünnen Bäume standen selten dicht genug, um Sichtschutz zu bieten. Wenn er sich in eine der Senken duckte, dann musste sein Verfolger nur etwas Geduld haben und warten, bis er Spannung oder Kälte nicht länger ertrug und sich erhob. Plötzliche Bewegungen waren leicht zu entdecken, gerade in der eisigen Starre dieses verlassenen Wäldchens.
Also lief er einfach weiter. Er war kein guter Sportler, aber ein wenig Ausdauer hatte er schon – und eine solche Angst, dass er die Anstrengung lange Zeit nicht wahrnahm. Der Mann, der sich ihm an die Fersen geheftet hatte, war noch immer da, kam jedoch schon seit einer ganzen Weile nicht näher. Was sollte das? Offenbar wusste sein Verfolger ganz genau, wo er sich befand, und mit so einem Gewehr konnte man ihn sicher noch aus einiger Entfernung treffen, schätzte er. Das konnte natürlich heißen, dass der Mann ihn vielleicht nicht erschießen wollte. Nach dem, was vorhin passiert war, schien das jedoch wenig wahrscheinlich.
Nein, der Mann brauchte nicht zu schießen, weil er sich ganz sicher war, seine Beute später einfacher zu erwischen. Das hier war eine Treibjagd. Was, wenn die beiden Jäger sich absprachen und ihn in die Enge trieben, wo er dann von weiteren Häschern erwartet wurde? Er war bisher davon ausgegangen, dass die beiden Soldaten auf Patrouillenfahrt und keine anderen Trupps in der Nähe waren, doch vermutlich stimmte das nicht. Es reichte ja, wenn sich die beiden Männer auf eine Himmelsrichtung geeinigt hatten, dann liefen sie den anderen Jägern automatisch vor die Flinten. Man konnte es drehen, wie man wollte. Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand, und er musste damit rechnen, dass schon hinter der nächsten kleinen Anhöhe die perfekte Falle auf ihn wartete. Er versuchte, die Panik herunterzuschlucken, und lauschte.
Der Mann, der ihm, zumeist außer Sicht, folgte, hatte noch keine Schüsse abgegeben, ihm aber immer wieder zugerufen stehenzubleiben. Das würde er auf keinen Fall tun, obwohl er wusste, dass er nicht unbegrenzt lange vor dem Erwachsenen davonrennen konnte. Er spürte bereits, dass er allmählich langsamer wurde; und wenn der Mann wirklich ein Soldat war, dann konnte er eine solche Verfolgung wahrscheinlich mehrere Stunden lang fortsetzen. Verzweifelt wünschte er sich den Freund an seine Seite. Der hätte ganz sicher gewusst, wie man sich in so einer Situation schlau verhielt und überlebte.
Alexej hatte ihn aber auch erst in diese Situation gebracht.
Unwirsch schob er den Gedanken beiseite. Er sollte sich darauf konzentrieren, hier herauszukommen. Wenn er versuchte, die Richtung zu ändern, riskierte er, den Verfolger näher herankommen zu lassen. Er konnte nur einen ganz leichten Bogen schlagen, wenn er ihm nicht vor die Waffe laufen wollte.
Sein Fuß stieß auf ein Hindernis unter dem tiefen Laub. Er war zu erschöpft, um das Gleichgewicht zu halten, und fiel in einen Zaun. Es dauerte einen Augenblick, bis er begriff, dass er tatsächlich zu derselben Stelle zurückgekehrt war, die sein Freund und er vor ein paar Stunden schon einmal passiert hatten. Noch ein weiterer Moment verging, bis er bemerkte, dass er fast zur Gänze im aufgehäuften Laub auf der hangwärtigen Seite des Maschendrahts versunken war. Hektisch streifte Sascha den Rucksack ab und schlüpfte tiefer in das eisige, lose Blattgewühl. Schließlich lag er längs des Zauns und sah sich um. Kein Verfolger. Keine Bewegung. Keine Tiere. Nicht einmal der Wind war zu hören, sein Herzschlag schien das lauteste Geräusch. Endlose Minuten passierte gar nichts.
Dann ein rhythmisches Rauschen von Blättern. Es kündigte den heranwatenden Verfolger an, lange bevor er in sein Blickfeld trat und sich suchend umsah. Mit angehaltenem Atem beobachtete er den Jäger. Das musste irgendeine Art von Soldat sein, auch wenn die Uniform nicht so war wie die, die er kannte. Doch die Haltung und die beiläufige Selbstverständlichkeit, mit der er die Waffe hielt, räumten alle Zweifel aus. Mit hellen Augen musterte der Mann aufmerksam die Umgebung, schien aber nicht sonderlich alarmiert, dass er seine Beute nicht sofort entdecken konnte.
Schweiß rann Sascha den Rücken hinunter.
Ein Ruf gellte zwischen den Bäumen, und der Soldat wandte den Kopf in die Richtung des Kameraden, der hinter Alexej her war. Er wagte nicht, den Kopf zu drehen. Ein Schuss fiel. Sascha versuchte zu atmen, aber es ging nicht. Ein weiterer Schuss krachte. Ein dritter. Der Mann, der ihn verfolgt hatte, verharrte reglos und hielt die Augen geschlossen, als zähle er die Schüsse mit. Als der letzte verhallt war, rief er dem anderen Soldaten etwas zu – in einer Sprache, die Sascha nicht verstand. Nach einigen Sekunden erhielt sein Verfolger eine kurze Antwort, die beunruhigend routiniert klang. Nicht so, wie er sich die Meldung eines Soldaten vorstellte, der gerade auf ein Kind geschossen hatte.
Dann drehte der Jäger sich zielsicher in Richtung des Laubverstecks und erwiderte Saschas Blick.
Mittwoch, 13. Februar 1974
00:39 uhr
Seit er hier war, zuckte der Blick des Mannes umher wie der eines Chamäleons. Der Polizist wartete geduldig, bis beide Augen in seine Richtung starrten. »Doktor Kaltenbrunn, hören Sie mich? Ich bin Oberleutnant Keller von der Mordkommission. Wissen Sie, warum ich hier–«
»Er wollte es nicht!«
»Sie wollten es nicht. Ja, ich verstehe, das ist klar... Was ist passiert, Doktor Kaltenbrunn?« Keller verstand überhaupt nichts, aber er war froh, dass Kaltenbrunn endlich redete.
»Er wollte es nicht. Ich musste ihn töten.« Erneut begann der leere Blick des Patienten, die stockfleckige Decke nach einer imaginären Beute abzusuchen.
»Doktor Kaltenbrunn.« Verdammt, er war kein Psychiater. »Worum ging es... Was wollte Professor Heise nicht?«
Der Alte in der Zwangsjacke reagierte nicht. Nur die Muskeln, die seine Augäpfel in ständiger Bewegung hielten, beschleunigten ihre Arbeit noch einmal. Keller dachte an die Ermahnungen seiner Mutter. Wenn man es provozierte, würden die Augen irgendwann in schielender Stellung einrasten – für immer. Das wusste jeder. Dann konnte man nichts mehr erkennen, sah blöde aus und wurde schließlich auch blöde. Doch das hier war weit gruseliger. Kaltenbrunns Augen waren nicht stehengeblieben. Sie hatten die Verbindung zueinander verloren und rasten in irrwitzigem Tempo durch die Welt. Was nahm man wahr, wenn man gleichzeitig in zwei verschiedene Richtungen blickte? Sah man überhaupt etwas – und was machte das Gehirn daraus? Kellers Hände wurden feucht, und ein kurzes Schaudern durchlief ihn. Er nahm seine unmoderne Schiebermütze ab und knetete sie. »Was wollte der Professor nicht, Doktor Kaltenbrunn? Reden Sie mit mir!«
Diesmal passierte die Frage des Ermittlers in wenigen Sekunden alle vorgeschalteten Instanzen. »Ich musste ihn töten... Er wollte nicht, dass ich mit jemandem spreche.« Für einen Moment schien der Patient bei klarem Verstand und fixierte Keller. »...einem von draußen.«
Wieder gingen die geweiteten Pupillen auf die ziellose Reise, und der Mann, der vor gut einer Stunde seinen Arzt erstochen hatte, zog sich tief ins Universum seiner Wahnvorstellungen zurück.
Das Sprechzimmer von Professor Doktor Wolfgang Heise lag am entgegengesetzten Ende des blassgrün gestrichenen Flures im ersten Stock. Stumpfer Linoleumboden, abblätternder Heizkörperlack und die dunklen Schatten, die der vergebliche Kampf mit Essigwasser gegen den winterlichen Schimmel hinterließ, machten es kaum einladender als den Besucherraum, in dem man Kaltenbrunn festgesetzt hatte.
Die berühmte Therapie-Couch eines Psychologen gab es in Heises Behandlungsraum nicht, nur eine unbequem aussehende Liege auf Rollen. Aber Heise war ja auch Psychiater. Die arbeiten wahrscheinlich eher mit Zwangsjacken, ging es Keller durch den Kopf. Beherrscht wurde das Zimmer von zwei großen Arbeitstischen mit grünlicher Linoleumoberfläche, die vielleicht deshalb zusammengeschoben worden waren, um Aufzeichnungen von Ärzten auszulegen oder Konferenzen abzuhalten – oder um mehr Abstand zwischen Personal und Insassen zu bringen, wie Keller vermutete. Zumindest Letzteres hatte heute Nacht nicht funktioniert. Auf der gegenüberliegenden Seite der großen Tischfläche saß ein korpulenter Mann um die siebzig mit Nickelbrille und weißem Arztkittel. Hemdkragen und linker Ärmel waren mit Blut getränkt. In seinem kahlen Kopf steckte ein dunkler Stift.
»Guten Tag, Genossin...«, begrüßte Keller die dunkelhaarige Frau, die hinter dem Toten stand und dessen Kopf betastete.
»Moreaux, Karla Moreaux. Ich bin von der Inneren der Poliklinik Döbeln. Und der Leichenbeschauer des Bezirks.« Die schlanke Mittfünfzigerin zog den Sezierhandschuh von ihrer Rechten und streckte sie Keller entgegen.
»Guten Tag, oder vielmehr guten Morgen, Frau Doktor. Ich bin Oberleutnant Keller von der K in Leipzig. Ich habe mich gerade gewundert, dass die Tatortarbeit schon so weit fortgeschritten ist. Leichenbeschau und Spurensicherung fast fertig, das ist–« Keller zögerte einen Augenblick nachdenklich. »Nun ja, wurscht, wenn Sie aus der Gegend sind.«
Moreaux wirkte ebenfalls überrascht. Jedenfalls vergingen einige Sekunden, bevor sie antwortete. »Da haben Sie ja einen ganz schönen Weg hinter sich. Wusste gar nicht, dass es im Kreisamt in Döbeln keine Kriminalpolizei gibt.«
»Haben die schon, aber bei Mord wird den Kollegen vom VPKA schnell mulmig. Ich nehme an, die Spurensicherung ist schon durch?«
»Sowas, gleich Leipzig...«, murmelte Moreaux und nickte ungläubig.
»Entschuldigung, Doktor Moreaux?«
»Äh, ja natürlich, die Spurensicherung ist fertig. Und der örtliche Tatortfotograf war auch schon da. Die hätten mich sonst gar nicht hier reingelassen.«
»Na ja, Tatortfotograf, immerhin. Nur einen hauptberuflichen Rechtsmediziner haben die hier augenscheinlich nicht. Seltsame Wege geht die Bürokratie manchmal. Dann lassen Sie mal hören, Doktor.« Keller rang sich ein Lächeln ab und hoffte, dass die Ärztin nun konzentrierter antwortete.
»Der Tote ist Professor Heise. Ich kannte den Kollegen persönlich, guter Mann. Hatte einen Lehrstuhl für Neurologie und Psychologie an der Uni in Leipzig. Galt als echte Koryphäe am Universitätsklinikum. Seit seiner Emeritierung war er nur noch leitender Arzt hier in Waldheim. Aber das ist ja anstrengend genug, denke ich.«
»Über die Todesursache besteht wohl keine Unklarheit?« Der Polizist umrundete den Tisch.
»Nein, Genosse Oberleutnant. Er wurde erstochen. Mit dem Stift, der in seinem linken Ohr steckt. Dürfte zirka fünf oder sechs Zentimeter in sein Gehirn eingedrungen sein. Ist zu einem beträchtlichen Teil im Gehörgang verschwunden. Professor Heise war sofort tot, soweit ich das ohne weitere Untersuchung vermuten kann. So ähnlich wie bei einem Kopfschuss, bei dem das Projektil nicht austritt, nur nicht ganz so blutig.« Moreaux verzog das Gesicht, als habe sie Sodbrennen. »Mann, ich arbeite lieber mit Lebenden, das können Sie mir glauben, Genosse Keller. Auch nach beinahe fünfzehn Jahren geht mir das immer noch ganz schön an die Nerven.«
»Schon gut, Doktor. Ich habe mich mittlerweile fast an den Anblick gewöhnt – leider.«
Die Ärztin räusperte sich. »Ähem, ja. Im Laufe des Tages bekommen Sie von mir einen vorläufigen Bericht. Am Todeszeitpunkt besteht für mich kein Zweifel. Laut Zeugenaussagen gestern Abend, ziemlich genau drei viertel elf. Also vor zwei Stunden, was mit dem Zustand der Leiche zusammenpasst.« Sie zog einen neuen Handschuh über. »Rigor mortis am Kiefer setzt gerade ein. Temperatur stimmt ebenfalls mit dem vermuteten Zeitpunkt überein.«
»Das hier ist der Tatort?«
»Das hier ist mit Sicherheit der Tatort. Meines Erachtens passen die Blutspuren auf Haut und Kleidung des Toten sowie die auf der Tischplatte. Und Anzeichen dafür, dass der Professor post mortem bewegt wurde, sind nicht zu entdecken.«
»Gut, gut, Doktor. Ich denke, das wäre es fürs Erste. Alles Weitere wird ja der endgültige Bericht der KTU ergeben.« Keller besah sich die Mordwaffe aus der Nähe, während Moreaux ihre lederne Tasche packte. »Ein ganz normaler Kugelschreiber, kein Aufdruck oder Ähnliches, soweit ich das bis hier erkennen kann. Sieht nach heimischer Produktion aus. Ich würde sagen, wir verwenden die gleichen im Präsidium. Das wird uns kaum weiterhelfen. Tja, jedenfalls sieht das eher nicht nach vorsätzlichem Mord aus.«
»Ist der Täter Linkshänder?«
»Was meinen Sie, Doktor?«
Moreaux stand auf und schob ihre dickrandige Hornbrille mit dem Handrücken hoch. »Ach, nichts weiter, Oberleutnant.«
»Doch, doch. Raus damit, Frau Doktor. Wie kommen Sie darauf, dass Kaltenbrunn Linkshänder ist?«
Die Ärztin wirkte ein wenig genervt. »Ich meine nur, dass der Täter ja wohl Linkshänder sein muss, denn er kann den Professor nur von hinten attackiert haben – vor ihm auf dem Tisch wird er ja wohl nicht gestanden haben.«
»Verzeihen Sie, Doktor. Sie haben natürlich recht.« Keller gähnte. »Eine Stunde im Auto reicht anscheinend nicht, um wach zu werden. Ich notiere mir das besser.« Er betrachtete seinen Füllfederhalter. »Hmm... Vielleicht trotzdem eine Tat mit Vorsatz. Schließlich werden die Patienten in diesem Irrenhaus kaum Messer oder andere Dinge in die Finger kriegen, die als Waffe taugen könnten. Da muss man nehmen, was einem gerade so zur Verfügung steht.« Für Keller passte trotzdem nicht alles zusammen. »Sagen Sie mal, Doktor, die Spurensicherung hat keine Kappe zu diesem Stift gefunden oder einen Clip oder so etwas?«
Moreaux blickte Keller entgeistert an. »Was? Nein, nicht dass ich wüsste. Jedenfalls hat das mir gegenüber keiner erwähnt. Wieso? Spielt das eine Rolle?«
»Nun ja. Wenn ich davon ausgehe, dass der Kugelschreiber Professor Heise gehörte, dann frage ich mich, wo er ihn aufbewahrt hat. Der Tisch ist komplett leer, kein Stiftbecher, keine Schublade und auch sonst nichts, wo man Schreibutensilien aufbewahren würde.«
»Aha«, entgegnete Moreaux abwesend.
»Glauben Sie, Professor Heise würde einen offenen Kugelschreiber einfach so in die Kitteltasche stecken? Kugelschreibertinte macht kaum entfernbare Flecken. Nein, ich glaube, er hätte ihn genauso in die Brusttasche gesteckt wie den, der da noch ist – ordentlich mit Kappe.«
»Das stimmt wohl.«
»Es gibt aber keine Kappe, Doktor. Und einen Grund, den Kugelschreiber zu zücken, hatte er scheinbar auch nicht, oder sehen Sie hier etwas, auf dem man schreiben würde? Dokumente hat die Spurensicherung hier im Zimmer meines Wissens nicht gefunden. Der Tatort ist ja sicherlich soweit dokumentiert, wie ich hoffe.«
Moreaux wirkte gespannt, erwiderte jedoch nichts.
Keller machte eine ausholende Geste. »Wissen Sie was? Ich würde sagen, wir haben es mit vorsätzlicher Tötung zu tun. Das ist nicht Professor Heises Stift, völlig unwahrscheinlich. Das Einzige, was einen wirklichen Sinn ergibt, ist, dass der Mörder die Tatwaffe mitgebracht hat. Auch wenn mir dieser Kaltenbrunn im derzeitigen Zustand kaum zu geplantem Vorgehen fähig erscheint.« Der Volkspolizist stutzte kurz. »Aber wer weiß, vielleicht ist die Kappe noch auf dem Kugelschreiber drauf.«
»Jaja, man weiß nie, was in solchen Köpfen vorgeht...«, sagte Moreaux, während sie in ihrer Tasche herumkramte.
Keller konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er den Namen der Nachtschwester in sein abgegriffenes Notizbuch schrieb. Die Frau, die kurz vor dreiundzwanzig Uhr auf dem örtlichen Revier angerufen hatte, hieß Alice Patrizia Springfeld, was insofern unpassend wirkte, als sie sicherlich weder im Wunderland noch sonst wo herumhüpfen würde. Sie brachte trotz geringer Körpergröße gut zwei Zentner auf die Waage und schnaufte nach jedem Satz wie ein abgekämpfter Ackergaul. Von ihr erfuhr er, dass Professor Heise den Patienten Kaltenbrunn gegen zweiundzwanzig Uhr dreißig auf dessen intensives Drängen hin in seinem Sprechzimmer empfangen hatte. Auf Kellers Nachfrage, ob dies nicht äußerst ungewöhnlich sei, erklärte die Schwester, dass Professor Heise ein ausgezeichneter Arzt und in wirklich dringenden Fällen auch nachts für seine Patienten zu sprechen gewesen sei. Außerdem habe er auf dem Klinikgelände gewohnt, wie die meisten Mitarbeiter des psychiatrischen Krankenhauses. Eine Viertelstunde später sei dann ein immer lauter werdender Streit aus dem Sprechzimmer zu hören gewesen, woraufhin sie die diensthabenden Aufseher herbeigerufen habe. Als die beiden Männer dann die Tür zu Heises Behandlungszimmer öffneten, sei es bereits wieder ruhig gewesen. Sie fanden den Professor ermordet auf seinem Stuhl und Kaltenbrunn leise jammernd zwischen Aktenschrank und Krankenliege kauernd. Die Pfleger Huber und Willendorf hatten den Patienten in einer Zwangsjacke fixiert, während Springfeld die Polizei rief.
Die Befragung der beiden Männer hatte Keller nicht weitergebracht. Sie hatten kaum Kontakt zu Kaltenbrunn, der sowieso mit niemandem außer mit Professor Heise und manchmal mit seinem Betreuer, einem gewissen Jörg Tassel, sprach.
Dieser junge Krankenpfleger stand nun völlig schlaftrunken hinter der Schwester und umklammerte einen emaillierten Metallbecher mit dampfendem Kaffee.
»Entschuldigung, Frau Springfeld, hätten Sie für mich vielleicht auch...«
»Oh, ja. Na klar.«
Nachdem Keller hastig einen großen Schluck genommen und sich der drückende Schmerz in der Speiseröhre etwas gelegt hatte, wandte er sich mit leidender Miene an Tassel. »Was können Sie mir über Doktor Kaltenbrunn sagen? Was ist er für ein Mensch? Womit hat er sich beschäftigt? Was macht er den ganzen Tag? Erzählen Sie doch mal.«
Tassel zögerte, als wisse er nicht recht, wo er anfangen sollte. »So genau weiß ich das gar nicht, Herr Kommissar. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht viel über Doktor Kaltenbrunn sagen.«
Kellers Hoffnung, bei der Vernehmung zu nächtlicher Stunde nicht viel sagen zu müssen, zerschlug sich. Wie bei den meisten Befragungen würde er auch diesmal mehr reden als der Zeuge. Einen Vorwurf machte er den Befragten nie, es war schließlich nicht so einfach, aus dem Stegreif einen Vortrag zu halten. Würde man ihn fragen, was für ein Mensch sein Vorgesetzter ist...
»Nun gut. Erinnern Sie sich, wie er war, als er eingeliefert wurde? War er aggressiv oder ruhig? Hat er etwas Spezielles gesagt oder getan? War er klar oder so abwesend, wie ich ihn vorhin erlebt habe? Vielleicht hatte er Gegenstände bei sich, die uns helfen könnten, die Umstände seiner Tat zu erklären?«
»Ich war nicht dabei, als er aufgenommen wurde, und habe ihn erst am nächsten Tag gesehen, als ich ihm zugeteilt wurde. Da wirkte er eher ein wenig verängstigt, nicht gewalttätig. War er eigentlich später auch nicht. Nein, nicht soweit ich mich erinnere.«
»Wann genau war das? Ich meine, wann wurde er eingeliefert?«
»Das war im Oktober, kurz nach dem Tag der Republik, glaube ich.«
»Aha. Sagen Sie, Herr Tassel, wenn ein Mensch hier eingeliefert wird, wird er dann gleich behandelt? Ich meine, bekommt er sofort Medikamente?«
»Ja, nachdem alle Aufnahmeformalitäten erledigt sind, wird der Patient von einem Arzt untersucht, und meistens wird dann auch gleich mit der Therapie begonnen. Also auch mit der Medikamentierung.«
»Von Professor Heise, nehme ich an.«
Der junge Pfleger wirkte abwesend. »Wie? Ach ja, bei Kaltenbrunn ist der behandelnde Arzt Professor Heise.«
»Gut«, meinte Keller gedehnt. »Herr Tassel, was sind denn das für Medikamente? Was hat Doktor Kaltenbrunn verordnet bekommen?«
»Doktor Kaltenbrunn hat Paramnesie.«
Keller zog die Augenbrauen hoch und schraubte die Kappe seines Füllfederhalters ab.
»Das ist eine Gedächtnisstörung. Der Patient erfindet dann Ereignisse und erinnert sich an Sachen, die es gar nicht gegeben hat.« Tassel wartete, bis der Polizist seine Erklärung notiert hatte und den Blick hob. »Gegen die Unruhe und Schlafstörungen hat Kaltenbrunn Meprobamat und Radedorm bekommen.«
Keller unterstrich die Namen der Präparate. »Aha, gut. So eine Art Münchhausen stelle ich mir da vor. Und das ist alles? Keine weiteren Medikamente? Nur gegen Unruhe und Schlafstörungen? Nichts gegen diese Paramnesie.«
Noch ehe Tassel antwortete, meldete sich die Springfeld zu Wort. »Außerdem natürlich noch täglich eine Vitaminspritze. Aber fragen Sie mich jetzt nicht nach der genauen Zusammensetzung. Die habe ich immer beim Professor abgeholt, oder er hat sie persönlich verabreicht.«
»Ist es nicht ungewöhnlich, dass der Chefarzt selbst die Medikamente austeilt?«
Tassel blickte zur Decke, als stünde dort die Antwort. »Nun ja. Das kommt nicht häufig vor. Es gibt aber schon Patienten, bei denen das so gehandhabt wird.«
»Außerdem mag... mochte der Professor den Kaltenbrunn irgendwie. Den Eindruck hatte ich«, ergänzte die Springfeld.
»Er mochte ihn?«
»Ja, ich glaube schon. Kaltenbrunn hat wohl viel gezeichnet. Das hat dem Professor auf eine Weise imponiert. Schließlich war Kaltenbrunn ja auch Wissenschaftler.«
»Wissenschaftler?«
»Ja, weiß ich auch nicht so genau... Hat Professor Heise mal erwähnt, glaube ich...«, druckste die Schwester.
Keller wandte sich wieder an Tassel. »Was hatten Sie für einen Kontakt zu Kaltenbrunn? Hat er Ihnen etwas über sein Leben erzählt, was er vorher gemacht hat und warum er krank geworden ist?« Keller spürte deutlich, dass seine Fragen in eine Richtung schwenkten, die dem Pfleger überhaupt nicht behagte.
»Nein. Nein, hat er nicht. Ich weiß nur, dass der Professor sagte, Kaltenbrunn könne nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. Er hat eine Paramnesie, das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Das hat mit Münchhausen übrigens überhaupt nichts zu tun. Es geht da meistens eher um Traumata oder Wahnvorstellungen, unter denen der Patient sehr leidet.«
Keller zog die Augenbrauen zusammen, sagte aber nichts. Es reichte, um den Pfleger weiter unter Druck zu setzen.
»Hören Sie, Herr Kommissar, ich weiß wirklich nichts weiter. Das müssen Sie mir glauben.« Er holte tief Luft. »Der Kaltenbrunn, er... er fühlte sich verfolgt. Die ganze Zeit. Er hat kaum etwas anderes erwähnt, wenn er sprach – und das war sowieso äußerst selten. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ehrlich. Außerdem wollte der Professor nicht, dass wir darüber sprechen. Er meinte, das würde Kaltenbrunn nur schaden. Und das wollte ich ja auch nicht.«
»Verfolgt? Von wem?«, hakte Keller nach.
Tassel zuckte mit den Schultern. »Aber ich weiß es doch nicht, Herr Kommissar. Er hat immer nur unverständliche Andeutungen gemacht, zusammenhangloses Zeug. Da konnte man nicht draus schlau werden. Das ist überhaupt nicht wichtig.«
Wieder schaltete sich die Schwester ein. »Nur einmal hat er sowas gesagt, dass eine grüne Mamba uns alle umbringen und dass der Tag näher rücken würde. Keine Ahnung, was das heißen soll.«
07:59 uhr
Roland Gärtners Ausgeglichenheit hing in nicht unwesentlichem Ausmaß von einem durchstrukturierten Tagesablauf ab. Wenn man ihn für den ganzen Tag verärgern wollte, musste man einer Sache, die in seinem Verantwortungsbereich lag, nur ein wenig zu viel Dringlichkeit zuordnen. Was er am meisten hasste, war es, gehetzt zu werden.
Heute Morgen war einer von diesen Tagen. Nicht nur, dass er beinahe eine Stunde vor der Zeit aus dem Bett geholt worden war, nein, man hatte ihm auch nicht zugestanden, die beiden obligatorischen Tassen Kaffee zu trinken – mit Sahne und jeweils zwei Stücken Zucker. Nicht einmal zu einer Zigarette an der frischen Luft gab man ihm Gelegenheit. Sein Fahrer hatte keinen Zweifel daran gelassen, mit welcher Priorität seine baldigstmögliche Anwesenheit im kleinen Konferenzraum realisiert werden sollte. Gärtner vermied es, Kelkowitz nach den genauen Worten des Chefs zu fragen. Er konnte sich die Auftragsvergabe lebhaft vorstellen. Außerdem würde es sowieso nichts nützen. Sein Tag war gelaufen, daran ließ sich nichts mehr ändern.
Und so kam es, dass der dunkle Peugeot um genau sieben Uhr neunundfünfzig auf den Innenhof vor Haus sieben rollte. Mit Unbehagen bemerkte Gärtner, wie nachlässig die schwarze Riesenlimousine des Chefs neben dem Eingang von Haus eins geparkt war. Das verhieß nichts Gutes. Es kam ziemlich selten vor, dass der Chef so früh im Ministerium auftauchte. Gärtner bekam einen kurzen Schweißausbruch, als ihm in den Sinn kam, dass der Chef womöglich in seinen Diensträumen übernachtet hatte; dann musste es ganz übel stehen. So etwas war bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, soweit er sich erinnern konnte.
Sobald Kelkowitz den Wagen zum Stillstand gebracht hatte, riss Gärtner die Tür auf, griff seine Aktentasche und den schweren Wollmantel und hastete ins Gebäude. Während er den Pförtner grüßte, bemerkte er aus den Augenwinkeln, dass der Pater Noster noch nicht wieder in Betrieb genommen worden war, und nahm die Treppe in den ersten Stock. Er rannte den Flur fast bis zum Ende hinunter, blieb vor der Tür zum Konferenzzimmer stehen, atmete einige Male tief durch, klopfte und betrat den Raum, ohne eine Aufforderung abzuwarten.
Das Wichtigste registrierte er sofort: Der Chef war noch nicht da. Dafür vier andere Personen, die er von der persönlichen Assistentin des Chefs, Frau Jessika Blume, abgesehen nur vom Sehen kannte. Alle waren sie aus den operativen Abteilungen des Ministeriums. Anscheinend war er der einzige Verwaltungsmensch hier, was seinem Wohlbefinden nicht gerade zuträglich war. Wortlos begab er sich an die gegenüberliegende Seite des Konferenztisches und wählte einen Stuhl, der möglichst viel Abstand zum Platz des Ministers versprach. Ein Blick auf seine französische Automatikuhr zeigte eine Minute nach acht. Es herrschte eine bedrückende Stille. Niemand sagte etwas, und jeder gab vor, mit seinen Unterlagen beschäftigt zu sein. Gärtner verwunderte das, denn er wusste noch nicht einmal, warum man ihn so eilig in die Normannenstraße gerufen hatte. Was sollte er da für Papiere überfliegen? So kramte er aus Verlegenheit in seiner schweinsledernen Aktentasche und holte seine großformatige Notizkladde (Gärtner hasste lose Blattsammlungen), einen sorgfältig gespitzten, weichen Bleistift und einen Radiergummi (man wusste nie, wann man etwas ändern musste) hervor.
Noch immer kein Chef und noch immer kein Gespräch. Er ließ den Blick durch den Konferenzraum schweifen. Nicht ganz sein Geschmack, diese allgegenwärtigen Holzverkleidungen; noch weniger der hauptsächlich in Beige, Crème und ganz wenig Blau gehaltene Orientteppich, auf dem der große Tisch – aus dunklem Holz – und die halbwegs modernen Stühle aus verchromtem Stahlrohr standen. Viel mehr gab es nicht zu sehen. Er starrte eine Weile vor sich hin, als ihm zum ersten Mal klar wurde, in was für einem schlechten Zustand der Raum eigentlich war. Kaum eine Möbelkante nicht abgestoßen, die Tapeten auf den wenigen holzfreien Wandflächen fast vergilbt und der Teppich schon leicht abgenutzt. Sogar der hellbraune Boden, und der war kein billiges PVC aus heimischer Herstellung, sondern echtes Linoleum, wirkte mitgenommen.
Der Chef war ein Paranoiker, das wusste man. Und das hier waren die sichtbaren Folgen. Jede Renovierung, neue Möbel, Reparaturen an den elektrischen Leitungen oder sonstige Veränderung bargen die Gefahr der Installation von Abhörgerätschaften. Diese Teile waren wirklich winzig geworden. Ohne Probleme konnte man heute ein ordentliches Mikrofon samt Sender in einem Telefonhörer unterbringen. Da mussten noch nicht einmal mehr die Kupferleitungen direkt angezapft werden. Für all die Vorsichtsmaßnahmen hatte Gärtner in gewisser Weise Verständnis, aber selbst Aufzüge unrepariert zu lassen, das war doch ein bisschen viel des Guten. Wer tauschte schon streng geheime Informationen in einem offenen Fahrstuhl aus? Jedenfalls glaubte er, dass dies der Grund für den seit einiger Zeit nicht betriebsbereiten Pater Noster sein musste.
Noch ein Blick auf die Uhr, sieben Minuten nach acht. Er beschloss, irgendetwas zu tun, um wach zu bleiben. Er schrieb Datum, Uhrzeit und die Namen der Anwesenden in sein Notizbuch. Als Nächstes machte er sich – völlig überflüssigerweise – einen Arbeitsplan für die kommende Woche. Dann klappte er den Deckel wieder zu und wartete. Mit jeder Minute zeigte der Koffeinmangel größere Wirkung, und er hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Plötzlich hörte er laute Stimmen jenseits der Konferenzraumtür. Das Organ des Chefs, unverkennbar. Gärtner war wieder hellwach, der zuvor abgefallene Blutdruck sogar leicht erhöht.
Die schwere Tür wurde so heftig aufgestoßen, dass sie ungebremst gegen das dunkle Sideboard knallte und eine beeindruckende Kerbe erhielt, die niemals ausgebessert werden würde. Ein auffallend kleiner, dafür kompakter Mann ohne Hals und mit einem rundlichen Gesicht, das in diesem Moment entfernt an eine Bulldoge erinnerte, machte einen Schritt in das Konferenzzimmer und brüllte los, ohne jemanden anzusehen: »Was ist das für eine verdammte Schweinerei? Eine Sauerei! Wenn ich den erwische... der... die werden mich alle noch kennenlernen. Dem schlag' ich den Kopp runter!«
Keiner im Raum wagte zu fragen, worum es ging und wer woran schuld war. Gärtner vermied jeden Blickkontakt und begann, die Namen der Anwesenden zu unterstreichen. Als er wieder aufsah, war der Minister verschwunden. Offensichtlich ging die vorherige Konversation auf dem Flur weiter. Er konnte nichts Zusammenhängendes verstehen, schnappte aber »...machen Sie mir sofort eine Verbindung...«, »... interessiert mich einen verdammten Dreck...« und »...wie, nicht auffindbar?... Schaffen Sie diesen verdammten Stümper sofort her...« auf.
Ganz schlecht. Der Minister hatte offensichtlich ebenfalls nicht gefrühstückt. Oder noch schlimmer: Irgendein weltfremder Ignorant hatte das Frühstücksei des Chefs länger als viereinhalb Minuten im kochenden Wasser gelassen. Vielleicht hatte der Eierlöffel auch auf der Papierserviette gelegen, statt daneben. Oder die Serviette fehlte. Äußerst schlecht.
Schwere Schritte, ein Türknallen und der Minister stand an der Stirnseite des Konferenztisches. Bevor er sich auf das schwarze Leder des sehr westlich aussehenden Drehstuhls niederließ, richtete er das Wort an die Runde.
»So eine verdammte Schweinerei! An uns darf nichts vorbeigehen. Wir müssen jederzeit alles wissen. So ein verfluchter Käse darf einfach nicht passieren. Ich könnte mich maßlos aufregen über sowas!« Keiner der Sitzenden sagte ein Wort und jeder mied weiterhin den Blickkontakt. »Wenn das hier vorbei ist, dann wird es für einige Genossen ernsthafte Konsequenzen geben... Früher haben wir da kurzen Prozess gemacht, da gab es nichts. Jetzt ist die Lage anders, aber wenn es nach mir ginge...« Er brach ab und setzte sich. Nachdem er seine untere Gesichtshälfte mit der Linken einige Sekunden durchgewalkt und die Finger der rechten Hand das unregelmäßige Trommeln auf der Tischplatte beendet hatten, sprach er in ungewöhnlich ruhigem Ton weiter.
»Ich denke, es hat jeder mitbekommen, dass wir uns letzte Woche, genauer gesagt am siebten Februar, mit der BRD auf die Einrichtung gegenseitiger Vertretungen geeinigt haben. Genosse Nier sei Dank. Außerdem hat sich die Deutsche Demokratische Republik nach langen Verhandlungen entschlossen, mit dem NSA Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu führen. Sogar das Mutterland des Imperialismus darf wahrscheinlich in wenigen Monaten seine dreckigen Hufe ganz offiziell in unsere Republik setzen.«
Gärtner konnte sich nicht vorstellen, dass die Etablierung einer ständigen Niederlassung der BRD in Ost-Berlin und die Anbahnung diplomatischer Beziehungen zum sonstigen nichtsozialistischen Ausland, speziell zu den Amerikanern, die Gründe für eine so hektisch einberufene Sitzung sein konnten, zumal das alles keine echten Neuigkeiten mehr waren – und endgültige Fakten waren auch noch keine geschaffen worden, auch wenn im Falle der Vereinbarungen über Ständige Vertretungen die Gespräche bereits weit fortgeschritten waren.
Der Minister für Staatssicherheit fuhr fort: »Wie dem auch sei. Meine persönliche Meinung interessiert nicht. Ihr und ich, darum geht es. Wir haben uns der Sache, der großen Sache des Sozialismus auf deutschem Boden zu fügen. Und wenn der Genosse Honecker und die Mitglieder des ZK der Meinung sind, dass es der Sache dient, dass die Imperialisten bei uns Botschaften bauen dürfen, dann ist es eben so. Außerdem haben der Genosse Generalsekretär und das Politbüro schon überall verkündet, dass es einen großen Fortschritt für die Deutsche Demokratische Republik und den Frieden zwischen den Völkern bedeutet. Wir können jetzt keinen Ärger, kein Gerede und keine neugierigen Schreiberlinge aus dem Westen gebrauchen. Seit letztem Jahr haben die es ja noch einfacher, in der DDR zu spionieren, weil wir sie offiziell akkreditieren. Mensch.« Während der letzten Sätze war der ruhige Ton von offener Empörung verdrängt worden. Bevor Mielke in Rage geriet, legte er erneut eine Redepause ein. »Es gibt nach meiner Meinung schon genug Spione und Verräter in unserem eigenen Haus. Wir müssen aufräumen. Wir sind mehr als Schild und Schwert der Partei. Es geht um das Wohl unserer sozialistischen Gesellschaft. Also macht gefälligst eure Arbeit für unsere Republik. Ich will hier jetzt keinen langen Käse mehr!« Noch immer fragende Gesichter bei den Anwesenden. Nur der Mann, der Gärtner als Generalmajor Rehmers bekannt war, verzog keine Miene. Offenbar wusste er, was ihn erwartete. »Genosse Rehmers, ich will genau wissen, was da los ist. Das ist dein Operationsgebiet und deine Verantwortung. An uns darf nichts vorbeigehen. Wir müssen alles wissen, das kann nicht sein, dass sowas vorkommt. Haben wir das vollkommen unter Kontrolle?«
»Ich habe schon länger eine Quelle vor Ort, Genosse Minister, zur Sicherheit, aber diese Vorkommnisse waren für meine Leute nicht vorhersehbar. Es war ruhig und lief nach Plan. Wir sind davon ausgegangen, dass das nicht passieren kann. Ganz sicher wird der gesamte Sachverhalt in wenigen Tagen aufgeklärt sein. Ich habe deshalb alle Aktivitäten und Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem OV Sonne umgehend in meinem Ressort gebündelt, in den entsprechenden Akten finden Sie alle relevanten Informationen. Ich habe außerdem sofort eine weitere Quelle installiert, die ganz nah dran ist. Ab jetzt haben wir alles unter Kontrolle, Genosse Minister. Und wenn SIRA demnächst läuft, wird sowieso alles übersichtlicher.«
»Noch nützt uns SIRA nichts. Außerdem verspreche ich mir da gar nicht so viel von wie die HV-A.« Der Minister für Staatssicherheit musterte Rehmers einige Sekunden. »Ich verlasse mich da ganz auf dich, Genosse. Du warst immer ein zuverlässiger Kamerad. Nur, wenn das hier schief geht, dann ist es endgültig vorbei, das versichere ich dir. Dann bin selbst ich machtlos. Ich will alles wissen, was da vorgeht. Jede Stunde Bericht, bis diese Schweinerei aus der Welt geschafft ist und wir die Lage beruhigt haben.« Ohne eine weitere Äußerung verließ er den Raum. Die verbliebenen MfS-Mitarbeiter sahen einander ratlos an, aber keiner von ihnen wagte es, das Konferenzzimmer zu verlassen.
Gelegentlich war die Stimme des Ministers über den Flur zu hören, verstehen konnte Gärtner nichts. Offensichtlich telefonierte er von seinem Dienstzimmer aus. Nach über einer halben Stunde kehrte er in das Konferenzzimmer zurück und wandte sich an Rehmers: »Deine Aufgabe ist klar. Enttäusch mich nicht. Ich will stündlich Bericht. Jetzt geht es um die durchzuführenden Maßnahmen im Ausland.«
Ohne eine Reaktion des Generalmajors zu erwarten, wechselte Mielke das Thema. »Wir haben es mit einem Vorgang zu tun, der sich nicht nur auf unser Staatsgebiet beschränkt, sondern auch Auswirkungen auf unser Verhältnis zum nichtsozialistischen Ausland haben könnte. Ich habe mich deswegen der Unterstützung der Hauptverwaltung Aufklärung in allen Belangen und in unbegrenztem Umfang versichert. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, dass ich Mitarbeiter der HV-A unmittelbar mit Aufgaben betraue.«
Er wandte sich an den kleineren der beiden Männer, deren Namen Gärtner nicht einfielen. »Genosse Kretschmann, du hörst mit deinen Leuten auf jedes Niesen und Hüsteln aus dem Westen. Sammelt Stimmungsberichte, schaut Westfernsehen und kauft Zeitungen. Es müssen alle Kontakte aktiviert werden, da darf uns nichts entgehen. Wir müssen genau darüber informiert sein, was die beschäftigt, wie deren Kenntnisstand ist und wie sie reagieren werden. Ihr stellt jeden Tag einen ausführlichen Pressespiegel zusammen und dokumentiert die sonstigen Ereignisse. Jeden Morgen liegt das Ganze vor acht bei Frau Blume auf dem Schreibtisch. Es gibt Operationen und Quellen, die unter keinen Umständen gefährdet werden dürfen. Mehr müsst ihr nicht wissen, und mehr werdet ihr auch nicht erfahren. Tut einfach das, was verlangt wird.« Er ließ seinen Blick durch die kleine Runde wandern und sprach dann wieder Kretschmann an: »Der großspurige Hansen kann so wichtig werden, wie er immer sein möchte. Lass deinen Friedenskundschafter rotieren.«
Kretschmann hob die Hand wie ein Schüler, was beinahe lächerlich wirkte, bei der aktuellen Stimmung des Ministers aber die probate Methode für Wortmeldungen war. »Genosse Minister, ich möchte nur kurz zu bedenken geben, dass wir den Kundschafter Hansen als Vorsorgemaßnahme schon vor einiger Zeit abgeschaltet haben. Es scheint mir nicht klug, einen Mitarbeiter in strategisch so exzellenter Stellung jetzt wieder zu reaktivieren und damit seine Enttarnung zu riskieren.«
Mielkes Gesichtsfarbe verwandelte sich in wenigen Augenblicken von rosigem Grau in ein beinahe violettes Rot. »Was bilden Sie sich ein, Kretschmann? Ich kann mich weder erinnern, dass ich nach Ihrem Rat gefragt habe, noch dass untere Chargen der HV-A hier irgendein Mitspracherecht haben. Es passiert hier, was ich für richtig halte! Und wer nicht spurt, den schicke ich eigenhändig nach Bautzen. Und ich versichere euch, dass von da keiner zurück kommt, dafür sorge ich. Verdammt nochmal. Ist das verstanden, Genosse?« Er atmete schwer.
»Jawohl, Genosse Minister.« Die restlichen Anwesenden schlossen sich dieser Versicherung murmelnd an.
»Ich habe nicht umsonst mit der Abwehr telefoniert – und wir waren schnell einer Meinung. Der Hansen soll endlich einmal etwas Nützliches bringen. An der richtigen Stelle sitzt der Kerl ja, oder nicht? Und was heißt hier Abschaltung… In Norwegen hat er sich auch nicht an seine Weisung gehalten. Ganz im Gegenteil, ein riskantes Husarenstück zur Befriedigung seiner Eitelkeit hat er sich geleistet – unwichtiges Zeug hat er angeguckt und anschließend ist alles auch noch im Rhein versenkt worden.« Mielke schüttelte den Kopf. »Kretschmann, du bist sein Führungsoffizier, mach ihm Dampf. Der kann froh sein, dass er so viele Freunde bei der HV-A hat und Mischa Wolf persönlich seine Hand über ihn hält. Bisher konnte man ja von den West-Touristen Erhellenderes erfahren als von diesem drittklassigen ABV, verflucht nochmal.« Er schnaufte, immer noch aufgebracht. »Mensch, wenn ich in dieser Position säße...«
Nach einigen Sekunden der Beruhigung wandte sich der Minister für Staatssicherheit dem anderen Unbekannten zu. »Und du, Genosse Delwo, kümmerst dich um unseren großen Bruder. Mit Fingerspitzengefühl. Bei jedem Vorkommnis Meldung an mich persönlich. Auch da will ich wissen, was vorgeht. Ansonsten haltet ihr den Mund. Gegenüber jedem – egal ob Freund oder Feind. Ist das alles verstanden?«
Die beiden Angesprochenen erhoben sich und deuteten ein Salutieren an. »Jawohl, Genosse Minister«, gelobte Kretschmann erneut, während Delwo schwieg.
»So. Raus, Leute. An die Arbeit. Tut, wofür ihr da seid, sammelt Informationen. Jede Unterlassung, jeder Fehler hat Konsequenzen.« Ob er die besondere Wichtigkeit der Aufgabe meinte oder schlicht drohte, war für die Angesprochenen nicht erkennbar, und das war sicherlich auch gewollt. »Und Sie, Gärtner, bleiben noch hier.«
Nachdem die drei Männer den Raum verlassen hatten, wirkte Mielke schlagartig ruhiger, so als hätte sein beinahe cholerischer Vortrag zum größten Teil aus Schauspielkunst bestanden.
»Also, Genosse Gärtner, jetzt zu Ihrer Aufgabe...« Der Minister erhob sich und tat zwei Schritte zu der großen Schrankwand in seinem Rücken. Er öffnete die beiden Flügel auf der linken Seite, was einen mannshohen Aktenschrank aus Metall mit grauem Hammerschlaglack zum Vorschein brachte. Eigentlich sieht das Ding aus wie ein riesiger Tresor, dachte Gärtner. Als der Chef mit einem langen, kompliziert aussehenden Schlüssel hantierte, der an einer Kette befestigt war, die wiederum mit seinem Gürtel verbunden war, war Gärtner sich sicher. Damit nicht genug; der Chef löste seinen Binder, öffnete den obersten Hemdknopf und zog eine Halskette über den Kopf, an der ein kleinerer, nicht minder aufwendig aussehender Schlüssel hing. Mit diesem schloss er die kleine Stahltür auf, die sich ganz oben rechts im Inneren des Tresors befand. Soweit Gärtner es von seinem Platz aus erkennen konnte, wurden darin nur zwei Schnellhefter aufbewahrt. Der Minister nahm den dickeren heraus und schloss sorgfältig alle Türen. Nachdem er die Halskette umständlich wieder über den Kopf gezogen, Hemd und Krawatte gerichtet und die Schlüsselkette in der Hosentasche verstaut hatte, ließ er die grüne Akte vor Gärtner auf den Tisch fallen.
»Sie, Genosse Gärtner, Sie lernen das ganze Dossier hier auswendig und fassen das so zusammen, dass Sie es mir in wenigen Sätzen wiedergeben können. Ich habe das Ganze bisher nicht für so wichtig gehalten. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass es in allen Teilen der Wahrheit entspricht. Aber das ist jetzt egal. Sie schreiben eine leicht verständliche Zusammenfassung, die ich an verschiedene Stellen verteilen muss. Fangen Sie sofort an und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.«
»Jawohl, Genosse Minister.«
Als Gärtner aufstehen wollte, drückte der Minister ihn zurück auf den Stuhl. »Sofort. Hier. Diese Akte darf den Raum nicht verlassen. Reden Sie mit niemandem, außer meiner Sekretärin – und auch mit ihr niemals über den Inhalt der Akte. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Sie bekommen alles, was Sie brauchen, von Frau Blume. Sie werden hier essen und schlafen, falls nötig. Es gibt neben meinem Dienstzimmer einige private Räume, die Ihnen zur Verfügung stehen. »
»Vielen Dank, Genosse Minister.«
Mielke winkte unwirsch ab. »Das ist keine Gratifikation, Gärtner, es dient lediglich dazu, Sie nicht von Ihrer Aufgabe abzuhalten. Beeilen Sie sich. Je schneller Sie fertig werden, umso besser.« Mit einer weiteren Handbewegung scheuchte er die hinzugekommene Sekretärin aus dem Raum. Bevor er das Konferenzzimmer verließ, sprach er noch einmal zu Gärtner: »Denken Sie daran, Ihre Aufgabe ist die geheimste. Ich weiß nicht einmal, wer über die Vorgänge in dieser Akte tatsächlich im Bilde ist. Es ist nicht unmöglich, dass diese Papiere sogar dem Genossen Honecker nicht gänzlich bekannt sind.« Dann steckte der Minister den Schlüssel von außen auf die Konferenztür. »Ich muss Ihnen nicht erklären, was das für Sie bedeutet«, mahnte er Gärtner, bevor er ihn einschloss.
11:16 uhr
»Mann, Keller. Ich habe schon gedacht, Sie hätten sich Ihren restlichen Urlaub genommen«, grüßte ein grauhaariger, nicht gerade schlanker Endfünfziger mit Ironie in der Stimme.
»Ich bin erst um vier aus Waldheim zurück gewesen, Chef.« Keller hatte keine Lust, sich schon am frühen Morgen mit seinem Vorgesetzten in die Haare zu bekommen.
»Und deswegen kreuzen Sie hier kommentarlos um elf auf, Oberleutnant? So geht das nicht. Eine gute Erfolgsquote rechtfertigt keine Disziplinlosigkeit, das wissen Sie doch. Also, was haben wir da in dieser Klinik in Waldheim?«
Keller rollte mit den Augen, während er seinen Mantel an den Haken hängte. Er kannte den Leiter der K zu gut, um etwas zu erwidern. Nach einer halbherzig gemurmelten Entschuldigung präsentierte er seinen knappen Bericht.
»Ein Irrer hat seinen Arzt umgebracht, kurz gesagt.«
Major Schüttau wartete auf mehr und seufzte lautstark, als Keller keine Anstalten machte, ausführlicher zu werden. »Das war nicht irgendein Arzt, Keller. Ich dachte eigentlich, dass Sie mit mehr Informationen zurückkommen. Sonst können Sie nächstes Mal ja gleich per Fernsprecher ermitteln und im Büro bleiben.« Nach einer kurzen Pause ergänzte Schüttau versöhnlicher: »Mensch, Keller, dieser Professor Heise hatte gute Beziehungen in die Partei und viele Freunde in einflussreichen Positionen. Ich möchte nicht, dass uns die ganze Sache auf die Füße fällt. Wir dürfen in diesem Fall keine Fehler machen. Aber das muss ich Ihnen doch nicht erzählen.«
Müde ließ sich Keller auf den unbequemen Besucherstuhl sinken und zog sein Notizbuch umständlich aus der Innentasche seines Jacketts. Ohne das Ding würde er die Details niemals zusammenbekommen. Schüttau schürzte die Lippen und wartete auf eine ausführlichere Schilderung. Keller fasste die Informationen zu Tatablauf und Todeszeit zusammen und beschrieb den Tatort mit einer Genauigkeit, die verriet, dass er seine Notizen vor allem für Daten, Zahlen und sperriges Fachvokabular benötigte, weniger für die visuellen Eindrücke. Das Gespräch mit dem dringend tatverdächtigen Kaltenbrunn hatte kaum hilfreiche Informationen geliefert, zu tief war der Mann in seine psychotischen Wahnvorstellungen verstrickt. Aber einen echten Zweifel an seiner Schuld konnte es kaum geben. Sofern ein derartig Verrückter wirklich schuldig sein konnte.
Erst als Keller zu seiner Unterhaltung mit Kaltenbrunns Pfleger Tassel kam, zeigte Schüttau Interesse. »Was soll das heißen? Der Mann ist Wissenschaftler? Das soll wohl ein Witz sein. Doktor Kaltenbrunn? Ist Doktor nicht eher sein Spitzname?«
»Ich weiß es nicht, Genosse Major«, erklärte Keller korrekt.
»Pah. Dann sollten Sie Ihre Hausaufgaben machen, Oberleutnant. Erstatten Sie um drei viertel vier Bericht. Und jetzt gehen Sie.«
Keller war eben dabei, seinen Mantel vom Haken zu klauben, als sein Vorgesetzter ihn noch einmal ansprach.
»Entschuldigungen Sie, Genosse Oberleutnant, ich verstehe ja, dass Sie glauben, dass dieser Fall nicht wirklich in unser Dezernat gehört. Normalerweise hätten die Kollegen vom VPKA vor Ort das auch erledigen können. Zu ermitteln gibt es da im Grunde nicht viel, nehme ich an. Sie verstehen sicher, dass Professor Heises Tod nicht wie eine Lappalie, wie ein beliebiger Unfall, abgehandelt werden soll. Also bringen Sie das sauber über die Bühne. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?«
Der Oberleutnant nickte und trat auf den Flur hinaus.
Irgendetwas in Schüttaus Tonfall war seltsam gewesen. Und dass sein Chef eine Mordsache so schnell als Routinefall abzutun versuchte und auf der anderen Seite nachdrücklich betonte, wie wichtig es sei, keine Fehler zu machen, passte nicht recht zu ihm.
In Kellers Kopf schellten Alarmglocken, die in der Vergangenheit stets Komplikationen angekündigt hatten, doch er war fest entschlossen, sie diesmal zu ignorieren.
»Ja, genau. Doktor Heinrich Kaltenbrunn«, knurrte Keller in den Fernsprechapparat. »Nein, ich weiß nicht, an welcher Fakultät der Mann seinen Titel erworben hat. Nein, auch nicht, wo er davor studiert hat. Hören Sie–« Er verschwendete seine Zeit, aber was sollte er machen? Irgendwo musste er anfangen, und die Zahl der Universitäten, an denen Kaltenbrunn promoviert haben konnte, war begrenzt. Wenn er denn tatsächlich einen Doktortitel in der DDR erworben hatte. Keller bedankte sich tonlos bei der Verwaltungssekretärin und knallte den Hörer auf die Gabel.
Die Patientenakte Kaltenbrunns lag vor ihm auf dem Schreibtisch, wobei die Anstaltsleitung darauf bestanden hatte, dass alle auch nur vage behandlungsbezogenen Unterlagen entfernt wurden. So blieben nur zwei graue Blätter mit den Einlieferungsdaten des Patienten, die ihm praktisch nichts verrieten. Der Titel eines Dr. rer. nat. war in das dafür vorgesehene Feld feinsäuberlich eingetragen worden, konnte aber alles Mögliche bedeuten. Der Geburtsort war mit Berlin angegeben, und Keller hatte bereits einen Anruf zur dortigen K abgesetzt, allerdings ohne große Hoffnung auf baldigen Rückruf. In der Hauptstadt hatte die Kriminalpolizei selbst genug zu tun. So war für ihn der nächste logische Schritt, die Hochschule zu identifizieren, an der Kaltenbrunn vielleicht studiert hatte. Zuerst hatte er sein Glück in Berlin versucht, aber dort waren keine Dokumente über einen Heinrich Kaltenbrunn zu finden gewesen. Ein großes Problem war, dass er nicht einmal Kaltenbrunns Geburtsjahr kannte. Ob der Mann während oder erst nach dem Krieg promoviert hatte, war damit völlig unklar. Nachdem auch Leipzig sich als Reinfall erwiesen hatte, blieben noch fünf Universitäten und eine ganze Reihe von Hochschulen. Keller nahm sein Büchlein, strich Leipzig durch und wählte dann die Nummer der TU Dresden. Dieses Ferngespräch blieb wie alle, die noch folgten, ohne jedes Ergebnis.
Wenn man davon ausging, dass die Akten seit Kriegsende unangetastet geblieben und mit typisch deutscher Gründlichkeit geführt worden waren, musste man zu dem Schluss kommen, dass ein Heinrich Kaltenbrunn an keiner Universität oder Hochschule der Deutschen Demokratischen Republik studiert oder promoviert hatte. Vielleicht waren seine Unterlagen auch einfach durch den Krieg verloren gegangen… Und was, wenn der Mann aus dem Westen kam? Oder wenn er bei den russischen Genossen studiert und promoviert hatte? Keller wischte sich über die Stirn und sank tief in seinen Sessel zurück.
Was, wenn dieser Kaltenbrunn einfach nur ein Hochstapler war? Falscher Name, falscher Lebenslauf, kein Studium, kein Doktortitel. Vielleicht war der Mörder von Professor Heise auch ein Landstreicher, der mit einer hanebüchenen Geschichte auf sich aufmerksam machen wollte und ein warmes Zuhause für den Winter gesucht hatte.
Keller seufzte, als ihm mit einem Mal bewusst wurde, dass er genau genommen nichts über diesen Kaltenbrunn wusste. Restlos alle Informationen über ihn stammten vom Klinikpersonal, und das gab sich offensichtlich Mühe, möglichst wenig preiszugeben. Doch vorausgesetzt das Wenige, was er von Jörg Tassel und der Springfeld erfahren hatte, stimmte, dann war die Theorie vom obdachlosen Landstreicher unwahrscheinlich. Insbesondere Professor Heises auffälliges Interesse an dem Patienten wäre so kaum zu erklären.