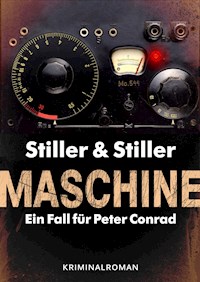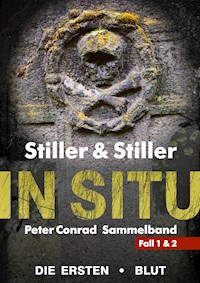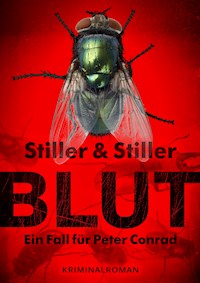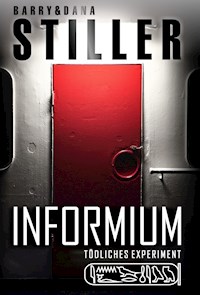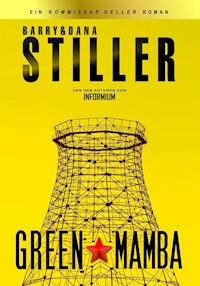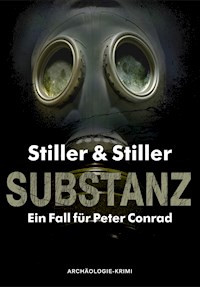
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Venedig, die malerische Stadt in der Lagune, in den späten 1980er Jahren. Anthropologe Peter Conrad und Studentin Lisa Franks interessieren sich nicht für das romantische Ambiente — sie sind nach ihrem letzten Abenteuer heilfroh, auf einer Ausgrabung unterzutauchen. Professor Soccio forscht auf der berüchtigten Pestinsel Lazzaretto Vecchio und kann einen Spezialisten wie Conrad gut gebrauchen. Es verspricht, ein angenehmer Sommer zu werden. Aber die Ruhe trügt. Von offiziellen Stellen vertuscht, wird Norditalien seit Monaten von merkwürdigen Todesfällen heimgesucht, und auch in Venedig tauchen erste Leichen auf. Als eines der Grabungsmitglieder stirbt und ein anderes spurlos verschwindet, finden sich die Archäologen unversehens inmitten der bedrohlichen Ereignisse wieder. Bald keimt in Conrad ein Verdacht auf, der so unglaublich ist, dass er ihn niemandem anvertrauen kann. Bis die Gefahr eine völlig neue Dimension annimmt, die das Leben von Millionen Menschen bedroht und auch Conrads und Franks’ Freundschaft auf eine Zerreißprobe stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Venedig, die malerische Stadt in der Lagune, in den späten 1980er Jahren.
Anthropologe Peter Conrad und Studentin Lisa Franks interessieren sich nicht für das romantische Ambiente—sie sind nach ihrem letzten Abenteuer heilfroh, auf einer Ausgrabung unterzutauchen. Professor Soccio forscht auf der berüchtigten Pestinsel Lazzaretto Vecchio und kann einen Spezialisten wie Conrad gut gebrauchen. Es verspricht, ein angenehmer Sommer zu werden.
Aber die Ruhe trügt. Von offiziellen Stellen vertuscht, wird Norditalien seit Monaten von merkwürdigen Todesfällen heimgesucht, und auch in Venedig tauchen erste Leichen auf. Als eines der Grabungsmitglieder stirbt und ein anderes spurlos verschwindet, finden sich die Archäologen unversehens inmitten der bedrohlichen Ereignisse wieder. Bald keimt in Conrad ein Verdacht auf, der so unglaublich ist, dass er ihn niemandem anvertrauen kann. Bis die Gefahr eine völlig neue Dimension annimmt, die das Leben von Millionen Menschen bedroht und auch Conrads und Franks' Freundschaft auf eine Zerreißprobe stellt.
BARRY & DANA STILLER
SUBSTANZ
Die bisher erschienen Romane von Stiller & Stiller
GREEN MAMBA — Schatten des Todes
INFORMIUM — Tödliches Experiment
Ein Fall für Peter Conrad:
DIE ERSTEN — Peter Conrads erster Fall
BLUT — Peter Conrads zweiter Fall
MASCHINE — Peter Conrads dritter Fall
SUBSTANZ — Peter Conrads vierter Fall
Peter Conrad Sammelband:
IN SITU — Peter Conrad Sammelband Fall 1 & 2
SUBSTANZ – Ein Fall für Peter Conrad
Barry & Dana Stiller
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit schriftlicher
Genehmigung des Herausgebers wiedergegeben werden. Alle Ereignisse, Personen, Orte,
öffentlichen und privaten Einrichtungen, Behörden, Firmen und Markennamen in
diesem Roman sind entweder frei erfunden oder werden fiktiv verwendet.
Umschlagfotografie: Seelhammer Photographie | www.seelhammer.de
Autorenfotos: Seelhammer Photographie | www.seelhammer.de
Alle Fotografien und sonstige Illustrationen, sofern nicht anders vermerkt: Stiller & Stiller
Sie finden Stiller & Stiller bei Facebook und Twitter unter @StillerBooks
Sie finden Stiller & Stiller im Internet unter www.stillerstiller.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter
dnb.dnb.de abrufbar.
Herausgeber: Jochen Seelhammer, Raiffeisenstr. 20, 57577 Hamm
Der Titel ist als E-Book bei der tolino media GmbH & Co. KG,
Albrechtstr. 14, 80636 München erschienen.
ISBN 978-3-752-211327-3
© 2020 by Stiller & Stiller
Für Helga Stiller
01
Er hatte die halbe Welt bereist. Das offene Meer, die Berge Asiens und die weiten Steppen Afrikas gesehen. Er hatte genommen, was immer er begehrenswert fand. Alles war ihm wunderbar und neu erschienen, er liebte das Abenteuer und, ja, auch die Gefahren, die ein solches Leben immer wieder bedeuten konnte. Nie wusste man, was hinter dem Horizont, im nächsten Hafen wartete. Doch genau das war es, was den Reiz eines Lebens in ständiger Bewegung ausmachte. Dass er deswegen möglicherweise nie ein alter Mann werden würde, der auf einer sonnenbeschienenen Bank die Tage verträumte und Kindern die Geschichten aus aufregenderen Tagen erzählen würde, hatte er von Anfang an in Kauf genommen. Das war nie das Ziel seines Daseins gewesen. Er hatte auch nie ernsthaft die Frage nach dem Sinn seines Lebens gestellt; das war ihm erst hier an diesem Ort bewusst geworden. Aber dass die letzten Tage seines irdischen Daseins so aussehen würden, hätte er niemals geglaubt.
Etwa eine Woche vor seiner Ankunft in Venedig, hatte ihn ein vages Unwohlsein gequält, das er nicht benennen konnte und mit dem er auch den Schiffsarzt nicht aufgesucht hatte. Doch dann war das Fieber gekommen. Nicht enden wollende Gluthitze. Und man hatte ihn nach der Ankunft sofort weggesperrt.
Seine Augen suchten haltlos die Schatten in den Ecken und Winkeln des halbdunklen Raums ab. War es schon wieder Nacht? Oder versagten seine Augen, so wie der Rest seines Körpers in den letzten Stunden abgebaut hatte? Er wand sich auf der dünnen Unterlage, kaum mehr als ein Sack mit Stroh. Der Raum verschwamm zu einem dunklen Brei. Das Fieber stahl ihm jede Kraft. Inzwischen konnte er nicht mehr auf den eigenen Füßen stehen, nicht mehr richtig essen, kaum noch Wasser und die dünne Brühe bei sich behalten.
Auch wenn ein Teil von ihm wusste, dass es jeden treffen konnte, dass er nur einer von vielen war, dass diese Möglichkeit immer bestanden hatte, fragte er sich immer wieder, ob es nicht doch einen Grund dafür gab, dass es ausgerechnet ihn getroffen hatte. Wie viele Begleiter auf seinen Reisen, Männer und sogar Frauen—die ein noch viel riskanteres Leben führten als er—waren dort draußen, und niemand hatte sie mit solchem Elend geschlagen?
Manchmal, ganz kurz, wenn das Licht in Blitzen durch das schmale Fenster fiel, glaubte er, ganz deutlich ein Kreuz auf der unverputzten Ziegelwand zu erkennen, aber immer, wenn er ein zweites Mal hinsah, war es verschwunden. War das ein Zeichen Gottes, dass er für seine Sünden gerichtet wurde und der Allmächtige selbst ihn in seinen Qualen sah und sie für wohlgetan hielt? Oder war im Gegenteil das Zeichen der Beweis dafür, dass sein Martyrium unverschuldet und eine Prüfung seines Glaubens war?
Auch wenn es mehrere Jahrzehnte her war, konnte er sich an die Worte des alten Priesters in der winzigen Kapelle am Rand seines Dorfes erinnern, als der von Hiobs Leiden berichtete. Mit der Leidenschaft, zu der nur ein Mann dieses Standes fähig war. Er hatte sich immer gefragt, ob Padre Colombo sich vor einer solchen Gottesprüfung sicher gefühlt hatte, weil er nicht von geeigneter Tugend war, um Gott und Teufel zu einer solchen Wette zu veranlassen.
Jetzt beschäftigte ihn die Geschichte Hiobs, die Vorstellung, dass die verschiedensten Leiden und Schläge des Schicksals einen einzigen Menschen treffen konnten, doch vor allem verfolgte ihn sein ketzerischer Hohn gegenüber jenem Priester. Hatte er mit seinen abfälligen, spöttischen Gedanken den Zorn des Herrn herausgefordert? Auch wenn er nie jemandem mit Absicht geschadet hatte, prüfte Gott nicht das Herz jedes Menschen? Und waren solche Gedanken nicht Sünde genug, besonders, wenn es um das Leiden des gerechtesten aller Menschen ging?
Was hatte er selbst schon je getan, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ihn hatte nie etwas anderes interessiert als sein eigenes Vergnügen und nicht selten der Profit, den er durch seine Reisen machen konnte. Und jetzt trug er etwas in sich, das ihn bis in den letzten Winkel, in die letzte Faser seines Seins anfüllte.
Schüttelfrost packte ihn hart im Nacken, und er biss die Zähne so fest aufeinander, dass sie knirschten. Dann kam der Husten, der ihn inzwischen immer öfter quälte und jetzt auch noch die wenigen Momente der Ruhe stahl, die ihm der Schlaf noch gewährt hatte. Die bellende Qual ebbte erst nach Minuten wieder ab und ließ ihn vollkommen erschöpft auf seiner ärmlichen Bettstatt in einen Dämmerzustand sinken, nur um ihn nach kurzer Frist erneut zu überfallen.
Ihm blieb bloß noch zu hoffen, dass sie wussten, was sie taten. Dass er hier in diesem Loch bleiben konnte, bis alles sein unausweichliches Ende nehmen würde. Dann würde er seinem Schöpfer gegenübertreten und endlich erfahren, ob er gestraft wurde oder geprüft—oder ob er für etwas ausersehen war, das er nicht erkennen konnte.
02
»Gino Soccio.«
»Buona giornata... äh... Mi chiamo Franks... Lisa Franks. Io... äh...« Innerhalb von zwei Sekunden war ihr Gesicht puterrot angelaufen.
»Signorina Lisa!«
»Io...« Sie warf Conrad einen wütenden Blick zu, der ihn mit Unschuldsmiene und zwei erhobenen Daumen erwiderte. »Ich... io...«, stotterte Franks, während sie sich, ihren Begleiter fixierend, in einer eindeutigen Geste über Kehle fuhr. »Io... äh chiamo...«
»Sie können Deutsch mit mir sprechen, wenn Ihnen das lieber ist, Signorina Lisa«, erwiderte die sonore Stimme, die Conrad deutlich verstand, obwohl Lisa den Hörer mit weiß hervortretenden Knöcheln fest an ihr rechtes Ohr presste. »Wenn man die Seuchen des Mittelalters als Steckenpferd hat, dann ist es von Zeit zu Zeit ganz hilfreich, die Sprache der Kollegen zu beherrschen.«
Sie überhörte seine Spitze. Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen und sie wiederholte ihre Drohgeste gegenüber Peter Conrad. »Äh, schön... am Telefon ist es wirklich nicht so einfach. Ich... mein Kommilitone, Herr Peter Conrad von der Universität Berlin hat mich gebeten–«
»Ah, ich weiß Bescheid, Fräulein Franks«, unterbrach sie der Italiener. »Herr Conrad hat mir von Ihrem Wunsch berichtet.«
»Meinem...?«, stammelte sie. »Ich... Wir... Also wir–« Dieses Mal unterbrach sie sich selbst. »Ich reiche Sie gerade rüber zu Herrn Conrad. Der kann Ihnen das selbst sagen.« Mit weniger rotem Kopf, aber weiterhin böser Miene übergab sie ihm den klebrigen Hörer.
»Guten Tag, Gino.« Er ließ eine Sekunde verstreichen, um sich an Lisas verblüfftem Gesichtsausdruck zu weiden. »Wir sind vor Ort. Wie geht es Ihnen?«
»Fantastisch, vielen Dank«, dröhnte Soccios Bass. »Ich hoffe, Sie und Ihre zauberhafte Begleiterin hatten eine angenehme Reise in unser wunderschönes Venedig.«
»Zauberhaft...«, murmelte Conrad leise, während man den Archäologen herzhaft lachen hörte.
»Ich dreh' dir den Hals um«, zischte Franks, während Conrad nach den richtigen Worten suchte.
»Ich habe Ihnen ein hübsches Zimmer in einer gemütlichen Pension reserviert. Nicht das Hotel Ritz, aber mit familiärer Atmosphäre, guter Küche und, das Wichtigste, in der Altstadt gelegen.«
Franks war jetzt ganz nah an Conrads Ohr. »Wenn der Kerl ein Doppelzimmer gebucht hat, überlebst du die Nacht nicht, Peter Conrad.«
Conrad machte eine unwirsche Bewegung, verzog missmutig das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Das... äh... das ist wunderbar. Vielen Dank!«
»Ein Doppelzimmer ist doch in Ordnung für Sie beide, nehme ich an?« Wieder hörte man Soccio lachen. »Anderenfalls wird es etwas kompliziert. Zurzeit ist hier kaum noch ein Zimmer zu bekommen. Hochsaison, Sie verstehen?«
»Ist schon in Ordnung«, antwortete Conrad, während er Franks' giftigem Blick zu entkommen versuchte. »Wir sind ja schließlich... befreundet.«
»Da bin ich erleichtert«, brummte der Italiener. »Aber wir sind ja alle Archäologen. Wie sollten wir den Grabungsalltag bewältigen, wenn wir uns an solchen Kleinigkeiten stören würden?« Wieder dieses polternde Lachen.
»Wenn der noch einmal geiert, erwürge ich den gleich mit«, zischte Lisa ihm ins Ohr.
»Äh, ja... Wo treffen wir uns?«, versuchte der Anthropologe auf den Punkt zu kommen. »Wir sitzen gerade vor der–«
»Ah, ich weiß, wo der Bahnhof ist«, unterbrach ihn Soccio. »Geben Sie mir noch ein wenig Zeit. In einer halben Stunde bin ich vor dem Eingang. Ich erkenne Sie sicher, wenn ich Sie sehe.« Noch bevor Conrad sich verabschieden konnte, hatte der Archäologe von der Universität Padua aufgelegt.
***
Es war warm, selbst hier im Schatten des kleinen Cafés am Kanal, in das sie mit Professor Soccio eingekehrt waren. Conrad trank von seinem eben servierten Cappuccino und wünschte sich, er hätte eine Limonade bestellt.
Soccio nippte einige Male genüsslich an seinem Espresso, ehe er zur Sache kam. »Lazzaretto Vecchio, das ist unser Grabungsareal für diesen Sommer und vermutlich die nächsten Jahre.« Er zog eine handliche Übersichtskarte der Lagune von Venedig aus der Innentasche seines Sakkos, breitete sie zwischen ihren Tassen und Wassergläsern aus und umfuhr die kleine Insel mit dem Zeigefinger. »Hier.«
»Eine Insel...«, murmelte Franks.
»Ich dachte, du hast den Bericht gelesen«, schaltete sich Conrad ein. »Die Insel der Verdammten.«
Sie winkte ab. »Sieht ziemlich klein aus. Ich habe mich nur gefragt, wie das mit dem Friedhof funktioniert.«
»Sie meinen das Wasser«, half der Italiener. »Man hat damals verhältnismäßig viel Material aufgeschüttet, sodass das Bodenniveau des alten Lazaretts rund zwei, teilweise drei Meter über der Wasserlinie liegt. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es im Mittelmeer kaum Gezeiten. Deshalb ist die Höhe des Wasserspiegels recht konstant. In der Adria ist diese Schwankung noch einmal geringer. Zum einen, weil sie recht weit vom Atlantik und seinen Einflüssen entfernt ist, zum anderen, weil die Form beziehungsweise Länge dieses Meeresgebietes das Ganze noch träger macht.« Er umkreiste langsam die Lagune und tippte auf eine der Verbindungen in die Adria. »Wie Sie sehen, gibt es nicht sonderlich viele Durchfahrten in unsere Lagune. Dieses beinahe abgeschlossene System ist somit noch stärker gedämpft. So konnte man relativ sicher sein, dass die Toten nicht im Wasser liegen.« Er räusperte sich. »Wobei das eher religiöse Gründe hatte. Um eine Trinkwasserverseuchung hat man sich damals weniger Sorgen gemacht, auch weil vor dem Bau der Versorgungsleitungen in der Neuzeit das Regenwasser in Zisternen gesammelt wurde... und in dieser Region regnet es ausreichend.«
»An die Gezeiten hatte ich gar nicht gedacht–«
»Ich habe das ein wenig vereinfacht, Signorina Lisa«, unterbrach Soccio ihren Gedankengang. Er nahm einen weiteren, winzigen Schluck von seinem Espresso. »Genau genommen ist die Lagune von Venedig in einen nördlichen und einen südlichen Bereich zu unterteilen. Die Altstadt, also das, was die meisten Menschen als Venedig bezeichnen, bildet durch ihre schiere Größe gewissermaßen eine Barriere. Nördlich davon gibt es praktisch keinen Tidenhub, dafür fast reines Süßwasser. Wir nennen das den 'toten' Teil der Lagune. Der lebendige Teil im Süden ist Brackwasser oder Salzwasser, hat also wesentlich mehr Austausch mit dem Mittelmeer und ist dem Einfluss des Mondes stärker unterworfen. Das Lazzaretto befindet sich in einem Übergangsgebiet. Jedenfalls ausreichend, dass die bisher gefundenen Überreste die meiste Zeit trocken gelagert waren.«
»Nun gut, verstanden«, ergriff Conrad das Wort. Obwohl er wusste, dass das mit dem Mond Unsinn war, verzichtete er darauf, den Leiter der Ausgrabung zu verbessern. »Aber Fräulein Franks meinte sicherlich das berühmte Hochwasser, das in Venedig nach meinem Wissen alles andere als eine Seltenheit darstellt.«
»Ah, sì. Acqua alta. Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen.« Der Archäologe lehnte sich zurück, blickte hinüber zum Bahnhof Santa Lucia, der im gleißenden Sommerlicht regelrecht zu leuchten schien. »Im Winterhalbjahr ist etwa ein Meter keine Seltenheit. Das ist nicht viel, und für unsere Insel spielt es kaum eine Rolle, wenn man die Toten nicht allzu tief vergräbt. Und das würde man als Venezianer sicherlich nicht tun. Im Übrigen hat man das wohl auch nicht, soweit wir bisher durch den Befund wissen. Wie dem auch sei... Dieser eine Meter Wasseranstieg bedeutet für den Markusplatz tatsächlich schon 'Land unter', wie es bei Ihnen heißt. Rund zwanzig Zentimeter immerhin. Mit normalen Gummistiefeln wird es da schon knapp, wenn man nicht wirklich langsam schlurft oder über die Stege läuft. Für den Rest der Altstadt hat so ein kleines Hochwasser jedoch kaum Auswirkungen. Sie können eigentlich überall trockenen Fußes hingelangen, außer am tiefst gelegenen Punkt, dem Markusplatz eben.«
»Dann ist das alles nicht so dramatisch, wie es im Fernsehen aussieht? Ich meine, man bekommt ja wirklich immer nur den Markusplatz gezeigt...«
Soccio hob mahnend die Hand. »Langsam, Signorina. Nur dreißig Zentimeter mehr überfluten bereits die halbe Stadt. Dann stehen Sie auf dem Markusplatz auch nur knietief im Wasser.« Er nahm einen großen Schluck Wasser und räusperte sich leise. »Ungefähr bei eineinhalb Metern ist im Grunde genommen die gesamte Insel betroffen. Venedig steht dann komplett unter Wasser. Aber das kommt nur sehr selten vor, und selbst dann wären unsere Toten wahrscheinlich nicht zur Gänze betroffen.«
Conrad und Franks nickten beinahe synchron.
»Allerdings gab es vor gut zwanzig Jahren einen Rekordstand von fast zwei Metern. Das bedeutet dann auch für die Lazarettinsel die fast völlige Überschwemmung. Doch wie schon gesagt: Das war das höchste gemessene Hochwasser. Meist bewegen wir uns zwischen einem und eineinhalb Metern.«
»Gut, die Toten auf der Pestinsel dürften demnach aus anthropologischer Sicht noch einiges hergeben«, resümierte der Doktorand und winkte nach dem Kellner. »Da bin ich mächtig gespannt.«
03
»So etwas nenne ich ein Loch«, bemerkte Conrad, nachdem er die papierdünne Zimmertür geöffnet hatte.
Der Raum war düster, obwohl es gerade sechzehn Uhr war und die Sonne von einem wolkenlosen Himmel schien (jedenfalls war das so, als sie das 'Hotel' Del Bajazzo betreten hatten), und wirkte deshalb erheblich kleiner, als er tatsächlich war. Das einzige Tageslicht kam von einem schmalen Fenster an der gegenüberliegenden Raumseite, das sich ein gutes Stück oberhalb ihrer Köpfe befand. Die linke Wand wurde von einem monströsen Kleiderschrank im Spanplatte-PVC-Holz-Look eingenommen, der mit seinen abgestoßenen Kantenumleimern dermaßen ramponiert aussah, als hätte man ihn vom Sperrmüll zurückgeholt. Die rechte Hälfte des Zimmers bestand aus einem ebenso heruntergekommenen Doppelbett, das auf einem grau-grün gemusterten Teppich stand, der wahrscheinlich nicht nur wie ein Ungezieferhort aussah. »Das ist ja wirklich ein schäbiges Etablissement«, murmelte er resignierend. »Das Erste, was ich morgen früh mache, ist diesem Soccio–«
»Ekelhaft! So etwas Widerliches habe ich–« Schnaufend flüchtete Franks aus dem winzigen Bad und stapfte eine Sekunde später auf dem Flur Richtung Ausgang. »So ein Saustall!«, hörte Conrad sie schreien. »Ich werde diesem blasiertem Affen an der Rezeption sowas von die Meinung geigen.«
Er beeilte sich, sie einzuholen, und bekam sie auf halber Strecke an der Schulter zu fassen. »Hey, hey, langsam. Lass mich das machen.«
»Wenn du glaubst, dass ich auch nur eine Minute–«
»Komm runter. Ich habe selber nicht die geringste Lust, mich in dieser heruntergekommenen Kaschemme auch nur zu setzen.«
Franks sog lautstark die Luft ein. »Außerdem steht da ein Doppelbett.«
Conrad ging auf diesen Versuch, die Situation aufzulockern, nicht ein. »Du produzierst bitte keinen Eklat, versprich mir das. Wir gehen jetzt nach vorne und bringen unseren Unmut in aller Unaufgeregtheit zum Ausdruck.«
Sie kniff die Augen zusammen und entwand sich seinem Griff.
»Wir sind bestimmt nicht die Ersten, die sich beschweren. Wir wollen dem Typen doch nicht die Genugtuung geben, da vorne einen Affentanz aufzuführen, bei dem er uns seelenruhig abtropfen lassen kann.«
Franks atmete aus und nickte widerwillig, doch sie stand noch immer kurz vor einer Explosion.
Der kleine Mann mit den streng nach hinten gegelten Haaren schien Conrad für einen endlosen Moment überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, als der sich vor ihm aufbaute und die Arme auf der niedrigen Theke verschränkte.
»Sie wünsche«, fragte der Italiener schließlich kaum hörbar und ohne den Blick zu heben.
Jetzt spürte auch Conrad, dass es schwer werden würde, die Fassung zu bewahren. »Es gibt da ein kleines Problem mit dem... Zimmer.«
Provozierend langsam sah der Rezeptionist auf und wartete mit desinteressiertem Gesichtsausdruck auf weitere Ausführungen seines Gastes.
Conrad verzichtete auf die offensichtlich überflüssigen Floskeln der Freundlichkeit. »Das Zimmer ist düster, weil es nur ein Kellerfenster gibt. Außerdem ist es völlig abgewrackt und macht einen extrem schmuddeligen Eindruck. Wir hätten deshalb gerne ein anderes Zimmer.«
Franks blickte ihn verständnislos an. »Das Möchtegern-Bad ist ein ekelhaftes Dreckloch«, schleuderte sie dem Italiener entgegen.
»Scusa signora... Ich verstehe nicht–«
»Ich geb' dir gleich–«, legte Franks los, wurde aber durch Conrads erneuten Schultergriff gestoppt.
»Wir haben hier ein schwerwiegendes Problem«, versuchte er es erneut.
»Äh... Problem... Ich verstehe nicht, signore...«, entgegnete der schmierfrisierte Mittfünfziger mit Unschuldsmiene.
Mittlerweile atmete auch Conrad schwer. »Hören Sie...«
»Ich trete dem schmierigen Schlumpf gleich in die Eier«, zischte Lisa. »Das kapiert er garantiert.«
Der Angesprochene wandte sich ihr zu, und sein Blick verriet Franks, dass er jedes Wort verstanden hatte.
Sie drehte sich abrupt um und zog Conrad hinter sich her. »Keine Minute, kein Wort mehr, wir holen unsere Klamotten und gehen«, raunte sie ihm zu.
Anstatt die Klinke zu benutzen, trat sie mit ihrem Bundeswehrstiefel gegen die angelehnte Papptür des Zimmers, was sie zwar öffnete, aber auch—ob beabsichtigt oder nicht, erschloss sich Conrad nicht—in der unteren Hälfte aus der Angel brach.
Er schüttelte den Kopf, konnte sich breites Grinsen aber nicht verkneifen. Als er seinen nagelneuen Rucksack vom Bett genommen hatte und Lisa ihren schulterte, kam der kleine Italiener in bisher ungekannter Gefühlsaufwallung auf sie zugelaufen.
»Sie könne doch nicht, ich bitte Sie...«, rief er wild gestikulierend.
»Beweg dich, und du bist tot«, knurrte Franks dem einen Kopf kleineren Mann zu, während der sich an die Wand des schmalen Flurs drückte, um sie vorbeizulassen.
Conrad begnügte sich damit, dem Rezeptionisten ein Schulterzucken und ein Lächeln zu schenken. »Ah, diese Weiber... Aber das kennen signore bestimmt besser als ich«, setzte er kopfschüttelnd hinzu, ohne sich noch einmal umzudrehen.
***
»Nicht schlecht«, stellte Franks kauend fest.
»Und gar nicht so teuer wie befürchtet«, ergänzte Conrad. »Liegt sicherlich daran, dass die Konkurrenz abends groß ist, wenn die Horden von Tagestouristen schon zurück auf dem Festland sind.«
»Hier gibt es ja anscheinend auch keine vernünftige Übernachtungsmöglichkeit«, murmelte sie in die Stoffserviette, während sie nach ihrem Bier griff.
Er überging das Thema. »Der Soccio hat uns noch überhaupt nichts zur eigentlichen Grabungskampagne erzählt. Keine Ahnung, was die bis dato eigentlich für einen Befund vor Ort haben. Das ist mir nachher erst aufgefallen.«
»Dafür wissen wir jetzt alles über das berühmte Hochwasser und eigentlich auch über die verzwickte Verwaltungsstruktur der Kommune Venedig... nur habe ich da nicht mehr zugehört.« Sie spießte das letzte Stück ihrer Champignonpizza auf die Gabel. »Aber seien wir ehrlich: Wir würden das Ganze auch lieber vor Ort auf der Fläche erklären, als mit Karten und Grabungstagebuch herumzudozieren.«
»Ja, vermutlich hast du recht«, bemerkte Conrad geistesabwesend. »Trotzdem finde ich es irgendwie merkwürdig. Ich habe eben nochmal an den Artikel in der GEO gedacht... Genau genommen wissen wir jetzt nicht mehr als das, was da auch drin stand. Er hat uns überhaupt nichts Interessantes gesagt. Ich meine, der Kerl ist doch schließlich Archäologe...«
Sie lehnte sich zurück und schob den leeren Teller ein wenig von sich. »Möglich, aber ich verstehe immer noch nicht, worauf du hinaus willst.«
Conrad schüttelte den Kopf. »Egal, vielleicht geht mir bloß der Tag ein bisschen auf die Nerven.« Er nahm die Speisekarte zur Hand. »Ich hatte eben erwartet, dass der Professor darauf brennen würde, uns von seiner Grabung vorzuschwärmen. Stattdessen ist er ungewöhnlich... sparsam mit Informationen.«
Sie winkte ab. »Quatsch, du bastelst dir da eine Verschwörung zusammen.«
»Klar, ist ja auch genau meine Domäne«, murmelte Conrad kaum hörbar. »Ich brauche jetzt noch ein Eis zum Nachtisch«, verkündete er, klappte die Karte zu und sah sich nach einer Bedienung um.
»Für mich ein Banana Split«, stimmte sie ein. »Wie gut, dass meine Mutter so schnell etwas angewiesen hat.«
Er verzog verlegen den Mund. »Ja, schauen wir mal, was der Tag morgen bringt. Wahrscheinlich will der gute Mann tatsächlich nicht alles zweimal erklären und wartet, bis wir die Fläche gesehen haben.«
»Apropos morgen«, hakte sie ein, während er nach dem Kellner winkte. »Wir können ja kaum in unsere Unterkunft zurück, selbst wenn wir wöllten... Was ich aber auf gar keinen Fall will.«
Ein Schreck durchfuhr ihn, und er glaubte, dass Lisa das bemerkte.
»Wir können wohl ebenso wenig unter einer Brücke pennen«, legte sie nach, »auch wenn Hochsommer ist und wir uns kürzlich mit Schlafsäcken und ziemlich teurem Campingequipment ausgerüstet haben.«
»Das Mount-Everest-taugliche Tonnenzelt nicht zu vergessen«, ergänzte er mit säuerlicher Miene. »Was schlägst du vor?«
Sie verdrehte die Augen und wandte sich dann in zuckersüßem Tonfall dem Kellner zu, dessen Namen sie bereits bei der zweiten Getränkebestellung recherchiert hatte: »Ah, Giovanni... abbiamo bisogno... di una stanza... prego.«
Der junge Mann beugte sich leicht zu ihr und setzte ein Lächeln auf, das Conrad zu Hause in Berlin wohl als Anzüglichkeit eingeordnet hätte. Derweil Giovanni wortreich und gestikulierend (soweit die Teller auf seinem linken Arm es zuließen) auf Lisas Anliegen zu antworten wusste, nahm ihr Gesicht zum ersten Mal an diesem Tag wirklich entspannte Züge an. Sie bedankte sich lächelnd, und er deutete eine Verbeugung an, bevor er sich dem Gast am übernächsten Tisch zuwandte, der bereits etwas fordernder nach dem Kellner verlangte.
»Und?«, fragte Conrad genervt, als Franks keine Anstalten machte, eine Erfolgsmeldung abzusetzen.
»Geht klar. Der älteste Bruder betreibt eine kleine Pension. Er kündigt uns an, damit wir reinkommen«, verkündete sie lapidar.
»Dazu braucht der fünf Minuten? Und dieses Etablissement heißt vielleicht 'Bella donna' oder ist es das 'In Cannelloni'? Jedenfalls ist das das einzige, was ich verstanden habe.« Er klang bissiger, als er wollte.
»Incantevole«, entgegnete Lisa milde lächelnd. »Ach, du hast wirklich keine Ahnung, wie man mit... Italienern sprechen muss.«
Angesichts ihres Auftrittes am Nachmittag war er tatsächlich einen Moment lang sprachlos. »Ah, Giovanni, una birra per favore, pronto!«, rief er Lisas neuem Freund quer durch das Restaurant zu.
04
»Commissario!«
Bruno Mancini machte eine Handbewegung, als wolle er einen Schwarm Mücken verscheuchen, und setzte seinen langsamen Gang den Steg entlang mit nach unten gerichtetem Blick fort. »Warte einfach ab, Toto. Der Commissario macht das immer so. Das ist seine Art, sich einen unbeeinflussten Ersteindruck zu verschaffen, und er hat mit dieser Methode eine Aufklärungsquote...«, vernahm er Salvatore Ingrossatos unnötiges Geplapper im Hintergrund. Gut, dann musste er den Neuen wenigstens nicht mehr selbst einnorden. Salvo gab dem jungen Polizisten weitere Hinweise zum Umgang mit ihm, während Mancini sich bemühte, seine Konzentration wieder dem Wesentlichen zuzuwenden.
Eines war ihm nach den wenigen Minuten seiner auch heute noch den meisten Kollegen merkwürdig erscheinenden Herangehensweise (er nannte das Tatortbegehung, auch wenn—wie es hier der Fall war—das Tatgeschehen an einem ganz anderen, bisher unbekannten Ort stattgefunden hatte), schon klar geworden: Das hier war keines der Delikte, mit denen sie sich sonst abgeben mussten. Kein aus dem Ruder gelaufenes Drogending, wie es in den letzten Jahren vor allem im Sommer immer häufiger vorkam, und auch kein Raubüberfall, jedenfalls kein offensichtlicher. Aber der Tote sah eindeutig nach Tourist aus, kein Einheimischer; ziemlich sicher noch nicht einmal Italiener. Auch einen Auftragsmord schloss Mancini nach wenigen Blicken auf den Leichnam aus. Es gab überhaupt keine äußeren Verletzungen, nichts, was auf einen gewaltsamen Tod des Mannes hindeutete. Trotzdem war dieser Grünschnabel von der örtlichen Polizei geistesgegenwärtig genug gewesen, die Polizia di Stato—und damit ihn—zu benachrichtigen. Und der schlaksige junge Mann hatte damit goldrichtig gelegen.
Mancini konnte es bisher nicht greifen, es war nichts weiter als ein Gefühl, eine Ahnung. Doch hier handelte es sich um einen Mord, das stand für ihn fest. Der Kerl war nicht einfach betrunken oder vollgedröhnt von einer Brücke in den Kanal gefallen. Was ist es, das nicht zusammenpasst? Er hob den Blick und schaute für eine Sekunde hinüber zur neuen Pescaria, drehte sich um und schlenderte zu Ingrossato zurück. »Salvo, wer hat ihn aus dem Wasser gezogen?«
»Der Kollege selbst. Agente Righera.« Ingrossato deutete auf den jungen Polizisten, der sie informiert hatte, und überließ ihm den Bericht.
»Um einundzwanzig Uhr fünfundzwanzig ging bei uns auf dem Revier der Anruf des Zeugen Zarelli ein. Ein offensichtlich toter Mann treibe zwischen den Pfählen am Palazzo Michiel. Als wir zehn Minuten später eintrafen, bin ich mit Dottoressa Galvini hinüber gerudert. Aber wir konnten für den leblosen Mann nichts mehr–«
»Sie haben ihn hier so abgelegt?«, unterbrach ihn Mancini.
»Ja, ich... wir haben ihn auf den Steg gelegt, und die Dottoressa hat versucht, ihn wiederzubeleben, konnte aber nur seinen Tod feststellen.«
»Hm, in Ordnung.« Der Commissario lockerte den scheuernden Kragen. Der verdammte Mückenstich im Nacken würde ihn noch wahnsinnig machen. »Äh, ja. Wo ist die Notärztin jetzt?«
»Dottoressa, der Commissario möchte kurz mit Ihnen reden«, rief Ingrossato einer auffallend kleinen Blondine zu, die mit dem Packen ihres klobigen Lederkoffers beschäftigt war.
»Agente... Toto, richtig? Sie können zurück aufs Revier. Lassen Sie Salvo bitte Ihre Privatnummer da. Vielleicht fällt mir nachher noch etwas auf, und ich muss Sie möglicherweise heute Nacht noch belästigen.«
Der Angesprochene protestierte nicht, sondern nickte mit einem Lächeln und entfernte sich wortlos.
»Ah, Dottoressa...«
»Galvini, Claudia Galvini. Agente Righera hat mich benachrichtigt, weil er wusste, dass ich heute Abend Bereitschaft habe. Falls Sie sich fragen–«
»Schon gut.« Natürlich dachte er sich seinen Teil, doch jetzt war nicht der Zeitpunkt, die junge Frau in Verlegenheit zu bringen. »Was können Sie mir zur Todesursache sagen? Völlig aus dem Bauch heraus, ich brauche im Augenblick keine fachlich abgesicherte Meinung«, fügte er hinzu, als er das Unbehagen in ihrem Blick bemerkte. »Einfach nur den ersten Eindruck. Was ging Ihnen spontan durch den Kopf?«
»Dass er nicht so aussieht, als sei er ins Wasser gefallen und ertrunken.«
»Danke, Dottoressa. Ich denke, alles Weitere wird die gerichtsmedizinische Untersuchung zeigen.«
»Das ist nicht... Ich habe jedenfalls keine–«
»Alles in Ordnung«, unterbrach Mancini, um ihr den Rechtfertigungsversuch zu ersparen. »Ich wollte tatsächlich nur wissen, was ihr professionelles Bauchgefühl im ersten Moment meinte.« Er kratzte seinen juckenden Hals. »Machen Sie sich nichts daraus. Fast alle Kollegen halten mich für einen schrägen Kauz, zumindest was meine Arbeit angeht. Ich denke, ich kann Sie notfalls über Agente Righera erreichen, falls mir noch etwas fehlt.« Er konnte sich diese kleine Unverschämtheit nicht verkneifen. Einen Moment verspürte er so etwas wie Neid auf den jungen Polizisten, obwohl er Righera nicht unsympathisch fand.
»Gut, wenn das alles ist, Commissario... Agente Righera weiß natürlich, wo er mich heute Nacht findet«, parierte sie seine Anzüglichkeit und lächelte.
»Ein... auffälliges Pärchen«, bemerkte Ingrossato leise, nachdem die Ärztin auf dem Ramo Dragan, der geradlinig vom Anlegesteg wegführte, außer Sichtweite war.
»Ja, er ist bestimmt drei Köpfe größer«, murmelte Mancini und verkniff sich weitere Anspielungen. »Nun, wir werden sehen, ob ich Recht habe. Ich glaube, hier hat jemand einen Toten entsorgt. Auf merkwürdige Weise...«
05
»Das da vorne hat er wohl gemeint.« Franks beschleunigte ihren Schritt bei der Aussicht auf einen ordentlichen Morgenkaffee.
Conrad folgte ihr gähnend. Die Pension von Kellner Giovannis Bruder war eine regelrechte Offenbarung gegen die dunkle Wanzenbude, in der Soccio sie hatte unterbringen wollen. Darüber würde er mit dem Grabungsleiter noch reden müssen. Wenn sie beide hier bleiben sollten, und daran hatte er keinen Zweifel, dann würde der Professor die umgerechnet zwanzig Mark mehr pro Übernachtung schlucken müssen. Eigentlich sollte das kein Thema sein, schließlich fand man einen guten Anthropologen nicht an jeder Ecke. Lisa hatte zwar vorgeschlagen, dass ihre Mutter den Mehraufwand zahlen könnte (so glücklich war sie über ihre neue Unterkunft), aber Conrad sah das nicht ein und hatte vehement widersprochen. Er hatte schon jetzt ein schlechtes Gewissen. Dabei war ihm vollkommen klar, dass er das Angebot doch annehmen würde, wenn Soccio sich verweigern sollte, denn zurück nach Deutschland wollten sie momentan unter keinen Umständen. Aber so weit waren sie noch nicht.
Er fragte sich, wieso er dazu neigte, sich ständig Dinge auszumalen, die noch gar nicht zur Debatte standen. Er war doch beileibe kein Pessimist und Schwarzseher... Sie hatten gut geschlafen (und Lisa hatte erstaunlich wenig über den Umstand gemeckert, dass auch in diesem Zimmer nur ein Doppelbett stand), am Morgen festgestellt, dass es eine fast durchgängige Fensterfront mit einem winzigen Balkon gab, und sie hatten ein sauberes Bad mit heißem Duschwasser vorgefunden. Sogar große Badetücher, die diesen Namen verdienten, hatten bereit gelegen.
»Alles gut«, murmelte er, als er nach der Tür griff, die Lisa für ihn aufhielt. Immer noch gähnend blickte er sich kurz in dem Bistro um und steuerte dann auf eine gemütliche Bank am Fenster zu. Augenblicklich wurde er am Ärmel seiner Windjacke unsanft zurückgezogen.
»An die Bar«, belehrte Franks ihn. »Immer an die Bar und im Stehen konsumieren. Sobald du dich hinsetzt, ist es mit Bedienung, Gedeck und Lametta und kostet mindestens das Doppelte. An der Bar bestellen und dann irgendwo hinsetzen geht auch nicht, falls dir das eingefallen wäre.«
Conrad zuckte mit den Schultern und kam zu den Schluss, dass er nicht gewillt war, die abendliche Pizza (darauf würde es bei ihnen fast immer hinauslaufen) im Stehen einzunehmen. Morgenkaffe und etwas Gebäck, das würde schon gehen.
Franks wünschte dem Barmann einen guten Morgen, orderte zwei Milchkaffee und jeweils ein süßes Brötchen und ein Croissant. Der Schmierlappen hinter dem Tresen grinste breit—es gab keinen Zweifel, dass auch er jedes Wort von Lisas Belehrung davor verstanden hatte—und erkundigte sich bei Lisa nach ihrem Schlaf und der Unterbringung... Jedenfalls schloss Conrad das aus den wenigen Fetzen, die er aufschnappte.
Er verspeiste seine beiden Gebäckstücke und war dankbar, dass seine Begleiterin ihm kein Gespräch aufzwang, bevor er einen zweiten Kaffee zu sich genommen hatte. Er schüttelte heftig den Kopf, was der Barmann mit einem weiteren Grinsen quittierte, während Lisa ihn überhaupt nicht beachtete. Nein, komm runter. Es besteht nicht der geringste Grund für schlechte Laune, schalt er sich. Soccio war einfach nur ein Geheimniskrämer und kauzig, das sollte ihn nicht wundern. Wahrscheinlich würde er selbst sein Pulver auch nicht verschießen, bevor er den Grabungsbefund in realita präsentieren konnte. Fakt war: Sie hatten eine interessante Grabung in spannender Umgebung aufgetan, das Wetter war schön, ohne heiß zu sein... und sie hatten, dank Lisa, keine Geldsorgen. Sobald er wieder Zugang zu seinem kläglichen Doktorandensalär hatte, würde er ihre Mehrausgaben zurückzahlen, also auch kein Grund für ein schlechtes Gewissen.
»Wir sollten langsam los«, unterbrach sie seine Grübelei. »Als Erstes müssen wir uns Vaporettotickets besorgen, am besten Wochenkarten oder gleich für den ganzen Monat. Das ist erheblich billiger.«
Er nickte und kramte nach seinem Portemonnaie.
Sie schob seine Hand zurück. »Ist schon bezahlt.«
»Gut, danke«, murmelte Conrad. Er hatte das überhaupt nicht mitbekommen. Eigentlich sollte er wacher sein. Auf der Grabung würde er seine Sinne zusammennehmen müssen, denn er wollte auf gar keinen Fall, dass Soccio den Eindruck bekam, für ihn alles dreimal erklären zu müssen.
»Ciao, Luca«, rief Lisa, als sie auf die kleine Piazza hinaustraten.
Den kannte sie also auch schon. Noch etwas, das er in seinem Dämmerzustand nicht mitbekommen hatte...
***
Schon wenige Minuten, nachdem sie den Anlegesteg nahe der Rialtobrücke betreten hatten, kam ein Boot, das ihr Umsteigeziel am Markusplatz ansteuerte. Erst als Conrad realisierte, dass neben den offensichtlichen Urlaubern der größte Teil der Mitfahrer aus Italienern in Alltagskleidung und ohne jegliches Gepäck bestand, wurde ihm bewusst, dass das Vaporetto für die Venezianer nichts anderes war als ein Omnibus. Dass man leicht schwankend auf dem Wasser unterwegs war, musste man sich wegdenken. Das hier war für die Einheimischen wahrscheinlich selbstverständlicher als der Linienbus aufs Festland, für Conrad hingegen hatte es noch einen winzigen Teil Abenteuer, und er genoss den Wind und sogar den Geruch des Großen Kanals, der hier draußen auf dem Wasser überraschenderweise weniger intensiv erschien als am Uferweg.
Wie tief mochte der Canal Grande sein? Er wusste, dass Schiffe und Boote mit möglichst wenig Tiefgang gebaut wurden. Die Kähne der Müllabfuhr, die (wie er von Lisa erfahren hatte) jeden Morgen auch durch die schmäleren Kanäle fuhren, lagen sogar voll beladen deutlich weniger als einen Meter tief im Wasser, so schätzte er. Er fand die Vorstellung faszinierend, dass man die stellenweise über fünfzig Meter breite Wasserstraße womöglich zu Fuß durchqueren konnte und dabei den Kopf über der Wasserfläche behielt. Man würde nicht ertrinken, dafür würde einem eines der hundert Boote, denen man auf diesem Weg begegnete, den Kopf abfahren. Aber wahrscheinlich war das Unsinn; er würde Soccio fragen. So hatte er wenigstens ein Gesprächsthema, wenn der Archäologe schon keine Lust hatte, über seine Fundstelle zu reden...
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Franks, ohne tatsächlich eine Antwort zu erwarten. »Schau, da drüben ist das Guggenheim.«
»Aha«, war das Einzige, was ihm einfiel. Manche Gebäude sahen ganz interessant aus, aber die meisten waren in der ständigen Wiederholung mit ihren immer gleichen Farben und Formen irgendwie... langweilig. Wahrscheinlich würde Lisa ihn für diese Gedanken zusammenstauchen, doch schon auf dieser einen Fahrt sah er zu viele Paläste und Prachtvillen, als dass er noch überrascht sein konnte. Venedig war in der Tat eine andere Welt, eine Art grandios vergammeltes Disneyland mit echten Hotels, Betrieben, Bewohnern und Schicksalen. Was komplett fehlte waren die Dinge, mit denen man 'draußen' in anderen Städten ganz selbstverständlich konfrontiert war: Hochhäuser, Straßenbahnen, Kaufhäuser und Autos. Das war vermutlich das Beeindruckendste: Wochenlang (Monate würden sie wohl nicht hier verbringen) ohne LKWs, Busse, Autos und Fahrräder zu leben—und ohne Ampeln. Er schmunzelte.
»Da hinten auf der linken Seite sieht man schon den Dogenpalast«, erklärte seine Kommilitonin. »Dort müssen wir umsteigen.«
Während sie sich durch die beachtlich dichte Menschenansammlung zum Ausstieg vorarbeiteten, versuchte Conrad vergeblich, einen Blick auf den Markusplatz zu bekommen, erkannte aber zumindest den fast hundert Meter hohen Markusturm.
»Das ist der Campanile«, bemerkte Franks. »Sollte ursprünglich wohl als Leuchtturm dienen. Gucken wir uns alles in den nächsten Tagen an.«
»Ja, natürlich.« Es hatte sowieso keinen Zweck zu widersprechen. Zumal schon wieder sein schlechtes Gewissen rumorte, weil Lisa ihn komplett aushielt.
***
An der Station San Marco-San Zaccaria hatten sie die Anlegestelle gewechselt, weil die Linie Richtung Lido vom anderen Ponton abfuhr. Seit einigen Minuten ging die Fahrt nun über das offene Wasser der Lagune. Hier begegneten ihnen auch schon größere Schiffe, und der Wellengang war merklich. Conrad gefiel das, während Lisa eine eher verkniffene Miene zeigte und auffallend schweigsam war. Dass die Station der ersten Insel, an der das Vaporetto haltmachte, San Sèrvolo hieß, bekam er dieses Mal nicht vorgetragen.
Wenige hundert Meter weiter legte ihr Boot an San Lazzaro an und nahm dann—immer noch recht gut besetzt—Kurs auf den Kanal, der zur Endstation auf der Strandinsel führte. Als sie die Mündung passierten, waren sie vermutlich kaum zweihundert Meter von der Insel der Verdammten entfernt. Für Conrad wirkte sie wie eine mächtige rote Ziegelwand, die jemand mitten in die Lagune von Venedig gebaut hatte. Wo soll man denn da graben?, ging es ihm durch den Kopf. Ein paar Minuten später machte das Vaporetto fest, und alle Passagiere gingen an Land.
Von der Anlegestelle aus folgten sie, wie Soccio ihnen aufgetragen hatte, dem schmalen Kanal, bis sie das direkt am Strand liegende Excelsior erblickten. Gegenüber von dem Luxushotel befand sich eine Art Mini-Marina für vielleicht ein Dutzend Boote. Wahrscheinlich gehört das zum Service für die Yachtbesitzer, dachte Conrad.
»Da drüben winkt einer. Ich vermute mal, dass das unser Grabungsleiter ist«, verkündete Franks und eilte auf den Mann zu.
»Vermutlich, die Figur passt ja«, brummte der Anthropologe in Gedanken an die bevorstehende Kommunikation und versuchte vergeblich, seine abhandengekommenen Brille zurechtzurücken. Kopfschüttelnd beeilte er sich, mit seiner Kommilitonin Schritt zu halten.
»Ich bin überaus glücklich, dass Sie es pünktlich einrichten konnten! Guten Morgen.«
Wir sind Deutsche. Conrad stoppte erfolgreich die Weiterleitung dieses Gedankens an seine Stimmbänder. »Guten Morgen. Ja, der Berufsverkehr mit dem Vaporetto funktioniert reibungsloser, als ich gedacht hätte.«
»Auf dem Wasser gibt es selten Stau. Das macht es erheblich einfacher«, dröhnte Soccios tiefe Stimme. »Für gewöhnlich haben meine Landsleute dennoch ein leicht anderes Verhältnis zur Pünktlichkeit, auch wenn diese Einstellung hier im Norden nicht so ausgeprägt ist... Mich jedenfalls nennt die Familie meiner Frau 'il tedesco'», fügte er mit einem donnernden Lachen hinzu.
Der massige Italiener erinnerte Conrad mit einem Mal an Bud Spencer, obwohl er den Schauspieler für noch etwas korpulenter hielt; aber das war schwer zu sagen, wenn man nur Kinofilme als Maßstab hatte... Könnte doch sein, dachte er feixend. Immerhin hatte auch der Schauspieler einen Doktortitel und sprach gut Deutsch, soweit er wusste. Ich werde mit Bud Spencer graben.
»Was ist so lustig? Lass mich mitlachen«, forderte Franks, während Soccio die Leine am Bug eines unauffälligen, kleinen Motorboots von der Klampe löste.
Conrad entschied sich im letzten Moment für eine unverfängliche Antwort, um sich einen neuen Spitznamen zu ersparen. »Ach, ich fand seine Analyse der italienischen Pünktlichkeit nur amüsant...«
Ihr Blick verriet, dass sie kein Wort glaubte.
Wenige Minuten später hatten sie den schmalen Kanals von der Hotel-Marina zurück in die Lagune hinter sich gelassen und sahen gut hundert Meter vom Strand des Lido entfernt eine seltsame rote Baustruktur über der Wasserlinie aufragen. »Sieht aus wie eine halb versunkene Burg«, bemerkte Franks.
»Architektonisch liegen Sie nicht so verkehrt, Lisa. Die Mauer diente aber dazu, die armen Seelen drinnen zu halten... Dabei dürften die meisten Insassen kaum zu einem Fluchtversuch in der Lage gewesen sein.«
Sie hatten sich dem Eiland auf vielleicht zwanzig Meter genähert und passierten jetzt die südöstliche Ecke des riesigen Ziegelbaus. Soccio steuerte nicht auf die Anlegestelle im Osten zu, die augenscheinlich nicht mehr als ein Loch in der Wand war; stattdessen nahm er Kurs auf einen hölzernen Steg, der sich an einem kleinen, durch einen schmalen Kanal von der eigentlichen Lazarettinsel getrennten, Stück Land am südwestlichen Ende befand.
»Das ist der ehemalige Hauptzugang«, erklärte der Archäologe. »Den näher am Lido liegenden Zugang auf der Ostseite hat man aus logistischen Gründen angelegt. Es ist einfacher, Waren und Ausrüstung dort direkt in die Gebäude zu bringen, als sie von hier aus über die teils unwegsame Insel zu schleppen. Und jetzt, wo wir den Boden an mehreren Stellen abtragen, wird es noch mühsamer.« Soccio stellte den winzigen Außenborder ab, brachte das Boot routiniert längsseits und bereitete sich aufs Festmachen vor. »Deshalb halten wir den Lieferanteneingang auch für Transporte frei.« Er angelte nach einer Leine, die vom Steg hing, und legte sie über eine Klampe am Heck. Dann wiederholte er den Handgriff am Bug und zog ihre Fähre nah genug heran, dass der Landgang möglich wurde. »Außerdem bekommen Sie auf diesem Weg einen authentischeren Eindruck und sehen gleichzeitig mehr von der 'isole del dolore', wie die meisten Venezianer das alte Lazzaretto nennen.«
06
Noch war nichts entschieden. Der Tropfen wuchs zu erstaunlicher Größe und schien sich förmlich an dem dünnen Glasröhrchen festzuklammern. Vorsichtig drückte er etwas fester auf den kleinen Gummibalg und hielt unwillkürlich die Luft an. Was würde passieren, wenn die beiden zusammenkamen? War er dem Durchbruch so nahe, wie er hoffte? Oder würde die Vereinigung alles zunichtemachen—wie es schon hunderte, nein tausende Male vorher passiert war? Schließlich reichte die Oberflächenspannung nicht mehr aus, und die klare Flüssigkeit löste sich von der Pipette. Er hatte immer noch keinen Atemzug getan. Der Fall aus kaum zehn Zentimetern Höhe schien eine Ewigkeit zu dauern, ganz so, als habe dieses Experiment die Schwerkraft außer Funktion gesetzt. Wie in Zeitlupe traf der Tropfen auf die gelbliche Substanz in der von der Kühlschrankkälte immer noch beschlagenen Petrischale. Er beobachtete, wie kleinste Spritzer beim Aufprall der Testflüssigkeit hochsprangen und in einem Umkreis von vielleicht einem Zentimeter in die Glasschale zurückfielen. Die Oberfläche beruhigte sich rasch. Es passierte nichts—exakt so, wie er es sich gewünscht hatte. Erleichtert atmete er aus und genoss die Stille. Hatte er das Ziel erreicht? Blieb die Substanz nach unzähligen Versuchen und Enttäuschungen nun endlich stabil? Euphorie wollte sich in ihm ausbreiten, doch er zwang sich, diese Regung zu unterdrücken. Noch ein paar Sekunden—zur Sicherheit. Zu oft war er im letzten Moment enttäuscht worden, seine Nerven lagen sowieso schon blank.
Ein leises Zischen, zunächst kaum hörbar, störte die göttliche Stille. Wieder atmete er tief ein und hielt die Luft an. Dieses Mal jedoch, um die aufkommende Wut im Zaum zu halten. Unter das Zischen mischte sich eine Art Brodeln, ein gedämpftes Blubbern. Er wusste, was das bedeutete: Er war wieder gescheitert.
Während das Zischeln langsam nachließ, veränderte sich die Farbe der zähen Flüssigkeit von einem transparenten Gelbton in eine dünne milchige Plörre. Allmählich wurde es wieder vollkommen still, und auch das leichte Blubbern ebbte vollkommen ab.
Er krallte seine Hände um die Tischkante, um nicht die Kontrolle zu verlieren, denn wenn er jetzt etwas Unüberlegtes täte, wäre es unweigerlich sein Ende—ein unglaublich qualvolles Ende. Das durfte nicht sein, er hatte noch viel zu tun. Mit einem Geräusch, das wesentlich lauter war als das, das seinen erneuten Misserfolg verkündet hatte, entließ er die verbrauchte Luft aus seinen Lungen und löste seinen Griff. Doch es war zu früh. Um die Spannung abzubauen, ließ ihn sein aufgewühltes Unterbewusstsein nach dem Erlenmeyerkolben direkt neben dem Versuchsaufbau greifen und das Gefäß gegen die Wand hinter ihm schleudern. Das laute Klirren brachte in die Realität zurück. Er hatte in seiner Rage das Chlorform erwischt. Lautlos fluchte er über seine Unbeherrschtheit. Verdammter Mist! Bei Raumtemperatur und ohne Sonnenlicht bestand keine große Gefahr, dass sich die klare Flüssigkeit in Gas verwandelte. Viel schlimmer war, dass es einiger Anstrengung bedurft hatte, um das Zeug in die Hände zu bekommen—und zwar ohne, dass er sich ausweisen oder irgendwelche Quittungen abzeichnen musste.
Verflucht! Noch nie hatte er derart die Beherrschung verloren. Und noch nie war er so nah am ersehnten Erfolg vorbeigeschliddert. Doch er musste sich mäßigen. Das Zeitfenster war knapp bemessen. Wer konnte schon vorhersagen, wann wieder ein solcher Fund, ein Jahrhundertschatz geborgen werden würde? In den nächsten ein oder zwei Tagen musste er eine Lösung finden, die Substanz zu stabilisieren, sonst würde er womöglich Jahre auf eine neue Möglichkeit warten müssen. Das war schon einmal passiert. Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Er hatte dazugelernt, es musste einfach funktionieren...
07
Soccio hatte versprochen, ihnen in Kürze eine Einweisung auf die Insel und seine Grabung zu geben, sich dann jedoch entschuldigt: »Ich muss erst noch etwas erledigen. Macht euch doch schon mit den anderen bekannt. Einfach geradeaus, da hinten, wo die Tür offensteht.«
Franks zuckte mit den Schultern und marschierte über den grasbewachsenen Innenhof. Conrad, der solchen Situationen mit weit weniger Gleichmut begegnete, folgte mit einigen Sekunden Abstand. Seine Bedenken zerstreuten sich glücklicherweise, sobald sie das improvisierte Grabungshaus betraten.
»Hallo, ich bin Andrea«, begrüßte sie ein sportlich aussehender Mann um die vierzig auf Englisch und bot ihnen einen Platz an einem großen, offensichtlich von der Grabungsmannschaft gezimmerten Holztisch an. »Ich bin einer der beiden Hobbyarchäologen. Ein Seniorenstudent, der noch einmal ein Abenteuer erleben möchte, bevor die morsch werdenden Knochen versagen.«
»Hört nicht auf den«, schaltete sich eine zierliche junge Frau mit raspelkurzen dunklen Haaren ein, bevor Conrad und Franks Andrea di Botellis Begrüßung überhaupt erwidern konnten. »Andrea hat in den letzten Jahren mehr mittelalterliche Kampagnen mitgemacht als wir anderen zusammen.«
Botelli kommentierte das mit einem Lächeln, das in Conrads Augen einen Hauch Überheblichkeit enthielt.
Gott sei Dank läuft hier alles auf Englisch, registrierte der Anthropologe erleichtert. »Ganz im Gegensatz zu uns. Wir haben noch keine einzige Mittelaltergrabung mitgemacht... wenn ich mich nicht irre.«
»Wenn man die Geschichte in London nicht dazu zählt«, ergänzte Franks leise auf Deutsch.
»Äh, ja«, überging er ihre Bemerkung. »Auf jeden Fall freuen wir uns, endlich hier zu sein. Was steht denn auf dem Programm?«
»Wir frühstücken gerade.« Die Studentin in militärischem Grünzeug—das sicherlich Lisas Gefallen fand—machte eine einladende Geste. »Ich bin Alexandra Panetta, alle hier nennen mich Lexi. Ich studiere Mediävistik in Padua bei Professore Soccio; den habt ihr ja schon kennengelernt.«
Der älteste Student am Tisch gab sich wesentlich fokussierter: »Wir hoffen, noch vor der Mittagspause die ersten Knochen auf der Fläche einmessen zu können.«
Conrad hörte nur mit einem Ohr zu und nickte bedächtig. Beim Anblick der beiden großen Thermoskannen und der prall gefüllten Brottüten wurde ihm klar, dass das kleine Weckchen und das Croissant schon seit einer Weile nicht mehr vorhielten. »Klasse, das ist jetzt genau das Richtige«, bedankte er sich und griff nach einem der auf der Öffnung stehenden Keramikbecher, füllte ihn mit dampfendem Kaffee und rührte ein Päckchen Milchweißer ein.
»Wir haben genug für alle.« Lexi schob ihnen zwei der Papiertüten zu. »Wir frühstücken hier morgens zusammen. Dabei kann man die Tagesplanung wunderbar erledigen. Jeden Morgen ist jemand anders mit der Besorgung dran, das spielt sich schnell ein«, ergänzte die Studentin, als sie Franks' fragenden Blick bemerkte.
Während Conrad zufrieden in die Tüte mit den süßen Brötchen griff und mit den beiden älteren Studenten einen Small Talk begann, zog Franks eine auf grünlichem Papier gedruckte Tageszeitung zu sich hinüber. »Ich darf doch«, murmelte sie leise, ohne den Blick zu heben. »Mal schauen, wie viel Italienisch hängen geblieben ist.«
***
Nach der Lektüre eines Leitartikels, der sich über einen offenbar ertrunkenen Touristen ausließ, konstatierte Franks, dass es mit ihrem Sprachverständnis besser bestellt war, als sie angenommen hatte. Sie blätterte zum Sportteil und stellte mit Verwunderung fest, dass sie hier vornehmlich die Bundesligaergebnisse vom letzten Wochenende fand. Bevor Lisa jedoch etwas Lesenswerteres gefunden hatte, gesellte sich der Professor zur Frühstücksgruppe, der zuvor auch der von Botelli erwähnte zweite Seniorenstudent beigetreten war. Der Mann machte—obwohl leicht übergewichtig—durchaus einen sportlichen Eindruck und wies die dunkle, wettergegerbte Haut eines Seemannes auf. Im Kontrast zu Andrea di Botelli schien er tatsächlich im Rentenalter zu sein. Er studierte, wie alle Anwesenden außer Conrad und Franks, Geschichte an der Universität in Padua und hieß Lorenzo Portobello; Lisa ließ die Vorstellung schmunzeln, dass vielleicht er (oder seine Familie) hinter den in Deutschland vor einigen Jahren schwer angesagten und nebenbei überteuerten Spießerstrickjäckchen steckte. Die Runde der sieben wurde durch eine Freundin von Lexi vervollständigt, die sich mit Gina Sandrelli eingeführt hatte und ebenfalls Mediävistik an Italiens drittältester Universität studierte. In gewisser Weise war sie der Gegenentwurf zu Panetta; die Haare waren blond und lang, ihre Figur eher unsportlich. Auch schien sie sich weitaus mehr für Kosmetik zu interessieren als ihre Freundin (wobei Lisa keineswegs entgangen war, dass auch Lexi einen Kajalstift sehr wohl benutzen konnte). Kurz und gut, die beiden kamen sich wahrscheinlich nie ins Gehege—die wichtigste Voraussetzung für eine beständige Freundschaft.
»Das Lazzaretto Vecchio bot sich zur Isolation von Kranken an«, holte Soccio sie aus ihren Gedanken. »Bereits im vierzehnten Jahrhundert entschloss man sich für diese, wie ich meine, sehr moderne Vorgehensweise. Natürlich hatte man in dieser Zeit keine Ahnung von Bakterien, schon gar nicht von Viren. Möglichkeiten zur Heilung waren so gut wie nicht vorhanden. Trotzdem war den Venezianern selbstverständlich klar, dass man die Kranken von den Gesunden fernhalten musste. Zudem zeigte die Beobachtung, dass die Seuche sich umso schneller ausbreitete, je enger die Menschen aufeinander hockten. Dass eine hohe Bevölkerungsdichte nicht die einzige Ursache für eine rasante Ausbreitung ist, ist uns heute bekannt, doch vor über fünfhundert Jahren zeigte diese Beobachtung den augenfälligsten Zusammenhang.« Der Archäologe füllte seinen Kaffee nach und rührte eine Unmenge Zucker hinein, während er fortfuhr: »Nun ist ja einleuchtend, dass man an den begrenzten Platzverhältnissen und der Einwohnerzahl auf die Schnelle nichts ändern konnte. Und ein Ausweichen auf das Umland war genauso wenig eine Option wie Abschottung. Die naheliegende Lösung war also auf den zahlreichen kleinen Inseln der Lagune zu suchen.« Soccio nippte an seinem Becher und verzog ein wenig das Gesicht. »Bah, ich bekomme noch mal Diabetes... Gut, jedenfalls spielte sich schnell ein System ein, welches darauf basierte, dass man auf einer nördlicheren, nahe an der Hauptinsel und Murano liegenden Insel—eigentlich eher eine trockene Erhöhung in einer von Brackwasserkanälen beherrschten Marschlandschaft—eine Quarantäneeinrichtung etablierte. Hier wurden die Verdachtsfälle, meist See- beziehungsweise Kaufleute besonders aus Arabien oder Asien, zwangsweise in kleinen Unterkünften untergebracht, während die Ladung ihrer Handelsschiffe in einem großen Lagerhaus gestapelt wurde. Die Waren wurden in dieser Zeit mit allen erdenklichen Methoden behandelt, von denen man glaubte, dass sie desinfizierend wirkten. Das ging vom einfachen Waschen bis zum Ausräuchern und der Behandlung mit diversen Substanzen, beispielsweise Essig. Dieses fast quadratische Eiland ist als Lazzaretto Nuovo bekannt. Erkrankte ein Insasse in der Quarantäneunterkunft, wurde er sofort hierher auf die alte Lazarettinsel gebracht. Sein Schicksal war damit in der Regel besiegelt, kaum jemand verließ das Lazzaretto Vecchio lebend. Schnell war die Insel als 'isole del dolore', Insel des Schmerzes, oder als Insel der Verdammten bekannt. Heutzutage wird sie meist schlicht als Pestinsel bezeichnet.«
08
Mancini nippte an dem hauchdünnen Plastikbecher. Die Brühe kochte beinahe noch, und er befürchtete, der weicher werdende Rand könnte jeden Moment einknicken und ihm die Lippe verbrennen, noch bevor seine Eingeweide an der Reihe waren. »Wenigstens merkt man bei der Hitze nicht, woraus das Zeug zusammengebraut ist«, murmelte er und zeigte auf den entkleideten Leichnam. »Guten Abend, oder vielmehr einen guten Morgen, Professoressa Bellucci. Können Sie mir schon irgendetwas berichten, womit ich etwas anfangen kann?« Er gähnte und ließ sich auf dem unbequemen Drehhocker neben der Schiebetür nieder.
»Guten Morgen, Commissario.« Die Gerichtsmedizinerin sah zu ihm hinüber und deckte den Toten mit einem weißen Tuch zu. »Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen meine äußerst vorläufigen Erkenntnisse bei einem ordentlichen Espresso darlege?«
Er blickte kurz auf sein Automatenheißgetränk und stellte es dann samt Inhalt vorsichtig in dem Mülleimer vor der Schiebetür ab.
Bellucci schüttelte den Kopf und machte sich an einem beeindruckenden Kaffeevollautomaten zu schaffen. »Ohne das Ding wäre es mir wahrscheinlich unmöglich, nachts zu arbeiten–« Sie streichelte mit der Linken über den verchromten Deckel des Bohnenbehälters und setzte die Maschine in Gang.
»Sie sind meine Rettung. Ich hätte die Plörre in meiner Verzweiflung beinahe getrunken.« Mancini ging hinüber zu einem der Spülbecken aus Edelstahl, nahm ein Becherglas aus dem Metallregal und ließ kaltes Wasser einlaufen. »Er ist nicht ertrunken, oder?«, rief er Bellucci über die Schulter zu.
»Das kann ich noch nicht definitiv sagen. Wir werden sehen, ob er Wasser in der Lunge hat. Bei der äußeren Beschau konnte ich keine Verletzungen feststellen, schon gar keine, die irgendwie geeignet wären, ein Ableben herbeizuführen.« Die Ärztin stellte seine Tasse auf einen leeren Obduktionstisch und holte dann ihr eigenes Getränk. »Er hat ein paar blaue Flecke, wie sie wahrscheinlich jeder von uns ab und zu aufweist, Blutreste in der Mundhöhle, postmortale Schrammen von der Bergung oder Hindernissen im Kanal, aber keinerlei Abwehrverletzungen oder sonst irgendetwas, das auf Gewalt hindeuten könnte.«
»Sie wollen mir nicht sagen, dass er kein Fall für mich–«
»Immer langsam, Commissario«, unterbrach sie gedehnt. »Natürlich wäre es möglich, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass Sie ihn vom Haken lassen müssen. Man wirft einen Verstorbenen ja nicht ohne Grund in den Kanal... Warten wir die Untersuchungsergebnisse ab.«
»Wie lange?«
»Kurz. Durchaus möglich, dass er nur ein paar Stunden im Wasser lag.«
Er nahm mit hochgezogener Braue einen großen Schluck Wasser und ermunterte sie mit aufwendiger Geste fortzufahren.
Die Gerichtsmedizinerin zog das weiße Laken bis zur Hüfte des Toten hinunter. »Wie schon erwähnt, ich kann noch nicht sagen, woran der Mann gestorben ist.«
»Gut. Das bedeutet für mich?«
»Ich werde mich nicht zu etwas versteigen, nur um Ihnen vorschnell einen Ermittlungsansatz zu liefern. Sehen Sie sich den Mann an. Und Sie haben seine Kleidung gesehen. Er hat gepflegte Hände, einen Haarschnitt und ist glatt rasiert. Keine Einstiche; und nach Drogen sieht das keinesfalls aus. Den Standard 'Betrunken in den Kanal gefallen' können wir wohl ebenso hintanstellen. Natürlich könnte er auf der Rialto einen Herzinfarkt erlitten haben und dann ins Wasser gekippt sein—völlig ohne Publikum... Aber wie realistisch ist das? Commissario, diese Überlegungen kann jeder Polizeischüler anstellen.«
Der Commissario brummte; das passierte immer, wenn er unzufrieden war und den Grund dafür nicht zu fassen bekam.
Sie seufzte. »Weil ich Sie so gut kenne, dass ich weiß, wie Sie damit umgehen werden, begebe ich mich jetzt auf die Ebene emotional gegründeter Spekulation.« Bellucci zog einen Hocker zu sich, nahm Platz und rollte dicht an Mancini heran. »Eine Infektion, sagt mein Gefühl. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie erst einmal seine Identität kennen, werden Sie feststellen, dass er keine entsprechende Krankheitsgeschichte hat.« Sie nahm den letzten Schluck Espresso und zog eine Packung grüner Dunhill aus der Kitteltasche. »Auch eine?«
Mancini wunderte sich, denn er hatte die Medizinerin noch nie in den Untersuchungsräumen mit einer Zigarette gesehen. Er zuckte mit den Schultern und nahm an. Eigentlich rauchte er schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr, doch eine Menthol zwischen den Seziertischen erschien ihm um diese Uhrzeit irgendwie passend.
»Wenn Sie mich fragen, dann ist mein erster Tipp der Doktor«, rückte Bellucci mit ihrer Befürchtung heraus. »Es ist etwas Schnelles, ein Tag, ein paar Tage maximal, vermute ich. Es würde mich nicht wundern, wenn unser Mann einen Arzt aufgesucht hat, weil er sich schlecht fühlte. Offenbar hat man dabei aber nichts Lebensbedrohliches festgestellt, sonst wäre er ja wohl in einem Krankenhaus gestorben. Vielleicht geben uns Medikamente in seinem Körper einen Hinweis.«
Der Polizist stand auf. »Das ist doch schon was.«
»Nageln Sie mich nicht fest«, kam ihm Professor Bellucci zuvor. »Ich habe noch keine Zeit für eine mikroskopische oder toxikologische Untersuchung gehabt. Auch Abstriche und Kulturen brauchen ihre Zeit. Nur würde es mich nicht wundern, wenn er ins Muster passt.«
»In der Tat fürchte ich schon, dass es so ist, seit ich ihn auf dem Steg habe liegen sehen«, grübelte Mancini. »Seine Sachen sind in der Kriminaltechnik. Alles sieht nach einem wohlhabenden Urlauber aus.« Er stellte seine leere Tasse auf die Spüle und drehte sich im Gehen noch einmal um. »Vielen Dank. Sie können mich jederzeit erreichen, wenn Sie Ergebnisse haben. Ich glaube nicht, dass ich so schnell nach Hause komme...«
»Erst einmal muss ich ihn aufschneiden«, rief die Pathologin Mancini durch die bereits zugezogene Schiebetür nach.
09
»Das habt ihr alles zu fünft freigelegt?«, erkundigte sich Conrad beeindruckt. Er schaute auf die rechteckige Zone von etwa fünfundzwanzig Metern Länge und zehn Metern Breite hinab. Das derzeitige Grabungsplanum lag ungefähr sechzig Zentimeter unter dem rezenten Bodenniveau.
»Zu viert«, berichtigte Soccio mit einem breiten Grinsen. »Der Ausgrabungsleiter schaufelt nicht mit, wie Sie sich sicher denken können.« Er ließ diese Behauptung für einige Sekunden wirken und ergötzte sich offensichtlich an seiner und Lisas Sprachlosigkeit. »Das ist natürlich Quatsch«, erlöste er sie. »Die Deckschichten haben wir mit Erstsemestern und willigen Amateuren abgetragen. Als wir auf die ersten relevanten Befunde gestoßen sind, haben wir die Grabungshelfer nach Hause geschickt. Das ist nicht so gemein, wie es sich anhört«, kam er Lisas Einwand zuvor. »Alle Teilnehmer wussten, worauf sie sich einlassen. Wir hatten wesentlich mehr Interessenten, als wir letztendlich beschäftigen konnten. Und es war ja auch ein ordentlich bezahlter Ferienjob an der frischen Luft... Die fachlichen Erklärungen sowie historisches Hintergrundwissen haben sie von uns natürlich sowieso bekommen.«
Soccios Rechtfertigung war Conrad gleichgültig. »Auf jeden Fall eine beeindruckende Erdbewegung. Seit wann liegt das Planum mit den Skeletten frei?«
»Schon seit letztem Herbst«, berichtete Soccio den verdutzten deutschen Archäologen. »Ich habe vergangenes Jahr zwei Grabungen in Mailand und Turin geleitet. Daher konnten wir hier erst spät im Sommer mit den Arbeiten anfangen. Natürlich haben wir den Befund mit zwei Schichten Folie und einem guten Teil des Aushubes wieder abgedeckt, als wir die Kampagne letztes Jahr beendet haben.«
»Den Drecksjob haben natürlich wieder die Statisten gemacht«, nuschelte Franks.
Falls er sie mitbekommen hatte, dann überging Soccio ihre Provokation. »Vor sechs Wochen haben wir die Grabung wieder aufgemacht und mit der Freilegung der Skelette begonnen. Ja, und spätestens nächste Woche hätte ich mich im Anthropologischen Institut nach einem fähigen Mitarbeiter erkundigen müssen.«
»Dafür sind wir ja da«, bemerkte Conrad mit stolzer Stimme.
»Exakt, Sie kommen wie gerufen. Aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, Peter, dass ich ungeachtet Ihrer Qualifikation ein paar Nachforschungen bei befreundeten Wissenschaftlern angestellt habe, bevor ich mich tatsächlich dafür entschieden habe, Sie für diese–«
»Schon okay«, kürzte der Anthropologe ab. »Gibt es hier so etwas wie einen Fundlagerraum, in dem ich ein provisorisches Labor für die gröbsten Untersuchungen der Knochen einrichten kann?«
»Ich denke, wir werden in den großzügigen Gebäuden noch etwas Adäquates für Sie beide finden.« Er blickte kurz zu Franks. »Die notwendige Ausrüstung, ein Mikroskop, diverse Feinwerkzeuge und anderes Laborzeug sollte morgen anlanden. Eine große Menge Regale und einige Tische haben wir bereits aufbauen lassen.«
»Apropos 'etwas Adäquates'», flüsterte sie Conrad ins Ohr, während er noch über Soccios selbstverständlich benutzte Passivkonstruktion nachdachte. Soccio schienen hier für alles Helfer zu haben...
Er brachte Lisa mit einer herrischen Bewegung zum Schweigen. »Das mache ich schon noch«, zischte er seiner Kommilitonin zu. »Heute Abend.«
»Alles in Ordnung?«, fragte der italienische Archäologe.
Conrad winkte ab. »Nichts Wichtiges. Ging um unsere Unterbringung. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen, später.«
Soccio nickte mit verständiger Miene, ging aber nicht darauf ein. »Wo war ich stehengeblieben? Ach ja. Also, wir sind nun an dem Punkt, an dem wir die ersten Knochen einmessen und bergen könnten.«
***
Die Sonne stand schon ziemlich tief am Himmel, als sie zum zweiten Mal an diesem Tag mit dem Vaporetto unweit des Markusplatzes anlegten. Obwohl die menschlichen Überreste zur Bergung vorbereitet waren, hatte Soccio seinen Anthropologen und Franks kaum etwas tun lassen, sie jedoch mit ausführlichen Geschichten um das Lazzaretto und ein paar Anekdoten über ihre Grabungskollegen unterhalten. Kaffee war außerdem reichlich geflossen. Conrad machte sich keine Hoffnung, dass diese entspannte Stimmung besonders lange andauern würde. Spätestens, wenn das erste Skelett draußen war, würde auch ein vordergründig gemütlicher Brummbär wie dieser Soccio Resultate sehen wollen.
Hatte er schon am Morgen das Vaporetto für gut gefüllt gehalten, stellte Conrad jetzt fest, dass der Verkehr abends noch dichter war—und das hieß hier: dichtes Gedränge von Menschen. Keine Autokarawanen oder voll besetzten Busse, hier in Venedig walzten Touristen und die wenigen Einheimischen in einem steten Menschenstrom durch die wichtigsten Wege und über all die Brücken, zwängten sich noch durch die schmalsten Gassen der Stadt. Und im Sommer hatten sie natürlich absolute Hochsaison in der Lagune.
Conrad atmete flach, während er neben Lisa hinter einer Gruppe aufdringlich parfümierter Amerikanerinnen den Anleger hinaufstieg, um sich in den laufenden Verkehr an der Riva degli Schavioni einzufädeln. Dass Widerstand gegen Lisas Plan, ihre Ankunft in Venedig doch noch angemessen zu begehen, völlig zwecklos wäre, wusste er. Außerdem war er froh, dass sie das heikle Thema Unterkunft in einem günstigen Augenblick mit Soccio geklärt hatte—dafür hatte sie sich das Vergnügen verdient, ein oder zwei Stündchen im Urlaubsflair zu schwelgen und ihn mit ihrem Wissen über die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu beeindrucken.
Er war froh, als sie endlich die breite, hell gepflasterte Uferpromenade erreicht hatten und sich ein wenig aus dem Gedränge lösen konnten.
»In einer Stunde fängt hier der Abendbetrieb in den Restaurants an«, bemerkte Lisa und wies auf die Etablissements, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten. »Aber das hier ist sowieso außerhalb unserer Preisklasse, und wir wollen ja etwas für unsere humanistische Bildung tun.«