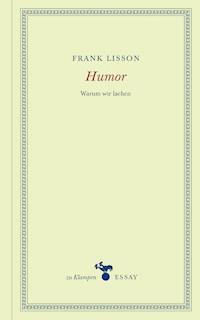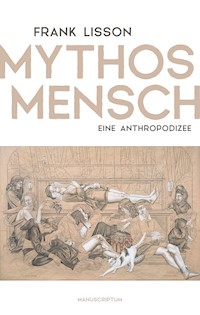Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Manuscriptum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ab dem 18. Jahrhundert wurde unter deutschen Neuhumanisten die Idee zur Forderung erhoben, daß es einen höheren menschlichen Sinn jenseits des bloß Utilitaristischen und Opportunen geben müsse. Und man meinte, daß diese Forderung oberste pädagogische Priorität zu genießen habe. Darin bestand die vielleicht bedeutendste deutsche Mission zum Wohle Europas, die freilich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. - Als ob man bereits um 1800 geahnt hätte, welch ähnliches Los der eigenen Kultur beschieden sein würde, sympathisierten die meisten deutschen Bildungsbürger mit dem Schicksal der Hellenen wie Erkrankte, die vom gleichen Leiden befallen waren. Man erkannte seine eigenen Besonderheiten bei den Hellenen wieder, dem einzigen Volk der Weltgeschichte, dessen Genialität und Zerrissenheit an die der Deutschen heranreichte. Um die Sehnsucht nach dem "freien, stolzen, schöpferischen Geist" zu rekonstruieren, spannt Frank Lisson (*1970) einen weiten Bogen vom "Homer-Erlebnis" über die Platon-, Sokrates- und Ödipus-Rezeption bis hin zum Ideal klassischer Bildung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GRIECHENTUM UND DEUTSCHER GEIST
FRANK LISSON
GRIECHENTUM UND DEUTSCHER GEIST
Anatomie einer Sehnsucht
Erstausgabe 2020 im Format der Selbstpublikation
Neue, verbesserte Ausgabe
© Manuscriptum Verlagsbuchhandlung Thomas Hoof
Lüdinghausen 2023
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne Zustimmung des Verlags ist strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die digitale Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-948075-51-4
eISBN 978-3-948075-70-5
www.manuscriptum.de
INHALT
Vorbemerkung
Prämisse
Heranführung
I.LUST AM WERDEN(1760–1820)
Das Homer-Erlebnis
Platon, der Künder
Phänomen Sokrates
Eine Frage der Liebe
II.WILLE ZUR GESAMTSCHAU(1800–1840)
Darstellung der hellenischen Welt:historisch
philosophisch
literaturgeschichtlich
Auf den Gipfeln des Olymp: Verwissenschaftlichung
Rätselweiser Oedipus: Mythos und Drama
III.WERT UND BEDEUTUNG DES ALTERTUMS(1820–1860)
Ex oriente lux?
Griechentum versus Christentum
Wunsch und Wirklichkeit
Vom Ideal klassischer Bildung
Auflösung
Personenregister
Ausführliche Inhaltsübersicht
Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geist. Frühe hat er sich überzeugt, daß im Gebiete des Verstandes, wie in der Sinnenwelt, alles ineinandergreift, und sein reger Trieb nach Übereinstimmung kann sich mit Bruchstücken nicht begnügen.
Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, 1789.
Was auch diesem fragwürdigen Buche zu Grunde liegen mag; es muss eine Frage ersten Ranges und Reizes gewesen sein; noch dazu eine tief persönliche Frage (…) – bleibt doch auch heute noch (…) auf diesem Gebiete beinahe Alles zu entdecken und auszugraben! Vor allem das Problem, d a s s hier ein Problem vorliegt…
Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, Versuch einer Selbstkritik, 1886.
Meine ganze Seele hängt an dem schönen Gedanken, durch Enthüllung des hellenischen Alterthums, Entwicklung des hellenischen Geistes das wenigstens im Einzelnen herzustellen, was den Deutschen im Ganzen schmachvoll abhanden gekommen – Begeisterung für Vaterland und Freyheit. Müßte ich je die Hoffnung schwinden lassen, das zu vermögen; würde mir es je klar werden, dieß Streben sey ohne Erreichung: so würde die Freude am Leben dahin seyn, die mich jetzt heiter seyn läßt bey allen den Schrecknissen, die sich jedem zeigen, der die Zeit und ihren Geist betrachtet und nicht in kaltem Egoismus oder in stumpfsinniger Sklaverei dahin träumt.
Franz Passow an Friedrich Jacobs, Weimar, 27. Dezember 1808.
Vorbemerkung
In diesem Buch soll das Wagnis unternommen werden, eines der wohl rätselhaftesten Phänomene deutscher Geistesgeschichte nicht anhand der Normen gegenwärtig gültiger Anschauungsweisen darzustellen, sondern ihm gewissermaßen zeitlos zu begegnen. Wer nämlich an der (heutigen) Welt und am (heutigen) Menschen nicht leidet, wird weder die deutsche Sehnsucht nach Hellas noch den geistigen Furor, den Schmerz und das Pathos etwa eines Hölderlin oder eines Nietzsche jemals verstehen, sondern das Wesen dieser tragischen Enthusiasten immer nur befremdlich finden und seinen philiströsen Pragmatismus weiterhin gegen die Visionen solcher Menschen ausspielen. Denn um die Relevanz des hier beleuchteten Problems gänzlich zu erfassen, muss man sich in die damalige Situation deutscher Bildungssehnsüchte hineinversetzen, welche natürlich immer nur einen geringen Ausschnitt herrschender Lebenswelten repräsentieren kann, die sich aber in ihrer kulturphilosophischen Virulenz für den zivilisationskritischen Beobachter doch gar nicht so sehr von der unsrigen unterscheidet. Die Betrachtungsweise, die hier versucht werden soll, ist also gewissermaßen eher eine von »innen« als eine von »außen«.
Nun macht freilich ein jeder entwicklungsgeschichtlich bedingter Mentalitätswandel die nötige Empathie für die Ursachen bestimmter historischer Ereignisse beinahe unmöglich, wodurch der Zugang zum echten Verständnis vielleicht für immer verbaut bleibt. Besonders der Mensch unserer Zeit glaubt sich auch methodisch allen vorherigen Köpfen überlegen; dabei verfügt er bloß über eine ungeheure Selbstgefälligkeit und Selbstsicherheit, deren Resultate jedoch bald schon wieder durch andere Selbstgewissheiten abgelöst werden können.
Wo etwa die Wirkung von Musik verstanden werden will, reicht es nicht aus, Noten oder Tonbeispiele einander analytisch gegenüberzustellen, sondern man muss einen Sinn dafür haben, das heißt: man muss etwas mitbringen, das keine rein wissenschaftliche Betrachtung je ersetzen kann, nämlich die Liebe zur Sache. Dies gilt umso mehr für die Wirkung der Sehnsucht nach Hellas auf die deutsche Geistesgeschichte des späten 18. bis frühen 20. Jahrhunderts. So wie die deutschen Neuhumanisten meinten, einen besonderen Sinn für das Griechentum zu haben, den keine andere Nation aufzubringen fähig wäre, und der ihnen erlaubte, die Deutschen mit den Hellenen in Verwandtschaft zu setzen, so bedarf es heute wiederum eines ebensolchen Sinnes, um jenen damaligen »deutschen Geist« und dessen Sinn für die Griechen zu verstehen. Falls nämlich alle Geschichtsschreibung notwendig Wissenschaftsdichtung ist, weil sich das Vergangene niemals exakt wiedergeben lässt, trifft dies insbesondere auf die Alte Geschichte und mehr noch auf die Rezeptionsgeschichte zu.
Natürlich verhält es sich mit all diesen Dingen wie mit Jacob Burckhardts einstigem Versuch, von »historischer Größe« zu handeln. Burckhardt war sich »der Fraglichkeit des Begriffs Größe wohl bewußt« und bekannte also: »notwendig müssen wir auf alles Systematisch-Wissenschaftliche verzichten.«1 Ähnliches gilt, gemäß der oben dargelegten Absicht, auch für das vorliegende Buch, das daher keineswegs mit einer akademischen Qualifikationsarbeit derzeit gültiger Muster verwechselt werden darf; sein Anspruch ist ein ganz anderer – vielleicht ein höherer.
1 Burckhardt, Weltgeschichtl. Betrachtungen (1868–1871, 1905), Stuttgart 1978, S. 209. – Vgl. auch Kants Rezension zu Herders Ideen zur Philos. der Gesch. der Menschheit (1784), die »nicht etwa eine logische Pünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe« sei, sondern ein »viel umfassender Blick, eine in Auffindung von Analogien fertige Sagazität (…) die, als Wirkungen von einem großen Gehalte der Gedanken, oder als vielbedeutende Winke, mehr von sich vermuten lassen, als kalte Beurteilung wohl gerade zu in denselben antreffen würde. Da indessen Freiheit im Denken (die hier in großem Maße angetroffen wird), von einem fruchtbaren Kopfe ausgeübt, immer Stoff zum Denken gibt, so wollen wir von den Ideen desselben (…) die wichtigsten und ihm eigentümlichsten auszuheben suchen«. Kant, Werkausgabe, Bd. 12, Frankfut a. M. 1977, S. 781.
Prämisse
Angenommen, es käme noch einmal ein großer Zweifel über Europa, gefolgt von einer neuen Begeisterung für die Ursprünge eigener kultureller Größe und Schönheit, und die Aufmerksamsten besännen sich ihrer Lage und dessen, was unsere schaurig-schöne Spezies aus einer einstmals bloß vorhandenen Natur hat werden lassen – wäre es dann nicht möglich, dass aus solchen Überlegungen eine Avantgarde der Widerständigen hervorginge, die sich dazu anspornte und befähigte, dem bisher Erreichten ganz andere Ziele entgegenzusetzen…?
So könnten in dreißig oder fünfzig Jahren erneut Zirkel herangewachsen sein, in denen man sich wieder der Unmittelbarkeit bewusst werden wollte, mit der das Leben den Menschen vor die Gesamtheit des Geschichtlichen stellt. Denn diese Unmittelbarkeit ist es, die uns an allen bisherigen Epochen gleichsam teilhaben lässt, insofern wir anschaulich denkende Wesen sind und allein diese Begabung uns davon abhalten sollte, dem jeweiligen Zeit-Raum auf Gedeih und Verderb verpflichtet zu bleiben. Sobald wir Vergangenheit nicht allein im Quantum ihrer Erfahrung begreifen, sondern als das Gesamte, das sich außerhalb unserer eigenen Erlebniswelt abspielt, verschmelzen Zeit und Raum zu identischen Kategorien und wir bekommen einen Sinn für die Gegenwärtigkeit aller Ereignisse, die sich jemals zugetragen haben, und von denen uns in gleicher Weise zu wissen möglich ist, wie von den entferntesten Regionen der Erde. – In diesem Sinne bietet Vergangenes oder besser: das Bild, welches wir von ihm in uns tragen, das gleiche Exil wie ein konkreter Ort in der Gegenwart: beides ermöglicht dem Menschen, sich den Zudringlichkeiten seiner direkten Umgebung eine Zeitlang zu entziehen.
Möglicherweise werden aus einem solchen geistigen Exil noch einmal Rudimente spätkulturellen Menschentums erwachen, denen die durch und durch industrialisierte Wirklichkeit geradezu widerwärtig geworden ist und die deshalb zu wissen verlangen, wann der Ausverkauf der Welt und die Vernichtung schöner Individualität ihren Anfang genommen haben, und warum eine Kultur, die einst das Höchste und Herrlichste erdachte, im Niedrigsten und Wertlosesten enden musste! Spätestens dann wäre es an der Zeit, endlich einmal ernsthaft nach der Würde des Menschen zu fragen, nämlich nach der Würde des Daseins in jener global übernetzten und banalisierten Welt, deren Vereinnahmungen und Komplexität niemand mehr entkommen kann, je weniger er sie zu begreifen vermag, und ob die sogenannte moderne Welt und Zivilisation für den freien, stolzen, schöpferischen Geist nicht zuletzt zu einer gravierenden Fehlentwicklung, ja zu einem einzigen Desaster geworden ist! Vielleicht werden dann einige Menschen, denen sich die versäumten Entfaltungsmöglichkeiten persönlicher Bildung auf einmal offenbaren, zu der Ansicht gelangen, dass ihr Zeitalter sie die grundfalschen Dinge gelehrt hat! Und plötzlich steigt in ihnen jene fürchterliche Gewissheit auf, nur deshalb an der Zivilisation ermüdet und erkrankt zu sein, weil der Zustand selber, in den sie über ihre Epoche hineinerzogen worden sind, der falsche ist! Daraufhin erinnern sie sich möglicherweise eines alten, kulturellen Trotzes, der ihnen rät, als wahrhaftige, als »freie, denkende Menschen« nicht dort stehenzubleiben, wo sie das Schicksal hingestellt hat, sondern ihrem innersten Wollen und Wesen zu folgen, ganz gleich, welche politischen oder technischen Wirklichkeiten gerade auf sie eindrängen!2 Und dann beginnen sie sich vielleicht wieder an jenen Visionen und Zielen zu erbauen, die einst von den Weisesten ersonnen worden waren, als es die Welt noch nicht zu kaufen gab. – Wohlan: schmiede also jeder für sich seine heilige Allianz mit den besten Kräften aus drei Jahrtausenden, und schlage mit den Waffen, die ihm daraus entstehen, jener Hydra der Zivilisation das eine oder andere Köpfchen ab; mögen ihr daraufhin auch noch so viele nachwachsen… Wissen wir doch längst, dass jeder Kampf gegen solche Ungeheuer ein vergeblicher ist – ja, dass jedes freie, selbstgestaltete Leben unter den Bedingungen der Zivilisation nichts als ein Anachronismus sein und folglich jedes geistige Tun nur noch um seiner selbst willen geschehen kann; weshalb allein dem Trotz die Ehre gebührt. Denn was ist, genaugenommen, das geistige Leben unter den Bedingungen der Zivilisation anderes als ein großes Trotzdem?
Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, ist, wie man sieht, lange her. Obwohl sie nur etwa ein Jahrhundert umfasste und erst seit gut hundertfünfzig Jahren hinter uns liegt, dürfte sie dem jetzigen Zeitalter derart ferngerückt, ja entrückt sein, so als habe sie niemals stattgefunden. Und doch handelt es sich bei diesem Ereignis um den wohl folgenreichsten Wendepunkt, der sich in der Kulturgeschichte unseres Kontinents jemals vollzogen hat. Wer die tieferen Gründe bestimmter Verhaltensweisen eines an sich selber leidenden Menschen aufschließen will, muss weit in dessen Werdegang hinabsteigen; er muss gewissermaßen nach dessen Traumata forschen. Es reicht nicht aus, danach zu fragen, was gestern oder vor wenigen Monaten geschehen war, sondern es ist zu fragen, was sich vor vielen Jahren und Jahrzehnten mit ihm ereignete, denn zumeist liegen die Ursachen einer mentalen Zerrüttung weit hinter dem ersten Auftreten ihrer Symptome zurück. Jeder reifere Mensch spiegelt im Umgang mit anderen und sich selber die Erfahrungen seiner Enttäuschungen wider. Ebenso verhält es sich mit Kollektiven wie Völkern und Kulturen: wer ernsthaft wissen will, warum sich, völkerpsychologisch betrachtet, Deutschland und Europa in eine heute kaum mehr zu leugnende »Persönlichkeitsstörung« hineinentwickelt haben, darf deren Anamnese nicht auf die letzten hundert Jahre beschränken. Oft sind die Wunden gar nicht mehr sichtbar, von denen jener untergründige Schmerz ausging, an dem der Organismus schließlich irrewerden sollte. Die Genese des Schmerzes war in Vergessenheit geraten, nachdem man begonnen hatte, die Symptome selber für deren Auslöser zu halten. Das deutlichste dieser Symptome, das heute gerne und nicht zu Unrecht als »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts und damit gewissermaßen als Anfang vom Ende Alteuropas bezeichnet wird, ist bekanntlich der große Krieg von 1914 bis 1945. Mochte sich der Kontinent von seinem totalen Zusammenbruch körperlich bald erholt haben, geistig blieb er, wie die Zukunft zeigte, unheilbar versehrt; denn das, was im 20. Jahrhundert zum Ausbruch kam, war sozusagen der »finale Blutsturz« einer lange und schwer an sich leidenden Kultur, deren wirr lächelnde Leichenbeschauer wir sind: sittlich von Grund auf veränderte Erben, denen es längst zur staatlichen Pflicht geworden ist, mittels der Restwärme des Kadavers neue Überlebensmodelle zu entwerfen.
Das hier zu erzählende Ereignis ist also das Ereignis eines Scheiterns – und zwar des vielleicht schwerwiegendsten Scheiterns der gesamten Ideengeschichte! Denn mit dem Versagen des klassischen Lebensentwurfs, seines Versagens am Menschen, war die historische Chance vertan, die anbrechende, sogenannte Moderne in geregelte, durch sichere Geschmacksurteile gefestigte Bahnen zu lenken, sie überhaupt zu hegen, ihr Schranken zu setzen und sie nicht sittlich, politisch, ästhetisch verkommen zu lassen. So zeigt sich am Scheitern der Idee des Humanismus vor allem die Schicksalskraft menschlicher Natur: seiner höhnend, schlug sie den hervorragenden Genius schöner Humanität immer wieder zurück in die Reihen evolutionärer Planmäßigkeit – und wurde schließlich Ursache so vieler darauffolgender Übel unserer hochbegabten, aber zutiefst ungenügsamen und deshalb schon so früh an sich selber leidenden und schließlich am eigenen Anspruch zerbrechenden Kultur.
Der Humanismus-Begriff umfasst die gesamte Weite menschlicher Möglichkeiten, hin zu einer formgebenden Sittlichkeit, deren Zweck die autonome Schönheit des Einzelnen ist. Herders Wort von der Humanität zielte ebenso darauf ab wie Schillers ästhetische Erziehung des Menschen oder die Sehnsucht nach dem sogenannten Original-Genie, dessen Natur von selber zur Entfaltung der eigenen Größe führt. Einzig um 1800 stand der Europäer an der Schwelle zu einer ästhetischen Versittlichung des Lebens, die ihm die höchstmöglichen ethischen Wertvorstellungen einer sinnlich zu erfassenden und geschmackvoll-harmonisch zu errichtenden Welt »schöner Individualität« als ideales und persönliches Entwicklungsziel anbot. – Freilich wurde dieser Vorschlag zur Grundveredelung des Menschen spätestens seit dem 20. Jahrhundert von den Mehrheiten rigoros verworfen und durch das eigene Beispiel zunichte gemacht; und so gibt es inzwischen keinen größeren Gegensatz zum Ideal des zur authentischen Schönheit gebildeten Menschen als den Repräsentanten und Vorreiter der heutigen Wirklichkeit.
Wie also kann ein denkendes und fühlendes Leben in diesem Spannungsfeld überhaupt möglich und erhaltenswert sein, sobald sich der Mensch dessen bewusst wird? Denn mit dem Eintritt in die sogenannte Moderne begann das große Ringen humanistischer Erfahrungen gegen den inneren Anti-Menschen, der als die Urgewalt primärer Natur aus einer an kultureller Übersättigung verödeten und erkrankten Spezies hervorgegangen war. Damit sollte der fürchterlichste Kampf beginnen, den das Menschentum gegen sich selber und alle seine Veredelungsabsichten je ausgetragen hat. Dieser Kampf wird solange andauern, bis die letzten Reste eines philosophisch-ästhetischen Selbsterhöhungsverlangens und die Sehnsucht nach natürlicher Schönheit abgestorben sind. Man findet sie schon heute nicht mehr, wo sich der Zivilisationsmensch erfolgreich in der Selbstabstumpfung übt und das alte, kulturelle Verlangen nach Verfeinerung jedem gleichsam ausgetrieben und weggezüchtet wird, damit die maschinelle Welt für ihn überhaupt zu ertragen ist.
Die weisesten und besonnensten Köpfe des 19. Jahrhunderts waren sich dagegen ausnahmslos einig in der inzwischen längst eingetroffenen Prophezeiung, dass »wir gänzlich in Barbarei versinken, wenn wir das Studium der Alten nicht in Ehren und Ansehen erhalten.«3 Man wusste: »Ohne die Schule der Alten wird eure Litteratur in gemeines Geschwätze und platte Philisterei ausarten.«4 Ferner konstatierte man: »Der Barbar und der neuamerikanische Bildungsmensch leben geschichtslos.«5 Doch je tiefgreifender sich dieser Prozess an uns vollzogen hat, desto vehementer weist unsere primäre Natur derlei Vorwürfe zurück. Denn wer würde die heute erreichte Welt grundsätzlich für verfehlt halten? – Nur Träumer und Phantasten.
Vielleicht lag es an dieser Dichotomie im abendländischen Wesen, dass seit Petrarca gerade vom Antiken eine so unwiderstehliche Anziehung auf die feinsinnigsten Gemüter ausging. Haben doch etliche Geistesmenschen ihr Leben einst den Alten geweiht! Nicht wenige sind dabei derart tief in die Sprachwelt der Griechen und Römer eingedrungen, dass sie darüber fast ihre eigene vergaßen – und dies gewissermaßen sogar für nötig hielten, um dem »Barbarischen« ihrer niederen nationalen Herkunft zu entwachsen. Besonders unter Deutschen und besonders zu jener Zeit, als unsere Nation kulturell und politisch zu sich selber fand, setzten die Alten ihr höchste Maßstäbe. Sie begründeten aber auch eine neue Identität, welche dazu befähigte, im Hellenischen das Eigene zu finden.6 Es waren die begabtesten und subtilsten Naturen, die im Abendland etwas vermissten, was allein im Altertum, allein in Hellas zu suchen wäre. Von ihnen, den zahllosen Jüngern der humanistischen Idee, auch von den vielen heute Vergessenen unter ihnen, wird im Folgenden die Rede sein. Denn die vergangene Größe deutscher Kultur entstand beinahe einzig aus der Begeisterung für die Vision einer sich am Altertum orientierenden Gesamtbildung des Menschen, den sogenannten humanistischen Studien. »Haben diese Studien weit schlimmere Zeiten, haben sie die Völkerwanderung und das ganze Mittelalter, haben sie den dreißigjährigen Krieg überdauert, in welchem fast gänzlich erloschen, sie dennoch bald wieder zu schöner Blüthe erstanden sind, so werden sie auch die Zeit der neuesten Wirren überdauern, denen selber sie, zumal für das zerrissene Deutsche Vaterland, ein heilsames Gegenmittel in der leider zu oft überhörten politischen Weisheit des Alterthums bieten können.«7
In gleicher Weise wie während des 20. Jahrhunderts die europäische Welthegemonie erlosch, schwand unter den europäischen Völkern auch der Sinn für die geistigen Voraussetzungen ihrer einstmaligen kulturellen Geltung.8 Und erst jetzt, nachdem uns die Anschauungserfahrungen des »klassischen« Europas verlorengegangen sind, um neuen Ausrichtungen Platz zu machen, ist es möglich geworden, sinnvoll und relativ vorbehaltlos über jene Ideale, Nöte und Sehnsüchte nachzudenken, die unserer wundersamen Kultur zum Verhängnis wurden. Denn erst dort, wo sich der tiefere Zusammenhang zwischen dem ehemaligen Selbstverständnis dieser Kultur, ihrem hochkomplexen Verhältnis zur eigenen Herkunft, zum Christentum, zum Orient und zur griechisch-römischen Antike dem kritischen Betrachter aufhellt, erklärt sich vielleicht auch die sonderbar bedrückende Geisteslage unserer Zeit – sowie der Grund dafür, warum diese kaum jemand bemerkt, geschweige denn ernsthaft darunter leidet.
Irgendwann erreicht jede Kultur, jeder Verband, ja jedes Milieu und sogar jede kleinste Gemeinschaft den Punkt, an dem es für sie nichts Wesentliches mehr zu sagen gibt, weil das, worüber Verständigung herrscht, längst ausgesprochen worden ist. Und für alles andere fehlt der Kultur, dem Verband, dem Milieu naturgemäß der hermeneutische Zugang. Denn das, was Gruppen zu Gruppen macht, setzt die Begrenzung dessen, worüber man sich zu verständigen hat, geradezu voraus. Die Sprechenden haben sich irgendwann buchstäblich auserzählt; sie haben alles, was ihnen an Mitteilung möglich ist, einander mitgeteilt und das zu Sagende damit verbraucht. Denn alles, was in seinem Zeitalter zu sagen wäre, hat der aufmerksame Mensch stagnierender Epochen irgendwann schon hundertmal gehört; und mit dem anderen, dem Unzeitgemäßen und Unausgesprochenen ist er allein. – Hierin finden wir eine Antwort auf die Frage, warum die Kulturen großer Erzählungen früher oder später sämtlich an sich selber ermüden und nach und nach ins große Gerede verfallen und eitles, selbstgefälliges Geschwätz, das Reden um des Redens und des Eindrucks willen, die bloße Rhetorik und das sophistische Kalkül an die Stelle echter, tiefer Gedanken und wesentlicher Mitteilungen treten. Gleiches lässt sich bereits bei den Kulturen der Spätantike beobachten: »Diese Zeiten standen auf der Wetterscheide zwischen der alten und der neuen Welt, sie selbst waren arm an produktiver Kraft und die Formen des Alterthums abgegriffen.«9 Wie lange ein solcher Zustand jedoch andauern kann, zeigt die byzantinische Periode, also das allmähliche Dahinvegetieren griechischer Poesie und Philosophie im Oströmischen Reich, bis zum Verlust Konstantinopels 1453: »in dieser zähen Unfruchtbarkeit spiegelt das Kaiserthum seine lange Verwesung ab.«10
Suchten wir im Altertum nach einem Zeitraum, der dem unsrigen am meisten ähnelte, so wären wir auf das 4./5./6. nachchristliche Jahrhundert verwiesen. Denn so wenig wie jene Epoche noch »antik« war, so wenig ist das mit unserem Säkulum anbrechende Weltalter in Europa noch »abendländisch«. Die frappierenden Parallelen beider Entwicklungszustände liegen auf der Hand. Und was 1883 der erst achtundzwanzigjährige Eduard Meyer mit dem luziden, an den Erfahrungen überbordender Zeitläufte geschulten Blick eines schon früh umfassend gebildeten Universalhistorikers zum Verlauf spätrömischer Lebenswirklichkeiten skizzierte, fand im 20. Jahrhundert sein spätabendländisches Pendant: »Nach einem langen, von den gewaltigsten Krisen begleiteten Zersetzungsprocess entsteht aus der Weltherrschaft der Republik das römische Kaiserreich, der grossartigste Staatsbau, den die Geschichte kennt. (…) Indessen unter seiner Herrschaft vollendet sich nur der Zersetzungsprocess der antiken Völker und des antiken Lebens. Alle Nationen sind vollkommen nivellirt; das nationale Leben erlischt, der Staat arbeitet als Maschine, deren Gang von der Regierung geordnet wird, während die Masse der Unterthanen nirgends in ihn eingreift und alles Interesse am staatlichen Leben verliert. (…) Alle Anschauungen sind ausgelebt, der ganze Kreis der Ideen ist durchmessen, die religiösen Vorstellungen der früheren Zeiten sind sinnlos geworden und genügen niemandem mehr, die Philosophie, welche zeitweilig an ihre Stelle getreten war, vermag auf die Dauer die Masse nicht zu befriedigen. (…) Der Unterschied der Denkweise des Orients und des Occidents, welcher lange geschlummert, bricht in tausend Gegensätzen hervor; überall sind die Völker bis in ihre untersten Tiefen hinein aufgeregt. Der schroffste Gegensatz führt auch die Katastrophe herbei. (…) Mit dem Siege der Germanen im Westen, der Araber im Osten endet die Geschichte des Alterthums.«11
Natürlich brachten Griechen und Römer dennoch weiterhin reichlich Menschen von Format hervor – so wie jede Generation die etwa gleiche Anzahl an Begabungen erzeugt, für diese jedoch jeweils andere Verwendungen bereithält –, und wie auch unsere Zeit natürlich ihre »Großen« hat; aber eben Menschen vom Schlage eines Iamblichos oder Proklos, jene mystifizierenden Neuplatoniker, die bereits jenseits echt philosophischen Denkens standen und den Keim des heraufziehenden Weltalters schon sämtlich in sich trugen; wie auch der im Staatsdienste stehende, pragmatisch-eklektische Philosoph, Rhetor und Aristoteles-Exeget Themistios, eine der »bedeutendsten Erscheinungen des an hervorragenden Männern reichen vierten Jahrhunderts«12, von dem das 19. Jahrhundert allerdings noch kaum Notiz nahm, weshalb Themistios weder in Tennemanns noch in Heinrich Ritters Philosophiegeschichte eigens behandelt wurde. Oder gewiefte Taktiker wie Libanios, der damals hochberühmte Rhetoriklehrer, Musterautor und »bedeutendste griechische Intellektuelle des vierten Jahrhunderts«13, der als glücklichster Repräsentant jener immer wiederkehrenden Zustände gelten darf, in denen der geschickte, anpassungsfreudige Redner die Aufmerksamkeit und Gunst seiner Zeitgenossen auf sich zieht, weil er von klein auf gelernt hat, wie man sich seinen Platz verschafft, den jeweils Mächtigen, selbst als Kritiker, schmeichelt und ihnen, wie sich selber, den Anschein von Wichtigkeit verleiht, obwohl niemand mehr etwas wirklich Bedeutendes zu sagen oder zu tun weiß. – Das gleiche Schicksal dürfte den heutigen philosophischen und literarischen Rhetoren beschieden sein, die mit nämlicher Notwendigkeit bloß für den Tag schreiben, mit der auch Leute wie Themistios oder Libanios um ihren sicheren Aufenthaltsort im Bestehenden besorgt waren. – Doch welchen Wert hatte ihr Tun über sich selber und ihre Zeit hinaus?
Das 4./5. Jahrhundert sowie das derzeit beginnende Weltalter: das sind die langen Epochen der Meister des großen, mitunter klugen Geredes, in das jeder, der von sich reden machen will, mit einstimmen muss, um selber Gesprächsstoff zu werden und zu bleiben und sich dadurch in Erinnerung zu halten. Philosophiehistoriker des 19. Jahrhunderts rätselten über »jenen merkwürdigen Verfall der Staaten, Sitten, Wissenschaften und Künste, der während der ersten fünf bis sechs Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung in den kultivirtesten Ländern Europa’s (…) in seiner ganzen Größe eintrat und natürlich auch die Philosophie und deren Studium in das allgemeine Verderben hinabzog.«14 Ähnlich wird man vielleicht schon in ein paar Jahrzehnten über das rasante Erlöschen des Interesses an den großen Fragen geschichtlicher Verläufe sowie den Abstieg der Philosophie in die völlige Bedeutungslosigkeit zu Beginn des dritten Jahrtausends rätseln. Im 19. Jahrhundert sah man in jenem langsamen Ausklingen der Alten Welt zugleich den Beginn der »entartenden philosophischen Thätigkeit« und »den gänzlichen Verderb der Eigenthümlichkeit des philosophischen Denkens«15, den »Verfall alternder Völker und eine einbrechende Barbarei (…). Denn an die Stelle der Griechen war kein anderes Volk getreten, welches mit gleichem Eifer den Wissenschaften überhaupt und der Philosophie im Besonderen sich gewidmet hätte«.16
Im 3. und 4. Jahrhundert löste der Glaube an den einen, »Erlösung« sowie das »ewige Leben« versprechenden christlichen Gott mittels seiner expandierenden Kirche beinahe die gleiche faszinierende, lebenserneuernde und bewusstseinsverändernde Sogkraft aus wie heute die digitale Technik mit all ihren Auswirkungen auf das menschliche Selbstverständnis und Verhalten. Ähnlich den Wandlungen im späten 20. Jahrhundert war auf den Skeptizismus ein neuer Dogmatismus gefolgt, auf die Philosophie die Religion, der Glaube als tragendes Element. Man spürte und wusste, dass das antike, heidnische Zeitalter definitiv zu Ende ging, so wie man heute um die gesellschaftlichen und mentalen Folgen derzeitiger Verwerfungen weiß. »Dieses ganze bunte Treiben bewegte sich zwischen den herrlichsten Denkmälern der Welt, in welchen die edelste Form und die größten geschichtlichen Erinnerungen sich zu einer unaussprechlichen Wirkung vereinigten. Wir wissen nicht mehr, was diese Werke dem Sophisten des vierten Jahrhunderts und seinen Schülern sein mochten. Es war die Zeit, da dem griechischen Geist ein Lebensinteresse nach dem andern abstarb, bis auf die begriffspaltende Dialektik und das todte Sammeln. (…) Das Jahrhundert war ausgegangen, sich eine neue Heimath für seine Gedanken und Gefühle zu suchen.«17
Es ist also ratsam und lohnend, sich seinen politischen und weltgeschichtlichen Blick für die heutige Wirklichkeit an den Verhältnissen der Spätantike zu schärfen und zu schulen. Das 4. Jahrhundert, in dem mit so vielen antiken Traditionen endgültig gebrochen worden war, verdeutlicht wie kaum eine andere Epoche die Dynamik sich neu generierender Lebensentwürfe, die nur allzu oft dem gleichen Muster folgt. Es war eine Herrschaftsform entstanden, die »mit allen ihren politischen Institutionen und der auf ihnen beruhenden allgemeinen Civilisation, die Schranken des Nationalbewusstseins durchbrochen und so Vieles aufgehoben hätte, was die Völker in ihren gegenseitigen Verhältnissen nicht blos äusserlich, sondern weit mehr innerlich von einander trennte. Der Universalismus des Christenthums hätte nie in das allgemeine Bewusstsein der Völker übergehen können, wenn er nicht den politischen Universalismus zu seiner Vorstufe gehabt hätte«.18 Im 4. Jahrhundert fand der Übergang vom heidnischen zum christlichen, vom antiken zum abendländischen Bewusstsein statt, so wie sich im 20. Jahrhundert der Übergang vom kulturellen zum zivilisationellen Bewusstsein vollzog. Es gibt in der gesamten Menschheitsgeschichte keine bedeutungsschwereren Mutationen des Geistes als in diesen beiden wandlungsintensiven Brückenjahrhunderten, die von einem Weltalter in ein anderes führten. Das 4. Jahrhundert war das Zeitalter Konstantins (280–337), des Ausklangs der heidnischen Philosophie und Literatur, das der Zerstörung des Serapeums von Alexandria (391) und das der Teilung des Römischen Reiches (395), welches so unterschiedliche Charaktere hervorbrachte wie den Verfasser der ersten Kirchengeschichte, Eusebius (ca. 260–340), den wundergläubigen Neuplatoniker Iamblichos (ca. 245–325), die kluge Mathematikerin Hypatia (ca. 355–415), den geschickten Rhetor Libanios (ca. 314–395), den Kirchenvater Augustinus (354–430) oder die Ausnahmegestalt Julianus (331–363): jenen Kaiser also, der sich, wenngleich völlig vergeblich, als einer der ganz wenigen Machtmenschen den heranrollenden Tendenzen entgegenzustemmen versucht hatte. Das hellenische Erziehungsideal, die Ephebie, war damals bereits »völlig abgestorben«, die meisten antiken Tempel standen verödet, ihrer einstigen Bedeutung beraubt, und 393 enden die Agone in Olympia. – »Aber noch immer war die große, seit langem fast einzige Bildungsmacht die Rhetorik.«19 Daher lernte man, nolens volens, sich zu arrangieren, »ist doch auch die Philosophie dieser Zeit nichts weiter als moralische Technik!«20 Wozu also jetzt noch eilen, wenn die Tendenz selber für ihre Durchsetzung sorgt! Erst im Jahre 529 werden die letzten Philosophenschulen zu Athen endgültig geschlossen und nunmehr alle Lehren griechischer Weltsicht durch Edikte des Kaisers Justinian verboten, weil erst »nachdem dieser Herd zerstört war, der Hellenismus als erloschen betrachtet werden konnte.«21 Langsam aber stetig verschwand das unchristliche, antike Gedankengut aus dem allgemeinen Bewusstsein, wie sich heute der Sinn für alles vorindustrielle Fühlen und Wollen verliert, der Mensch längst das Produkt seiner zivilgesellschaftlichen Dogmen und technischen Lebensanforderungen geworden ist. – Außerdem war diese Epoche, wie heute, eine Zeit der folgenschwersten Völkerwanderungen.
Trotz allem aber erwachte die versunkene hellenische Welt noch mehrere Male im Abendland, wo sie schließlich sogar das Fundament einer bis dahin unerreichten Menschenbildung legte, deren beachtlichstes und folgenreichstes Erzeugnis vielleicht die Geburt jenes spezifisch deutschen Denkens und Wollens war, das in bewusster Anlehnung an die als geistesverwandt empfundenen Hellenen22 im künstlerisch-kulturellen Sinne die wohl schönsten und größten Ziele entwarf, welche sich menschlicher Geist jemals gesetzt hatte. Wollen wir jenes Ereignis verstehen, so kommt es nicht darauf an, was der heutige »Forschungsstand« besser zu wissen meint; da dieser doch in dreißig oder fünfzig Jahren schon wieder einem ganz anderen, dem dann herrschenden Zeitgeist angepasst sein wird.23 Vielmehr sollten wir nachzuempfinden versuchen, wie damals gedacht und gefühlt worden sein musste, damit aus der Vereinigung zwischen Faust und Helena ein derart prächtiges Geschöpf wie der deutsche Humanismus überhaupt hatte gezeugt werden können. Dazu war der leidenschaftlich-exemplarische Umgang mit denjenigen Überresten der Alten nötig, »die in Form und Inhalt, in Gedanken und Vortrag ewige Muster alles Denkens und aller Rede sind. Diesen Werth legt ihnen das übereinstimmende Zeugniss der einsichtsvollsten Menschen aller Zeiten bei, und nennt sie classisch.«24
Nun gehört es zu den merkwürdigsten historischen Erfahrungen, dass jeder Kulturnation offenbar jeweils nur eine Klassik beschieden ist, in der sie ihr Bestes zur Blüte bringt. Die Kultur muss quasi reif dafür sein, damit die Begabungen der jeweiligen Zeit ihr Genie entfalten und zu »Klassikern« avancieren können. – Doch wie »weit entfernt sind diese Anfänge von der Vorstellung der Einen Menschheit, die alle Völker umfaßt, des Einen Reiches, das nicht von dieser Welt ist, – jener Vorstellung, die ihren vollendeten Ausdruck in der Erscheinung des Heilandes gewinnt. Das ist der Punkt, zu dem hin die Entwickelung der alten, der heidnischen Welt strebt, von dem aus ihre Geschichte begriffen werden muß. Es gilt jene Sonderungen zu überwinden, über jene localen, natürlichen Bestimmungen sich hinauszuarbeiten, an die Stelle der nationalen Entwickelung die persönliche und damit die allgemein menschliche zu gewinnen. Das Höchste, was das Alterthum aus eigener Kraft zu erreichen vermocht hat, ist der Untergang des Heidenthums.«25 – Diese berühmt gewordene Behauptung stellte Johann Gustav Droysen 1843 auf, als sich kaum noch leugnen ließ, dass der schöne Traum einer geistig-kulturellen Erneuerung Deutschlands und Europas durch Wiederaneignung altgriechischer Lebensart unerfüllt bleiben müsse. Und es faszinierte ihn die Epoche des sich verausgabenden Griechentums, die er mit dem freilich merkwürdigen, zunächst allerlei Kritik und Spott hervorrufenden Begriff Hellenismus26 benannte, nicht zuletzt deshalb so sehr, weil es Gründe genug gab, aus dem, was uns die letzten vorchristlichen Jahrhunderte überliefern, manche Verwandtschaft zur eigenen Zeit, zum späten Abendland herauszulesen.
Eine solche, irgendwann notwendig einsetzende Kulturkritik bringt oft solange neue Erträge subversiven Schöpfertums hervor, wie dieser Prozess anhält. Hat auch er sich aber erschöpft, folgt auf das genialische, originelle, kreative Schaffen echter, eigenständiger Werke die nicht minder intellektuelle Phase des Konservierens und Erforschens, die Zeit der Grammatiker, Archivare, der kritischen Sammler und Deuter, der Dozenten und Verwalter des Geschaffenen, kurz: die Zeit der Verwissenschaftlichung des Lebens. Und vielleicht war es gerade jene Abkehr von der einstigen Erfahrungs- und Erlebnisintensität produktiver Kulturkritik, die dem Menschen der heutigen Zivilisation glauben macht, dass die größte, jemals vom Abendland selber erbrachte Leistung in der Überwindung des Kulturellen samt seiner Nationalstaaten und eigentümlichen Charaktere bestehe. Insofern betreibt Wissenschaft um ihrer selbst willen tatsächlich eine Art »Weltvernichtung«. – Zu beantworten oder wenigstens aufzuwerfen wäre daher die vielleicht elementarste Frage unserer Zeit, nämlich warum der heutige, postkulturelle Europäer als die Eigenheit, die er einst darstellte, nunmehr nur noch von sich weg will, um als bloßer »Mensch unter Menschen« in der Welt aufzugehen.
Nun kennt die Geschichte freilich manche Eruptionen. Und nichts, nicht einmal die gewaltige Roma aeterna währte ewig. Darum dürfte wohl auch die heutige Wirklichkeit, trotz ihres schamlosen Ausgreifens in alle Winkel der Erde, auf keinem Gebiet das letzte Wort gesprochen haben, sondern, in weiten Zeiträumen gedacht, ebenso vergänglich und überwindbar sein wie alle Epochen zuvor. Bis dahin aber gilt es, sich absichtsvoll an jene Weltalter zu erinnern, deren kulturelle Leistungen großer, freier, wahrhaft gebildeter Menschen uns Nachgeborenen, die wir unter einem schrecklichen Versäumnis und infolgedessen unter einer kaum bemerkten geistigen Verwahrlosung leiden, weiterhin Trost zu spenden vermögen. »Die Welt mag noch so düster sein: setzt man plötzlich ein Stück hellenischen Lebens hinein, so hellt sie sich auf.« Die Hellenen nämlich »verklären die Geschichte des Alterthums und sind recht eigentlich ein Zufluchtsort für jeden ernsten Menschen.«27
Das Abendland suchte und fand den Weg zu seiner Vollendung, indem es sich an der klassischen Antike bildete. – Sollte also in ferner Zukunft ein solches Bedürfnis nach einem höheren Menschentum noch einmal irgendwo in Europa erwachen, wäre es keineswegs ausgeschlossen, dass der Erinnerung an das vergangene Abendland dann die gleiche befruchtende und kulturell stimulierende Bedeutung und Aufgabe zufiele wie einst der Antike, als diese dem Abendland herrlichster Wegweiser war.
Denn freilich hätte es eine deutsche Klassik ohne die geistige Bindung an das ferne und fremde Altertum aus gefühlter Verwandtschaft niemals gegeben. Und eben deshalb hatten es die Deutschen nötig, sich ausgerechnet für Hellas zu begeistern, um im 18./19. Jahrhundert endlich zu ihrer eigenen, speziellen Form der Hochkultur zu gelangen! Immerhin galt für die Charakterbildung der Deutschen, was sonst nur für die Hellenen galt: »Schwerlich hat je ein Volk mehr Contraste in sich vereinigt, schwerlich aber auch eine vielseitigere Ausbildung errungen.«28 Erst das Griechentum gab den Deutschen einen Begriff von ihrem eigenen Genius. Denn alles, was wir heute unter »deutscher Klassik« verstehen und an ihr bewundern, wäre ohne den Enthusiasmus für die (griechische) Antike gar nie zustande gekommen. Ohne das Altertum gäbe es überhaupt kein »Abendland«, ja nicht einmal ein Christentum. Wer also den Gang der deutschen und europäischen Kultur verstehen will, bis hin zu ihren gegenwärtigen Symptomen absichtlicher Selbstauslöschung, jener schon vor sechzig Jahren bemerkten »Selbstpreisgabe des Okzidents«29, muss zuvor ihr Verhältnis zum Altertum verstanden haben! Denn eben dort ist nach den Ursachen der Pathogenese des heutigen Europas zu suchen.
Zwar dürfte niemandem in seiner Not dadurch geholfen sein, dass man ihm die Genese oder die Determination dieser Not zu erklären versucht. Wer die Agonie Alteuropas, das Pathologische der spätabendländischen Kultur überhaupt noch als Not empfindet, nachdem jedes Verständnis für die Sorge um den Bestand kultureller Erbschaften dem allgemeinen Bewusstsein entschwunden ist, wird durch die spekulative Herleitung dieses Vorganges das Schicksal unseres Kontinents nicht besser ertragen lernen. – Und doch scheint es erforderlich, nach den tieferen Gründen auch der unabwendbarsten Sache zu forschen, um ihr nicht gänzlich hilflos und unwissend gegenüberzustehen; man sollte sich also wenigstens bemühen, den hochkomplexen Kausalnexus kultureller Entwicklungsprozesse seiner Natur nach zu verstehen.
2 »Eine solche sklavische Hingebung an die Launen des Tyrannen Schicksal, ist nun freilich eines freien, denkenden Menschen höchst unwürdig. Ein freier denkender Mensch bleibt da nicht stehen, wo der Zufall ihn hinstößt«. Heinrich v. Kleist an seine Halbschwester Ulrike, im Mai 1799.
3 Niebuhr, Vorträge über römische Alterthümer, an der Universität zu Bonn gehalten (1825–1830), Hrsg. von M. Isler, Berlin 1858, S. 23.
4 Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, Bd. 2, Leipzig 1844, S. 124.
5 Jacob Burckhardt, Historische Fragmente, Stuttgart 1957, S. 3.
6 »Among our subjects, there is a preponderance of Germans, and the reasons is not far to seek. The modern historical-philological study and classical antiquity, the modern conception of Altertumswissenschaft, is a German invention.« Briggs/Calder III, Classical Scholarship, New York 1990, S. X. – Und weil es hier vor allem um die Darstellung jener deutschen Eigenart und Identitätsfindung geht, werden im Folgenden, unter Berücksichtigung weniger Ausnahmen, allein deutschsprachige Texte herangezogen, und die vielen lateinischen Abhandlungen, aber auch größere Werke und fleißig zusammengetragene Materialsammlungen, welche oft die Grundlagen späterer Literatur- oder Philosophiegeschichten der Griechen bildeten, wie etwa die ab 1705 (3. Aufl. 1718–1728, 14 Bde.; zuletzt 1790–1809) herausgegebene Bibliotheca graeca des Johann Albert Fabricius, oder Johann Jakob Bruckers Historia critica philosophiae, 1742ff. (2. Aufl. 1766f., 6 Bde.) sowie dessen Institutiones historiae philosophicae (1747 u. ö.) zumeist stillschweigend übergangen.
7 August Boeckh, Von d. Philologie, besonders d. klass. in Beziehung zur morgenländischen, zum Unterricht u. zur Gegenwart; Rede vom 30.09.1850, in: Böckhs Gesam. Kl. Schriften, Bd. 2: Reden, hrsg. v. F. Ascherson, Leipzig 1859, S. 198f.
8 Dessen war man sich spätestens seit den 1950er Jahren völlig klargeworden: »Niemand (…) wird darüber im Zweifel sein, daß wir heute an einer entscheidenden Wende angelangt sind. Die Durchdringung der Welt mit europäischem Geiste ist zu Ende, wir sehen heute die Wellen, die einst von Europa ausgingen, wieder zurückfluten. Die Emanzipation der arabischen Welt (…) ist in unseren Tagen in vollem Gange, ja zu einem großen Teil bereits vollendet.« Hermann Bengtson, Niebuhr u. die Idee d. Universalgesch. d. Altertums, Vortrag, Würzburg 1960, S. 20. Vgl. auch Joseph Vogt, Geschichte d. Altertums u. Universalgesch., Wiesbaden 1957, S. 4 u. 21: »Heute hat die Idee der Welteinheit die Menschen aller Völker und Zonen so tief ergriffen«, und es herrsche »der entschiedene Wille, nach den politischen Katastrophen und den geistigen Zusammenbrüchen uns in einer die ganze Menschheit umfassenden geschichtlichen Welt neu zu orientieren.«
9 Gottfried Bernhardy, Grundriss d. Griech. Litteratur, Bd. 1, Halle ²1852, S. 549.
10 Bernhardy, ebd., S. 574. Vgl. ders., Grundriss d. Griech. Litt., 1876, S. 681: »Im Gegensatz zu den Völkern der Abendlandes, welche mit frischer und reger Kraft ihre Nationalität gestalten durften, siecht daher der Byzantinische Staat leblos und vereinsamt; auch in der zähen Unfruchtbarkeit der Litteratur bezeugt das Kaiserthum seine lange Verwesung.« Ferner: Wilhelm Wachsmuth, Allgem. Culturgesch., Bd. 1, Leipzig 1850, S. 492: »Das Fortbestehen des byzantinischen Reichs bis gegen Ende des Mittelalters ist eine langsame Auszehrung, die ohne irgend eine Auffrischung oder Verjüngung der Lebenskraft des Staatskörpers den ungestümsten Angriffen äußerer Feinde und dem Verfall und der Auflösung im Innern ein Jahrtausend hindurch zähen Widerstand zu leisten vermogte.«
11 Meyer, Gesch. des Alterthums, Bd. 1, 1884, S. 23f. – »Das Buch wirkte bahnbrechend, denn es war das erste Mal, daß ein Historiker, der die kritische Methode auf dem Gebiet der klassischen Historie erlernt hatte, die Orientalische Geschichte auf Grund eigenster Forschungen durchgearbeitet hatte.« U. Wilcken, Gedächtnisrede (1930), in: H. Marohl, Meyer, Bibliographie, Stuttgart 1941, S. 120.
12 Friedr. Ueberweg, Grundriss d. Gesch. d. Phil., Darmstadt 1967 (1925), S. 657.
13 Rene Pfeilschifter, Die Spätantike, München 2014, S. 91. Theodor Mommsen dagegen meinte, Libanios sei »mehr bekannt als bedeutend« gewesen. Mommsen, Röm. Geschichte, Bd. 5, Berlin 1894 (1885), S. 461.
14 Wilhelm T. Krug’s Gesch. d. Philos. alter Zeit, Leipzig ²1827 (1815), S. 29f.
15 Ernst Reinhold, Lehrbuch d. Gesch. d. Philosophie, Jena ³1849 (1836), S. 180.
16 Heinrich Ritter, Gesch. der christl. Philosophie, Bd. 1, Hamburg 1841, S. 5f.
17 Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantin’s des Großen, Basel 1853, S. 501f.
18 Ferdinand Christian Baur, Das Christenthum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte, Tübingen 1853, S. 5.
19 Albin Lesky, Gesch. der griechischen Literatur, München 1993 (1971), S. 972.
20 Hermann’s Culturgeschich. d. Griechen u. Römer, Bd. 1, Göttingen 1857, S. 242.
21 Ernst von Lasaulx, Der Untergang des Hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter durch die christlichen Kaiser, München 1854, S. 143.
22 Max Wegner sprach sogar noch 1955 von einer »blutbedingten Geistesverwandtschaft«; Wegner, Land der Griechen, Berlin 1955, S. 276.
23 Hier ein bezeichnendes Beispiel für die Umdeutung und »Modernisierung« der Sichtweisen: während in der Platon-Monographie von Gottfried Martin (Rowohlt 1969) kein Altertumswissenschaftler und Platon-Kenner so oft genannt wird wie Wilamowitz-Moellendorff, nämlich passim auf 15 Seiten, kommt der Name in der modifizierten Ausgabe von Uwe Neumann (2001) kein einziges Mal mehr vor!
24 Friedr. Creuzer, Das akadem. Studium d. Alterthums, Heidelberg 1807, S. 4f.
25 Droysen, Gesch. d. Hellenismus, Bd. 2, Hamburg 1843, S. 7. Auch O. Marbach, Gesch. d. Griech. Philosophie, Leipzig 1838, S. 287: »Roms tiefste Bedeutung ist es das Grab Griechenlands und die Wiege der christlichen Welt zu sein.«
26 Vgl. Wilfried Nippel, J. G. Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik, München 2008, S. 33.
27 Nietzsche, Einleitung in das Studium der classischen Philologie (1871), in: Nietzsche, Gesammelte Werke, Bd. 2, München 1920, S. 365.
28 P. F. Kanngiesser, Die alte komische Bühne in Athen, Breslau 1817, S. 498.
29 »Das Problem, wie der griechische Geist in diesen verschiedenen Aspekten bis auf den heutigen Tag weiterwirkt, ist nahezu unübersehbar. Selbst die Situation der gegenwärtigen Jahre, das erstaunliche und bestürzende Zusammentreffen einer ungebrochenen Attraktionskraft des okzidentalen Denkens und Lebens auf die fremden Völker mit der tiefsten innern Unsicherheit, ja Selbstpreisgabe des Okzidents selbst, beruht zum größten Teil auf Voraussetzungen, die uns von den Griechen überkommen sind.« Olof Gigon, Das hellenische Erbe, in: Propyläen Weltgeschichte, Bd. 3, Berlin 1991 (1962), S. 576.
Heranführung
Im Herbst eines ungenannten Jahres, irgendwann zwischen 1921 und 1925, machen sich zehn bis zwölf junge Männer, wahrscheinlich von Potsdam aus, auf den Weg nach Griechenland. Sie haben alle eine humanistische Schulbildung genossen, sind um die fünfundzwanzig Jahre alt, eher etwas jünger, und was sie treibt, ist ihre Sehnsucht nach dem Süden, die eine Sehnsucht nach den eigenen geistigen Wurzeln ist. »Humanismus und Christentum sind die beiden Werte, um deren Erkenntnis es uns vor allem ging.«30 Denn: »An den Quellen seiner Kultur lernt er«, der Deutsche, »sich selber neu begreifen.« Sie tragen Fahrtenhemd und Halstuch, Tornister, Brotbeutel und mit Nägeln beschlagene Schnürstiefel, führen einen Wimpel mit sich. Es sind Angehörige des Bundes Deutscher Neupfadfinder,31 einer Abspaltung des Deutschen Pfadfinderbundes. Einige von ihnen dürften am Weltkrieg teilgenommen haben. Junge, angehende Philologen, Germanisten, Historiker oder Theologen. Wohl alle verfügen über ausgeprägte Kenntnisse des Altgriechischen, mancher versteht auch Neugriechisch. »Aufgewachsen in einer Zeit kultureller Unsicherheit«, sind sie »früh mit dem Hellas des Deutschen bekannt geworden.« Nun wollen sie den Boden dieser »geistigen Macht« selber kennenlernen, das »Stück geistiger Heimat«, an das sie mit »unbedingter Hingabe« gebunden sind, erleben; die Luft atmen, die Aura erspüren, in der es geschehen konnte, »daß die Griechen so tief eindrangen in die Geheimnisse des Lebens. Sie lebten in wirklicher Unmittelbarkeit zu einander und zu den Mächten, die sie über sich spürten.«32 Ein ehrliches Pathos führt die Reisenden dabei an: »Nach Hellas! (…) Heimat des Geistes! Dich lieben wir um der Schönheit deiner Werke, um deiner reinen Natur willen, die köstlich und herbe zugleich, noch einsam ist wie das trauernde Große. Dich ehren wir um deiner Menschen willen, die um Höchstes gekämpft und Höchstes erreicht haben – ein Menschenbild, so ewig gültig und stark: darum ringen auch wir.«33
Solche Zeugnisse tiefer Sehnsucht und Suche nach imaginierten Welten geistiger Herkunft sind Ausdruck jener schöpferischen Empfindung, die in Deutschland mehr als hundertfünfzig Jahre lang weit über das Bildungsbürgertum hinaus geschmacks- und meinungsprägend war. Um 1900 gaben weltscheue Dichter diesem allmählich verblassenden Gefühl noch einmal einen trotzig-heiter-melancholischen Klang, in dem das gesamte Motivreservoir spät- oder neuromantischer Graecophilie mitschwang: »Eine kleine schar zieht stille bahnen / Stolz entfernt vom wirkenden getriebe / Und als losung steht auf ihren fahnen: / Hellas ewig unsre liebe.«34 Andere, wie Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, sprachen zur gleichen Zeit das längst Offenkundige unumwunden aus: »Die Antike als Ideal und Einheit ist dahin; die Wissenschaft selbst hat diesen Glauben zerstört«.35 Inzwischen nämlich konnte niemand mehr leugnen, dass der »unhistorischen Idealisierung des deutschem Wesen so nahe verwandten Griechenvolkes (…) durch die eindringenden geschichtlichen Forschungen der letzten Jahrzehnte gründlich ein Ende gemacht worden«36 war. Dennoch blieb bei vielen ein tiefer Schmerz und Kummer zurück, dessen treibende Ursache gerade in seiner Unerklärbarkeit lag. Am deutlichsten hatte einst wohl Friedrich Hölderlin dieses Mysterium ausgesprochen: »Was ist es, das / An die alten seeligen Küsten / Mich fesselt, daß ich mehr noch / Sie liebe, als mein Vaterland?«37 Oder wenn er bekannte: »Griechenland war meine erste Liebe und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, es werde meine letzte sein.«38 Jedenfalls gehört es zu den markantesten, aber oft unterschätzten Umständen deutscher Nationswerdung, dass das deutsche Bildungsbürgertum seine geistige Heimat nicht im eigenen Land, ja nicht einmal in der eigenen Geschichte, sondern in den fremden Regionen und Kulturen des fernen Altertums verortete. »In Hellas liegen die Wurzeln unserer besten Bildung: wir würden unendlich verarmen, wenn wir den Zusammenhang mit dieser unserer geistigen Heimat jemals sich lockern ließen.«39
Im frühen 20. Jahrhundert endlich wuchsen die Bemühungen, jenes alte, leidenschaftliche Verlangen als bloßen Wahn zu begreifen: »Es wird mir immer deutlicher«, notierte Oswald Spengler, »daß eines der tiefsten Rätsel der abendl. Seele, ihr Schlüssel vielleicht, diese ungerechte Liebe zur Antike ist. Ich teile sie mehr, als die meisten andren nur ahnen können. Wie oft stand ich bis zum Weinen erschüttert vor einer unbedeutenden Ruine! Und trotzdem, welch ein Unsinn ist diese Liebe! Welche andre Kultur hat je etwas Ähnliches durchlebt? Und es ist nur die Antike, nicht Ägypten, nicht Indien, das wir lieben. Und um gerecht zu sein, ist es nicht einmal die Antike, sondern ein Wahnbild, das wir aus allem zusammengestellt haben, was uns fehlt.«40 Im Untergang des Abendlandes las sich der gleiche Gedanke 1918 dann so: »wir haben in unser Bild von den Griechen und Römern jedesmal das hineingelegt, hineingefühlt, was wir in der Tiefe der eignen Seele entbehrten oder erhofften. Eines Tages wird uns ein geistreicher Psychologe die Geschichte dieser verhängnisvollsten Illusion, die Geschichte dessen, was wir seit den Tagen der Gotik jedesmal als antik verehrt haben, erzählen.«41
Obwohl damit, scharfsinnig und prägnant, ein Kulturproblem ersten Ranges angesprochen worden war, scheint das Phänomen als solches bis heute unverstanden geblieben zu sein; ja, man hat es bisher nicht einmal gründlich zu durchdringen versucht, weil es den meisten Beobachtern von vornherein als kuriose Grille schwärmerisch übersteuerter Schöngeister galt. Man blickte etwa auf Winckelmann, Herder, Goethe, Hölderlin, Wilhelm von Humboldt, verwundert darüber, wie so viele einst aus bloß überlieferten Relikten, einem »Altertum aus dritter Hand«, das niemand in seiner wahren Gestalt zu erkennen vermochte, »herauslasen und heraussahen, was sie selber sehnsuchtsvoll, ihrer eigenen abendländisch-europäischen Vergangenheit müde und auch ein wenig unwahrhaftig gegen sich selbst, hineingelegt hatten.«42 Man verstand »das Ausmaß dieser Bezauberung« nicht, weil man nicht mehr nachvollziehen konnte, was diese Menschen einst umtrieb, und blickte auf das Mirakel deutscher Kultur wie einst die Franzosen, denen Heinrich Heine das Wesen der Deutschen nahezubringen versuchte: »Denn die Erzeugnisse unserer schönen Literatur bleiben für sie nur stumme Blumen, der ganze deutsche Gedanke bleibt für sie ein unwirtliches Rätsel, solange sie die Bedeutung der Religion und der Philosophie in Deutschland nicht kennen.«43 Also fragte man auch hierzulande bald nicht mehr nach den tieferen Gründen jener Sehnsucht, sondern beließ es bei dem Eingeständnis, dass »die ganze deutsche Griechenbegeisterung ein historisches Unikum und durchaus noch nicht befriedigend gedeutet« sei, denn ihr wohne »insgesamt etwas Rätselhaftes«44 inne.
Und dieses Rätsel klingt schon in seinem Wortlaut zu fremd und zu fern, als dass man sich der Mühe unterziehen wollte, es überhaupt ernst zu nehmen, es genauer zu betrachten oder gar zu lösen. Vielleicht fühlte man sich von Anfang an gar nicht mehr berufen dazu, weil der legendäre ἱεϱὸς γάμος, der »heilige Ehebund« zwischen Griechentum und Deutschtum, zwischen Hellas und Germanien, von dem Jacob Burckhardt einst weihevoll sprach45, und der bei den Griechen als die Verbindung des Himmels mit der Erde gerühmt wurde, längst wieder gelöst war, noch bevor er überhaupt fester geschlossen werden konnte.46 Zuvor war Wilhelm von Humboldt der Überzeugung gewesen, dass »Griechischer Geist auf Deutschen geimpft, erst das giebt, worin die Menschheit, ohne Stillstand, vorschreiten kann.«47 Damit war natürlich ein Fortschritt im Sinne der Humanisierung des Menschen gemeint, wie er dann doch nicht stattfand, sondern, sich vielmehr in sein Gegenteil verkehrend, als Animalisierung des Menschen heute größte Triumphe feiert, weil er im weltverschlingenden, auf seine Urbedürfnisse zurückgeworfenen »Verbraucher« global erreicht worden ist.
Was und wie die Alten wirklich dachten, was sie meinten und wollten, ließ sich seit »Wiederherstellung der Wissenschaften« im 15. Jahrhundert freilich nie und lässt sich heute weniger denn je konkret erfassen oder nachbilden. Zu fern liegen ihre Welten, zu wenig ist uns daraus überkommen, zu schwierig gestaltet sich das Eindringen in ihre Sprachen, wollten wir sie ihrem Wesen nach tatsächlich »verstehen«. Nicht, was die Alten einst sagten, sondern wie sie später verstanden wurden, darauf kommt es an! Denn keine philologische Akribie war je imstande, den originalen Urtext eines antiken Autors derart zu rekonstruieren, dass er von allen späteren Konjekturen frei gewesen wäre. Sind doch sämtliche Texte, die uns heute zur Verfügung stehen, das Ergebnis bestimmter Lesarten, die in zahlreichen Philologen-Generationen, je nach Begabung und Zeitgeschmack, zu verschiedenen Wertungen und Umdeutungen führten. »Homeros, so scheint es, war nun einmal bestimmt, von seinen Bewunderern verwandelt zu werden«48 – aber auch diese ihrerseits zu verwandeln. Allein die Auswahl dessen, was die Späteren – und zwar schon im Altertum! – für erhaltenswert befanden, fällte bereits ein Urteil über das Bild der Antike, das von da an für alle Darauffolgenden verbindlich schien.
Daher war die Suche nach dem »Geist des Altertums« stets eine Suche nach den Beweggründen des eigenen Geistes, dem man eine durch die Geschichte geadelte Herkunft zu geben verlangte. Hat doch jeder »noch bei den Alten gefunden, was er brauchte oder wünschte; vorzüglich sich selbst.«49 Was also bewirkte eine solche Bezugnahme in denjenigen, die ihr Leben etwa der Liebe zu den Griechen verschrieben, weil sie sich in der neuzeitlichen oder »modernen« Welt einfach nicht heimisch fühlen konnten? – Es gehört zu den wenig beachteten Tatsachen, dass das Abendland um 1800 an der Schwelle zweier Weltalter stand, und dass die Zukunft Europas an eben dieser Frage entschieden werden würde: gelänge eine breite und wirkungsvolle Sensibilisierung für die antiken Werte und damit eine »Rückkehr« der neueren Völker ins Kulturelle, oder würden die »modernen Ideen« den Kontinent gänzlich überwältigen, den Humanismus vergessen machen und einen »neuen Menschen« erzeugen, dessen Vorlieben für das Materielle, Industrielle, Utopisch-Soziale gradewegs in die Profanisierung der »neuen, riesenhaften Gewerbkraft«50 und damit in die komfortable Verwahrlosung postkultureller Zustände führte, wodurch »ganz nordamerikanische Ansichten von dem relativen Wert der Studien um sich griffen.«51 Somit war der Kampf um die Hellenisierung des Lebens weitaus mehr als eine philosophisch-ästhetische Marotte; er enthielt die finalen Sorgen und den Existenzialismus derer, die bis heute ahnend begreifen, wie es um die eigene Sache steht, wo diese im Wirbel der Weltgeschäftigkeit ihrer endgültigen Auflösung entgegensteuert.
Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Bewusstseinsstufen bei der Erkenntnis des griechischen Altertums in Deutschland unterscheiden: die erste Phase, die etwa zwischen 1760 und 1820 anzusetzen wäre, wurde geprägt durch ein naiv-euphorisch-optimistisches Erfassen der Idee des Schönen auf der Grundlage bestimmter, subjektiv verklärter Altertümer zumeist aus der Kunst und Literatur. Man entdeckte das Ideal griechischer Formvollendung ebenso neu für sich, wie die Originalität Homers. In der zweiten Phase, die etwa von 1820 bis 1840 reichte, erwachte ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit den Altertümern; hierauf bildete sich jenes realistische Verhältnis zu den Dingen heraus, das grundlegend war für die späteren, grandiosen Leistungen deutscher Altertumswissenschaft. In der dritten Phase allgemeiner Ernüchterung zwischen 1840 und 1860 wichen der einstige Enthusiasmus und die großen, kulturerneuernden Hoffnungen, die man in die persönlichkeitsbildende Kraft der studia humaniora gesetzt hatte, einem den politischen und technischen Entwicklungen geschuldeten Skeptizismus, der schließlich in jenem weit um sich greifenden philosophischen Pessimismus gipfelte, welcher zugleich das Ende der missionarischen Aufgabe des deutschen Geistes einläutete. Damit verschwand die vielleicht schönste jemals erdachte Vision aus dem Repertoire gelebter Ideen: die der Autogenese zum sittlich-ästhetisch, ganzheitlich gebildeten Individuum – und es trat an deren Stelle das Bedürfnis nach technischem Komfort, wirtschaftlichem Wachstum um jeden Preis, nach Nutzmenschentum und sozialer Kompatibilität.
Denn spätestens ab 1860 darf der deutsche Humanismus als gescheitert gelten. Ein neues Zeitalter brach sich Bahn, in dem für Konzepte wie die Hellenisierung oder Ästhetisierung des Menschen zulasten eines allumfassenden Profitstrebens kein Platz mehr war. Die humanistische Idee hatte die Natur des Menschen als solche zur Disposition gestellt und für einen grundsätzlichen Eingriff in die Entwicklung plädiert, um das Animalische dieser Natur durch Erziehung zum Schönen dauerhaft in Schranken zu halten. Das Todesjahr Schopenhauers markiert jedoch zugleich das Sterben einer Epoche, in der erstmals und einmalig ein Geistestypus zu Ansehen und Einfluss gelangte, dessen freilich überhöhte Lebensentwürfe für den Verlauf der europäischen Kultur zuletzt ohne Wirkung blieben und nur eine kurze Verzögerung jener gewaltigen Konvulsionen bewirken konnte, die aus musischen, zur Klassizität begabten Wesen technisch perfektionierte Konsumenten machen.
Im Sommer des Jahres 1805 schrieb Wilhelm von Humboldt aus Rom an Friedrich August Wolf: »Unsere neue Welt ist eigentlich gar keine; sie besteht bloß in einer Sehnsucht nach der vormaligen, und einem ungewissen Tappen nach einer zunächst zu bildenden. In diesem heillosesten aller Zustände suchen Phantasie und Empfindung einen Ruhepunkt und finden ihn wiederum nur hier.«52 – Welches Unbehagen nagte also schon damals an einer Kultur, deren vornehmste Köpfe ihren Ort noch nicht gefunden hatten, und in denen frühzeitig die böse Ahnung aufgestiegen war, dass man als abendländischer Mensch seinen eigenen Ort im Hier und Jetzt auch niemals finden werde! In keiner anderen Kultur enthielt das Motiv der Sehnsucht eine solche Antriebskraft wie im Abendland des 18./19. Jahrhunderts. Wenn der abendländische Europäer, zumal der deutsche, auszog, dann suchte er nach etwas, das er in grauer Vorzeit verloren zu haben meinte.53 So ist die Liebe zum Altertum als schöpferisch vielleicht fruchtbarster Ausdruck jener tiefen Unzufriedenheit zu verstehen, die dem »deutsche Wesen« mehr als allen anderen Völkern seit langem innezuwohnen scheint und die spätestens seit der Reformation über die verschiedensten Wege geistiger Umorientierung immer wieder ausbrach. Denn keine Nation Europas hat seit 1517 tiefere Existenzkrisen durchlitten, ist seit 1618 schwerer durch Kriege verwüstet worden, hat seit 1918 öfter politisch die Richtung gewechselt und ist bis heute innerlich zerrissener als die der deutschen Länder. Nirgendwo fanden häufiger und gewaltigere Umwälzungen statt als dort. Und nirgendwo übte bis ins 20. Jahrhundert hinein das rein Geistige, das Fühlen und Wollen der »Dichter und Denker« eine größere Wirkung auf die kollektive Gemütslage aus als unter Deutschen. Mehr als allen anderen Völkern war den Deutschen einst die Idee Weltinhalt und Lebenssinn, formende Kraft und gestaltendes Prinzip.
Daraus resultiert ihre so häufige Flucht ins Spekulative und Freigeistige.54 Und es waren die Alten, die jenen giftigen Stachel des Willens zur Wahrheit im Fleisch Europas hinterlassen hatten; einen Willen, der allen anderen Weltkulturen tatsächlich fehlt. Dieser Stachel bewirkte, dass sich die Wunde der Philosophie auch im Abendland niemals schloss, sondern immer wieder entzündete, und zwar am heftigsten im deutschen Selbstfindungsprozess des 19. Jahrhunderts. Führt der Weg der Philosophie stets »nach Hause«, wie Novalis erkannte, so wurde der deutsche Idealismus mehr denn je zum Heimweg, seit unter Deutschen, wie nirgendwo sonst im nachantiken Europa, bemerkt worden war, dass das Reale oder bloß Pragmatisch-Geistige, etwa des Christentums, so wenig eine echte Heimat im Sinne mentalkultureller Herkunft oder persönlicher Vervollkommnung zu bieten vermochte wie die Liebe zu einem Menschen. Denn wo vom »deutschen Geist« gesprochen wird, ist genau jene Disposition gemeint, durch die sich ein solches Streben von anderen Welteinrichtungs- und Welterrichtungsversuchen deutlich unterscheidet: die Idee einer Sache höher zu stellen als deren tatsächliches, wirkliches Vorhandensein. Darin bestand nicht nur der Erfolg Hegels und die Motivation seiner zahlreichen Epigonen, sondern zuletzt auch die fortdauernde Attraktivität der deutschen Klassik, allen voran die Popularität Schillers, die bezeichnenderweise erst in den 1840er, 1850er Jahren verstärkt einsetzte, als die Leuchtkraft Goethes und Hegels merklich schwand, da der bildungsbürgerliche Raubbau an diesen beiden überreich verlockenden Steinbrüchen des Geistes vorerst erschöpft war und sich andere, insbesondere nationalpolitische Interessen in den Vordergrund schoben. Denn freilich benötigt alles »Klassische« eine gewisse Gärungszeit, auch einen gewissen Abstand zur Sache selber, um zu voller Reife und Blüte zu gelangen. Das Große enthält seinen objektiven Wert erst durch den Vergleich dessen, worin es zeitlich eingebettet und wovon es räumlich umgeben ist. Um aber dies in Ruhe zu bemerken, muss man weit genug vom Geschehenen entfernt sein. Deshalb ist das Bedürfnis, diese knapp hinter uns liegende kulturelle Entwicklungsphase ihrem Wesen nach tatsächlich zu verstehen, noch gar nicht geweckt. Schließlich kam das Verlangen, das Altertum zu verstehen (trotz aller sogenannten Renaissancen), auch erst um 1750 auf, als der Abstand zur Antike groß genug war, um das, was man an ihr verloren zu haben glaubte, schätzen zu lernen.
So entstand unter Deutschen ein ausgereiftes Bewusstsein für den tieferen Gehalt ihrer Klassiker genaugenommen vielleicht erst ab den 1910er Jahren – um dann allerdings auch umso rascher wieder zu vergehen. Die Größe Schillers, die freilich viel »deutscher«, will heißen: störrischer, möglicherweise auch hintergründiger und unzugänglicher ist als die Größe Goethes, benötigte eben deshalb so lange, um in ihrer ganzen Qualität gewürdigt zu werden, weil sie als reine »Anschauungssache« nicht der »Erfahrung«, sondern der »Idee« entspringt und folglich gleichfalls angeschaut und lange besehen werden muss, um erkannt zu werden. – Und wie viel Allegorisches verbirgt sich doch hinter der Tatsache, dass Schillers innerlich durch Krankheiten zerfressener Leichnam 1805 im Kassengewölbe auf dem Jakobsfriedhof zu Weimar beigesetzt und erst zweiundzwanzig Jahre später, also noch vor Goethes Tod, in die 1825 errichtete Fürstengruft umgebettet worden war, wobei man, wie inzwischen bewiesen, die falschen Gebeine barg, weshalb Schillers Sarkophag heute leer ist; seine sterblichen Überreste sind auf ewig dahin – weil unbemerkt verrottet und verwest.
Obwohl alle Erfahrung lehrt, dass ein Gedanke nur so viel wert ist, wie die Aufnahme, die er findet, jede Philosophie also hinter ihre Rezeption zurücktreten muss, verhalten sich die meisten Historiker bis heute so, als sei eine Lehre gleichzusetzen mit ihrer Wirkung. Dabei kommt es genaugenommen gar nicht darauf an, was die einzelnen Philosophen gelehrt haben, sondern was daraus gemacht worden ist, das heißt: was die jeweiligen Zeitalter darin zu erkennen meinten, was sie also darin suchten. Führen wir uns vor Augen, wie lange besonders die antiken Philosophen in Europa bloße Namen waren, die man auf bestimmte Schlagworte reduzierte, und jeder Gelehrte die Aussagen und Urteile seiner Vorgänger übernahm, ohne sie jemals einer echten Kritik unterzogen zu haben, wird klar, warum kaum eine der vielen Philosophiegeschichten ihrem Stoff tatsächlich gerecht wird. Selbst in den besten finden sich fast ausschließlich mehr oder weniger gründliche Nacherzählungen antiker Schriftsteller, allenfalls in textkritischer Aufmachung. Wer aber fragte je ernsthaft danach, warum ausgerechnet dieser oder jener Autor erhalten blieb, während die Schriften anderer verlorengingen?55 Wer fragte nach dem Einfluss, den die Rezipienten, Zensoren, Ignoranten, Sortierer und Kopisten auf die Philosophiegeschichte nahmen? Wozu dienten die Zeugnisse der Alten dem Geist der Neueren? Welche Impulse gehen vom individuellen Denken auf den jeweiligen Zeitgeist aus? Und umgekehrt: wie verwandelt der Zeitgeist unseren Blick auf Vergangenes? Denn Geschichte ist weniger eine Frage der Tatsachen als vielmehr eine der Wirkungen: was hat wie und warum auf wen Macht ausgeübt – darauf kommt es an. Von den Tatsachen weiß nur Genaueres, wer sie erlebt hat. Deren Wirkungen aber werden von einer Generation in die nächste fortgetragen. Daher ist Geschichte immer und vor allem Rezeptionsgeschichte; jedes historische Ereignis erzählt ein Stück Menschheitsbiographie, und zwar hauptsächlich dadurch, wie es erzählt wird. Aus dieser Art und Weise nehmen wir den Mut, für etwas zu leben, das noch nicht ist, aber vielleicht einmal war.
Es liegt eine tragische Ironie in dem Umstand, dass die meisten Impulse, die vom Altertum auf die deutsche Geisteskultur ausgegangen sind, auf Irrtümern beruhten! Waren es doch stets die großen Ahnungen und nicht die ernüchternde Akribie historischer Forschungen, von denen inspiriert der schöpferische Mensch sich zum Künstler an der Geschichte aufschwang – und dadurch überhaupt erst Kultur schuf, will sagen: einen originellen Sinn in ein Ereignis hineinlegte, das von sich aus diesen Sinn noch gar nicht enthielt. Ein solches Erschauen bannt den Betroffenen derart, dass er den Dingen einen anderen Klang, ein anderes Ansehen zu geben verlangt, weil er sie als Begeisterter tatsächlich anders wahrnimmt. All die sachlichen Fehler oder falschen Deutungen, die etwa Johann Joachim Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums (1764), Johann Heinrich Just Köppens Erklärende Anmerkungen zum Homer (ab 1787), Friedrich August Wolfs Prolegomena ad Homerum (1795), Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der alten Völker (ab 1810) oder Karl Otfried Müllers Die Dorier (1824) enthielten, beeinflussten jedoch das Qualitätsurteil der meisten ihrer damaligen, wohlwollenden Leser ebenso wenig negativ wie später Nietzsches Geburt der Tragödie (1872), Schliemanns Suche nach dem Palast des Agamemnon in Mykenae (1878) oder Spenglers Untergang des Abendlandes (1918); im Gegenteil: das Fehlerhafte oder Spekulative verlieh den Werken sogar oft erst jenen Nimbus des begeistert Erschauten, den bis 1850 selbst ausgewiesene Koryphäen der kritischen Methode, freilich nicht immer ganz uneigennützig, oft höher bewerteten als das reine Fachwissen. Denn treffend sei »auch bei jener Art von Werken, was Longin von den poetischen sagt, dass ein hoher Geist, der mitunter nicht geringe Fehler begeht, den Vorzug vor dem geistlosen Fleiss verdiene, der jeden Irrthum verhütet.«56
Zweifellos hat die Ehrfurcht vor dem Altertum überall dort kulturell belebend gewirkt, wo eine Gesellschaft dem Idealen mit naiver Ernsthaftigkeit verfiel. Erst im späten 19. Jahrhundert ward ein Zustand erreicht, der dazu verführte, dank eines bequem zurechtgemachten Griechentums auf eigene künstlerische Anstrengungen und Originalität zu verzichten – oder beides dem Realverständnis des Positivismus zu opfern. Dadurch gerieten Kunst und Wissenschaft zwar noch einmal heftig aneinander, was manche Spätblüte hervorschießen ließ, wodurch aber auch die ideelle Kultur zuletzt aller ihrer Irrtümer überführt zu werden und in den Zustand operativer Belanglosigkeit herabzusinken drohte. – Diesen kulturpsychologischen Vorgang hellsichtig durchschauend wie kein zweiter, konstatierte Nietzsche ab 1870, dass die Liebe seiner Zeitgenossen zum Altertum, ähnlich wie die Liebe zur christlichen Religion, bloß noch auf Vorurteilen beruhe und auf Missverständnissen, die absichtlich weitergetragen würden, weil inzwischen zu viele im Staat davon profitierten: »Es ist also ein Standesinteresse, reinere Einsichten über das Alterthum nicht aufkommen zu lassen: zumal die Einsicht, dass das Alterthum im tiefsten Sinne unzeitgemäss macht