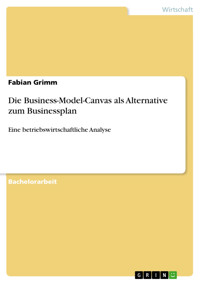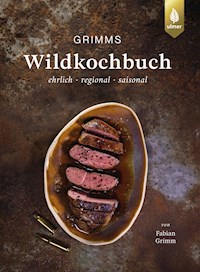
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ehrliche und regionale Ernährung mit Tieren, die ihre Bedürfnisse und Instinkte in Freiheit ausleben konnten – das ist die Philosophie von Jäger und Wild-Foodblogger Fabian Grimm. Dieses Wildkochbuch zeigt, dass Sie kein Sternekoch sein müssen, um Wildfleisch zu verarbeiten. Von wilden Spareribs bis zur Reh-Leberwurst kombiniert Fabian Grimm in 50 bodenständigen und einfach umsetzbaren Rezepten jedes Teilstück und seine Stärken mit saisonalen Zutaten wie Kräutern, Beeren und Pilzen. Spannend und mitreißend erzählt das Buch vom Verhalten und Lebensraum der Tiere und gibt Antworten auf wichtige Fragen zur Fleischqualität, Küchenpraxis und dem Einkauf von Wild.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Fleisch von einem Tier, das selbstbestimmt leben konnte und hoffentlich ein gutes, glückliches Dasein hatte.
FABIAN GRIMM
GRIMMS
Wildkochbuch
ehrlich · regional · saisonal
50 REZEPTE MIT PILZEN, BEEREN UND WILDKRÄUTERN
Vorwort
WILD & JAGD
Warum ich jage
Gutes Fleisch – gibt es das überhaupt?
Kontrolle ist gut, selber machen ist noch besser
Fleisch-Ess-Lust
Gast in einer fremden Welt
Aufgaben der Jagd
Wildtiermanagement in der Kulturlandschaft
Jagd als nachhaltige Nutzung
Der Umgang mit Wild und Wildschäden
Einen Ausgleich finden
Wild als Lebensmittel
Vorurteile gegenüber Wild
Wild kaufen
Wann gibt es Wild?
Fleischhygiene
Sicherer Wildgenuss
Muss man Wild durchgaren?
Fleischqualität beurteilen
Küchenpraxis
Wildarten und Teilstücke
Fleisch ist nicht gleich Fleisch
Das beste Teilstück?
Ausbeinen und Parieren
Wild konservieren
Wildfleisch einfrieren
Wildfleisch einkochen
Häufige Fragen
Brühe kochen
REHWILD
Aufgang der Jagd
Fakten Rehwild
Rezepte
DAMWILD
Gemeinsame Jagdmomente
Fakten Damwild
Rezepte
STOCKENTE
Fressen und gefressen werden?
Fakten Stockente
Rezepte
FELDHASE
Seltene Beute
Fakten Feldhase
Rezepte
SCHWARZWILD
Standlaut!
Fakten Schwarzwild
Rezepte
SERVICE
Bezugsquellen für Wildfleisch
Zum Weiterlesen
Der Autor
Ein Rücken mit zwei Filets, zwei Keulen, zwei Hachsen, zwei Schultern, zwei Eisbeine, ein paar Rippen, der Bauch und der Hals – ein ganzes Tier. Ein Reh, um genau zu sein. Ich möchte es essen, deshalb habe ich es fachgerecht in die einzelnen Zuschnitte zerteilt.
Wenn ich die verschiedenen Teilstücke sauber ausgelöst vor mir habe, ist das Tier nicht mehr als solches zu erkennen. Der Tisch sieht aus wie die Auslage in einer Metzgerei. Trotzdem erinnere ich mich. Ich habe dieses Lebensmittel nicht gekauft, sondern mir von Anfang an selbst erarbeitet. Da liegt kein anonymes Fleisch, sondern meine Beute. Das Reh, das ich essen möchte, habe ich selbst getötet. Oder „erlegt“, wie wir Jäger sagen.
Zunächst wird das Fleisch eingefroren, später geht es an die Zubereitung. Stück für Stück wird das Tier in den nächsten Wochen auf dem Teller landen. Ein Tier selbst zu verarbeiten bedeutet, das Lebensmittel Fleisch von Grund auf kennenzulernen. Zu jedem Filet gehört ein Eisbein, zu jeder Keule eine Schulter und zu jedem Braten aus dem beliebten Rücken ein weniger begehrter Hals. Jedes Teilstück bringt seine eigenen Stärken und Vorzüge mit. Sie zu erforschen und den optimalen Geschmack herauszukitzeln, ist eine spannende Herausforderung und sorgt für Abwechslung.
Das Fleisch ist für mich der wichtigste Grund zu jagen – trotzdem ist Jagd mehr, als Wild zu erlegen. Zu meinem Selbstverständnis als Jäger gehört auch, mich intensiv mit dem Wild und seinem Lebensraum zu beschäftigen. Ich möchte lernen, das ganze Ökosystem zu verstehen und auch die im Revier vorkommenden Kräuter, Pilze und Beeren bestimmen können. Wo spitzt in den letzten Wintertagen schon der Bärlauch aus der Erde? Ab wann wird es sich wieder lohnen, nach Pfifferlingen zu suchen? Lassen sich die Früchte der aus Nordamerika eingeschleppten spätblühenden Traubenkirsche verarbeiten – appetitlich sehen sie doch eigentlich aus?
Wann immer es möglich ist, versuche ich, meine Beute mit dem zu kombinieren, was gerade im Revier wächst. Wie von selbst schmeckt der Frühsommer dann vollkommen anders als der Herbst. Während ich das Reh zugeschnitten habe, habe ich schon begonnen, über passende Rezepte nachzudenken. Ehrlich und bodenständig sollen die Gerichte sein, mit wenigen, präzise eingesetzten Aromen. Jagen, sammeln und draußen sein ist für mich ein Lebensgefühl – als Ziel für mein Wildkochbuch habe ich mir gesetzt, es auf den Teller zu bringen!
WILD & JAGD
LEBEWESEN UND LEBENSMITTEL
WARUM ICH JAGE
Tiere zu töten, um Fleisch essen zu können, gilt auf der einen Seite als etwas vollkommen Normales: Auch wenn viel über vegane Ernährung diskutiert wird, essen über 90 Prozent der Bevölkerung Fleisch. Die Länge der mit Fleisch und Wurst gefüllten Kühltheken in den Läden belegt es eindrücklich.
Auf der anderen Seite ist es heute aber ausgesprochen unüblich, ein Tier selbst, also eigenhändig, zu töten, um es dann essen zu können. Hausschlachtungen und private Kleintierhaltung sind selten geworden, sogar auf dem Land ist es nicht mehr selbstverständlich, Hühner oder Kaninchen zu sehen. Fleisch kauft man im Supermarkt oder beim Metzger. Das Lebensmittel ist dann ordentlich zugeschnitten, sauber verpackt, etikettiert – und ohne Fell, Knochen oder Augen kaum als ehemaliges Lebewesen zu erkennen. Über die Lebensumstände der verarbeiteten Tiere weiß man wenig. Sattgrüne Weiden, blauen Himmel und überglückliche Tiere zeigen uns die Verpackungen und Werbebroschüren, mit verwackelten Aufnahmen schrecklich leidender Kreaturen in dunklen Ställen halten Tierrechtler immer wieder dagegen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte? Aber auch, wenn man sich informieren möchte, ist es nicht leicht, objektive Fakten zu bekommen. Sie selbst zu überprüfen, statt auf Siegel, Zertifikate und Berichte zu vertrauen, ist noch komplizierter.
Wegen dieser Unsicherheit hatte ich mir vorgenommen, auf Fleisch zu verzichten, als ich sechzehn oder siebzehn Jahre alt war. Die Entscheidung hatte ich aus rationalen Erwägungen gefällt, nicht weil mir Burger, Döner oder Bratwurst nicht geschmeckt hätten. Es gab keinen konkreten, dramatischen Anlass – keinen Besuch auf dem Schlachthof, kein geschlachtetes Haustier und auch keinen klaren Beginn meiner Zeit als Vegetarier. Nach und nach habe ich einfach aufgehört, Fleisch zu essen, der Übergang hat einige Monate gedauert. Kein Fleisch auf dem Teller bedeutete auch, keine Verantwortung für eventuelles Tierleid durch meine Ernährung tragen zu müssen. Das schien mir eine gute Lösung.
Als ich später zusammen mit meiner Freundin die erste eigene Wohnung, und damit auch die erste eigene Küche gemietet habe, habe ich dort gerne und viel gekocht – natürlich vegetarisch. Mit der Zeit und mit der Anzahl der Kochbücher und Gewürze im Schrank wuchs auch die Erfahrung. Die indische Küche etwa bietet traditionell eine fantastische Vielfalt an fleischlosen Rezepten, aber auch in anderen Ländern und Regionen finden sich spannende vegetarische Gerichte.
Fleisch habe ich damals nicht im Geringsten vermisst. Ich hatte ohnehin nie wirklich gelernt, es selbst zuzubereiten. An so etwas wie Jagd war zu dieser Zeit überhaupt nicht zu denken, schon weil wir mitten in Berlin und fern von Wald und Wild gelebt haben. Zum Asiamarkt oder zum Bioladen waren es dafür mit dem Rad nur fünf Minuten – Tofu, Tempeh und Nussmus mit Biosiegel lagen nicht nur sprichwörtlich erheblich näher als der Gedanke an Rehe, Hirsche und Wildschweine.
GUTES FLEISCH – GIBT ES DAS ÜBERHAUPT?
Einige Jahre nach der Entscheidung gegen Fleisch auf dem Teller wurde während mehrerer gemeinsamer Besuche bei Freunden in Schottland plötzlich manches greifbar, was vorher abstrakt geblieben war: Ethan und Yvonne haben Landwirtschaft studiert. Mehr als dreihundert eigene Schafe bestimmen mittlerweile ihren Alltag. Ihr Betrieb produziert Lammfleisch – konventionell und ohne Biosiegel. Jedes Jahr bekommen die Schafe im Frühjahr ihre Lämmer, im Herbst und Winter werden sie verkauft und geschlachtet.
Es war selbstverständlich, dass wir während der Zeit, die wir bei ihnen verbrachten, auch mithalfen, die Tiere zu versorgen – und unvermeidlich, die kleinen Lämmer dabei augenblicklich ins Herz zu schließen. Eine eigenartige Situation: Ich füttere ein Lamm, tränke es, führe es auf eine neue Weide oder schneide ihm sogar die Hufe. Damit trage ich dazu bei, dass es sich lohnen wird, es zu töten.
Je besser die Schafe versorgt werden, desto gesünder sind sie. Wenn es ihnen gut geht, nehmen sie schneller zu und kräftige Tiere sind bei den Käufern begehrter. Gerade zu Beginn der Saison im Herbst haben die Tiere in vielen Betrieben noch nicht das nötige Gewicht erreicht, um geschlachtet zu werden. Die Landwirte mit besonders starken Lämmern, die dann schon „liefern“ können, erzielen die besten Preise.
Überraschend war für mich dabei, dass dieser Widerspruch zwischen liebevoller Pflege und absehbarem Ende nicht nur meiner Freundin und mir aufgefallen war. Offen und ehrlich konnten wir solche Dinge an den Abenden mit den beiden Landwirten diskutieren und auch ohne Probleme kritische Fragen stellen. Ein Schlüsselmoment war für mich, als wir uns erkundigten, warum die beiden nicht auch Schafsmilch melken und verkaufen: Für die Fleischproduktion leben die Tiere in größeren Herden, um den Ort herum auf den Weiden verteilt. Ihr Blöken ist zu jeder Zeit aus allen Himmelsrichtungen zu hören. Einen richtigen Stall gibt es nicht, nur eine Scheune für besonders kalte Winternächte. Das ist fantastisch für die Tiere, weil sie viel Bewegung bekommen und innerhalb der vom Weidezaun gesetzten Grenzen ein großes Maß an Freiheit genießen. Sie können grasen oder dösen, sich an Bäumen schrubbern, sich etwas abseits halten oder die Nähe ihrer Artgenossen suchen, und gelegentlich auch mal ausbrechen. Ihre Besitzer sehen sie eigentlich nur, wenn sie auf den täglichen Kontrollfahrten etwas Kraftfutter vorbeibringen.
Mit Milchschafen wäre das alles anders. Sie müssten in einem Stall stehen, oder wenigstens immer auf einer Weide ganz nah am Betrieb: Morgens und abends alle Tiere erst zum Melken abzuholen und sie dann anschließend wieder zu verteilen, das wäre unmöglich. Fleisch lässt sich im Betrieb von Ethan und Yvonne wohl tatsächlich tiergerechter erzeugen als Milch.
Wieder zu Hause dachte ich viel darüber nach. Als Vegetarier aß ich Käse und trank Milch, nicht in Massen, aber doch gerne, regelmäßig und bisher mit gutem Gewissen. Das ist heute anders. Viel mehr noch als das veränderte Bewusstsein für diese Problematik beschäftigt mich aber, dass ich es vorher schlicht nicht besser wusste. Wie viele ähnliche Denkfehler würden sich auftun, wenn ich auch in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion tiefere Einblicke bekommen könnte?
Bisher hatte ich die Kühltheke ganz hinten im Bioladen kaum wahrgenommen. Sie verkaufen dort Fleisch, auch von Lämmern, mit Biosiegel und all den anderen Stempeln und Logos. Was diese Tiere wohl für ein Leben hatten? Ob es ihnen so gut ging wie Ethans Schafen, die viel Zuwendung und Bewegung, aber keine Zertifikate haben? Wahrscheinlich schon. Bestimmt sogar, es ist ja „gutes“ Fleisch. Aber was heißt in diesem Zusammenhang schon gut?
KONTROLLE IST GUT, SELBER MACHEN IST NOCH BESSER
Und vor allem: Was heißt schlecht? Mein ganzes Weltbild war durch ein paar Wochen in Schottland durcheinander gewirbelt worden: Nicht nur, dass ich gerne und aus freien Stücken auf einem Hof mitgeholfen hatte, der Fleisch produziert, auch die Diskussionen an den Abenden wirkten nach. Vegetarier oder nicht, die Herstellung meiner Lebensmittel beeinflusst die Umwelt, das hatte ich erst jetzt in der ganzen Tragweite verstanden.
Auch als Vegetarier beeinflusse ICH die Umwelt, und das ganz maßgeblich.
Ein Acker, ein Feld und auch ein kleines Beet ist ein Stück Land, das irgendwann einmal von Bäumen, Büschen, Kräutern und allem natürlichen Bewuchs befreit wurde. Vielleicht musste es sogar durch Gräben und Drainagen entwässert werden. Schließlich wächst dort dann eine einzige Sorte Nutzpflanzen, alles andere ist „Unkraut“ und wird bekämpft. Die Eingriffe können mehr oder weniger schonend erfolgen, aber im Kern der Sache weicht immer ein vielfältiger Lebensraum, um auf der Fläche Nahrungsmittel herstellen zu können. Solange ich essen möchte, muss ich wohl einen Umgang damit finden.
Genau zu dieser Zeit trat ganz unerwartet die Jagd in unser Leben: Meine Freundin hatte sich aus Interesse an dem komplexen Ökosystem Wald und dem Wunsch, es verantwortungsvoll und nachhaltig zu bewirtschaften, für ein Forstwirtschaftsstudium entschieden. Zwar ist der Jagdschein an sich kein verpflichtender Bestandteil der Ausbildung, trotzdem stellte sich bald heraus, dass es kaum Absolventen dieses Studiengangs gibt, die nicht wenigstens die Jägerprüfung hinter sich gebracht haben: Wer einen Wald bewirtschaftet, ist oft auch für die Wildtiere auf dieser Fläche zuständig. In Stellenausschreibungen für die Berufsgruppe wird der Jagdschein meistens vorausgesetzt.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema war also zunächst eine erzwungene, doch durch die in der ganzen Wohnung verteilten Lehrbücher entwickelte sich auch bei mir schnell ein gewisses Interesse an der Jagd. Ein Bild aus einem der Bände hat sich mir besonders ins Gedächtnis gebrannt: Ein polierter Metalltisch voller Fleisch. Große und kleine Stücke nebeneinander, am Rand des Tischs ein Messer. Schimmernde Muskelpakete, weißes Fett, zugeschnittene Steaks und bereits gewürfeltes Fleisch, bereit, um als Gulasch zubereitet zu werden. Ein Wildschwein, oder das, was davon übrigbleibt, wenn man das Fell und alle Knochen entfernt. Ein einziges Tier, ein einziges Mal sich überwinden abzudrücken, ergibt genug „selbstgemachtes“ Fleisch für Wochen und Monate. Mit zwei oder drei solchen Wildschweinen käme man wahrscheinlich ein ganzes Jahr aus, vielleicht sogar dann, wenn man regelmäßig Fleisch isst?
Ein zu hundert Prozent selbst erzeugtes Lebensmittel fest in den eigenen Speiseplan zu integrieren, dieser Gedanke hat mir sofort gefallen.
Nach den Erlebnissen in Schottland war jedenfalls klar, dass ich unbedingt mehr direkte Verantwortung für meine Ernährung übernehmen wollte. Es hatte sich absolut nicht bewährt, mich durch die einfache Regel „kein Fleisch – kein schlechtes Gewissen“ dem Problem entziehen zu wollen, im Gegenteil. Zwei Wege standen nun offen: Entweder in Zukunft regelmäßig und gründlich über die Lebensmittel auf meinem Teller zu recherchieren, die Anforderungen der verschiedenen Anbau- und Zertifizierungsverbände zu lesen und die Produktionsketten möglichst lückenlos nachzuvollziehen – oder viel, viel dichter an den Kern des Ganzen heranzugehen, und zu versuchen, selbst eigene Lebensmittel zu produzieren.
Zutatenlisten penibel zu kontrollieren, ist nicht mein Ding. Hätte sich die Jagd zu diesem Zeitpunkt nicht beinahe aufgedrängt, wäre es wohl auf eine Parzelle im Schrebergartenverein hinausgelaufen, falls sich keine bessere Lösung gefunden hätte.
Nach langen Überlegungen stand stattdessen der erste Unterrichtstag in einer Jagdschule an: drei Wochen theoretischer Kurs, in zwei Blöcke aufgeteilt, dazu Übungsstunden auf dem Schießplatz und eine Menge Zeit mit den Lehrbüchern. Zwei Monate später die Prüfung.
Bestanden!
FLEISCH-ESS-LUST
Ein knappes Jahr nachdem die Jagd zum ersten Mal in mein Leben getreten war, hielt ich ein grünes Heftchen im Format DIN A6 in der Hand. Meinen Jagdschein!
Noch einmal eine ganze Weile später war es dann so weit, und zum ersten Mal erlaubte mir ein Förster, einen Nachmittag in seinem Revier zu jagen. Zum Sonnenuntergang lag meine erste Beute vor mir. Das Damwild-Weibchen war vermutlich fast taub gewesen und ganz sicher ziemlich struppig und ausgesprochen mager. Eigentlich hätte ich ein Kalb und kein Weibchen erlegen sollen. Eine Katastrophe! Ich hatte einen großen Fehler gemacht. Zum Glück blieb er immerhin folgenlos, denn das Tier war schon so alt, dass es nicht einmal mehr die Kraft hatte, ein Kalb auszutragen und aufzuziehen.
Zwei volle Arbeitstage habe ich gebraucht, bis das Tier endlich fertig zerteilt und zugeschnitten in der Gefriertruhe lag. Nur die beiden Filets habe ich damals nicht eingefroren, sondern sofort gebraten. Aus heutiger Sicht war es gleich der nächste Fehler, dass ich dafür Butter verwendet habe, und kein hitzebeständiges Öl oder Butterschmalz. Eine richtige Kruste hatte das Fleisch auf dem Teller dann auch nicht, dafür war es bis in den Kern komplett durchgegart, weil ich es bei bestenfalls mittlerer Hitze eine ganze Weile gebraten hatte ...
Völlig egal: das erste Stück Fleisch nach Jahren hat trotzdem geschmeckt! Ich war stolz, ein Lebensmittel essen zu können, das ich von Anfang bis zum Ende selbst erzeugt hatte. Und gelitten hatte das Tier nicht, das konnte ich mit Sicherheit sagen. Es hatte sein langes Leben in Freiheit verbracht und war nach meinem Schuss augenblicklich tot gewesen. Außer mir hatte kein einziger Mensch das Fleisch auf meinem Teller auch nur berührt. Ein unglaubliches Gefühl.
GAST IN EINER FREMDEN WELT
Mittlerweile bin ich seit sieben Jahren Jäger. Die Jagd und alles, was dazu gehört, spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Mit Akira ist ein Jagdhund, ein „Kleiner Münsterländer“, bei uns eingezogen, die Farben Grün und Braun dominieren inzwischen den Kleiderschrank und in der Großstadt wohnen meine Freundin und ich schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren habe ich einiges über die vielen Facetten der Jagd gelernt. Der Kern des Ganzen ist für mich nach wie vor der gleiche geblieben: Als Jäger habe ich die Möglichkeit, auf ursprünglichste Art Lebensmittel selbst zu beschaffen.
Auch wenn ich immer noch ständig dazulerne, weiß ich inzwischen einigermaßen, was ich tue. Ich kann ein Kalb von einem ausgewachsenen Tier unterscheiden und die beim ersten Versuch noch so mühselige Arbeit des Zuschneidens geht jetzt flüssig von der Hand. Was früher zwei Tage gedauert hat, schaffe ich heute in zwei Stunden.
Trotzdem gibt es einfachere Wege als ausgerechnet die Jagd, um an gutes Fleisch zu kommen. Für die Zeit und die Arbeit, die hinter einem selbst erlegtem Steak steckt, darf ich niemals einen Stundenlohn ausrechnen – ohne ordentlich zu schummeln, käme ich nicht einmal in die Nähe der Preise für das beste Fleisch aus dem Bioladen. Jäger zu sein bedeutet nun einmal auch, oft mit leeren Händen heimzukommen.
Das ist in Ordnung, es muss sogar so sein. Die Jagd macht Freude und bietet mir mehr als reine Fleischbeschaffung. Es ist aufregend, sich in die Tiere hineinzuversetzen und zu versuchen, ihren Lebensraum aus ihrer Perspektive zu sehen. Wo finde ich welche Spuren und Fährten? Wann fallen leckere, reife Eicheln vom Baum, gibt es dieses Jahr Bucheckern und was wächst auf welchem Feld? Welches Kraut schmeckt am besten und auf welcher Lichtung ist es zu finden? Welche geheimen Wege führen in sicherer Entfernung an den Häusern, Wanderwegen, Straßen und Hochsitzen der Menschen vorbei und in welchem Gestrüpp kann man sich am besten verstecken? Solche Dinge möchte ich herausfinden. Dabei gilt es, behutsam und sensibel vorzugehen, um ein möglichst unbemerkter Gast in dieser fremden Welt zu bleiben.
Das Tier steht für mich bei der Jagd im Mittelpunkt. Auch wenn mir die Zeit im Wald Freude macht, versuche ich trotzdem, nur so viel wie nötig zu jagen. Und auch, wenn es in einer Kulturlandschaft immer wieder nötig sein kann, bestimmte Arten in ihrer Zahl zu reduzieren, möchte ich nur ungern mehr erjagen, als ich und mein engstes Umfeld auch selbst verbrauchen können.
Mir ist es am liebsten, wenn ich nur wenige Male gezielt und effizient rausgehe und dabei trotzdem genug Beute machen kann, um danach für eine Weile mehr Zeit in der Küche als im Wald zu verbringen. Ich vermeide es, auf dem Hochsitz zu warten, wenn ich eigentlich zu müde bin, oder nach einem langen Tag zu unkonzentriert, um Chancen auch zu nutzen. Das mag sehr rational klingen, aber für das Wild ist jeder Ansitz eine Störung, egal ob ich schieße oder nicht. Ich muss davon ausgehen, dass ich bemerkt werde, Geruch hinterlasse und allgemein für Unruhe sorge. Das Wild weiß genau, was es bedeutet, wenn in der Dämmerung Menschen in kleinen Baumhäusern lauern, da bin ich mir sicher.
Jagd ist für mich weder Selbstzweck, Freizeitspaß noch Schädlingsbekämpfung, sondern in erster Linie eine Möglichkeit, Verantwortung für meine Ernährung zu übernehmen.
AUFGABEN DER JAGD
Warum ich jage, habe ich im vorherigen Kapitel ausführlich erläutert: Ich möchte Fleisch essen, für dessen Herstellung ich selbst die volle Verantwortung trage. Es macht mir Freude, ein Lebensmittel von Anfang an selbst herzustellen.
Andere Jägerinnen und Jäger haben sich vielleicht auch aus anderen Gründen für den Jagdschein entschieden. Für einige ist die Jagd eine alte Familientradition, tief verwurzelt in ihrem Umfeld. Manche halten zuerst einen eleganten Jagdhund, merken dann wie schwierig es ist, den Vierbeiner angemessen auszulasten und kommen schließlich über die Hundeausbildung zur Jagd. Für viele ist die Jagd auch ganz einfach ein Weg, um Wildtiere und ihren Lebensraum intensiv kennenzulernen und hautnah zu erleben.
Knapp 400.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Deutschland. Zwangsläufig unterscheidet sich auch das, was als „Jägerleben“ begriffen wird. Während manche ein eigenes Revier betreuen und mehr oder weniger täglich jagen, reicht es anderen, vielleicht nur ein- oder zwei Mal im Jahr auf dem Hochsitz zu sein. Jenseits dieser Unterschiede bei der individuellen Motivation und Passion stellt sich aber die Frage, warum überhaupt gejagt wird – immerhin verlangen verschiedene Gruppierungen regelmäßig und lautstark, die Jagd zu verbieten oder wenigstens weitgehend einzuschränken.
WILDTIER-MANAGEMENT IN DER KULTUR-LANDSCHAFT
Auch in unseren Nachbarländern gibt es Jagd und Jäger. Die vorkommenden Wildarten, die Jagdmethoden und die Art und Weise der Organisation unterscheiden sich, doch am Ende führt nirgendwo ein Weg daran vorbei, die Anzahl freilebender Tiere in gewissem Maß zu reduzieren. Die Jagd erfüllt eine offenbar unverzichtbare Funktion – „Wildtiermanagement“ wird manchmal als moderner Begriff für den „Sinn der Jagd“ verwendet.
Ich mache es mir an dieser Stelle einfach und zitiere das Bundesjagdgesetz: Ziel der Jagd ist „die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen.“ Dabei sollen „Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.“
Diese beiden Sätze stecken den Rahmen ab, in dem sich alle Jägerinnen und Jäger in Deutschland bewegen. Die Bestände der Wildtiere werden erhalten, die Jagd soll sie aber gleichzeitig soweit „anpassen“, dass die Tiere keine übermäßigen Schäden verursachen.
Um zu erläutern, was das bedeutet, ist es nötig, weit auszuholen: Zunächst ist es entscheidend, sich bewusst zu machen, dass wir uns wenigstens in Deutschland und Europa längst nicht mehr in der „Natur“ befinden. Der Begriff wird zwar häufig benutzt, um all das zu beschreiben, was außerhalb der Städte und Dörfer liegt, oder auch um besonders ursprünglich anmutende Orte zu kennzeichnen – doch wenn man es genau nimmt, ist das nicht richtig.
Menschen haben ihre natürliche Umgebung verändert und ihren Lebensraum ihren Bedürfnissen angepasst. Manchmal ist das ganz offensichtlich: schnurgerade kanalisierte Flüsse, perfekt rechtwinklige Felder und Straßen und Häuser nennt niemand „Natur“. Vielleicht weniger deutlich ins Auge fallen einst sumpfige oder moorige Gebiete, die irgendwann entwässert wurden und heute Acker- und Weideflächen sind. Ein paar Kühe auf einer grünen Wiese wirken auf den ersten Blick nicht nur idyllisch, sondern auch ganz „natürlich“ – obwohl sie es nicht sind. Vollkommen unsichtbar, aber nicht weniger gravierend sind auch die allgegenwärtigen Veränderungen durch Einträge von Schad- und Nährstoffen aus Regen und Luft.
Im Getreide sieht es aus „wie Sau“: Wildschweine haben reifende Ähren gefressen und auf großer Fläche Halme umgedrückt.
Ob wir es wollen oder nicht: Wir leben in einer in allen Bereichen vom Menschen mehr oder weniger bewusst gestalteten „Kulturlandschaft“. „Wir“, das bedeutet in diesem Fall nicht nur wir Menschen: Alle Arten in dieser Landschaft haben sich mit dem Menschen wenigstens arrangiert – oder wurden sogar von ihm angepflanzt oder gezüchtet. Wir teilen uns einen Lebensraum.
Flächen, auf denen „die Natur sich selbst reguliert“, wie man es oft hört, gibt es schlicht nicht mehr.
Arten, die mit den Veränderungen der Umgebung nicht zurechtkommen, verschwinden. Sie verlieren ihren Lebensraum, können sich nicht mehr ernähren oder fortpflanzen und drohen auszusterben. Zuerst nur lokal, in bestimmten Gebieten, dann vielleicht auf großer Fläche und wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen gefunden werden, schließlich sogar vollständig.
Besonders bekannte Beispiele für diese Problematik sind Rebhuhn und Feldhase, deren Populationen seit Jahren zurückgehen. Die Produktionsmethoden der modernen Landwirtschaft haben dazu geführt, dass die Größe der Felder stetig zunimmt und dabei Grenzlinien, Hecken und Brachflächen zusehends verschwinden. Das macht beiden Arten schwer zu schaffen.
Andere Tiere profitieren von den Veränderungen durch den Menschen und vermehren sich besonders stark. Wildschweine finden im Augenblick optimale Lebensbedingungen: Reichlich Mais, viel Getreide, dazu Raps im Frühsommer und dazwischen Wälder mit ordentlich Unterwuchs und Gestrüpp zum Verstecken. Rehe gibt es durch Landwirtschaft und Waldbau heute ebenfalls besonders zahlreich und die aktuelle Forderung, verstärkt auf Laubbäume zu setzen, kommt ihren Ernährungsgewohnheiten sogar noch einmal entgegen.
JAGD ALS NACHHALTIGE NUTZUNG
In dieser menschengemachten Landschaft findet die Jagd statt. Sie ist wie Land- und Forstwirtschaft eine Form der Landnutzung: statt Holz und Feldfrüchten wird Wildfleisch „erzeugt“. Trotzdem gibt es keine Flächen, die ausschließlich für die Jagd genutzt werden – umgekehrt aber kaum Gebiete ohne Jagd.
Außerhalb der Städte und Dörfer wird überall gejagt, auf den Feldern, den Wiesen und in den Wäldern. Unmittelbar hinter dem letzten Gartenzaun beginnt in der Regel ein Jagdrevier. Das Recht auf einer Fläche zu jagen liegt zunächst bei den Eigentümern, häufig wird es aber verpachtet. Der Fall, dass Eigentum, Jagd und Bewirtschaftung in einer Hand liegen, ist ausgesprochen selten. Trotzdem sind jagdliche, waldbauliche und landwirtschaftliche Nutzung eng miteinander verflochten. Gibt es Probleme mit wildlebenden Tieren, sind die Jägerinnen und Jäger vor Ort die ersten Ansprechpartner. Nur sie dürfen beispielsweise Wildschweine schießen, die frisch gesäte Maiskörner wieder ausbuddeln, oder Rehe erlegen, die gepflanzte Bäume anknabbern.
DER UMGANG MIT WILD & WILD SCHÄDEN
Wilde Tiere ecken in einer fast vollständig vom Menschen genutzten Landschaft an. „Wildschäden“ werden alle von Wildtieren verursachten Veränderungen genannt, die der Planung des Menschen zuwiderlaufen: