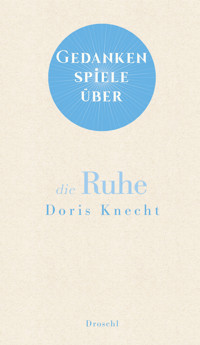9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Doris Knechts Debütroman geht es dem Karrieristen Gruber an den Kragen. Der Manager, Mitte dreißig, hat sich sein Leben zwischen Topjob, Flughafenlounges, Designappartement und Bettgeschichten hübsch eingerichtet. Er gefällt sich als zynischer Bescheidwisser, der seine Geliebte auch schon mal zum Weinen bringt, damit sie lernt, was die Realität von TV-Soaps unterscheidet. Dass er sich aber selbst mit einem coolen, sexy Superhelden verwechselt, dass er dann doch ein bisschen kleiner und schwächer ist als die Realität, das muss Gruber erfahren, als ein Tumor in seinem Bauch entdeckt wird. Gruber säuft, feiert durch und prügelt sich. Gruber macht Selbsterfahrung und Chemotherapie. Und Gruber verliebt sich. Schließlich wird er wieder heil. Aber er ist am Ende kein besserer Mensch. Vielleicht nur ein bisschen offener, liebevoller und kompromissbereiter. Vielleicht. Schmissig und pointenreich treibt Doris Knecht ihren höchst neurotischen und oft komischen Helden voran, bis in die Arme einer schlauen Berliner DJane – die in Gruber irgendetwas sieht, was nicht einmal Gruber selbst in sich sehen kann, und die sich ebenfalls mordsmäßig verliebt ... Ein vielschichtiger Roman voller Witz und Wut. Und ein Held, in dem sich jeder wiedererkennt – auch wenn er gar nicht will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Doris Knecht
Gruber geht
Roman
Über dieses Buch
In Doris Knechts Debütroman geht es dem Karrieristen Gruber an den Kragen. Der Manager, Mitte dreißig, hat sich sein Leben zwischen Topjob, Flughafenlounges, Designappartement und Bettgeschichten hübsch eingerichtet. Er gefällt sich als zynischer Bescheidwisser, der seine Geliebte auch schon mal zum Weinen bringt, damit sie lernt, was die Realität von TV-Soaps unterscheidet. Dass er sich aber selbst mit einem coolen, sexy Superhelden verwechselt, dass er dann doch ein bisschen kleiner und schwächer ist als die Realität, das muss Gruber erfahren, als ein Tumor in seinem Bauch entdeckt wird. Gruber säuft, feiert durch und prügelt sich. Gruber macht Selbsterfahrung und Chemotherapie. Und Gruber verliebt sich. Schließlich wird er wieder heil. Aber er ist am Ende kein besserer Mensch. Vielleicht nur ein bisschen offener, liebevoller und kompromissbereiter. Vielleicht.
Schmissig und pointenreich treibt Doris Knecht ihren höchst neurotischen und oft komischen Helden voran, bis in die Arme einer schlauen Berliner DJane – die in Gruber irgendetwas sieht, was nicht einmal Gruber selbst in sich sehen kann, und die sich ebenfalls mordsmäßig verliebt ... Ein vielschichtiger Roman voller Witz und Wut. Und ein Held, in dem sich jeder wiedererkennt – auch wenn er gar nicht will.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Anzinger | Wüschner | Rasp, Münschen
Umschlagabbildung: © plainpicture/Kniel Synnatzschke
ISBN 978-3-644-10831-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Gruber geht aus dem Zimmer, geht aus der Wohnung, geht aus dem Haus. Es ist sechs Uhr früh; ein Taxi wartet schon am Rand des Gehsteigs, der Fahrer steigt aus und öffnet Gruber den Kofferraum. Guten Morgen. Guten Morgen. Gruber setzt sich nach hinten, legt Umhängetasche und Trenchcoat neben sich, dabei knistert das Kuvert boshaft in seiner Manteltasche. Ein grelles Unbehagen rast durch Gruber und legt einen Augenblick lang sein Bewusstsein lahm. Nein, gar nicht daran denken, nicht (der Schmerz schläft noch, seit drei Tagen schon, okay, einfach schlafen lassen) daran denken. Gruber ignoriert das ungute Gefühl und steckt die Kopfhörer an sein iPhone, geredet wird jetzt nicht. Nur nicht reden um diese Zeit. Überhaupt nicht reden mit Taxifahrern, nie mit Taxifahrern reden. Der iPod spielt Dylans «Tell Tale Signs», die Bootlegs, das Beste, wie Gruber findet, das Dylan in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Gruber hört seine Musik passend zur Tageszeit und passend zur Aussicht. Dylan passt immer. Es ist noch dunkel, die Straßen sind leer, die Stadt hat ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht. Nach fünfzehn Minuten fährt das Taxi an der Ölraffinerie vorbei, ein Moment, den Gruber auch beim tausendsten Mal nicht verpassen möchte. Dylan singt über das Mädchen vom «Red River Shore», und wie er sie heiraten will, und wie sie ihm ihren besten Rat gibt: dass er heimgehen und ein einfaches Leben leben soll. Gruber starrt auf die vorbeiziehenden Lichter der Raffinerie, Hunderte, Tausende von nackten Glühbirnen an Containern und auf Türmchen und Masten, glühendkalte industrielle Schönheit. Ein einfaches Leben. Hm. Gruber denkt an das Kuvert, an den Scheißtag, der vor ihm liegt, er denkt an den Abend, er denkt an Denise, vielleicht wird er heute mit Denise schlafen. Er denkt an Denise, Dööönis, wie sie unter ihm liegt und ihm nicht in die Augen schaut. Er war allerdings, na ja, letztes Mal danach irgendwie unlocker ihr gegenüber, brüsk, und hat dann zwei oder drei ihrer Mails nicht beantwortet. Vielleicht wird er heute doch nicht mit ihr schlafen. Nicht: Deniiise. Dööönis.
Dann sind sie am Flughafen. Gruber zahlt, steigt vorsichtig aus (nicht den Schmerz wecken), hebt, diese stinkfaulen Wiener Taxler, seinen Koffer selbst aus dem Kofferraum und zieht ihn über die Straße zum Terminal A. Sein Trolley wiegt, er weiß das, er hat das zuhause überprüft, zwei Mal hat er es überprüft, genau 7,7 Kilo, das geht als Handgepäck durch. Gruber hat keine Zeit fürs Warten an Gepäckbändern: Von einem Bein aufs andere treten. Auf die Uhr schauen. Sich eine gute Position sichern. Das Leben vorbeiziehen sehen. Auf die Uhr schauen. Auf die Uhr schauen. Auf die Uhr schauen. Er ist froh, dass er niemanden hier kennt; es gibt wahrscheinlich nichts Entsetzlicheres als Smalltalk frühmorgens am Gate. Im Trolley befinden sich zwei gute Hemden, ein Slimane-Anzug, ein Unterhemd, zwei Boxershorts, zwei Paar Socken, ein Kabel für sein Notebook, ein Akku für sein iPhone und sein gesamter Hygienebedarf in 75-ml-Plastikflaschen, Shampoo, Conditioner, Duschgel, Rasierwasser. Danke 9/11. Er braucht seinen Trolley nicht aufzugeben, die Formalitäten sind schnell erledigt, unter anderem weil Gruber sich an sein Prinzip für solche Situationen hält, wenngleich dieses im diametralen Widerspruch zu seiner Persönlichkeit steht: Immer freundlich zu Dienstleistern sein. Natürlich nur aus Gründen des Vorteils. Das ist, Gruber hat es ausprobiert, zeitsparend und damit nutzbringend. Immer freundlich zu sein, immer zuvorkommend. Jedenfalls solange es keinen konkreten Anlass zu entschiedener Unfreundlichkeit gibt. Hier und jetzt gibt es ihn nicht. Hier und jetzt hat er es, wie meistens um diese Zeit, mit einer unausgeschlafenen jungen Frau in schlecht sitzender, billiger Uniform zu tun, die es gewohnt ist, von unausgeschlafenen Passagieren überheblich und grob behandelt zu werden. Diese hier hat zu schwarze Haare, zu stark gezupfte Augenbrauen, zu klumpige Wimperntusche und zu viel solariumfarbenes Make-up im Gesicht. Sie reagiert auf Grubers muntere Freundlichkeit extrem positiv. Nein, euphorisch. Grubers Trolley könnte auch zwölf Kilo wiegen, kein Problem.
Im Flieger sitzt Gruber allein in der linken Dreierreihe, auf der anderen Seite sitzt eine Frau allein in der rechten Dreierreihe. Die Frau wirft begehrliche Blicke auf seine Zeitungen, und Gruber reicht ihr, nachdem sie etwas von verschlafen und vergessen und viel zu früh stammelte, was er ausgelesen hat, Kurier, Standard, Krone, FAZ, Financial Times, sie lächelt ihn jedes Mal müde, aber dankbar an. Er kennt ihr Gesicht von irgendwo her, sie hat wuschelige, leuchtend dunkelblonde Haare, Ringe unter den Augen, einen breiten, vollen Mund, woher kennt er ihr Gesicht? Gruber denkt darüber nach, sie sieht interessant aus, aber sie ist nicht schön genug, dass er sich länger mit der Frage beschäftigen will, wo er sie schon einmal gesehen hat. Egal. Wenn’s wichtig wäre, wüsste er es. Sex hatte er nie mit ihr, Gruber ist sich (der Schmerz, er ist noch da, und er wacht jetzt auf) relativ sicher. Nicht hundertprozentig, aber fast. Als der Flieger seine Flughöhe erreicht hat, steckt sich Gruber wieder die Stöpsel in die Ohren, hört noch zwei, drei Mal «Red River Shore» und scrollt dann (der Schmerz regt und räkelt sich unter Grubers Bauchdecke, aber er schwächelt, vielleicht verschwindet er wieder, wenn Gruber ihn ignoriert) vor auf elf, die Orgel. Die Orgel ist bitte ein Wahnsinn. Er würde gerne der Herzog eine SMS wegen dieser Orgel schicken, aber erstens ist er in der Luft, zweitens würde die Herzog den Titel zu persönlich nehmen, man kann der Herzog keinen Song empfehlen, der «Dreamin of You» heißt, ohne dass sie das als Signal auffasst, sich Gruber wieder einmal ein bisschen an den Hals zu werfen. Die Herzog hat (Gruber nimmt jetzt doch lieber eine 400er Seractil und spült sie mit einem Schluck Wasser hinunter) die merkwürdige Angewohnheit, sich temporär in Gruber zu verlieben, wenn Gruber sie mit irgendwas rührt, und die Orgel wäre definitiv geeignet, die Herzog zu rühren. Diese Möglichkeit trachtet Gruber zwar nicht grundsätzlich zu vermeiden, aber doch für kargere Zeiten zu reservieren.
Die Dylan-Manie, die passt nicht zu Gruber. Gruber sieht nicht aus wie der typische Dylan-Fan und er benimmt sich nicht wie der typische Dylan-Fan. Gruber weiß es, und er redet deshalb eher gar nicht darüber. Seine Kollegen und Geschäftspartner gehen heimlich in Puffs oder in Swingerclubs oder masturbieren bei Testfahrten in Autos, die sie sich nicht leisten können. Gruber hört heimlich Dylan. Philipp weiß es, und Kathi natürlich, und er spricht mit dem Bachmeier darüber und mit der Herzog, die eine der wenigen Frauen ist, mit der Gruber überhaupt spricht, also im Sinne von: reden, nicht aufreißen. Was vielleicht damit zu tun hat, dass die Herzog eine der wenigen Frauen ist, die überhaupt über Musik reden. Bloß kommt es Gruber mitunter vor, als wolle sie Dylan vor einem wie ihm beschützen, vollkommen bescheuert, sie nervt, sie macht ihm das kaputt in ihrer überkritischen Art, denn Gruber findet keineswegs, dass man leben und denken und daherkommen muss wie Dylan, um Dylans Musik mögen zu dürfen, also überhaupt nicht. Kompletter Blödsinn, bitte. Die Herzog findet das schon, obwohl ihr selbst dafür jegliche Basis fehlt, absolut jede; weder lebt noch denkt und zum Glück sieht sie auch nicht aus wie Dylan. Die Herzog lebt unter einer Klimt-Zeichnung, sie hängt über ihrem Sofa und hing einst im Vorraum der Gästetoilette ihrer Eltern, und der Klimt ist eins der wertloseren Dinge in ihrem Dasein, jetzt mal abgesehen vom ideellen Wert. Der Kühlschrank der Herzog ist vermutlich teurer als die Klimt-Zeichnung. So gesehen ist es ein permanenter Fehler, die Herzog nicht anzubaggern, eigentlich sollte er die Herzog bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit aufs Standesamt schleppen, lebensversicherungstechnisch. Aber auf keinen Fall besteht auch nur der Furz eines Anlasses, sich von der Herzog wegen Dylan Vorhaltungen machen zu lassen.
In Zürich kommt Gruber am nervigen Gate E an, von dem man mit der einzigen Schweizer U-Bahn zur Ankunftshalle fahren muss. Dort zieht er sich mit den wieder einmal wohlüberlegt – Gruber fühlt eine tiefe, warme Selbstzufriedenheit in sich aufsteigen – mitgenommenen Franken-Münzen ein Ticket, setzt sich in den Zug und schreibt, während er durch die Zürcher Vorstadt fährt, sofort vom iPhone eine SMS an Carmen: «zürich. diese scheißstadt schon wieder. eben hat mich einer wegen dem iPod angepflaumt. so typisch.» Das ist gelogen. Es ist meistens gelogen, was Gruber Carmen aus Zürich oder München oder Mailand oder Manchester oder Darmstadt oder Sofia oder Graz oder Frankfurt am Main simst, aber er hat da diese schöne Tradition mit ihr. Warum jetzt damit aufhören. Carmen mag mittelgroße Städte, Gruber hasst mittelgroße Städte, was insofern peinigend ist, als Carmen ständig in Metropolen zu tun hat und Gruber permanent in mittelgroßen Städten. Carmen simst, wie immer, zurück, dass er ein Idiot ist, dass er endlich die Feldberger anrufen soll, die geht mit ihm in ein wirklich gutes Restaurant zum Essen oder in ein lässiges Lokal etwas trinken oder bekocht ihn und stellt ihm lässige, interessante Leute vor, auf jeden Fall findet er mit der Feldberger zuverlässig einen Platz in Zürich, an dem Zürich wie eine Stadt aussieht und nicht wie ein Millionendorf, herzliche Grüße aus Bejing. Wie immer ignoriert Gruber das, denn darum geht es nicht. Darum geht es doch nicht! Es geht darum, dass man mittelgroße Städte aus Prinzip hassen muss, aus Prinzip, weil einen mittelgroße Städte unablässig spüren lassen, dass man nicht in einer großen, einer echten Stadt und folglich ein kompletter Versager ist. Dass man es nicht geschafft hat, dass DU es nicht geschafft hast. An jeder herausgeputzten Ecke lassen sie einen das spüren. Vor jedem scheiß Provinz-Designerladen spürst du es, in jedem zweitklassigen Spießerrestaurant, das einen auf kosmopolitisch macht. Scheiß Zürich. Carmen ist die einzige Person auf der Welt, die in so einer Stadt Freunde findet. Gruber hat in so einer Stadt nichts als Feinde. Geschäftspartner. Taxifahrer. Hotelportiers, Designerladenverkäuferinnen. Huren, Chefs des Maisons, alle feindlich. Er wird Carmen heute Abend aus der Kronenhalle eine Mail schicken, die pfeifen wird, weil es dort wieder recht scheiße sein wird. Scheiße wie immer, in herrlichem Ambiente, aber ungeheuer scheiße.
Gruber stellt «Dreamin of You» auf repeat und überlegt, ob er Denise anrufen soll. Vielleicht würde es sie ja versöhnen, von ihm aus dem Schlaf gerissen zu werden. Da muss es einer doch ernst meinen, wenn er dich schon vor neun Uhr früh sprechen will. Oder wenn er übersieht, wie früh es noch ist, weil er dich so vermisst. Das wäre doch einmal ein schönes Signal. Das müsste eine wie die doch gut finden. Andererseits wird Gruber durch diesen Gedankengang selber wieder bewusst, wie früh es noch ist, und dass er so früh überhaupt nicht spricht, so früh spricht er aus Prinzip mit niemandem, außer es dient dem Geschäft. Selbst wenn das jetzt seine Chancen auf einen netten Fick erheblich schmälert: nein. Außerdem kann er Denise diesmal nicht mit zu diesem Essen in die Kronenhalle nehmen, er muss mit diesen Trotteln hin, da kann sie nicht dazu, trotz ihres Arsches. Er müsste ihr (Gruber legt seine Hand auf seinen Bauch, drückt vorsichtig, fester, gut, da ist nichts mehr) auf eine nette, charmante Weise klarmachen, dass sie erst später erwünscht ist, dann aber außerordentlich, und dass es viel netter für sie wäre, wenn sie auf das mittelmäßige, ja miese Essen in der Kronenhalle verzichtet und stattdessen ins Kino geht oder mit einer Freundin was trinkt und ihn erst später in der Bar trifft, die Freundin kann sie ja mitbringen. So müsste das sein, Gruber weiß allerdings genau, dass ihm die charakterlichen Voraussetzungen, die ihm erfolgreiches Schönreden von sichtlich ungünstigen Situationen ermöglichen würden, nicht gegeben sind. Er würde es versauen, so oder so, also kann er es genauso gut später versauen, wenn er fitter ist und das erste Scheißmeeting hinter sich gebracht hat. Überhaupt Dööönis, so toll bist du auch wieder nicht. Guter Arsch, aber sonst, Dööönis, musst du gar nicht glauben, dass du so toll bist.
Am Bahnhof steigt Gruber aus, geht in die lichte Halle, zieht sich ein paar hundert Franken aus dem Automaten, kauft sich die Neue Zürcher Zeitung, den Blick und GQ, scharfe Kaugummis und Zigaretten und zündet sich noch am Kiosk eine an. Gruber raucht nicht. Gruber raucht nur dann und wann einmal eine nach Steuererklärungen, nach Umzügen, nach dem Sex, nach dem Essen, nach Flügen, nach schwierigen Besprechungen, wenn es sehr kalt ist, wenn es sehr heiß ist, wenn ungeöffnete Briefe in seiner Manteltasche knistern. Er raucht nur, wenn es die Situation erfordert, es geht dabei ausschließlich um die Situation, nicht um die Zigarette, nicht um etwas wie Sucht. Die Zigarette ist der Situation geschuldet, man muss Situationen ernst nehmen, muss sie mit Respekt behandeln, sonst wenden sie sich gegen dich. Man muss rauchen, wenn es die Situation erfordert; und das ist jetzt der Fall, er beruhigt die Situation und die Situation weiß es zu würdigen, er spürt es schon, die Situation meint es jetzt gut mit ihm, irgendetwas wird heute gelingen. Gruber reißt sich den Rauch in die Lunge, bis er am Taxistand ist, und tritt die Zigarette dann aus. Zum Hotel Greulich. Bei der Bäckeranlage, ja, genau. Das Taxi ist so überheizt, wie es schon das Zugabteil war, er wird sich erkälten bei diesen ständigen brutalen Temperaturwechseln, das ist schon mal sicher. Gruber steckt sich wieder die Musik in die Ohren, schon gar nicht will er mit einem Schweizer Taxifahrer reden. Man versteht sowieso nichts, es ist eine unerträgliche Qual.
Das Greulich hat er sich idiotischerweise von Carmen einreden lassen. Das ist ganz schlecht, ganz schlecht, weil er, wäre er nicht im Greulich, sondern im Seehotel oder im Theatro, Carmen eine Mail über die Zumutung von Zürcher Hotels wie dem Seehotel oder dem Theatro schicken könnte, die so schön tun und doch nur hübsch eingewickelten Mindeststandard verkaufen, und Carmen würde ihm antworten, warum er nicht endlich einmal im Greulich übernachtet, wie sie es ihm immer sagt. Geh ins Greulich! Das wird ihm nicht mehr passieren, dass er auf einen Rat von Carmen hört, es schneidet ihm seine Kontaktmöglichkeiten zu ihr ab. Das Greulich ist angenehm. Schön, aber nicht aufgeplustert, modern, aber nicht totdesignt. Das Zimmer ist, Gott sei’s gepriesen, moderat beheizt. Im Hof gibt es einen kleinen Birkenwald mit Tischchen und Stühlchen, die Idylle ist derart überinszeniert, dass es schon wieder lässig ist. Man frühstückt überwiegend in der Gesellschaft von Künstlern, Schriftstellern oder Architekten, was Gruber wurscht sein sollte. Völlig einerlei sollte Gruber das sein. Gruber ist bitte keiner, der irgendein Interesse daran pflegt, wer um ihn herum sein Leben wie und zu welchem Zweck in den Sand setzt, und es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres als angestrengten Smalltalk an Hotelfrühstücksbuffets. Dass er sich von Carmen dabei ertappen hat lassen, dass er sich in der Gesellschaft von Künstlervolk wohler fühlt als in Gesellschaft von mittelbilligen Business-Anzügen, wurmt ihn zusätzlich. Er ist ein Mover und Shaker, verdammt noch mal, das heißt, ihn können ALLE mal. Komplett alle. Sie wird das büßen. Büßen, büßen, büßen. Gruber lässt sich seinen Schlüssel geben, Zimmer Nummer 18, wie immer, unterschreibt den Zettel und winkt ab, als ihm Gepäcktransport angeboten wird. Er rollt seinen Trolley am Restaurant vorbei nach draußen in den Hof, über einen dunklen Bretterboden um den Birkenwald herum und zu seinem Zimmer, schließt auf, setzt sich aufs Bett, holt sein iPhone raus. «ist dir eigentlich klar, dass ich gegen birken allergisch bin? dieses scheißgreulich.» Carmen antwortet, während Gruber sein Hemd wechselt, mit sechs Worten. «honey. es ist märz. keine pollen.» Aber Gruber setzt noch eins drauf, «anyway. fack zürich», und darauf antwortet Carmen nicht mehr.
Der ist irgendwie crazy. Der hat sie irgendwie nicht alle. Man sieht ihm das nicht gleich an, ich meine, er schaut ja nicht schlecht aus. John schaut ganz gut aus, so groß halt, bisschen schlaksig, gute Haare. Weiß, wie man redet, wie man sich anzieht. Gute Schuhe, saubere Fingernägel, das ist heutzutage ja nicht selbstverständlich! Und er hat auch Manieren, jedenfalls solange er sie unbedingt braucht. Danach merkst du ziemlich bald, dass er einen an der Waffel hat. Ich meine, lustig an der Waffel. Ein Wiener halt, irre charmant, aber im Prinzip unzurechnungsfähig. Ich hatte schon einmal einen Wiener, die sind offenbar alle so. So geschmeidig, so elastisch irgendwie, diese unglaubliche Fähigkeit, sich um sein Gegenüber herumzuwickeln. Jetzt nicht wörtlich. Eben nicht so plump wie einer aus dem Aargau oder so. Du hast das Gefühl, die interessieren sich wirklich für dich, und sind auch noch witzig. Und großzügig ist John auch, auf eine vollkommen selbstverständliche Weise, ich meine, geizige Männer, das geht bei mir ja gar nicht. Ich hab John in der Kantine kennengelernt, das ist ja schon abartig genug, ich meine, einen Schweizer würdest du nie einfach so in der Kantine kennenlernen. Zeig mir einen Schweizer, den man in der Kantine kennenlernen kann. Einen Schweizer kannst du umrennen, einmal auf ihn drauf steigen, zweimal deinen Absatz auf seinem Gesicht umdrehen, er entschuldigt sich und kriecht zur Kassa, ohne dich auch nur zur Kenntnis genommen zu haben. Aber der ist eben kein Schweizer. Macht einen natürlich auch misstrauisch: Das hätte sonst eine sein können, die ihm das Wasser vom Tablett rempelt, Susan Boyle, Sarah Palin, Alice Schwarzer, was weiß ich, John würde vermutlich naturbedingt sofort die Charmemaschine anwerfen, der flirtet sicherheitshalber jede an, die ihn anrempelt. Der hat das in den Genen, nehme ich mal an. Automatisch schauen, was geht, und dann erst schauen, was das für eine ist, bei der was ginge. Man kann dann ja immer noch höflich abwinken.
Aber dann hatte ich den an der Backe. Fand ich ja zuerst gar nicht super. Eigentlich irrsinnig unsuper. Darf ich mich zu Ihnen setzen, darf ich Sie einladen, den ganzen Scheiß, meine Güte. Nein. Nein, hab ich gesagt! War dem aber egal, und nach zwei Minuten war es mir auch egal, also eigentlich war’s mir da schon recht, der kann was, das habe ich gleich gemerkt. Der hatte wohl irgendeinen Terminmarathon in unserem Konzern, irgendwelche Verhandlungen, Vertragsdetails abklären, was weiß ich, am nächsten Tag auch, aber für den Abend hat er mich zum Essen eingeladen, und da hat er mich schon genug interessiert, dass ich zugesagt habe. Charme, das hat der. Wir haben uns in der Kronenhalle getroffen, und zuerst hat er nur geschimpft: Das Essen, der Service, der Wein, die Preise, er war ziemlich laut und ungut, er ging mir extrem auf den Geist. Vielleicht war er nur nervös, und ich wollte, ehrlich gesagt, schon verschwinden. Ich habe echt überlegt, ob ich aufs WC gehen, mir hinten heimlich den Mantel geben lassen und durch die Bar abhauen soll. Kein Scheiß, ich habe wirklich ernsthaft darüber nachgedacht. Als er ein bisschen etwas getrunken hatte, wurde es besser, und da wurde er dann wirklich witzig und aufmerksam und wir haben ziemlich entspannt geplaudert. Wie er erzählt hat, was er macht, das hatte irgendwie Feuer. Und, blödes Wort, aber es passt, Leidenschaft. Und immer in diesem Wienerisch, das war irgendwie süß. Und er kann zuhören, zeig mir einen Mann, der zuhören kann. Und er ist nicht verheiratet und hat keine Freundin! Also, wenn’s wahr ist, aber ich glaub schon. Ich meine, der ist so launisch, den hältst du in Wirklichkeit höchstens zehn Stunden am Stück aus und dann auch nur, wenn er sechs davon schläft. Und dann auch nicht, weil er schnarcht wie eine Sau. Wir sind dann noch ins Mascotte, da war er schon ziemlich zutraulich, aber nicht auf dumm, sondern okay irgendwie, und wie wir um eins oder so raus sind, hat er mich auf der Straße geküsst, und zwar ganz gut, und da habe ich gedacht, okay, auch schon egal. Wir haben uns ein Taxi genommen und sind zu mir. Da wurd’s dann eher komisch, weil er dann bei mir plötzlich total anders war. Total zögerlich auf einmal. Ich habe ihn auf dem Sofa platziert und eine Flasche Wein aufgemacht. Und komischerweise wollte er dann auf einmal wieder reden. Und nichts als Unsinn. Er hat immer so blöd gesagt: Döööönisdöööönisdöööönis, schöne Wohnung, Döööönis, schönes Sofa, Döööönis, was machst du so, Döööönis, und Dööönis, hast du was von Bob Dylan hier?, Döööönis, nur so Scheiß, das ging mir schwer auf den Keks. Ich meine, Bob Dylan, der hat sie doch nicht alle. Und ich wollte auch schon lang nicht mehr reden, haha, aber ich mußte mich ihm praktisch auf den Schoß werfen, damit er mit dem Quatschen aufhört und etwas weitergeht, bevor es mir endgültig zu dumm wurde. Und ich war SO kurz davor. Aber dann hat er sowieso ... und es war ziemlich. Na ja. Seltsam. Schon okay, aber schon sehr seltsam. Zwischendurch war er extrem süß und super, aber dann hat er mich wieder so angefasst, so, so kalt und distanziert, und als sei er wütend. Komisch war das. Danach konnte er nicht schnell genug wegkommen, das fand ich ziemlich ungut. Er hat gesagt, er muss früh auf am nächsten Tag, Termine, Termine, das übliche Plingplong. Ermüdend. Als er draußen war, bin ich im Bett gelegen und hab mir gedacht: Trottel. Und: dumme Kuh. Das war jetzt aber nötig, was.
Immerhin hat er dann, ich nehme an vom Taxi aus, noch eine ganz nette SMS geschickt, und am nächsten Tag sogar angerufen und gesagt, er ist auf dem Weg zum Flughafen, und ob es okay ist, dass er sich wieder meldet, wenn er in Zürich ist. Ich sagte klar, obwohl ich mir nicht sicher war. Ich hab ihn danach noch zweimal getroffen, und es war immer ähnlich. Es war immer ein Teil super, und ein Teil total bescheuert, zum Davonrennen, und der Sex ist ... also er kann wirklich noch was lernen beim Sex. Das zweite Mal habe ich bei ihm im Hotel übernachtet, und das war eigentlich in Ordnung. Da wollte er, dass ich bleibe, er wollte sogar, dass ich in seinem Arm einschlafe. Aber in der Früh war er wieder so irrsinnig unangenehm, brüsk, abweisend und direkt gemein, sodass ich dann nicht mehr mit ihm gefrühstückt habe. Wollte er wahrscheinlich auch erreichen. Und deswegen hab ich ihm danach eine wütende Mail geschickt. Darauf hat er nicht einmal geantwortet, der kann mich jetzt mal, aber echt.
Der Tag war Mist. Tonnenweise aus dem Fenster geschmissene Energie. Völlig für den Hugo. Gruber weiß schon, dass aus dem Geschäft nichts werden wird, so viel hat Gruber schon gelernt, im Urin hat er es, dass aus diesem Deal hier nichts wird. Trotzdem muss er mit den Leuten, die ihm morgen vor dem Abflug oder übermorgen per Mail mitteilen werden, dass aus der Sache leider nichts wird, heute noch essen gehen. Und so tun, als gäbe es das Geschäft noch, so tun, als glaube er, das Geschäft würde stattfinden, wäre noch zu retten, als wären nur noch ein paar Details zu klären. Es ist eine einzige beschissene Selbsterniedrigung. Diese brechlangweiligen Pisser.
Gruber sitzt in Unterhosen auf dem Bett im Hotel, sein Anzug hängt an einem Bügel. Er nimmt den Brief aus seinem Mantel und steckt ihn ins Zippfach seiner Tasche, trinkt einen Wodka-Tonic, den er sich von der Bar hat bringen lassen, checkt seine E-Mails, linkt sich ins Facebook ein, checkt sein Profil und was in der Zwischenzeit passiert ist. Nur Unsinn, wie meistens, er weiß gar nicht, was er in diesem blöden Facebook überhaupt macht: Phil Grill gibt bekannt, dass er für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren beabsichtigt, der Stallinger hat in der Früh irrtümlich die Unterhose seines achtjährigen Sohnes angezogen und kann jetzt im Meeting nur wimmern, Philipp hat den «Welcher-achtziger-Jahre-Song-bist-du»-Test gemacht und ist mit dem Ergebnis, Whams «Wake me up before you go go», extrem unzufrieden, Jenny hat ihn für 650 Dollar als pet gekauft und in «fucking asshole» umbenannt, es gibt eine vollkommen sinnfreie Debatte über Honzos Haarschnitt, das Fräulein Blauensteiner wünscht sich, dass es endlich Frühling werde und hat schon mal ein paar Fotos von sich mit sehr wenig Textil hochgeladen, der Bachmeier fragt, ob Gruber die neue Dylan schon gehört hat. Fünf seiner Freunde haben ihr Profil-Bild geändert. Er hat acht neue Freundschaftsanträge, sechs von den Leuten sind ihm unbekannt. Er lehnt alle Männer ab und akzeptiert alle Frauen, man nimmt, was man kriegen kann, in diesen mageren Zeiten. Gruber schreibt «sitzt nackt in Paris und trinkt Champagner» in die Statuszeile und versucht, Jenny anzuchatten, aber sie ist schon wieder offline. Ein paar seiner Freunde, darunter Philipp, sind online, aber Gruber hat keine Lust, mit einem von ihnen zu quatschen, worüber auch, was hat man sich schon zu sagen. Gruber loggt sich wieder aus, masturbiert, während er sich Denise vorstellt und dann Jenny und diese Sache, die sie mit ihm gemacht hat, dann geht er duschen. Er beschließt, mit der Tram zur Kronenhalle zu fahren, ein Taxi kriegt man in diesem Drecknest sowieso nicht.
Er steigt eine Station früher aus der Straßenbahn und läuft zu Fuß über die Brücke. Nur, falls die Herren Stinkfad und Sackblöd bei seiner Ankunft gerade aus dem Taxi steigen, dann könnte er nämlich sagen, er hat noch einen kleinen Spaziergang vom Hotel her gemacht. Er ist nämlich ein Naturbursch, voll im Saft, damit das klar ist, mit Spitzenkondition, er geht oft zwischendurch einmal ein paar Kilometer, macht dich locker, lüftet dich schön aus, speziell an einem so klaren Märzabend ... Das Geschäft wird es nicht retten, aber die Wichsköpfe fühlen sich vielleicht noch beschissener als sie sich hoffentlich eh schon fühlen.
«Ja.»
«Deine Mutter!;»
«Ja, Mama. Ich weiß, Mama. Morgen.»
Irgendwas stimmt nicht. Gruber kann sein rechtes Auge spüren. Und es geht nicht auf. Das Auge pocht. Das Auge pocht irre. Nein, eigentlich pocht der ganze Kopf.
«Guten Morgen, mein Schatz. Wo bist du?»
«In Mailand, Mutter.»
Gruber spürt auch seine Unterlippe. Sie spannt und schmerzt und fühlt sich gleichzeitig taub an. Irgendetwas stimmt absolut nicht.
«Wie geht es dir?»
«Gut, Mutter.» Gruber fühlt sich insgesamt taub an, schwammförmig. Spongejohn.
«Hast du den Anwalt angerufen? Das Grundstück.»
Das Grundstück, genau. Hat er nicht. Das Grundstück ist ihm egal. Vor allem ist ihm das Grundstück jetzt in diesem Moment egal. Gruber möchte wissen, warum sein Auge pocht. Warum es sich so geschwollen anfühlt. Gruber möchte unbedingt wissen, wie ein Auge aussieht, das derart pocht. Er braucht jetzt Ruhe, um sich an den Grund zu erinnern, warum sein Auge so aussieht und sein Kopf sich so anfühlt, und dann braucht er Ruhe, um diese Erinnerung zu verdrängen und sich darum zu kümmern, dass sein Auge besser aussieht. Und dann braucht er eine Zigarette, unbedingt.
«Mutter, ich kann jetzt nicht. Ich bin auf dem Weg zu einem Meeting.»
«Bist du nicht, Johannes. Ich höre doch, dass du noch im Bett liegst.»
«Ich sitze im Taxi.»
«Tust du nicht. Was ist mit deiner Lippe los? Du sprichst so undeutlich.»
«Gar nichts, Mama, alles okay, es geht mir gut, alles okay.»
Alles okay. Gruber muss an das ungeöffnete Kuvert denken.
«Du klingst aber nicht so.»
«Ich bin nur müde. Und, na gut, ein bisschen verkatert. Ich ruf dich später zurück. Ich muss jetzt duschen. Wie spät ist es überhaupt?»
«Halb acht, Johannes. Die beste Zeit, um den Anwalt zu erreichen. Danach ist er wieder beim Gericht. Du hast seine Handynummer. Du hast doch noch seine Handynummer?»
«Hab ich. Irgendwo. Mutter, ich rufe dich zurück.»
«Und ruf bitte Katharina an.»
«Warum soll ich Kathi anrufen?»
«Achter März. Sie hat Geburtstag, wenn du dich erinnerst. Oder schreib ihr wenigstens eine SMS.»
«Mach ich, versprochen, ich muss jetzt aufhören.»
«Du klingst nicht gut. Fliegst du heute ...?»
«Bitte, Mutter, ich muss, ich leg jetzt auf, ich melde mich später, ich schwöre es. Hab dich lieb.»
Gruber drückt auf die rote Taste und lässt das Telefon aus der Hand aufs Bett rutschen. Er bleibt auf dem Rücken liegen und betastet vorsichtig sein Gesicht. Nicht gut. Fühlt sich nicht gut an. Tut weh. Tut sauweh. Sein rechtes Auge ist eindeutig geschwollen, seine Lippe ist blutig und schorfig und definitiv dicker als normal. Außerdem hat Gruber, das stellt er nun fest, sein Hemd noch an, und soweit er es überblicken kann, hat es nicht mehr die Originalfarbe. Das Hemd sollte fliederfarben sein, ein sehr zartes, dennoch männliches, zweifelsfrei unschwules Flieder. Ist es nicht mehr. Gruber tastet nach den Seractil neben sich, die er sich abends gewohnheitsmäßig zurechtlegt, und schiebt sich vorsichtig ein Stück zum Kopfende des Bettes hinauf. Au. AU, verdammt! Er greift nach der Wasserflasche und schraubt sie auf, ohne hinzusehen. Während er sich die Tablette zwischen die wunden Lippen schiebt und vorsichtig die Flasche ansetzt, wird Gruber klar, dass das nun der Punkt wäre, an dem er darüber nachdenken sollte, was gestern war. Dass er sich nun Stück für Stück die letzte Nacht vergegenwärtigen sollte, angefangen mit, gut, angefangen an dem Moment, an dem er sanft, aber entschieden aus der Kronenhalle entfernt wurde, geleitet von zwei kräftigen, wahrscheinlich italienischstämmigen Kellnern, hinter denen die Maître de Service herwatschelte, die Alte mit der Brille, die er in traurig tadelndem Tonfall vor sich hinschweizern hörte, während er weitergeschimpft hatte, während er es diesen verklemmten Schweizern relativ deutlich gesagt hatte. Während ihn die verklemmten Schweizer von ihren Tischen anstarrten, mit ihren Angeber-Breitlings und Glashüttes und Patek Philippes und ihren Goldketten und ihren geschissenen Scheißmaßschuhen.
Während die Kerle, mit denen er heute Vormittag eigentlich noch ein Meeting hätte, noch ein Meeting gehabt hätte, mit ernsten Mienen tuschelten. Denen er. Gütiger. Scheiße. Nicht, dass es Falsche erwischt hätte, es ist nie falsch, Schweizer zu beleidigen, schon gar nicht solche Schweizer Pisser. Hirnamputierte Spießer. Trotzdem. Mist. Er will jetzt nicht daran denken, er will an etwas anderes denken, an etwas Angenehmes, aber das wird durch die rasenden Schmerzen nicht direkt begünstigt. Wie lange kann das verficktnochmal dauern, bis diese Pillen endlich wirken? Wie lange dauert das jetzt schon? Wie lange dauert das noch? Und hat er noch Zigaretten? Etwas Schönes denken. Kathi, Kathi hat heute Geburtstag, er wird sie anrufen und ihr ein Geschenk versprechen und ihr etwas Nettes sagen und nicht, wie er sich gestern, wo noch mal, im Mascotte, richtig, im Mascotte, völlig deprimiert und angesoffen und zugekokst an eine sowieso viel zu blonde Tusse herangemacht hat, an die am dümmsten aussehende Fotze mit dem breitesten, gewaltbereitesten, dumpfsten Muskeltrottel direkt neben sich. Tötung auf Verlangen, würde Kathi sagen, Tötung auf Verlangen, definitiv. Und lachen würde sie. Und er hat versucht, Denise anzurufen, er hat etwa, hm, zwanzig Mal versucht, Denise anzurufen, und zwei Mal hat sie auch abgehoben. Einmal hat sie gesagt, sie kommt nicht, dann hat sie gesagt, er soll nicht mehr anrufen, er hat ihr dann achtzehn Nachrichten hinterlassen, der Zärtlichkeitsquotient dabei, nun ja, rapide abfallend. Irgendwann hat er nur noch aus Prinzip angerufen, aus dem Gruberschen Aufgeben-gibt’s-nicht-Prinzip, dann am Ende aus Hass, einfach nur noch, um sie zu quälen, um ihr wirklich lästig zu sein und die Nacht zu verderben, weil sie es nicht besser verdient hat. Und um sie dazu zu bringen, über ihn nachzudenken, ihn schließlich auch zu hassen und vielleicht ein bisschen Angst vor ihm zu kriegen. Die dumme Fut. Wenn Denise abgehoben hätte, wäre er der bescheuerten Fickblonden nie auf die Pelle gerückt. Knallrosa Lipgloss, heilige Scheiße. Er muss wirklich dicht gewesen sein. Er will jetzt nicht noch länger über die dumme Blonde und ihren hirnamputierten Zuhälter mit der kecken Unterschichtstolle, Modell Mecklenburg-Vorpommern, nachdenken, denn sonst könnte ihm früher oder später noch im Detail wieder einfallen, wie er die Schwanzlutscher von diesem Konzern, nun ja, beschimpft hat. Er will daran jetzt nicht denken. Er will, dass die Seractil wirken und er will eine Zigarette, und dann will er sich eventuell sein Gesicht im Spiegel ansehen und dann etwas dagegen tun, dass es so aussieht, und dann. Und dann. Dann ruft er möglicherweise Kathi an. Oder schickt ihr eine SMS. Oder sowas.
Letztes Jahr im Juli waren wir alle gemeinsam in Kroatien. Die Mutter ist siebzig geworden, sie hat es sich gewünscht. Sie hat die Termine koordiniert und das Haus gemietet. Es war schwer, Johnny dazu zu bewegen, sich Urlaub zu nehmen, und er kam dann auch nur für zwei Tage nach. Hat aber eh gereicht. Hat allen total gereicht, nur die Kinder fanden ihn lustig. Das Haus war schön, ein großes altes Haus am Meer mit schön abgetretenen, dick lackierten Dielenböden, großen Zimmern mit alten Holzbetten, einer überdachten Terrasse aus Stein, rundherum Rosen, Lilien, Olivenbäume. Eine Treppe aus flachen Steinen führte zum Wasser. Das Meer war unvorstellbar türkis. Die perfekte Idylle. Und Johnny steht jeder Art von Idylle, sagen wir, reserviert gegenüber. Nein, ablehnend, ganz besonders wenn er merkt, dass sie inszeniert ist. Und natürlich war sie das; Mutter wollte schön siebzig werden, nicht irgendwie. Schön. Es sollte alles richtig schön sein. Das packt Johnny nicht. Dagegen rebelliert er wie ein Vierzehnjähriger. Dass so etwas funktioniert, daran glaubt Johnny nicht, da muss, meint er, irgendwo ein Zünder eingebaut sein, und früher oder später geht es hoch. Ex- oder implodiert. Johnny steht daneben, beobachtet und wartet. Man kann sehen, jeder kann sehen, wie er darauf wartet, bebend, händereibend. Er weiß, dass es passieren wird. Er merkt nicht, dass er selber der Sprengmeister ist und dass die Idylle wahrscheinlich bestens weiter funktionieren würde, wenn er nicht da wäre und zündeln würde. Wenn er es nicht in die Luft sprengen würde. Das Wesen der Idylle liegt ja nicht in ihrer Perfektion an sich, sondern darin, dass alle mitmachen. Und dass alle die faulen Stellen übersehen, jedenfalls eine Zeit lang. Und so eine Idylle auf Zeit, die ein gemeinsamer Urlaub nun mal ist, verlangt ja genau das. Wir andern sind mittlerweile einigermaßen erprobt darin, wie man Ausgleich schafft, wir sind uns selbst und den Umgang mit Kindern und unsere zeitweise Überforderung mit den Kindern schon gewohnt. Es gibt da große Toleranzen. Johnny hat keine Toleranzen, gar keine. Johnny will nichts ausgleichen. Johnny will die Katastrophe. Er will den Crash sehen, er will seine Bestätigung, dass es nicht funktioniert. Tom sagt, Johnny ist einfach ein Arschloch, und wahrscheinlich hat er recht. Johnny zeigt so lange auf die Risse und Absplitterung der Idylle, bis es den anderen schließlich auch nicht mehr gelingt, sie zu übersehen. Johnny sorgt dafür, dass es bricht, er ist die Sollbruchstelle jeder Idylle, und das ist er mit großem, fast moralischem Eifer. Wir wissen, wenn wir ihn mitnehmen und dabeihaben, dann werden wir brechen und danach wird es nicht mehr ganz wie vorher sein. Wenn Johnny etwas kaputt gemacht hat, bleibt uns für immer das Bewusstsein, dass es einmal anders, besser, vollständiger war. Aber er gehört nun mal zur Familie, da kannst du nichts machen.
Ein makelloser, sonniger Tag am Strand reihte sich an den anderen. Es war schön. Die Kinder waren glücklich. Das Meer war warm für die Jahreszeit, sie pflügten durchs Wasser und riefen «Relax, relax!» und «easy!». Mutter war auch glücklich, sie hatte bei einem ihrer Frühmorgenspaziergänge einen Fischer angesprochen, und der blieb nun jeden Tag mit seinem Kombi vor dem Haus stehen und wir kauften frischen Fisch aus dem Kofferraum. Alle hatten eine gute Zeit, selbst Tom, der so Großfamiliensachen sonst eher verzichtbar findet. Vormittags lagen wir am Strand, mittags trieben wir die Kinder aus dem Wasser und hinauf zum Haus und aßen, was Mutter gekocht hatte, Wachtelbohnensalat, Tomatensalat, Polpo-Salat, Bruscetta, Tsatsiki, Tabuleh, angebratenen Aal, Sardellen in Zitronensoße und tranken Wein dazu. Die Kinder bekamen Nudeln und Palatschinken. Dann legten wir den Kleinen schlafen, die Größeren spielten Nintendo oder schauten Filme, und Tom und ich gingen ins Bett. Es war schön. Dann kam Johnny, und es war ein bisschen wie in diesem Andersen-Märchen von der Schneekönigin. Wir hatten auf einmal Eisklumpen in unseren Augen und unseren Herzen. Wir konnten nicht mehr richtig sehen und nicht mehr richtig fühlen. Oder eben: Wir konnten plötzlich richtig sehen. Wir sahen das Schlechte. Das Aufreibende. Das Nervige. Die Risse. Johnny brauchte nur noch so ein bisschen daran zu wackeln. Danach ließ sich die Idylle nicht mehr richtig zusammensetzen. Teile fehlten. Jemand hatte sie verloren. Jemand hatte sie versteckt. Jemand hatte sie verschluckt.