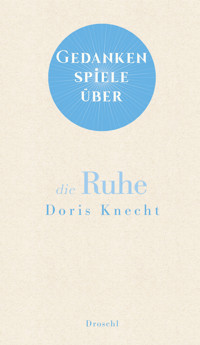9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, ein Haus und der Wald – ein fesselnder Roman über Verlust und Neuanfang. Verfilmt fürs Kino mit Brigitte Hobmeier, Gerti Drassl und Johannes Krisch. Eine Frau allein in einem abgelegenen Haus in den Voralpen: Marian hat alles verloren. Die Krise und eigene Fehler trieben sie in den Bankrott, zum völligen Rückzug. Aber auch ihr Versuch, im geerbten Haus wieder zu sich zu finden, wird zum Überlebenskampf. Mühsam lernt Marian, sich zu versorgen, sie fischt, wildert, stiehlt Hühner, und dann ist da Franz … Eine starke, gefallene Frau mit dem Willen zum Neuanfang, und das Landleben als Spiegel einer brüchigen bürgerlichen Welt – Doris Knecht erzählt mit unverwechselbarem Ton und auf mitreißende Weise davon, wie es ist, wenn man sein schönes Leben auf einen Schlag verliert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Doris Knecht
Wald
Roman
Über dieses Buch
Eine Frau allein in einem abgelegenen Haus in den Voralpen: Marian haust primitiv, in unfreiwilliger Autarkie, denn sie hat alles verloren. Früher, in der Stadt, hatte Marian Mode entworfen und lebte gut, dann trieben die Krise und eigene Fehler sie in den Bankrott, zum völligen Rückzug. Aber auch der Versuch, im geerbten Haus wieder zu sich zu finden, wird für Marian zum Überlebenskampf. Mühsam lernt sie, sich zu versorgen, sie fischt, wildert, stiehlt Gemüse und Hühner. Und sie muss sich arrangieren, in neuen Abhängigkeiten: Der Grundbesitzer Franz versorgt sie mit dem Nötigsten – nicht ganz uneigennützig. Im Dorf feindet man die Außenseiterin immer mehr an. Als sie beschimpft und bedroht wird, muss Marian sich den Dingen stellen. Was ist das nun eigentlich mit Franz? Und wie kann sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen?
Stückweise enthüllt der Roman Marians Sturz, schnell und unverblümt erzählt er, wie sie sich in ihrem neuen, archaischen Leben zu behaupten lernt. Eine starke, gefallene Frau mit dem Willen zum Neuanfang und das Dasein auf dem Land als Spiegel einer brüchigen bürgerlichen Welt – in «Wald» findet Doris Knecht nicht nur einen unverwechselbaren Ton, sie erzählt auch auf mitreißende Weise davon, wie es ist, wenn man sein schönes Leben auf einen Schlag verliert.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Umschlagabbildung «Stillleben mit Pilzen und Schmetterlingen», Otto Marseus van Schrieck (1619–1678) / Musée des Beaux-Arts, Rouen, France / Giraudon / Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-11541-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Das Geräusch ist ...
Sie gibt sich ...
Sie hat nicht ...
Erst einmal raten, ...
Sie sollte jetzt ...
Sie schreitet aus, ...
Der Weg führt ...
Man ist am ...
Vor dem Fenster ...
Sie hatte den ...
Früher hat sie ...
Früher, viel früher: ...
Es klopft an ...
Eine Nähmaschine. Sie ...
Das frühere Leben, ...
Im ersten Winter ...
Der Teig ist ...
Sie hört Schüsse. ...
Es ist arschkalt ...
Im Badezimmerspiegel sieht ...
Franz ist kein ...
Als Franz kommt, ...
Das Geräusch ist winzig. Ein Klicken nur, minimal, gar nicht laut, von irgendwo unten, und sie wird davon wach. Rutscht schnell aus dem Schlaf heraus, aus einem Traum, lauscht: nicht ängstlich, lauernd – aber da ist kein Geräusch mehr. Es ist still. Finster und sehr still. Sie bewegt sich nicht, sie will verhindern, dass das Geräusch, das entsteht, wenn sie sich in ihrem Bettzeug bewegt, ein anderes anlockt. Sie hat keine Angst. Vor merkwürdigen Geräuschen in der Nacht hat sie schon lange keine Angst mehr. Angst hatte sie früher, als sie noch mit Oliver zusammen war und sich nichts anderes vorstellen konnte als das, eine mysteriöse, ja bizarre Überängstlichkeit war ihr damals immanent gewesen, unerklärlich hinter den drei Luxusschlössern ihrer stahltürverstärkten Wohnung, in der sie nicht schlafen konnte, wenn Oliver nicht da war, in der sie wach lag und ihren massierten, epilierten, gecremten Körper in seiner Biobaumwollhülle herumwälzte. Alles in zarten Pastellfarben, denn damals hatte sie zum Schlafen zartes Pastell bevorzugt, nachdem sie irgendwo gelesen hatte, dass Frauen in weißer Wäsche weniger Sex hätten. Was Marian dann für sich auf die Formel heruntergebrochen hatte, Weiß sei unsexy, abgesehen von weißen Blusen, klassisch geknöpft, die zumindest Oliver und später auch Bruno sehr sexy gefunden hatten. In ihrer Pastellwäsche unter ihren sandbeigen oder schiefergrauen Leinenlaken hatte Marian auf jedes Geräusch gehorcht, bis das nervöse Kribbeln in ihrem empfindlichen Organismus endlich von Schlaf durchschwemmt wurde und sie in einen Traum versank, einen Albtraum, einen Albtraum mit Versatzstücken irgendeines amerikanischen Serienkrimis, den sie auf dem Flachbildschirm vor dem Bett weiterlaufen ließ, bis ihn die Sleep-Funktion ausschaltete. Was ihrer Ruhe, so viel war ihr immerhin klar, nicht unbedingt förderlich war. Immerhin überdeckten die beängstigenden, aber vertrauten Geräusche aus dem Fernseher wenigstens die wirklich besorgniserregenden, weil nicht sofort zuzuordnenden Geräusche in ihrer großen Wohnung, das Rascheln, das Knistern und Knacken, das Tappen und Tapsen und Trippeln in den drei unbewohnten und die meiste Zeit unbenutzten Zimmern (ihre Heimwerkstatt, Olivers Heimatelier, das Gästezimmer), die sie manchmal, wenn Oliver nicht da und es besonders schlimm war, zugesperrt hatte. Auch wenn selbst der Marian von damals, die ihre Hysterie zu Sensibilität verklärte, die Angst, es könnten sich darin irgendwelche Einbrecher oder die Geister vormals hier Verstorbener verbergen, kindisch und irrational vorkam. Idiotisch. Und ja, hysterisch, sie gab es zu, sogar sich selber. Und obgleich ihr selbst in ihrer damaligen Verschrobenheit klar war, dass insbesondere Geister sich kaum von Stahlschlössern abhalten ließen, ein Zimmer zu verlassen. Dann war Oliver weg, und sie blieb übrig in der großen Wohnung, allein, und siehe da: Ging ja. Nach ein paar Nächten. Und gut, nach einem weiteren Luxusschloss, einem Balkenschloss und einer einbruchssicheren Terrassentür, es hätte ja sein können, dass ein besonders ehrgeiziger und akrobatischer Einbrecher über das steile Dach balancierte und sich abseilte auf ihre Terrasse oder, spidermangleich, von unten acht Stockwerke die Glasfassade hochkrabbelte. Das Schloss hatte sie dreitausend Euro gekostet, die sie damals für gut investiertes Geld hielt, was es insofern war, als sie danach wieder schlafen konnte, jedenfalls die paar Monate, die sie die Wohnung noch hatte. Jetzt, im Bett ihrer in demselben verstorbenen Tante, lachte Marian über derlei, mitunter zumindest. Lustige alte Ängste, Luxusgefühle, First World Problems, nur noch mit Mühe erinner- und nachfühlbar. Sie vermisste sie nicht. Sie vermisste nur manchmal ein Dasein, das den luxuriösen Aspekt der Möglichkeit solcher Ängste im Pauschalpreis inbegriffen gehabt hatte.
Sie lauscht noch einmal: kein Geräusch jetzt. Sie kann sich nicht mehr erinnern, ob Bruno in dem Traum war oder Oliver vielleicht, sie spürt nur noch, dass es warm war, irgendwer Warmer war da, also eher Oliver als Bruno. Bruno war nicht warm. Schön, sexy, schnell, amüsant: aber warm? Nein. Die Blitzgescheitheit, die Männer attraktiv machte, diese Verstandesschärfe kam immer mit einer gewissen Kälte, auch bei Bruno, besonders bei Bruno. Er war clever genug gewesen, dass er diese Kälte verbarg und überspielte, aber sie war da, und irgendwann spürte man sie, irgendwann war sie nicht mehr zu leugnen, und auch Marian konnte es irgendwann nicht mehr wegleugnen, obwohl es ihr eine Zeitlang gelang, länger, als gut für sie war, eine letztlich ungesunde Weile länger. Oliver war warm, die längste Zeit war Oliver warm, fast bis ganz zum Ende. War Franz in dem Traum? Etwas regt sich in ihr, als sie die schon fast zerschmolzenen Traumrückstände nach Franz absucht, und es regt sich an einer Stelle, wo sie es nicht unbedingt will. Franz, doch: vielleicht. Sie träumt jetzt manchmal von Franz. Da waren jedenfalls Menschen in dem Traum, das Gesicht des jungen Kerls, des neuen Nachbarn, der gestern bei ihr angeklopft und sich vorgestellt hatte, drängt sich in ihr Bewusstsein, ein gerade noch glattes, etwas ausgetrocknetes, aber sehr freundliches Gesicht mit einem rötlich blonden Gestrüpp rundherum; mit den Augen stimmt was nicht, irgendwas in den Augen war falsch gewesen, aber das Lächeln so warm, es zerfließt in ihrem noch halb schlafenden Bewusstsein, nur die Traumwärme ist noch da. Es fühlt sich so an, als seien es einigermaßen freundliche, gute Menschen gewesen in dem Traum, sie haben keine Namen mehr und keine Gestalt, es ist alles weg, nur ein weiches Gefühl ist noch übrig, eine grund- und schwerelose Zufriedenheit, die gleich in der Realität zerfließen wird wie Kondensstreifen im Blau des Himmels.
Sie gibt sich keine Mühe, zurück in den Traum zu finden. Hat ohnedies keinen Sinn. Er ist dahin. Es war nur geträumt. So gesehen war das Klacken ein Segen: Es hat sie aus dem Traum geschleudert, hat den Traum schlagartig beendet, minus den Schmerz, den langsames, allmähliches Erwachen mitunter verursacht, wenn man noch glaubt, das sei es, das sei das eigene, echte Leben und es sei voll mit warmen, netten Menschen, und wenn dieses Traumleben dann verblasst, sich davonschleicht, einen allein zurücklässt, in einem ganz anderen Dasein. Es ist alles nicht mehr so warm jetzt. Härter, ehrlicher, echter und ohne Raum für einlullende Lügen, mit denen man sich über Unebenheiten hinwegschwindeln konnte, über größere Lügen. Immerhin träumt Marian jetzt nicht mehr schlecht oder nur noch sehr selten. Sie hatte schon lange keinen Albtraum mehr. In ihren Träumen ist es jetzt meistens warm, schmusig, watteweich, pastellfarben, süß, alles, was ihr Leben gerade nicht ist oder höchstens ganz selten. Wenn das Leben richtig beschissen ist, hören Albträume, das weiß Marian mittlerweile, zuverlässig auf. Auch wenn man es sich selbst ausgesucht hat, wenn man sich dafür entschieden hat, wenn man es so wollte, wie Marian es wollte, gegen alle Widerstände, entgegen dem besseren Wissen und guten Willen aller anderen.
Erst gestern hatte Kim wieder angerufen beziehungsweise: Kim hatte versucht anzurufen. Marian hatte den Anruf nicht angenommen, hatte sich das plärrende Handy von dem Fenstersims gegriffen, auf dem es lag, leblos normalerweise, hatte es angesehen, angestarrt, mit kurzsichtig zusammengekniffenen Augen, was auf ihrer Stirn eine steile Falte erzeugte, die ihr nicht gefallen würde, in einem anderen Leben, in dem Falten eine Rolle spielten. Sie hatte den Namen gelesen, hatte das Handy vom Sims genommen, es in ihrer Hand klingeln und vibrieren lassen. Das Fenster war an einigen Stellen angelaufen, es gehörte, wie Marian währenddessen konstatierte, geputzt. Sie hatte das Handy auf das Fensterbrett zurückgelegt. Es schrillte. Draußen waren die Anzeichen des Herbstes unübersehbar, grauer Himmel, das Handy schrillte, gelbe Blätter in der Wiese, die ein forscher Herbstwind schon heruntergeweht hatte. Das Handy schrillte. Die Astern blühten schon hier und da und bunte Lilien, und die violetten und grünen Blätter über den großen Rot- und Weißkraut-Kugeln welkten schon, sie würde das Kraut bald ernten können. Und die Weiden. Die Weiden, das wusste sie nun, wurden im Frühjahr als Erstes grün, und im Sommer, noch vor dem Herbst, wurden zuerst die Blätter der Weiden gelb und fielen dann als falbes Laub ab, in solchen Mengen, dass das Gras darunter erstickte. Es schrillte. Sie dachte an das Laub und daran, wie sie es bald würde rechen müssen, sie dachte an die Anstrengung des Rechens, um sich nicht Kim an ihrem Handy vorstellen zu müssen, einem schicken neuen iPhone vermutlich, und sie dachte an alles, was im Winter auf sie zukommen würde, und sie dachte, dass sie nicht an die Wölbung auf Kims glatter Stirn denken wollte, eine tiefe, zornige Falte, die sich irgendwann so scharf einkerben würde wie bei Marian selbst, die nun einen Riss in der Stirn hatte, heftig und unauslöschlich, wie gegerbt. Oder vielleicht würde Kim vor dieser Stirnfalte ja bewahrt bleiben, vielleicht beugte Kim ja rechtzeitig mit Botox vor oder wenigstens mit Hyaluron, sie würde es ihr raten müssen, oder vielleicht erfanden sie ja schon demnächst etwas Besseres, was Kims Stirn entkerben würde, nachhaltiger als Marian die ihre, bei der alle nicht operativen Maßnahmen schließlich vergebens gewesen waren. Und letztlich eh für ’n Hugo, wie man so schön sagte.
Das Telefon brüllte sie an, ein enervierendes Geräusch, das richtig unangenehm wurde, bis es schließlich aussetzte. Das Handy schrillte nicht mehr, es war jetzt still, viel stiller als zuvor. Das Klingeln hatte lange gedauert, noch länger als vorgestern, als Marian auch nicht rangegangen war. Und auch nicht am Sonntag. Dabei hätte sie unendlich gerne Kims Stimme gehört, das tiefe, warme Gurren darin, sie verzehrte sich nach dieser Stimme und ihrem fröhlichen Singsang, sie wurde fast verrückt vor Verlangen abzuheben, vor Sehnsucht nach der Freundlichkeit und Liebe, die genau in dem Moment in diesem kleinen Plastikteil steckte und die in Form reinen Glücks von ihren Ohren aus ihren ganzen Organismus durchschwemmen würde, wenn sie nur auf diesen Knopf drückte. Es hatte geschrillt und geschrillt und immer weitergeschrillt, zwölfmal, bis es abbrach. Als es endlich aufgehört hatte, war Marian ein Durcheinander, ein Desaster mit nassen Augen und feuchtem Kragen, noch lange, nachdem es längst still war. Aber sie wusste, was Kim zu sagen hatte, und sie wollte es nicht hören, weil sie es erst freundlich, dann barsch zurückweisen würde, und Kim würde es nicht verstehen, und Enttäuschung würde das Gurren verdrängen und Sorge den Singsang kontaminieren, und am Ende bliebe nichts zurück als Traurigkeit und Kims Tränen und der bittere Schmerz von Zurückweisung, Verlust, Missverstehen, unerfüllten Wünschen, auf dieser wie auf der anderen Seite. Und trotz des Schmerzes war es richtig. Musste exakt so sein. Der Schmerz war sowieso da, mehr kann und will sie Kim nicht zumuten. Es ist ihre Krise, sie wird sie nicht zu Kims Krise machen. Es hat sie getroffen, nicht Kim. Sie will nicht, dass Kim sich kümmert. Sie will nicht umsorgt werden, nicht von Kim. Es soll Kim gutgehen. Es ist nicht Kims Aufgabe, sich um sie zu kümmern, nicht nach allem, was war. Sie wohnt in Kims Haus, dem Haus, das Marian ihr geschenkt hat, nachdem sie es von ihrer Tante geerbt hatte. Und nun will Marian es so, wie es jetzt ist, und trotz des letzten Winters und trotz allem, was sie in diesem Winter erlebt hatte, und sie will es immer noch. Es ist jetzt so, besser geht es nicht. Sie kann sich selber kümmern, sie hält sich über Wasser, sie schafft das schon, sie braucht Kim nicht. Das Haus, ihre Zuflucht, mehr nicht, mehr kann Kim jetzt nicht tun. Soll Kim jetzt nicht tun. Sie braucht niemanden, und wenn doch, dann gibt es Franz.
Sie dreht sich zur Seite, ihre Hüfte tut weh, schon seit ein paar Tagen. Es wird jeweils besser, nachdem sie aufgestanden ist, sie wird bald aufstehen, sie macht, um anhand der Helligkeit die Tageszeit einzuschätzen, kurz die Augen auf, lässt Licht herein, falls eins da ist. Ein bissl eins ist da: Es ist noch dunkel, nicht mehr ganz dunkel, es schleicht schon Blau ins Schwarz. Vor sechs, schätzt sie. Sie reibt sich die Augen, blaue Augen in einem nun fleckigen, teigigen Gesicht. Das Gesicht ist gealtert in den letzten zwei Jahren, vor allem im letzten Jahr, im letzten Winter. Sie weiß es, und wenn sie vor dem kleinen Badezimmerspiegel steht, morgens oder abends, studiert sie manchmal ihre Falten, und manchmal sagt sie sich, dass sie etwas dagegen unternehmen sollte, was sie könnte, unter anderen Voraussetzungen, ein bisschen was wenigstens. Früher hätte sie. Das, was früher einmal wichtig war, das, was vor zwei, drei Jahren große, mitunter immense Bedeutung hatte, ist immer noch präsent, nicht nur als Erinnerung, sondern als aktiver Teil ihres Bewusstseins. Das ist noch in Betrieb, auf Standby. Die Umstände haben es nur relativiert, vorübergehend. Es ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür, aber sie will es deshalb keineswegs ganz ausschalten. Marian möchte, dass es präsent bleibt, sie will, dass das kleine rote Lamperl weiterhin brennt, auch wenn es Energie braucht, vermeintlich sinnlos. Aber es ist nicht sinnlos. Es ist ein Fanal. Sie will, dass die Falten unter den Augen und um die Lippen herum sie stören, denn: Was, wenn nicht? Was, wenn nicht mehr, was, wenn es ihr egal ist, wenn es für sie keine Rolle mehr spielt, ob sie Falten hat und ob diese Falten tiefer und mehr werden und ob ihre Mundwinkel scharfe Kerben bilden und die Haut links und rechts von ihrem Kinn schlaff wird, unübersehbar, jeden Tag ein bisschen mehr?
Mag sein, dass es keinem auffällt, weil keiner da ist, dem es auffällt, außer ihr selbst. Es spielt eine Rolle, die Falten, das ganze fatal ungebremste Altern in ihrem Gesicht. (Die Anzeichen des Älterwerdens der Haut – das war doch ein uralter Werbespruch, nicht auszurotten, auch der tief im Bewusstsein, was war das noch einmal für eine Werbung, wofür? Irgendwas Billiges, Zweitklassiges, Massenkosmetik, sonst würde es wohl kaum einen Werbespruch dafür geben.) Und es spielte eben auch dann eine Rolle, dass ihr Gesicht (Oil of Olaz, genau, das war’s gewesen, hatte sie nie verwendet, natürlich nicht) älter und schlaffer wurde, auch wenn man diese Tatsache, wie es Bruno bei jeder sich bietenden Gelegenheit gerne getan hatte, durch die Lacan’sche Dingslehre laufen ließ, nach der nur das existiert, was gesehen, wahrgenommen wird; von einem Betrachter als existent definiert, im Auge eines Betrachters überhaupt erst materialisiert wird. Aber Betrachter gab es keine, Franz einmal ausgenommen, aber Franz schien die Beschaffenheit ihres Gesichtes völlig einerlei zu sein, noch zumindest. Und wo es keinen Betrachter gab (und ein Betrachter, den das Betrachtete nicht interessierte, der es gar nicht wahrnahm, fiel doch wohl in die Kategorie kein Betrachter, war als Betrachter wohl ebenso inexistent wie ein lebloses Objekt), da gab es auch ihre Falten nicht. Bruno hätte das viel eleganter und präziser ausgedrückt, hätte vermutlich auch noch Foucault angeführt oder sonst einen seiner französischen Angeber-Philosophen oder Hegel, Hegel funktionierte ja auch immer. Jedenfalls ging es vereinfacht gedacht darum, dass es, wenn es kein Marian registrierendes Bewusstsein gab, auch keine Marian gab, dass ohne den auf sie gerichteten, sie wahrnehmenden Blick Marian nicht existierte, mit oder ohne Falten nicht. So einfach.
Dieses philosophische Problem wäre letzten Winter für Marian beinahe ganz konkret, letal konkret geworden, nachdem der Schnaps des Onkels die zu jener Zeit einzige Person, die Marian hatte sehen können, blind gemacht hatte, nämlich Marian selbst. Sie schaute nicht mehr in den Spiegel, morgens nicht und abends nicht, sie sah sich nicht mehr, und damit sah niemand sie mehr, und so war sie quasi gar nicht da. Hätte Franz sie nicht zufällig gehört und gesehen, an diesem Februartag im Wald, wäre sie vielleicht tatsächlich nicht mehr da, nicht nur als Objekt keiner Betrachtung, sondern objektiv gar nicht mehr, und wenn jetzt ein Betrachter oder eine Betrachterin zu dem Haus gekommen wäre und hineingeschaut hätte, wäre darin außer ein paar Spuren nichts mehr von Marian, denn sie wäre längst unter der Erde oder, wahrscheinlicher, eine Handvoll Asche in einer Blechdose auf einem Schrankbrett in der modern-rustikalen Wohnzimmerwand (Eiche gekalkt) ihrer Schwester. Oder von dieser irgendwo verstreut, da sie den Platz auf dem eichegekalkten Schrankbrett für etwas Wichtigeres gebraucht hätte, einen Nippes-Elefanten wahrscheinlich, ihren nunmehr zweihundertsechsundfünfzigsten oder dreihunderteinundvierzigsten Nippes-Elefanten, denn die Schwester sammelte Elefanten. Seit ihrer Kindheit schon. Es hatte mit einem Stofftier im Tiergarten Schönbrunn begonnen und nie wieder aufgehört. Und auf das Regal ihrer Schwester hätte sie es auch nur geschafft, wenn irgendjemand, die neugierige Püribäurin zum Beispiel, Marian schließlich gefunden hätte, steifgefroren, mit einer leeren Schnapsflasche in den steinharten Fingern.
Aber sie sah sich noch, sah sich wieder im halbtrüben Badezimmerspiegel, jeden Abend und jeden Morgen. Sie war vorhanden, sie lebte. Und auch Franz konnte jetzt beweisen, dass sie da war, dass es sie wirklich gab, und so nahm sie sich jeden Morgen und jeden Abend in diesem Spiegel nicht nur wahr, sondern betrachtete und inspizierte sich und ihre Falten und Fältchen und den kleinen Graben unter dem linken Auge. Wieso nur unter dem linken? Wieso nicht unter dem rechten? Was macht ihr linkes Auge, ihre linke Gesichtshälfte anders als ihre rechte? Diese Kerben und Falten, die da so unbekämpft die Untermoisterisiertheit ihres Gesichtes ausnutzen und fröhlich darin wuchern, stören sie. Sie nimmt dieses Stören als gutes Zeichen. Denn wenn sie Marian nicht mehr störten, wenn sie sie nicht mehr ablehnte, wenn sie anfing, diese Falten zu übersehen oder gar als Teil von sich zu nehmen: Dann hätte sie sich abgefunden, dann hätte sie aufgegeben, dann akzeptierte sie das hier als ihr Leben; aber das tut sie nicht, denn das hier ist eine Phase. Eine Phase, die vielleicht noch länger dauern wird, aber eine Phase jedenfalls. Eine Phase, die einen Anfang hatte und ein Ende haben wird. Ein bisschen, wie wenn man unschuldig im Gefängnis landet oder ihretwegen auch schuldig. Schlussendlich hatte sie sich ja selbst dafür entschieden, dafür und gegen die Bewährung mit Auflagen und unter strenger Aufsicht, was die andere Möglichkeit gewesen wäre. Dann lieber das hier, auch wenn das nicht ihr richtiges Leben ist, nur ihr derzeitiges, eins, das ihr irrtümlich vorübergehend zugefallen war und in dem sie gegen diese Falten gerade nicht viel unternehmen konnte, aber dann, aber dann, aber irgendwann.
Sie klappt die müden Lider wieder hoch, das Blau ist knalliger geworden, und wenn sie sich nicht täuscht, erkennt sie am Himmel ein rosa Flirren. Das, was sie an Wetter vor dem Fenster erspäht und identifizieren kann, macht ihr Hoffnung: Es wird heute eventuell reichen, wenn sie nur in der Früh den Ofen in der Küche an- und einmal richtig hochheizt und nicht auch den im Wohnzimmer, vielleicht würde es heute noch einmal warm genug werden, dass sie bis zum Abend kein Holz braucht. Sie schaut auf die steifen Haare auf ihren Armen und die von der Kälte aufgeraute Haut, lässt ihren Blick auf diesen Armen ruhen, darauf aufwachen, langsam. Ihre Arme sind lang, dünn, sehr blass, gesprenkelt mit braunen Punkten und Flecken, viel mehr Punkten und Flecken als früher. Sie friert, widersteht aber dem Drang, ihre Arme zurück unter die Decke zu schieben. Ein bisschen liegen bleiben noch. Ausnützen, dass man vor dem Wecker wach geworden ist, von diesem Klicksen. Sie horcht erneut, aber da ist nichts, nicht einmal ein feinstes Piepen. Vielleicht ist die Maus entkommen; im günstigsten Fall war sie schlagartig tot. Eine weniger. Sie hat schnell aufgehört, die Mäusekadaver zu zählen, es müssen inzwischen Dutzende gewesen sein, Hunderte vielleicht schon. Sie findet es noch immer ekelhaft, die blutigen, entstellten Körper aus der Falle zu klauben. Sie hat spezielle Handschuhe dafür, alte, blutverkrustete Arbeitshandschuhe, die sie im Schuppen fand. Sie sind steif und zu groß, und es macht Mühe, mit ihnen den von einer Feder gespannten Drahtbügel aufzustemmen, aber es widert sie zu sehr an, die zerquetschten Mäuseleichen mit bloßen Händen aus der Falle zu befreien. Anfangs warf sie manchmal die Falle samt Mäusekadaver vor die Tür, aber die Katzen fraßen zu oft nicht nur die Maus heraus, sondern verschleppten das Mausefallemausgemisch, und wenn sie die Falle nicht zufällig wiederfand, musste sie eine neue besorgen. Sie tut das jetzt nur noch, wenn, was unglücklicherweise immer wieder vorkommt, die Maus das Zuschnappen der Falle mit halb zerquetschtem Leib überlebt hat und in der Falle zuckt, manchmal vermutlich schon seit Stunden. Mitunter findet sie die Fallen ganz woanders als dort, wo sie sie aufgestellt hat, weil sie von dem eingeklemmten, sich verzweifelt um Befreiung bemühenden Mäusekörper meterweit weggezappelt wurden. Als sie das erste Mal eine sich im Todeskampf windende Maus in der Falle gefunden hatte, grauste es sie so sehr, dass sie sie mit dem Besen vor die Haustür und über die bröckelnden Stufen geschoben hatte, aber noch bevor sie nach der Schaufel greifen konnte, um das Tier totzuschlagen, hatte der Kater der Penederin das strampelnde Viech samt Falle geschnappt und war damit hinters Haus gerast. Der rote war das gewesen, der, den sie Rolf nennt, obwohl sie mittlerweile weiß, dass er Muxl heißt. Als sie später die Falle fand, klemmte darin nur noch ein Stück Knochen, der Rest des Mäusekörpers war verschwunden.
Marian hatte Mäuse kleiner in Erinnerung gehabt, zarter, süßer. Möglicherweise sind die Mäuse in der Stadt ja tatsächlich kleiner als Landmäuse. Auch Marian war zarter und süßer gewesen damals, elegant und mitunter exquisit, sie hatte, wenn es die Situation erforderte, zickig und kompliziert sein können, anspruchsvoll und verwöhnt, obwohl sie das alles im Grunde schon damals gar nicht war. Aber als sich einmal der Verdacht bestätigte, dass sie eine Maus hatten, im Apartment in der City, hatte sie darauf genau so reagiert, wie man es von einer Frau wie ihr erwarten konnte: mit kontrollierter Hysterie. Eine Maus! Um Himmels willen! Gekrabbel, Dreck, Bakterien, angeknabberte Lebensmittel, zernagte Schuhe, ruinierte Abendkleider. Sie und Oliver hatten lange herumgerätselt, wie eine Maus mitten in der Stadt in eine im siebten Stock gelegene Neubauwohnung kommt: War sie mit dem Lift hochgefahren? Hatte sie sich in einem Einkaufskorb eingeschmuggelt? War sie übers Dach gekommen, über die Terrasse? Oder könnte eine kleine Maus tatsächlich all die Stufen hochklettern oder -hüpfen oder was immer, können Mäuse so was?
Sie hatten sich jedenfalls mit ihrer Existenz abfinden müssen, nachdem sie lange nicht glauben wollten, dass es sich bei den kleinen schwarzen Krümeln in ihren sauberen Laden tatsächlich um Mäuseköttel handelte. Aber nachdem die Maus eine Tafel edler belgischer Zartbitterschokolade aufgebissen und angeknabbert hatte, gab es keinen Zweifel mehr. Sie hatte einen Kammerjäger anrufen wollen, hatte schon mehrere Links gefunden und sie Oliver geschickt.
«Wegen einer Maus?»
«Ich will keine Maus in meiner Wohnung!»
«Es ist nur eine einzige kleine Maus.»
«Woher willst du das wissen? Vielleicht sind es zwei. Und vielleicht sind die zwei verliebt. Und dann sind es vielleicht bald viele.»
«Echt, Marian. Werd jetzt nicht hysterisch.»
«Wenn ich aber daran denke, wie die Maus vielleicht nachts über mein Gesicht läuft …»
«Tut sie nicht. Köttel hat es nur in der Küche. Ich erwische sie.»
«Dann erwisch sie bitte dalli.»
«Jaja.»
Oliver hatte zwei Lebendfallen in der Küche und eine im Flur aufgestellt, und jeden Morgen hatte sie sich geweigert, das Bett zu verlassen, bevor Oliver nachgesehen hatte, ob das Viech sich von Käse, Speck oder Nutella (hatte sie im Internet gelesen) hatte anlocken lassen. Morgen für Morgen hatte es das nicht, bis sie schließlich beide sicher waren, die Maus sei von selber wieder ausgezogen. Hast du heute irgendwo Mäusekacke gesehen? Nein, du? Vielleicht war die Maus in eine freundlichere Wohnung umgezogen, weil ihr das Futter knapp geworden war, nachdem Marian einen Sonntag geopfert hatte, um alle Lebensmittel sicher wegzusperren oder in luft- und bissdichte Gläser zu verschließen.
Dann hatte sie eines Abends, an einem der Dienstage, an denen sie Oliver mit seinen Kumpels auf irgendeiner Wiese Fußball spielen glaubte, ihre Freundinnen eingeladen, alte Freundinnen, die sie noch aus ihren Mariannezeiten kannte, bevor sie während des Studiums angefangen hatte, erst einen, dann zwei Buchstaben ihres, wie sie fand, biederen, provinziellen und altmodischen Vornamens einfach zu unterschlagen, konsequent: Mariann erst, schließlich, weil ihr Mariann immer noch zu sehr nach Sissi-Film klang, Marian. Marian: das klang, fand sie, modern, kreativ, international, geheimnisvoll, androgyn, genderneutral. Sie fand, das passe besser zu einer Modedesignerin, und sie hatte eine halbe, zusehends betrunkenere Nacht lang eine neue Unterschrift geübt, bis auch die zu genau der Modedesignerin passte, die sie zu werden beabsichtigte: elegant, eigenwillig, unverwechselbar, mit einem Hauch Prätention in den Spitzen. Nur ihr Pass und ihr Bankkonto erinnerten sich noch an ihren echten Namen. Und diese paar Freundinnen, die sich hartnäckig weigerten, ihren neuen Namen zu akzeptieren und damit ihre neue Persönlichkeit, die sie mit sturer Beharrlichkeit Marianne nannten, eine sogar Nanni, was sie schon als Kind gehasst hatte. Sie bereute bereits, sie eingeladen, die alte Clique zusammengebracht zu haben, aus Anlass eines von Sabines seltenen Heimatbesuchen, in den sie einen Besuch in der Stadt einbaute, inklusive eines Treffens mit ihrer ältesten Freundin Marianne. Äh, Marian, die dann gleich vorschlug, bei sich daheim ein Essen zu kochen. Sie hätte ja einfach mit Sabine essen gehen können, in ein schönes Wiener Wirtshaus, die Sabine hatte vermutlich schon länger kein vernünftiges Schnitzel mehr zwischen den Zähnen gehabt. Stattdessen hatte sie sich in ihrer Küche bis an den Rand der Erschöpfung verausgabt, als wäre sie in der Tat noch immer jene Marianne, die es allen beweisen wollte. Die zeigen musste, dass und wie sie es geschafft hatte, dass sie Erfolg hatte, Geld, Oliver, Stil, Geschmack, trotz ihres Exnamens. Die Mädels hatten auch alles gehorsam bewundert, hatten sich, als wäre es eine Folge von «Das perfekte Dinner», durch die vielen Zimmer geaht und geoht, während Marian wie nebenher in der Küche werkte. Dann saßen alle um den schweren, uralten Eichentisch, der eigentlich ein bisschen zu rustikal war für diese Bürgerwohnung, vor sich leerenden Gläsern und halbvollen Vorspeisentellern. Als Marian kurz in die Küche ging, um noch etwas Brot zu holen, hatte sie auf der blitzsauberen Edelstahlarbeitsfläche, die sie kurz vor dem Eintreffen der Mädels noch einmal blank gewischt hatte, einen Mäuseköttel entdeckt. Eindeutig einen Köttel. Ein einzelner kleiner schwarzer Köttel auf der glänzenden Fläche, unmittelbar neben dem Kirschholzbrett, auf dem sie gerade noch etwas Ciabatta herunterschneiden wollte. Sie hatte leise geflucht, eine dünne Scheibe von dem Brot abgesäbelt und sie zusammen mit den Bröseln auf dem Brett in den Müll gekippt. Sie hatte den Köttel mit einem Papiertuch aufgeklaubt und weggeschmissen. Hatte das Brett und das Messer abgewaschen, hatte scharfes babyblaues Fensterputzmittel auf den Edelstahl gesprüht und erneut gewischt, roter Zorn fleckte die Alabasterblässe ihres Gesichts, und dann das Messer und das Brett abgewaschen. Und sich die Hände mit antibakterieller Seife geschrubbt, gründlicher noch als sonst. Dann hatte sie dreimal durchgeamtet, tiefe, heilende Uchay-Atemzüge, wie Achim, ihr Yogalehrer, es ihr beigebracht hatte, mit verengter Stimmritze und rauem Hauch, bevor sie den Rest des Brotes, an dem keine Spuren von Maus zu entdecken waren, aufgeschnitten hatte und mit dem Brotkorb wieder ins Esszimmer gegangen war, gestöckelt, besser gesagt, wo sie Tamis Frage nach ihrer überlangen Abwesenheit mit lächelndem Gelüge beantwortet hatte, Salzfass umgekippt oder so etwas. Am nächsten Morgen, als sie noch vom Bett aus eben den Kammerjäger anrufen wollte, hatte ihr Oliver den Drahtkorb mit der darin wütenden Maus präsentiert.
Es war eine sehr kleine Maus gewesen, süß beinahe, dunkelbraun und zart, mit spitzem Gesicht und großen, glänzenden Augen, nicht so ein fettes, grausliches Tier mit dickem, rundem Kopf wie die Viecher hier. Die Mäuse am Land wirken gegen die Stadtmaus wie Mutanten, groß, graubraun, drall und ekelhaft wie kleine Ratten. Die alten Schnappfallen aus Holz und Draht sind längst zu klein und schwach für ihre riesigen Schädel, aber offenbar kümmert das die Mausefallenhersteller herzlich wenig. Am Anfang hatte sie Lebendfallen aufgestellt, wie Oliver sie damals besorgt hatte: Sie hatte ganz ähnliche Drahtkäfige nach langem Suchen im Schuppen gefunden. Die Mäuse, die sie damit fing, hatte sie anfangs auf dem Feld vom Püribauer-Bauern ausgesetzt. Bis irgendwann, als sie die sechste oder siebte fette graubraune Hausmaus auf einer Wiese freiließ, der Verdacht in ihr keimte, dass es möglicherweise immer wieder die gleiche Maus war, die sie da fing. Schließlich hatte sie den Schwanz der Maus, obwohl es sie vor dem Viech ekelte, durch das Drahtgitter hindurch mit dem magentafarbenen Sonntagsnagellack der Tante lackiert, der noch immer im Badezimmerregal stand und erstaunlicherweise nicht völlig eingetrocknet war. Das hätten die Mädels mal sehen sollen, wie die Nanni das jetzt machte. Die Mäuse, die sie in den nächsten Tagen fing und aussetzte, hatten alle naturrosa Schwänze, und als sie sich gerade selber auslachte, wegen ihrer doofen, fast schon paranoiden Idee, fand sie eine Maus mit pinkfarbenem Schwanz in der Falle. Sie hatte diese Maus noch einmal, ein letztes Mal, auf dem Feld vom Püribauer ausgesetzt und von da an die alten Schnappfallen verwendet, die in allen Ecken im Haus gelegen hatten; aber die Maus mit dem Nagellackschwanz fand sie darin nicht wieder.
Zuerst hatte sie Käse genommen, kleine Brocken, die die Mäuse nachts immer wieder geschickt aus der Falle gezupft hatten, ohne dass diese zugeschnappt wäre, was sie ärgerte: schade um den Käse. Weil: Sie mag jetzt Käse. Früher hat sie keinen Käse gegessen, jedenfalls keinen Kuhmilchkäse, und keine Milch getrunken, früher litt sie, nachdem sie angefangen hatte, wegen ihrer Hautprobleme eine chinesische Ärztin zu konsultieren, unter einer Laktoseintoleranz. Und nicht nur sie litt darunter, sondern auch Oliver und ihre Freunde und die Kellner und Köche in den Restaurants, die sie frequentierten, mussten leiden.
«Hören Sie, da in dem Lachstartar: Ist da auch ganz sicher kein Milchprodukt enthalten?»
«Meines Wissens nach nicht.»
«Ich vertrage keine Milchprodukte. Ich kann das nicht verdauen.»
«Ich werde den Koch noch einmal darauf aufmerksam machen.»
«Bitte tun Sie das. Aber verlässlich. Sie gefährden sonst meine Gesundheit.» (Oliver jedes Mal: ganz verbogen vor Verlegenheit. Ganz besonders bei dem einen Mal in dem veganen Restaurant, als die Kellnerin sie in einer Mischung aus Verständnislosigkeit und Mitleid angestarrt hatte, nur weil Marian sichergehen wollte, dass sich in ihrem veganen Linsentopf auch ganz gewiss keine Spur von Kuhmilch finde.)
Sie hatte ihr Stammkaffeehaus neben dem Atelier gezwungen, ihr den Latte macchiato mit extra und nur für Marian angeschaffter garantiert laktosefreier Sojamilch zuzubereiten, weil es ihr einfach nicht möglich war, ihren Kaffee ganz ohne Milch zu trinken. Zwanzig Jahre Gewohnheit ließen sich halt nicht so einfach wegdiagnostizieren. Und sie hatte Oliver gezwungen, den Käse – seinen Käse – nicht nur in Frischhaltefolie, sondern zusätzlich auch in ein luftdichtes Plastikgeschirr mit klickenden Klappverschlüssen zu packen, weil ihr, wie sie behauptet hatte, schon der Geruch von Käse Magendrücken und Übelkeit verursachte.
Das hat aufgehört. Gänzlich. Unter Laktoseunverträglichkeit leidet sie jetzt nicht mehr. Von der war sie auf einmal genesen. Vielleicht, dass sie, wie das ja auch bei Brunos Histaminallergie der Fall war, sein großes und für ihn wirklich elendes Problem, irgendwann ausgeheilt war, was sein konnte, wenn man nur lange genug konsequent das verursachende und krankmachende Produkt wegließ, Wein oder Milch oder Mehl, bei Glutenunverträglichkeit. Irgendwann war jedenfalls Käse im Haus gewesen, und sie hatte den Käse gegessen und vertragen. Sie hatte ihren Körper beobachtet, während sie den Käse aß, ihre Haut, die Funktion ihres Organismus, die Geräusche, die ihr Magen machte, während er anfing, den Käse zu verdauen. Sie erwartete jeden Moment den Druck im Oberbauch und den Schmerz, in den dieser Druck früher zuverlässig überging, so wie sie, wann immer sie beim Chinesen oder auch beim Thailänder gegessen hatte, das Ziehen im Hals erwartete: ah, Glutamat, doch Glutamat, entgegen der Versicherung von Speisekarte und Personal. Aber als sie den Käse aß, geschah nichts. Und wenn nun Käse da ist, isst sie Käse, und wenn es Milch gibt, trinkt sie auch Milch und schüttet sie vor allem in den Kaffee, warm, wenn der Ofen geheizt ist, mit einer Gabel aufgeschäumt. Beziehungsweise, sie schüttet den Kaffee in die warme aufgeschäumte Milch, weil das nämlich einen Unterschied macht, ob man die Milch in den Kaffee oder den Kaffee in die Milch schüttet, doch, macht es, immer noch. Obwohl sie nach wie vor den Kaffee aus der Gaggia vermisste, die ihr schließlich Nelly abgekauft hatte, um mehr Geld, als Marian dafür verlangt hatte, das Gesicht gezeichnet von unzureichend weggedrücktem Mitleid und dem schlechten Gewissen von einer, die es sich leisten konnte, einer Freundin, die es sich nicht mehr leisten konnte, eine teure Espressomaschine abzukaufen. Das Mitgefühl in Nellys Antlitz war so groß und ehrlich gewesen, dass schließlich Marian mit Nelly Mitleid bekommen hatte, ist ja gut, hatte sie gesagt, es ist in Ordnung, ich trink doch sowieso kaum mehr Kaffee, und wenn ich mal ganz dringend einen brauche, komm ich bei dir vorbei, auf einen wirklich guten Espresso. Da hatte sie schon so viel verloren, dieses bisschen Extraverlust machte ihr schon nichts mehr aus, sie war schon ganz weich, schon egal, kein Hass, no bad vibes. Ja, bitte, mach das, ganz im Ernst, jederzeit, hatte Nelly gesagt, mit feuchten Augen, und Marian hatte es versprochen, während sie Nelly sanft zur Tür des Ateliers hinausgeschoben hatte, ja, ich komme, ganz bestimmt, ganz bald. Da war das Atelier schon gekündigt, da war die Wohnung schon verloren, da hafteten schon auf den meisten ihrer wertvolleren Sachen kleine Pfändungsaufkleber, auf allem, was sie nicht rechtzeitig weggeschafft und bei Freunden versteckt hatte. Da hatte sie sich schon ergeben, hatte aufgehört zu kämpfen, sich zu wehren, eine kurze Zeit erst, aber es war eine elendigliche Erleichterung gewesen. Nach all den Gesprächen und Verhandlungen mit Banken, Gläubigern, Freunden, Verwandten. Nach all den Zurückweisungen und Niederlagen, nach all dem Kopfschütteln und den bedauernden Worten, denen brutale Konsequenzen folgten. Nach all den wertlosen Papieren, nach all den Unterschriften, nach all dem Danken für nichts. Nach dem Kämpfen, dem Weinen, der Panik, nach dem Hoffen und Betteln, nach dem Strampeln und Nicht-wahrhaben-Wollen und dem Nichtaufgeben: Endlich verlieren dürfen. Doch aufgeben können. Endlich nicht mehr tapfer sein müssen. Endlich loslassen können, wegrutschen, abgleiten: fallen.
Sie war gefallen, und dort, wo sie schließlich aufgeprallt war, tat Milch nicht weh und schmeckte Kaffee auch, wenn es kein nicaraguanischer, von glücklichen Bauern handgepflückter Biokaffee war, sondern ganz normaler Kaffee, wie ihn alle tranken, aus einer Filtermaschine. Manchmal Espresso aus der alten Bialetti, aber meistens Filterkaffee, den billigsten vom Nah & Frisch im Nachbarort. Er erfüllte seinen Zweck, er machte im richtigen Tempo wach, und es schmeckte einigermaßen, und besser schmeckte es mit Milch.
Die Milch und den Käse von seinem Bauern bringt Franz manchmal mit; seinem Bauern, die Leibeigenschaft war in dieser Gegend nur auf dem Papier abgeschafft worden, de facto ist alles beim Alten, es gibt Herren und Bauern, und Franz ist ein Herr. Franz hat ihr auch ein Glas selbstgeschleuderten Honig mitgebracht und einen kleinen Sack Katzen-Trockenfutter.
«Nein, nicht für die Katzen!»
«Sondern?»
«Wart.»
Franz hatte ihr gezeigt, wie man Katzenbrekkies mit etwas Honig auf den beweglichen Teil der Mausefalle klebt, ganz hinten beim Scharnier, damit die Maus ihren Kopf möglichst weit hineinreckte und der Draht genau ihren Hals erwischen würde, zack. So, schau. Aha, okay, danke, ich hab’s geschnallt. Sie hatte die Falle, die Franz ihr gerichtet hatte, noch kaum in der Wohnzimmerecke am Fußboden platziert, ganz vorsichtig, damit sie bloß nicht zuschnappte, da hatte sie schon seine Hand zwischen ihren Schenkeln gespürt. Es gibt von Franz nichts umsonst. Es gibt überhaupt nichts mehr umsonst. Es gab, wenn man es ehrlich betrachtet, auch früher nichts umsonst, aber auf eine andere Weise; eine Weise, die einem weniger abverlangte, irgendwie. Weniger Substanz. Manchmal, wie bei dem Kleid von der Petschnig, auch mehr, aber meistens weniger. Obwohl dieses Weniger auch relativ war, wenn man sich die Knochenarbeit, die zähe, die dafür notwendig war, vor Augen führte. Was hatte sie geschuftet für ihr Geld, und wenn sie sich manchmal ihren Stundenlohn ausrechnete, war der zum Heulen. Insofern. Hart, manchmal sehr hart verdientes Geld. Aber wenn sie es dann ausgab, wenn sie bezahlte damit: Alma Boots von Acne, in zwei Farben gleich, Seven-For-All-Mankind-Jeans, die auch nicht besser passten als ihre eigentliche Lieblingsjeans von Mango, Schuhe, Schuhe und Schuhe, ein teurer Edelstahl-Entsafter für die Green Juices, die auf einmal alle tranken und trinken mussten, Schuhe, Brot, Toast, Salami, Butter, Sojamilch, mindestens eine teure Designertasche pro Jahr, ein Fahrrad, Designermöbel, eine Jahresnetzkarte, einen Wohnungsumbau, ein 100-Euro-Antifalten-Peeling-Pulver, eine 300-Euro-Antifalten-Creme: Geld war abstrakt, etwas, das man umso leichter gab, je weniger man dafür bekam, je unexistenzieller, desto leichter. Luxus bedeutete Leben und Freiheit. Man gab dieses Geld gerne aus, und auch wenn es hart verdient war, so doch auch mit einem gewissen Maß an Selbstverwirklichung. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Das Kleid von der Petschnig, das war dann so ein Punkt. Der entscheidende Punkt vielleicht.
Aber der Preis für die nicht bestellten Brekkies und den Honig an diesem Nachmittag war schon besonders hoch gewesen, sehr teuer. Entschieden zu teuer für Lidl-Katzenfutter und eins von den vierhundert Gläsern Honig, die Franz,