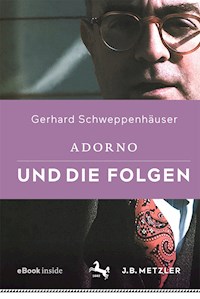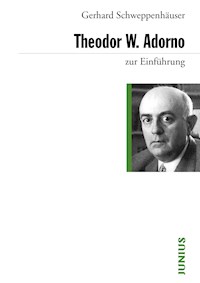10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Gerhard Schweppenhäuser erläutert in verständlicher Sprache zentrale Fragen und Begriffe der Ethik. Ausgehend von der seit jeher bestehenden Grundspannung zwischen Freiheit und Determinismus, Autonomie und Fremdbestimmung, vermittelt er Sichtweisen und Antwortoptionen verschiedener ethischer Schulen von der Antike bis heute. Dabei orientiert er sich an zehn Problemfeldern: »Seiendes und Geltendes«, »Praktische Vernunft«, »Ethik und Politik«, »Sollen, Pflicht«, »Freiheit«, »Autonomie«, »Gerechtigkeit«, »Menschenrechte und moralphilosophischer Universalismus«, »Glück« und »Gutes, gelingendes oder stellvertretendes Leben«. Eine vorzügliche Einführung in die großen ethischen Debatten – auch für Anfänger. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerhard Schweppenhäuser
Grundbegriffe der Ethik
Reclam
2006, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Foto der Plastik Le Peuseur (entstanden zwischen 1880 und 1882) von Auguste Rodin (1840–1917)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961868-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014089-5
www.reclam.de
Inhalt
1. Vorbemerkungen
2. Seiendes und Geltendes
3. Praktische Vernunft
4. Ethik und Politik
5. Sollen, Pflicht
6. Freiheit
7. Autonomie
8. Gerechtigkeit
9. Menschenrechte und moralphilosophischer Universalismus
10. Glück
11. Gutes, gelingendes oder stellvertretendes Leben?
Literaturhinweise
Zum Autor
Namenregister
Sachregister
[9]1. Vorbemerkungen
Ethische Grundbegriffe benötigen wir, um Grundfragen der Moral zu klären. Mit ihrer Hilfe lässt sich ergründen, was die Kriterien gelingenden Lebens und richtigen Handelns sind.
Moralisches Handeln, lehrte Kant, ist praktische Vernunft, freie Selbstbestimmung. Das Wesentliche »jeder Moral ist, dass sie ein langer Zwang ist«, schrieb Nietzsche (1886, 91). Wir haben es hier mit weit mehr zu tun als mit zwei inkompatiblen Paradigmen der philosophischen Tradition. Die beiden Aussagen widersprechen einander aufs entschiedenste, weil sie sehr präzise die gegensätzlichen Bestimmungen benennen, die in der Sache selbst liegen. Keine freie Selbstbestimmung ohne Selbstbeherrschung; kein Zwang ohne den Widerstand, den er hervorruft und aus dem sich Freiheit herausbilden kann.
»Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?« (Kant 1803, 711.) Diese Frage liegt Kants Vorlesungen zur Pädagogik zugrunde. Das Paradoxon der Erziehung zur Selbstbestimmung ist auch für die Ethik relevant. Wie können Individuen auf der Grundlage allgemeingültiger, verbindlicher Prinzipien handeln, die unabhängig von Ort und Zeit gewährleisten, dass alle in Freiheit und Selbstbestimmung leben können? Kants moralphilosophische Überlegungen haben eine normativ richtig (d. h. gerecht) eingerichtete Gesellschaft zum Ziel. Diese ist die Voraussetzung seines aufklärerischen Prinzips einer rational begründeten Würde des autonomenMenschen. Wenn die Menschheit in jedem Einzelnen nicht nur mental, sondern auch real »Zweck an sich selbst« wäre, müssten die besonderen Einzelinteressen und das allgemeine Interesse nicht mehr auseinanderfallen.
[10]»Der FreiheitGesetze geben« (Kant 1803, 728) – das ist seit der Neuzeit das Thema der Moralphilosophie. Doch gerade wo Zwang und Gewalt durch vernünftige Interaktion überwunden werden sollten, nämlich in der Moral, wirkten sie fort, lautet Nietzsches Diagnose. Der Rahmen für humane, friedliche Interaktion und Interessenausgleich, für Achtung und Anerkennung der anderen, werde durch Gewaltverhältnisse abgesteckt. Gewalt werde durch moralische Gebote und Konventionen internalisiert; das Überwundene kehre wieder, wenn sich Moral gegen die eigene, innere Natur erweist. »›Du sollst gehorchen, irgend wem, und auf lange: sonst gehst du zu Grunde und verlierst die letzte Achtung vor dir selbst‹ – dies scheint mir der moralische Imperativ der Natur zu sein« (Nietzsche 1886, 92). Für Nietzsche stand eine »Umwertung aller Werte« an, wenn sich die Gattung zu einer Lebensform freier, unabhängigerMenschen weiterentwickeln solle. Wie dies sozial, politisch oder ökonomisch zu verwirklichen wäre, darüber finden sich bei ihm allerdings nur Mutmaßungen, teilweise sehr abwegige. Dass die von Kant philosophisch begründete Autonomie des Subjekts, die für Nietzsche Fiktion war, gesellschaftliche Realität werden könnte, wenn eine solidarische Menschheit selbstbestimmtes Subjekt ihrer Praxis würde – das war ein Gedanke, den Nietzsche nicht zuließ (ebenso wenig wie der Neonietzscheanismus der Postmoderne, aber auch dessen systemtheoretischer Kontrapunkt).
Moralphilosophie behandelt nicht bloß Fragen und Problemstellungen des einzelnen Subjekts und seiner Handlungsentscheidungen. Sie entfaltet sich mit dem kritischen Nachdenken über das Allgemeine, zu dem es sich in Beziehung zu setzen hat: zu Gesellschaft, Politik und [11]Geschichte. Im Folgenden wird es um gegensätzliche Bestimmungen in der Sache selbst, nämlich in der Philosophie der Moral, gehen. Untersucht werden die normativ-kritische Kraft des Diskurses der abendländischen Moralphilosophie und seine Widersprüche. Dies geschieht in einer dialektischen Bewegung des Gedankens: indem versucht wird, innere Ambivalenzen und Antagonismen in den Objekten des Denkens begrifflich zum Ausdruck zu bringen. Die Gegensätze in der Sache sind durch Begriffe, Urteile und Schlüsse angemessen nachzuzeichnen, nicht – durch Aufhebung der Widersprüche in der Identität eines sich selbst reflektierenden Geistes oder einer logisch konsistenten formalisierten Sprache – zu harmonisieren. In exemplarischen und systematischen Erörterungen sowie in punktuellen philosophiegeschichtlichen Exkursen wird es um Gegenwart und Tradition einiger grundlegender Begriffe gehen, die den Diskurs der Ethik von der Antike bis heute prägen.*
In diesen Grundbegriffen reflektiert sich der Gegensatz, vielleicht sogar der Antagonismus zwischen individuellem Freiheits- und Glücksanspruch und gesellschaftlichem Zwang, zwischen Autonomie und Fremdbestimmung, zwischen der befreienden Kraft und der sozialen Stabilisierungsfunktion der Moral.
[12]Diese Ambivalenz findet ihren besonders intensiven Ausdruck in einem Konzept, das in diesem Buch zwar nicht eigens erörtert wird, aber hier vorab Erwähnung finden soll: dem Konzept der Empörung. Es bezeichnet die Empfindung, die Menschen angesichts moralisch nicht hinnehmbarer Handlungen und Zustände verspüren. Im Kontext gesellschaftlich-politischen Handelns steht es für Aufstand, Erhebung und Widerstand gegen Herrschaft und Unterdrückung. Zusammen mit dem Konzept der Solidarität (das als soziopolitisches zu verstehen ist, nicht als moralisches) bildet es den gesellschaftlichen Bezugsrahmen einer kritischen Theorie der Moral.
[13]2. Seiendes und Geltendes
2.1 Normen und Werte
In der Ethik wird über die Prinzipien der Moral, ihre Begründung und ihre Anwendung nachgedacht. Anders gesagt: Ethik ist derjenige Teil der Philosophie, in dem es um Werte und Normen geht, also um moralische und sittliche Kriterien, nach denen Handeln beurteilt wird. Unter Werten versteht man höchste Güter wie Glück oder Freiheit, während NormenRegeln sind, die unbedingte Geltung beanspruchen, wenn es etwa um Gerechtigkeit oder Wahrhaftigkeit geht.
Moralische Werte bilden sozusagen Hintergrundannahmen darüber, was einerseits zu einem gelingenden Leben der Individuen gehört und was andererseits eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft ausmacht. Hier geht es, mit Kant gesprochen, nicht um den »relativen Wert« von etwas, also nicht um seinen »Preis«, sondern um »einen innern Wert« von etwas (Kant 1786, 71). Moralische Normen sind »handlungsleitende Anweisungen, die dazu dienen, Werte zu realisieren oder gegenüber anderen Zielsetzungen zu schützen« (Schmid Noerr 2012, 36). Werte sind dann sozusagen Angebote, während NormenGebote bzw. Verbote sind. Mit anderen Worten: Werte sind attraktiv, Normen entweder präskriptiv (vorschreibend) oder restriktiv (eingrenzend).
Sieht man sich beispielsweise den moralischen Wert der Selbstbestimmung näher an, der im Bildungs- und Gesundheitswesen, in der sozialen Arbeit und in der Altenpflege häufig im Fokus steht, zeigt sich Folgendes: Für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, gilt die Norm, so [14]zu handeln, dass Willensäußerungen von Schüler*innen, Klient*innen und Patient*innen möglichst weitgehend beachtet und befolgt werden, damit der Wert der Selbstbestimmung der Akteure realisiert werden kann, etwa in Bezug auf die persönlichen Freiheiten der Bewohner*innen eines Seniorenheims oder einer therapeutischen Wohngemeinschaft für Heranwachsende sowie in Bezug auf den Datenschutz ebenso wie pädagogische Förderungsmaßnahmen.
2.1.1 Wertlehre
Der Begriff des Werts stammt allerdings nicht aus der Ethik bzw. der Philosophie der Moral, sondern aus der Ökonomie – also aus jener Sphäre, von der Kant sein soeben angeführtes Konzept des ›innern Werts‹ abgegrenzt hat.
Für Kant ist der innereWert eine Kategorie der »Moralität« (Kant 1786, 70). Diese ist nichts per se Gegebenes; sie entsteht vielmehr dann, wenn Menschen ihr Handeln an einer moralischen »Gesetzgebung« ausrichten, durch die »ein Reich der Zwecke möglich ist« (70). Unter diesem Gesichtspunkt unterscheidet Kant grundlegende menschliche Kompetenzen und Charakterdispositionen, die zusammen die »Sittlichkeit« (71) ausmachen. Diese hat man sich vorzustellen als Moralität, die sich im soziokulturellen Zusammenleben verwirklicht. Ganz oben in der Rangliste stehen Kant zufolge zwei moralische Haltungen: »Treue im Versprechen« und »Wohlwollen aus Grundsätzen« (71). Diese hätten einen »innern Wert« (71). Alles Können und Wissen hingegen, das »sich auf die allgemeinen menschlichen [15]Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen Marktpreis« (71). Auch diejenigen Kompetenzen und Dispositionen, die zwar nicht überlebensnotwendig, aber für ein menschliches Zusammenleben unverzichtbar sind, haben lediglich einen Preis, nämlich einen »Affektionspreis« (71). Hierunter fasst Kant »Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten«, »Witz, lebhafte Einbildungskraft und Launen« (71). Im Unterschied zum diesen menschlichen Kompetenzen, die alle »bloß einen relativen Wert, d. i. einen Preis« besäßen, hätten allein die moralischen Handlungsdispositionen »Würde« (71). Moralität ist demnach mit nichts zu verrechnen; sie darf nicht als Mittel zum Zweck missverstanden werden, denn sie selbst ist der höchste aller denkbaren und möglichen Zwecke.
Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. (71.)
Im ökonomischen Bereich liegen die Dinge in Bezug auf den Wert ganz anders. Hier geht es eben gerade nicht um ›innern Wert‹, nicht um ›Würde‹ und den »Zweck an sich selbst«, als den man »ein vernünftiges Wesen« (71) anzusehen und zu respektieren habe, sofern es moralisch reflektiert und handelt. Hier geht es um Äquivalente. Ökonomisch gesprochen, ist Wert vor allem Tauschwert, der Dingen oder Dienstleistungen in Marktgesellschaften zugemessen wird. Bei Knappheit steigt der Wert eines Gutes – wie die Wertschätzung, die ihm zuteilwird. Stets drückt sie sich auch [16]darin aus, auf was jemand zu verzichten bereit ist, um das Begehrte zu besitzen. Wert ist in dieser Hinsicht per se eine negative Kategorie. Sie bezeichnet das monetäre Äquivalent von etwas, also ein Äquivalent, das nicht positiv oder direkt zur Hand ist, sondern nur potentiell im Tausch realisiert werden kann.
Bevor ein Wert im Tausch realisiert wird, ist er nur virtuell vorhanden. Ein Fahrzeug hat diesen oder jenen Wert auf dem Gebrauchtwagenmarkt, doch solange man es nicht veräußert, verfügt man nicht über den entsprechenden Geldbetrag. Dass das Fahrzeug einen praktischen, einen persönlichen oder gar einen sentimentalen ›Wert‹ haben mag, steht auf einem anderen Blatt. Es spielt keine Rolle bei der Berechnung und Realisierung seines Tauschwerts. Das wird insbesondere im Falle eines Verkehrsunfalls mit sogenanntem ›wirtschaftlichen Totalschaden‹ relevant: Wenn die Instandsetzungskosten des beschädigten Fahrzeugs seinen derzeitigen Tauschwert, den sogenannten ›Zeitwert‹, übersteigen, dann ›lohnt‹ oder ›rechnet‹ sich die Reparatur nicht.
Werte im ökonomischen Sinn werden auf Märkten ermittelt. Sieht man von Sekundärmärkten wie dem für Gebrauchtwagen ab, dann gilt in der Weise, wie Wirtschaft heute betrieben wird und die heute fast auf der ganzen Welt dominiert, dass sich der Mehrwert von Waren durch Verkauf auf dem Markt zu realisieren hat.
Doch wo wird der Mehrwert erzeugt? Er entsteht bei der Produktion von Waren, und zwar dadurch, dass den Bestandteilen des Produkts, vermittels lebendiger Arbeitskraft, unbezahlte Mehrarbeit hinzugefügt wird. Wie geht das zu? Die Eigentümer der Produktionsmittel kaufen denjenigen, die nichts anderes zu verkaufen haben als ihre [17]Arbeitskraft, diese als Ware ab. Die WareArbeitskraft wird zu ihrem Tauschwert gekauft: Darin besteht der zentrale Inhalt eines jeden Arbeitsvertrags. Die WareArbeitskraft besitzt einen ganz speziellen Gebrauchswert, den keine andere Ware sonst hat: Sie kann Mehrwert entstehen lassen. »Dass die Arbeitskraftbesitzer durch ihre Arbeit einen größeren Wert bilden, als sie in Gestalt des Lohns erhalten« (Heinrich 2016, 175), bildet entsprechend der Analyse von Karl Marx die Voraussetzung für die Schaffung von Mehrwert. Unter dem Aspekt des Arbeitslohnes bedeutet das: Nach einem gewissen Teil des Arbeitstags arbeitet der Arbeitskraftverkäufer sozusagen gratis weiter, ab hier fügt er den Produkten oder Dienstleistungen unbezahlte Mehrarbeit hinzu. Einzig und allein aus dieser Differenz zwischen der bezahlten und der nicht bezahlten Arbeit resultiert der Mehrwert für den Eigentümer der Produktionsmittel.
Je moderner, das heißt: je maschineller und rationalisierter, die Produktion ist, desto kleiner wird allerdings im gesellschaftlichen Durchschnitt derjenige Mehrwertanteil, der auf die einzelne Ware entfällt. Aufgrund dessen müssen mehr einzelne Waren verkauft werden, wenn man im Ganzen auf seine Kosten kommen und Mehrwert abschöpfen will. Gleichwohl können die Eigentümer der Produktionsmittel nicht darauf verzichten, die Produktionsvorgänge fortwährend zu modernisieren und durch Einsatz von Maschinen zu rationalisieren. Denn dadurch kann weniger Lohn gezahlt werden. Das macht die Produktion ›produktiver‹. Doch zugleich entfällt, wie gesagt, auf die einzelne produzierte Ware ein geringerer Mehrwertanteil, weil weniger Arbeitszeit aufgewendet wird, um sie zu fertigen. Daher müssen Kapitalinvestoren immer mehr Waren[18]produzieren und auf den Markt werfen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen, und das Ziel ist selbstverständlich nicht nur die Amortisierung des investierten Kapitals, sondern dessen ständige Vermehrung. Der Analyse von Marx zufolge ist Kapital nichts anderes als »Wert, der vorgeschossen wird, um sich zu vermehren« (ebd.).
Daher sind Märkte heute Umschlagplätze im Zyklus einer permanenten Überproduktionsökonomie. Der Sachgrund dafür, dass mehr produziert wird, als Menschen gebrauchen und verbrauchen (können), ist, wie angedeutet wurde, die sinkende Menge Mehrwert, der gegebenenfalls am Markt realisiert werden kann, im einzelnen Produkt. Der Überproduktion entspricht Marx zufolge eine Überzahl von Arbeiter*innen. Von denen werden immer weniger benötigt, um Mehrwert zu produzieren, weil die maschinelle Herstellung von Waren in stets zunehmendem Maße ohne menschliche Arbeitskraft auskommt. Marx hat es daher als »allgemeine[s] Gesetz der kapitalistischen Akkumulation« (Marx 1894, 675) betrachtet, wenn das »Steigen der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters« (674) geschehe: »alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in Beherrschungs- und Exploitationsmittel […], verstümmeln den Arbeiter in einen Teilmenschen, entwürdigen ihn zum Anhängsel der Maschinerie« (ebd.), das am Ende auch noch überflüssig wird.
Es kommt hinzu, dass sich der Preis, den Unternehmen für die WareArbeitskraft zu zahlen haben, senkt, wenn Lebensmittel, Bekleidung und Brennstoffe (zum Heizen und für Fahrzeuge) zu durchschnittlich niedrigen Preisen auf dem Markt sind. Das ergibt sich entweder von selbst auf [19]den Märkten – oder es kann durch staatliche Subventionen erreicht werden.
Die hierzulande viel und gern beklagte Verfügbarkeit billiger Grundnahrungsmittel, mit der die bekannten Missstände der Massentierhaltung zusammenhängen, ist also kein genuin ethisches Problem, das über veränderte moralische Einstellungen der Konsument*innen gelöst werden könnte. Forderungen nach freiwilligem Verzicht auf den Kauf von »Billigfleisch« oder nach einem gesetzlichen Verbot von »Dumpingpreisen« für Lebensmittel treffen nicht den Kern des Problems. Der Preis der WareArbeitskraft bemisst sich in der kapitalistischen Wirtschaftsweise daran, wie viel Geld im Durchschnitt zu ihrer Regeneration benötigt wird, und zwar unter Bedingungen, die im Allgemeinen als menschenwürdig gelten.
Unter relativ hochentwickelten Lebensbedingungen zählt dazu übrigens auch die Möglichkeit, zur Erholung Urlaubsreisen zu machen, weswegen die gegenwärtige Angebotsökonomie zum Billigtourismus animiert, mit allen bekannten Negativfolgen für die Umwelt. Wobei zu bedenken ist, dass der Großteil des für den Klimawandel verantwortlich gemachten CO2-Ausstoßes nicht vom Individual- und Ferienverkehr stammt; er wird von Industrie und Handel und, in erheblichem Maße, vom Militär produziert.
Im Konkurrenzkampf des Weltmarkts haben die Staaten daher unter anderem die Aufgabe, durch politische Rahmenentscheidungen (vor allem durch finanzielle Subventionen) dafür zu sorgen, dass der Tauschwert der Arbeitskraft, also ihr Marktpreis, niedrig bleibt, damit der Mehrwert, den die Unternehmen sich aneignen, möglichst groß ist. In Deutschland hat die SPD (mit Hilfe der Grünen) zu [20]Beginn des Jahrtausends unter dem Titel »Agenda 2010« die Rahmenbedingungen für die erhebliche Ausweitung des Niedriglohn-Sektors geschaffen. Niedrige Lebensmittelpreise helfen bei der Stabilisierung dieses Zustands – und bei der Verfestigung ethisch problematischer Produktionsbedingungen für niedrigpreisige Lebensmittel, mit denen sich die working poor und das Prekariat über Wasser halten.
Auch die Überproduktion und massenweise Produktion von Waren, die womöglich in ethischer Hinsicht hochproblematisch sind (z. B. deshalb, weil sie unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden oder weil ihre Herstellung und Verwendung der belebten und unbelebten Natur schwere Schäden zufügen), ist nicht auf Gedankenlosigkeit oder moralische Verkommenheit der Akteure (insonderheit: der Konsument*innen) zurückzuführen. Sie ist ein Bestandteil der Produktion, also jener Wirtschaftsweise, die ›unseren westlichen Werten‹ zugrunde liegt.
All das hat nur auf den zweiten Blick etwas mit ethischen Fragen zu tun. Doch es zeigt sich: Werte stehen für etwas, auf das man zu verzichten bereit ist, damit man etwas anderes besitzen oder genießen kann. Im Gegenzug stellt man das, über das man nicht verfügt, als den entsprechenden Wert dar. Von Werten spricht man also dann, wenn es darum geht, dass man etwas per se nicht hat, aber über einen Gegenwert verfügt.
Im 19. Jahrhundert wurde der Wertbegriff von Rudolf Hermann Lotze in die philosophische Terminologie aufgenommen, um mit seiner Hilfe die Sphäre der Geltung von der Sphäre des Seienden zu unterscheiden (Lotze 1841, 1882). Seine große Karriere machte »der vom [21]Neukantianismus philosophisch in Umlauf gebrachte Name der Werte« (Habermas 1970, 150) aber bei Friedrich Nietzsche. Seine »Umwertung aller Werte« stellte den Wertbegriff ins Rampenlicht der Ethik. Er exponierte und kritisierte dabei mit einem Schlag dessen Problematik. Darauf werden wir noch zurückkommen.
Wenn Moralphilosophen von Werten sprechen und dabei an etwas dezidiert nicht Tauschbares denken, dann kommt mitunter Seltsames dabei heraus. Vor über einem Jahrhundert vertrat etwa Max Scheler die Auffassung, es gebe einen Kosmos der Werte, der ganz unabhängig von den Menschen existiere. Das Wertreich sei in sich selbst gegründet und nach objektiven Kriterien geordnet; Werte wie »mutig«, »edel« oder »vornehm« stünden ganz oben, während »gemein« ganz unten rangiere (Scheler 1921, S. 9 ff.). Er vertrat tatsächlich die Auffassung, dass Werte nicht das Ergebnis unserer Bewertung von etwas seien, sondern dass es sich genau umgekehrt verhalte: Wir würden Menschen, Handlungsweisen, Dinge und Sachverhalte gemäß den Wertkriterien bewerten, die sie objektiv enthalten – vorausgesetzt freilich, dass wir in der Lage sind, uns zu einer angemessenen Schau der Werte aufzuschwingen, was naturgemäß nur wenigen gegeben sei.
Heute vertreten die meisten Philosoph*innen den Standpunkt, dass Werte handlungsleitende Orientierungsmaßstäbe sind, nicht Eigenschaften von Sachverhalten oder Handlungen. Werte werden nicht mehr als substantielle Entitäten gedacht, sondern als Produkte menschlicher Setzung. Damit geht oft die Position des Wertrelativismus einher: Dass Werten transkulturelle, zeit- und ortsübergreifende Geltungsansprüche zukommen können, wird dann [22]bezweifelt. Dieser Zweifel muss aber nicht das letzte Wort haben.
Schon Heinrich Rickert hat um die Wende zum 20. Jahrhundert versucht, den unauflösbaren Widersprüchen bzw. Aporien des Wertobjektivismus und gleichzeitig den Aporien seines Gegenstücks, des reinen Subjektivismus der Werte, zu entgehen. Für Rickert sind Werte zwar keine ontologischen Wesenheiten, aber mehr als bloß subjektiv-beliebige Setzungen. Alles Werten finde stets in kulturellen Zusammenhängen statt, und Kultur ist eine »wertbehaftete Wirklichkeit«. Die Wirklichkeit der Werte ist, so Rickert, eine geistige Wirklichkeit der Bewertung und der Anerkennung von Geltungsansprüchen, mit denen sich eine Kulturwissenschaft zu beschäftigen habe, die »Sinndeutung« betreibt (Rickert 1899, Prechtl 1999). Als Max Weber nach dem Ersten Weltkrieg die Frage nach dem »Wert« der Wissenschaft stellte, fragte er nach dem »Sinn«, den organisierte, fortschreitende Forschung für die Interessen der Menschheit hat, und er meinte damit einen »über das Technische hinausreichenden Sinn« (Weber 1919a, 20). Der Sinn moderner, arbeitsteiliger Wissenschaft sei nicht etwa die Prätention, dass man veraltete Fragen nach dem »›Sinn‹ der Welt« (24) beantworten könne. Weber bezeichnet den – nicht bloß instrumentellen – Sinn von Wissenschaft als Wert. Dies impliziert Folgendes: Die Bedeutung des entbehrungsreichen und gefahrvollen Prozesses der Naturbeherrschung durch Arbeit, Technik und Wissenschaft besteht darin, dass er der Menschheit etwas verheißen kann, für das sich Mühe, Hingabe und Opfer lohnen. Was ist »wissenswert« (26)? Wofür lohnt sich der geistige, physisch-zeitliche und finanzielle Aufwand methodisch [23]kontrollierter, logisch und technisch überprüfter Forschungsprozesse? Weber, der sich an dieser Stelle auf Nietzsche beruft, meinte nicht, dass Wissenschaft und TechnikGlück zu versprechen hätten – aber doch immerhin die »Beherrschung des Lebens« (25), im gesellschaftlichen wie im naturhaften Sinne.
2.1.2 Werte-Lamento
Die Klage über einen ›Werteverfall‹ gehört zum Markenkern rechtsgerichteten politischen Denkens. Eine sogenannte »Werteunion« beispielsweise, die sich 2017 innerhalb der CDU/CSU als Widerstandsgruppe gegen Bundeskanzlerin Merkel formiert hatte, bezeichnet sich selbst als »Zusammenschluss wertkonservativer und wirtschaftsliberaler Unionsmitglieder« (Werteunion 2020). Eines ihrer Hauptanliegen besteht im Kampf gegen die Zuwanderung von Fliehenden nach Europa. Zu den Anführern der »Werteunion« gehört Hans Georg Maaßen, der wegen seiner Nähe zur nationalistisch-völkischen Partei AfD 2018 als Chef des bundesdeutschen Geheimdienstes zurücktreten musste. In einer Zeit, da rassistische und antisemitische Attacken auf offener Straße in der Bundesrepublik immer häufiger und brutaler stattfinden, propagiert die »Werteunion« eine sogenannte ›europäisch-deutsche Leitkultur‹ und »warnt vor Gefahr von links« (Werteunion 2020).
Die Klage über den ›Werteverfall‹ ist auch fester Bestandteil im Repertoire der Moral- und Kulturkritik. Dafür nun ein älteres und ein neueres Beispiel, denn ebenso wie die Sprache der Politik weist auch die Sprache der Moral- und [24]Kulturkritik aufschlussreiche Indikatoren für einen Bereich auf, den man als praktische Philosophie des Alltags bezeichnen kann.
»Die Salzburger Festspiele mit Appell an neue Werte eröffnet«, lautete eine Schlagzeile in der Frankfurter Neuen Presse vom 25. Juli 1998. Der österreichische Bundespräsident, so war zu lesen, hatte die Gelegenheit genutzt, seinen Zukunftssorgen Luft zu machen und zugleich seiner Hoffnung auf die versittlichende Kraft der Musik Ausdruck zu verleihen:
»An der Wende in ein neues Jahrtausend erleben wir die Gleichzeitigkeit eines immensen Werteverlusts und eines enormen Bedarfs nach ethischen Normen, die Menschen, Völker und Kontinente dauerhaft verbinden können«, sagte Klestil. Dabei komme den Künsten und der Religion eine entscheidende Rolle zu, da sie einen »unmittelbaren Zugang zu Herzen und Seelen finden«.
Im Salzburger Festspielprogramm fand sich an prominenter Stelle Peter Zadeks Inszenierung der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Dort hat Bertolt Brecht zwar nicht den Satz »Erst kommt das Fressen, dann die Moral« untergebracht (dieser Befund, den er seinen Protagonisten als Zynismus in den Mund legte und gleichzeitig selbst leider wahr fand, stammt aus der Dreigroschenoper). Aber in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny wird eine nicht minder ätzende Kritik bürgerlicher Doppelmoral der Markt- und Konkurrenzgesellschaft formuliert (Brecht 1930). Mahagonny ist eine Karikatur der bürgerlichen Marktgesellschaft, die Georg Wilhelm Friedrich Hegel als das »System [25]der Bedürfnisse« und als »Kampfplatz« bezeichnet hatte. Im Kampf der Interessen kann jedes zahlungskräftige Bedürfnis befriedigt werden. In Brechts Stadt darf man alles; dort ist eigentlich alles erlaubt, nur eines nicht: Zahlungsunfähigkeit. Die Konstellation der Festspiele, die mit Beschwörungen von Werten und Europa eröffnet, aber mit Brecht vollzogen wurden (der sich nach dem Zweiten Weltkrieg Chancen ausgerechnet hatte, Leiter der Salzburger Festspiele zu werden, was ihm erspart hätte, in die DDR gehen zu müssen, um angemessene Bedingungen für seine Theaterarbeit zu haben), ist im Rückblick entlarvend. Sie liefert vielleicht ein Indiz dafür, dass Kunst tatsächlich ein moralisches Potential besitzt, allerdings ein größeres, als es ihr moralisierende Festredner zusprechen. Der Verzicht auf eine philosophische (und das heißt: kritisch-rationale) Reflexion des Wertproblems, der die zitierten Wertebekundungen geradezu programmatisch kennzeichnet, erweist sich als belanglose polit-religiöse Rhetorik.
Ähnliches lässt sich in einem neueren Beispiel für moralkritische Klagen über den ›Verfall der Werte‹ beobachten, das aus einem Zeitungsartikel über Probleme der Polizei stammt. Der Autor zitiert den Chef der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen:
»Werteverfall, steigende Brutalität und eine sinkende Hemmschwelle gehören zu unserem Alltagsgeschäft«. Als Beispiel nannte er die steigende Zahl der Angriffe auf Polizisten. Ein Viertel dieser Angriffe habe sogar einen staatsfeindlichen Hintergrund, und es käme zu schweren Straftaten wie gefährliche Körperverletzungen. (Seher 2014.)
[26]Die Rede vom Verfall der Werte richtet sich hier gegen mangelnden Respekt und gegen Gehorsamsverweigerung gegenüber der Obrigkeit bzw. den Repräsentant*innen ihrer Zwangsgewalt vor Ort. Bezeichnend an diesem Beispiel ist der direkte Zusammenhang, in dem die Verfallsklage mit dem Gewaltmonopol des Staates steht, dessen Sinn und Zweck ja die Absicherung bestehender Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse ist.
Dass bewaffnete Zwangsgewalt als hoher Wert anzusehen sei, geht philosophisch auf die politische Ethik von Thomas Hobbes zurück. Hobbes beschrieb die Menschen als von Natur aus böse. Im fiktiven sogenannten »Naturzustand«, nämlich einem »Kriegszustand« (Hobbes 1651, 329), in dem es »keine staatlichen Gesetze« (681) gibt, würden die Menschen amoralisch agieren, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Jeder reißt an sich, was er kann. Im permanenten Konkurrenzkampf denken alle nur an sich und ihren Vorteil. Alles dreht sich um das Eigentum und seine Verteidigung, keiner nimmt Rücksicht auf den anderen, alle sind egoistisch und asozial.
Zu einer geordneten Zivilisation kann es unter Bürgerkriegsbedingungen nicht kommen, so Hobbes. Seine neuzeitlich-materialistische Philosophie ist in diesem Zusammenhang auch deshalb von Interesse, weil man sich verdeutlichen kann, wie die Vorstellung ethischer Güter sich in die Vorstellung ethischer Werte verwandelt hat. Bei Hobbes wird das Glück als oberstes Prinzip der Ethik durch das Prinzip der Selbsterhaltung ersetzt, an dem jeder Mensch ein natürliches Interesse habe (263). Glück und ein gutes Leben werden zu unverhofften Geschenken des Schicksals, auf das kein Verlass ist. Das einzige Ziel, auf das Menschen[27]ihr Handeln rationalerweise ausrichten können, sei das Überleben. Pure Selbsterhaltung avanciert zum höchsten Gut. Sie ist nur unter einigermaßen friedlichen Bedingungen möglich, argumentiert Hobbes, der im 17. Jahrhundert zur Genüge erfahren musste, was es bedeutet, in Bürgerkriegszuständen zu leben, die sich endlos hinzuziehen scheinen. Daher sei der bellum omnium contra omnes (der Krieg aller gegen alle, jener vermeintliche status naturalis) unter allen Umständen abzuwehren.
Die praktische Philosophie von Hobbes ist indessen keine des Friedens und der Versöhnung; sie rechtfertigt Herrschaft und Zwang. Die Legitimität staatlicher Zwangsgewalt wird freilich an die freiwillige Zustimmung derjenigen gebunden, die sich ihr zu unterwerfen haben. In Hobbes’ Modell ist die Staatsgründung ein Vertragsschluss, bei dem die Individuen ihr »natürliches« Recht aufgeben: Sie verzichten darauf, sich alles zu nehmen, was sie wollen, und dies wird durch einen Zuwachs an Sicherheit ausgeglichen. Bei rationaler Prüfung würde jeder einsehen, dass er vom Ende des Kriegszustands profitiert, genauso wie alle anderen. Hobbes drückt es so nicht aus, aber der Sache nach ist klar: Die partielle Abschaffung bzw. Einschränkung der individuellen Freiheit, die der Zwangsgewalt des Staates zu unterwerfen sei, macht Freiheit zu jenem zentralen Wert, auf den sich die modernen Nationalstaaten des Westens bis heute berufen.
Hobbes’ kontraktualistische Fundierung der Moral ist von einem Widerspruch gekennzeichnet, wie der Philosoph Gunzelin Schmid Noerr feststellt: Hobbes »gründete die Moral auf einen virtuellen Vertrag, den die Bürger frei miteinander geschlossen haben, sprach ihnen aber das [28]Recht ab, die vereinbarten Normen je infrage zu stellen« (Schmid Noerr 2006, 73). Der Einzelne wird als auf ganz sich bezogenes Individuum gedacht, das nicht durch Normen des Miteinanders gebunden ist. Um zusammenleben zu können, müssen sich alle Individuen Normen unterwerfen, deren Geltung sie freiwillig anerkennen, die aber durch eine übermächtige Zwangsgewalt abgesichert sind. Doch Hobbes kann nicht stringent darlegen, warum die Menschen ihren Eigennutz zurückstellen und moralisch handeln sollten. Er delegiert »das moralische Gewissen der Einzelnen« an den Staat und plädiert für eine »autoritäre Lösung der Interessengegensätze und Glaubenskonflikte« (74) im Gemeinwesen.
Dass die Moral bei Hobbes letztlich auf Zwang gegründet wird, passt auf den ersten Blick nicht zur abendländischen Auffassung, der zufolge Moral ein im Prinzip freies, willentliches Handeln, innerlich reguliert, darstellt. Dieser Widerspruch kann auf die Spannung zwischen »individuelle[n] Interessen und gesellschaftliche[n] Sanktionen« (ebd.) zurückgeführt werden. Er kann als Ausdruck eines sozialen Widerstreits gelten, der in heutigen Konkurrenz- und Klassengesellschaften keineswegs verschwunden ist. Aus dieser Sicht hat Hobbes das marktradikale Menschenbild gerechtfertigt, das unsere heutige Gesellschaft kennzeichnet.
Das Werte-Lamento ist offenbar auch unvermeidlich, wenn sich eine neue Jugendkultur durchsetzt: Gesellschaftliche Phänomene, die traditionell negativ beurteilt werden – z. B. Egoismus, Verweigerungshaltung und Konkurrenzmentalität oder Konsumismus, exzessiver Gebrauch neuer Medien und eine als hemmungslos empfundene Selbstbezogenheit –, werden dann gern auf den Verlust [29]verbindlicher Werte zurückgeführt. Dabei wird übersehen (oder verleugnet), dass es sich bei jenen Phänomenen nie um ein gänzliches Fehlen von Werten und Bewertungsweisen handelt, sondern lediglich um Umwertungen, die meist nicht bewusst reflektiert werden (Hilgers 2002). Der Pazifismus der Hippies in den 1960er Jahren wurde hierzulande mit Klagen über den Verfall der Werte kommentiert, und ganz ähnlich waren die Reaktionen auf den rassistischenTerror rechtsradikaler Jugendlicher seit den 1990er Jahren. Nun sind aber nicht nur love and peace, Toleranz und MultikulturalitätWerte, sondern eben auch imaginierte nationale Identitäten, Rassenhygiene, ethnische Sauberkeit und heilige Kriegsziele – so unerfreulich das auch ist, wenn man diese Werte von einem modernen, aufgeklärten Standpunkt aus betrachtet. In der Gegenwart kehren sie als Orientierungsgrößen zurück, die zunehmend auch von jungen, völkisch gesinnten Menschen geschätzt werden, weil sich im Rekurs darauf ein regressiver Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderen Lebensgewohnheiten und anderen sexuellen Orientierungen rationalisieren lässt.
Was manchen Beobachter*innen zunächst als eine Spielart der Jugendkultur erscheinen mochte, wuchs rasch zu einer ganz neuen Gestalt der öffentlichen Kommunikation an: die Netzkultur des digitalen Zeitalters. Kein Wunder, dass auch auf diesem weiten Feld die Klage über Werteverfall laut wurde. Hier geht es vor allem um gewandelte Formen des Umgangs miteinander und der Wertschätzung anderer. Allgemein wird der Verlust von Respekt und Anstand angeprangert. Durch die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit digitalen Endgeräten und Internetzugängen hat sich eine Social-Media-Öffentlichkeit[30]konstituiert, die in immer größerem Ausmaß auf journalistische Professionalität verzichtet. Kommentator*innen und Welterklärer*innen bilden ihre eigenen Formen der Mitteilung aus. Dabei haben sich die Phänomene des shitstorms, der hate speech und der cancel culture in den Vordergrund gedrängt. Sie scheinen dem Muster des Aufbegehrens von Schülern zu folgen, deren Tyrannen sich zurückziehen. Menschen mit Gewaltphantasien schreiben sich in den social media warm, wo sie kaum von gatekeepers behelligt werden. Der marktradikale Umbau der Medienlandschaft hatte ihre Kontrollinstanzen geschwächt. Dass sie in postmodernen Diskursen als altmodisch und moralisch-belehrend delegitimiert wurden, kam hinzu. Kurzatmiges Aufbegehren kann sich in diesem Klima als radikale Kritik gerieren (und sich selbst als solche missverstehen). Wozu soll man sich beispielsweise die Mühe machen und Kants Schriften studieren, wenn man doch kurzerhand darauf hinweisen kann, dass er sich in seiner Anthropologie nicht von den rassistischen Auffassungen seiner Zeit frei machen konnte? Bedauerlicherweise entgeht solch einer Lektüreverweigerung, dass derselbe Kant in seiner Moralphilosophie entscheidende Argumente formuliert hat, ohne die eine radikale Kritik des Rassismus theorielos und willkürlich bleiben würde (siehe dazu Brumlik 2020).
Die Vereinigung »Werte Leben« beklagte 2020, dass immer mehr »beleidigende Kommentare«, »feindselige Kommentare oder Posts« in den sozialen Netzwerken auftauchen, die einzelne Personen herabsetzen, und »Hassreden […] ganze Menschengruppen ins Visier« nähmen, »um diese gezielt herabzuwürdigen« (Werte Leben Online 2020). Gegen kommunikative »digitale Gewalt« gibt die [31]Vereinigung pädagogische Ratschläge, die auf eine Haltung der Toleranz, des Respekts und der Bereitschaft zur Aufklärung abzielen. Sie empfiehlt jungen Nutzer*innen der sozialen Netzwerke, ruhig zu bleiben, wenn sie angegriffen werden, und nicht durch aufgebrachte Reaktionen zur Eskalation beizutragen. Sie empfiehlt des Weiteren, »Hater« zu blockieren sowie Eltern, Lehrer*innen und Vertrauenspersonen um Hilfe zu bitten. Zur allgemeinen Bekämpfung des Phänomens wird empfohlen, Hasskommentare nicht zu »liken« oder zu »teilen«, sich nicht unbedacht beeinflussen zu lassen, sondern zu seiner eigenen Meinung zu stehen, diese kundzutun und andere Nutzer*innen aufzuklären: »Wir bei WERTE LEBEN – ONLINE machen uns stark für mehr Respekt und Mitgefühl im Netz. Auch Du kannst mit uns zusammen Dein Zeichen gegen Hass im Netz setzen.« (Ebd.)
So richtig und wichtig die pädagogische Ermahnung ist: Es steht zu befürchten, dass ihre Wirkung begrenzt bleiben wird, zumal dann, wenn es um Erwachsene geht. Menschen, die irre Kommentare im Internet schreiben, auf den Straßen »Lügenpresse« brüllen, Politiker*innen beleidigen oder mit dem Tode bedrohen und vor laufenden Kameras Fernsehreporter verprügeln, tun das nicht, weil ihnen noch niemand erklärt hat, wie unanständig so etwas ist. Ihr kommunikativesHandeln und Misshandeln ist vermutlich kein Ausdruck der Gleichgültigkeit gegenüber jedweden Werten, vielmehr einer eigenen Wertorientierung. Was für sie von hohem Wert ist und zuvor aus Furcht vor Sanktionen nicht an die Öffentlichkeit gelangte, das kann heute die Runde machen – unbehelligt von Redakteur*innen, die man andernorts dafür bezahlt, zu verhindern, dass [32]repressive und destruktive Gewaltphantasien verbreitet werden. Zeitweise wird diese ehemalige Nischenkultur des autoritätsgebundenen Charakters in deutschen Länderparlamenten adäquat repräsentiert.
Um derartige Zusammenhänge in ihrer Komplexität zu beschreiben und über ihre Wirkmechanismen aufzuklären, reicht ethische Reflexion allein nicht aus. Sie muss sich mit sozialpsychologischen und (bei diesem Beispiel jedenfalls) mit mediensoziologischen Überlegungen verbinden.
Die privatwirtschaftlich basierte Netzkultur des digitalen Zeitalters greift eine ehedem wichtige Instanz des Zirkulationssektors an, die durch die Digitalisierung von Produktions- und Zirkulationssphäre geschwächt ist. Dabei tritt zweierlei zutage:
dass die Macht der Presse im Schwinden begriffen ist, weil Zeitungen tendenziell überflüssig werden, wenn Informationswaren auf dem neuesten Stand der Technik über neue Distributionsmedien vermarktet werden, und
dass das erzieherische polit-kulturelle Bollwerk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer verzichtbarer erscheint. Meinungen triumphieren über Wahrheit und Erkenntnis, Identität triumphiert über Differenz und Differenzierung. Die Wertverschiebungen an der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Basis führen zu Veränderungen der Wertorientierung in der sozialen Kommunikation.
Die Tendenz ist indessen auch von entgegenwirkenden Faktoren begleitet. Nach dem Ausbruch der SARS-CoV-2-Pandemie konnten die öffentlich-rechtlichen [33]Informationsmedien hierzulande beim Publikum wieder aufholen. Ob sie damit das Terrain zurückgewinnen, das sie an kommerzielle Kanäle und an die chaotischen (Des-)Informationssphären sozialer Netzwerke verloren hatten, steht noch dahin. Allerdings war es nicht erst die Nachfrage nach allgemeinverständlichen Darstellungen aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und nach Widerlegung von Verschwörungsnarrativen, die ein vitalesInteresse an methodisch kontrolliert gewonnenem Wissen hervorgebracht haben. Dieses zeigte sich bereits in der Massen-Jugendbewegung »Fridays for Future«, dem Protest gegen die destruktiven Folgen industriekapitalistischer Naturausbeutung.
2.2 Kontroverse Werte
Werte sind Gegenstand von Kontroversen. Für viele Menschen schien nach dem 11. September 2001 deutlich geworden zu sein, dass nicht nur Frieden einen Wert darstellt, sondern ebenso Freiheit und die Kraft, sich gegen Angreifer zu verteidigen, die bereit sind, Menschenleben einzeln und in Massen für ihre Werte zu opfern. Die Bundesrepublik befindet sich seit 2015 laut offizieller Sprachregelung in einem »Kampf« gegen den IS und sein Kalifat. »Deutsche Soldaten sind auch künftig im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat im Einsatz. Der Auftrag der Bundeswehr wird ausgeweitet«, teilte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung im November 2016 mit (Bundesregierung 2016). Die religiös-faschistischen Herrscherfiguren des IS wollen durch kriegerische Aktivität nach außen ihren Herrschaftsbereich im Innern absichern. Der Kampf[34]dagegen wird »von einer breiten internationalen Koalition getragen, der Deutschland seit Anfang 2015 angehört« (ebd.), so die Internetseite der Bundesregierung. Dass Deutschland seit seinem Eintritt in den »Kampf«, den man auch als Krieg bezeichnen kann, Zielscheibe derjenigen Kampfmittel ist, welche die asymmetrischen Kriege der Gegenwart kennzeichnen, ist insofern folgerichtig. Niemand hört es gern, wenn etwa die Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz in Berlin im Dezember 2016 als Opfer eines weltweiten Krieges der nordatlantischen Wertegemeinschaft verbucht werden, doch spricht einiges für diese These.
In der weltweiten Krise, die 2020 von der SARS-CoV-2-Pandemie ausgelöst wurde, diskutierte man in Deutschland heftig über ethische Grundlagen politischer Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. Zur Debatte stand die Legitimität repressiver Zwangsmittel im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaats. Dabei ist es nicht zu Unrecht als »moralische[r] Zwiespalt« (Kornelius 2020) bezeichnet worden, dass sich die Ordnungsmacht über das individuelle Recht auf Bewegungs- und Versammlungsfreiheit hinwegsetzt, um das Leben von Menschen zu schützen, das unter bestimmten Umständen durch eine Infektionsgefahr bedroht ist. Versammlungsverbote, Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren sind klassische ordnungspolitische Instrumente zur Kontrolle einer potentiell sich widersetzenden Öffentlichkeit. Sie dürfen nicht nur mit Hinweis auf einen politischen ›Ausnahmezustand‹ (Bedrohung von außen, von innen oder durch eine Naturkatastrophe) gerechtfertigt werden, sondern müssen sich gemäß moralischen Kriterien als angemessen zum Schutz bedrohter Minderheiten ausweisen lassen. Die [35]entsprechende Argumentation hatte in diesem Falle eine medizinische Seite, denn die Maßnahmen wurden ergriffen, um festzustellen, ob sie sich überhaupt als kurz- und mittelfristig effektiv erweisen würden. Und es hatte eine ethische Seite: Politik ist auf moralische Rechtfertigung angewiesen.
Was sind ethischeWerte? Welcher Einsatz für sie darf als angemessen gelten? Wie gesagt: Gegenwärtig dominieren nicht mehr ontologische, sondern handlungstheoretische Bestimmungen. Vieles spricht dafür, Werte als relativ auf Bedürfnisse bezogen zu verstehen. Der Philosoph Wolfgang Schlüter hat das mit den Begriffen einer materialistischen Anthropologie erklärt. Werte resultieren demzufolge aus psychischen Reaktionen auf Triebbefriedigungsaufschub:
Körperliche, seelische und geistige Bedürfnisse verlangen nach unmittelbarer Befriedigung; ist diese versagt, so wird aus dem Bedürfnis ein Wert: Ich begreife die Versagung, die Befriedigung des Bedürfnisses wird mir wertvoll, und ich denke über Wege nach, diesen Wert zu realisieren, da sich seine Realisierung offensichtlich nicht einfach aus den naheliegenden Möglichkeiten ergibt. Der dafür notwendige Vernunftgebrauch muß erheblich gesteigert werden, wenn verschiedene Bedürfnisse miteinander konkurrieren, die nicht unmittelbar befriedigt werden können: Es muß eine Wertehierarchie aufgebaut werden. (Schlüter 1995, 177.)
Diese Erklärung der hierarchischen Anordnung unserer Bewertungen ist plausibler als Schelers Vorstellung von einem an sich seienden, hierarchischen Wertekosmos.
[36]Von diesem bedürfnis- und handlungstheoretischen Begriff des Wertes her kann nun auch der Begriff der Norm näher erläutert werden. In der Alltagssprache ist die Rede von Normen mehrdeutig. Damit können empirische, d. h. aus dem Erfahrungswissen abgeleitete Durchschnittsqualitäten gemeint sein, die unter Umständen willkürlich per Dekret gesetzt worden sind (beispielsweise die Normen des Deutschen Instituts für Normung DIN oder der Rahmen, der für die Abmessungen eines Fußballfeldes vorgegeben ist). Es können aber auch kontrafaktische Regeln und Maßstäbe gemeint sein (also solche, die dem tatsächlich Gegebenen entgegenstehen). Nur auf Letztere bezieht sich der philosophische Begriff der Norm oder des Normativen. Philosophisch gesprochen, sind Normen verbindliche Sollensforderungen. Ihre Gültigkeit kann sowohl als relativ auf bestimmte Handlungsziele ausgerichtet als auch im Sinne einer absoluten Gültigkeit aufgefasst werden, d. h. einer Gültigkeit, die in sich selbst legitim ist und nicht der Ableitung aus je bestimmten Zwecken des Handelns bedarf. Letzteres kennzeichnet idealistisch begründete Ethiken, während materialistische Theorien die Geltung von Normen relativ zu den Zielen des Handelns verstehen.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal die bedürfnistheoretischeMoralanthropologie von Schlüter angeführt, der seinen Ansatz mit der, auf Arnold Gehlens zurückgehenden, sozialanthropologischen Entlastungstheorie kombiniert:
Habe ich […] hinreichend Erfahrung mit der Realisierungsmöglichkeit eines Wertes und mit der erprobten Abstufung der konkurrierenden Werte, so entlaste ich [37]mich unter dem stetigen Ansturm neuer Bedürfnisse und neuer Situationen, indem ich die gefundenen und erprobten Wege der Wertrealisierung und -abstufung normiere. Die Norm ist eine festgelegte Form der Wertrealisierung, die den Vernunftgebrauch entlastet. Eine so zustandegekommene Norm kann dann ihrerseits die Entstehung neuer Bedürfnisse verursachen, aber auch in ein Spannungsverhältnis treten zu einer inzwischen veränderten Bedürfnislage, weil diese naturgemäß zu einer neuen Wertehierarchisierung drängt, der Zweck der Norm aber darin besteht, gleichsam endlich mal Ruhe und Klarheit an der Bedürfnisfront zu schaffen. (Schlüter 1995, 177 f.)
Normen können demnach als sozial kodierte und sanktionierte Methoden definiert werden, mit denen man versucht, Werte zu verwirklichen.
2.3 Ethik und Moral
Das Spezifische des philosophischen Nachdenkens über Normen und Werte besteht darin, dass diese auf Prinzipien zurückgeführt werden und ihr universaler Charakter begründet oder problematisiert werden soll. Es wird also der Frage nachgegangen, was es mit dem schlechthin allgemein verbindlichen Geltungsanspruch auf sich hat, den Moralprinzipien, anscheinend naturgemäß, mit sich führen. Moralprinzipien, Werte und Normen beziehen sich stets auf Angelegenheiten, die tendenziell alle Menschen in vitaler Weise betreffen. Es geht, vereinfacht gesagt, um die Frage, wie wir leben sollen.
[38]In antiken Ethiken steht das Motiv des guten Lebens, also des Glücks, im Zentrum, in neuzeitlichen Ethiken das Motiv der Pflicht. Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Fundierung der Moral auf dem Prinzip der Selbsterhaltung einen wichtigen Zwischenschritt darstellt, den man als Indikator für die Individualisierungstendenz der europäischen Neuzeit bezeichnen kann.
Wird menschliche Glückseligkeit als die letzte Begründungsinstanz für moralische Ge- und Verbote verstanden, spricht man in philosophischer Terminologie von einer materialen Ethik. Ethiken, für die die letzte Begründungsinstanz ein Konzept unbedingt geltender Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber ist, werden dagegen als formale Ethiken bezeichnet. Denn, wie Kant ausgeführt hat (siehe Kap. 10): Was Menschen als Glück bzw. als glückliches Leben empfinden, ist individuell sehr verschieden und jeweils an Inhalte gebunden, die nicht miteinander kompatibel sind. Demgegenüber ist das Konzept ethischer Verpflichtung als formales Konzept stringent verallgemeinerbar, denn es beruht nicht darauf, wozu wir im konkreten Einzelfall verpflichtet sind, sondern es hat den Charakter einer strikten Regel, die immer gilt. Kants prominentestes Beispiel dafür ist das Gebot, jederzeit die Wahrheit zu sagen.
Dazu später mehr; zunächst aber noch einige Bemerkungen über die Begriffe ›Ethik‹, ›Moral‹ und ›Moralphilosophie‹. Jeweils immer dann, wenn in der Ethik über Prinzipien, Begründungen und Anwendungen der Moral nachgedacht wird, kann man auch sagen, dass Ethik die Philosophie der Moral ist. Ethik bedeutet also etwa das Gleiche wie Moralphilosophie. Daher werden die beiden Ausdrücke in der Philosophie meist synonym verwendet.
[39]Das war aber in der Geschichte der Philosophie lange Zeit nicht der Fall. Denn zumeist verstand man unter ›Ethik‹ Tugendlehren oder die Lehre von den Gütern, die zu einem gelingenden Leben erforderlich sind. In älteren philosophischen Texten wird unter Ethik ›Sittenlehre‹ oder ›Tugendlehre‹ verstanden. Deren Gegenstand, die Moral, ist dann die Gesamtheit der bestehenden Sitten und der anerkannten Tugenden. Sitten und Tugenden sind indessen nicht das Gleiche. Die Sitten eines Gemeinwesens umfassen dessen kollektive Praxis (Hegel bezeichnete sie als daseiende »Sittlichkeit«), also alles, was in intersubjektiver Praxis üblich ist und als gerechtfertigt gilt. Heute würde man eher von der ›Kultur‹ als von der ›Sittlichkeit‹ eines Gemeinwesens sprechen. Tugenden hingegen sind Veranlagungen bzw. Dispositionen des Individuums. Die Antike verstand unter einer Tugend (griech. arete) eine Charaktereigenschaft, die positiv bewertet wird, wie z. B. Tapferkeit, Weisheit oder Gerechtigkeit. Ein tugendhafter Mensch war einer, dessen charakterliche Disposition insgesamt zum ›Guten‹ tendiert, worunter durchaus Verschiedenes verstanden wurde.
Ethos (mit kurzem e ausgesprochen) heißt bei Aristoteles so viel wie allgemeine Üblichkeiten, Gewohnheiten, Brauch. Der Begriff steht also für Sitte und Konventionen. Éthos (mit langem e) dagegen steht bei Aristoteles – der die Termini ἔθος und ἦθος erstmals systematisch im Kontext der Moralphilosophie verwendet hat – für die Haltung des mündigen Bürgers der Polis. Dieser folge mit seinem ethischen Urteilsvermögen, also indem er seine praktische Vernunft anwendet, nicht mehr bloß den Konventionen; er könne vielmehr in konkreten Situationen selbständig rational entscheiden, was moralisch richtig ist. Urteilsvermögen[40]und Einsicht machen seine moralische Kompetenz aus (vgl. Pieper 2000, 24 ff.).
Ethik ist also nicht Ethos, sondern die Theorie des Ethos. Der griechische Ausdruck éthe stand für ›Sitten‹, die lateinisch mores heißen. Joachim RittersHistorisches Wörterbuch der Philosophie, das begriffsgeschichtliche Standardwerk, stellt fest, dass der Ausdruck ›Moralphilosophie‹ auf die lateinische Übersetzung des griechischen Wortes ethiké zurückgeht. Diese Übersetzung stammt von Cicero, der den Ausdruck philosophia moralis erfand und damit den Begriff der Moralphilosophie terminologisch einführte (Ritter, Bd. 6, Sp. 149 ff.).
Der Philosoph Ernst Tugendhat meinte, die Übertragung des griechischen Wortes ethos in das lateinische moral (von mores) gehe auf einen Übersetzungsfehler zurück, der ἔθος und ἦθος in eins gesetzt habe: Auf diese Weise seien ›Charakter‹ und ›Sitte‹ versehentlich miteinander identifiziert worden (Tugendhat 1993, 34). Gegen diese Vermutung spricht jedoch, dass die Synonymie ganz treffend die Ambivalenz zum Ausdruck bringt, die in der Sache selbst steckt, denn sie steht für zwei Aspekte desselben Gegenstands: Ethos steht für Brauch, Sitte und Konvention, éthos für Charakter, als Tugend oder Grundhaltung des kompetent und eigenständig urteilenden Subjekts. Dem trägt die Doppeldeutigkeit der Adjektive ›moralisch‹ und ›sittlich‹ in der deutschen Sprache Rechnung, denn sie »können sowohl im Sinne von ἔθος wie von ἦθος verwendet werden« (Pieper 2000, 26 f.). Tugendhat irrt demnach, wenn er schreibt: »Die Herkunft des Wortes ›Ethik‹ hat also mit dem, was wir unter ›Ethik‹ verstehen, nichts zu tun.« (Tugendhat 1993, 34.)
[41]Die zweite Auflage von Rudolf Eislers berühmtem Handwörterbuch der Philosophie aus den 1920er Jahren definiert das Stichwort »Moralphilosophie« als »Ethik« und fährt daraufhin schlicht fort: »siehe dort«. Unter dem Stichwort »Ethik« findet man dann die wichtige Unterscheidung zwischen »empirischer« und »philosophischer Ethik«. Empirische Ethik beschreibt moralische Phänomene und versucht, ihre Entstehung zu erklären: Sie wird als »Moralwissenschaft, d. h. Psychologie und Soziologie« sowie »Entwicklungsgeschichte« des »sittlichen Verhaltens« definiert. Die philosophische Ethik dagegen bewertet ihre Gegenstände; sie wird definiert als »die kritisch-normative Wissenschaft vom Sittlichen, vom sittlichen Wollen und Handeln, von den sittlichen Werten, von den Prinzipien der Sittlichkeit« (Eisler 1922, 203).
Dieser Differenzierung liegt eine Einsicht zugrunde, die philosophisch ganz wesentlich ist: Moralische oder sittliche Phänomene sind keine Naturgegebenheiten, sondern etwas, was Menschen selbst hervorbringen, auch wenn sie sich darüber nicht im Klaren sind. Intuitiv handelnMenschen häufig so, als ob die Handlungsgrundsätze, die sie befolgen oder verletzen, unumstößliche Gegebenheiten wären, die unbedingt gelten. Gleichzeitig wissen sie, dass jene Handlungsgrundsätze dies keineswegs überall tun oder immer getan haben: andere Länder (oder Zeiten), andere Sitten.
Heute ist die Position des moralischen Relativismus ein Gemeinplatz, gerade unter aufgeklärten Europäer*innen, die um keinen Preis eurozentrisch erscheinen wollen. Und dennoch neigt man intuitiv dazu, es nicht für bloß konventionell zu halten, dass es moralisch geboten ist, ein Kind [42]vor dem Ertrinken zu retten. Man neigt in der Regel zu der Überzeugung, dass es nicht nur gerechtfertigt, sondern unumgänglich ist, wenn man einen Menschen verachtet, der davon lebt, arglose alte Menschen um ihre Ersparnisse zu betrügen. Und als in unserem Kulturkreis die Einsicht zum Gemeingut wurde, dass solche Empfindungen nicht aus einer gottgewollten Ordnung folgen und dass es nicht mehr (und nicht weniger) als ein menschlicher Konflikt ist, wenn wir dagegen verstoßen, löste dies tiefste Irritationen aus. Nicht zuletzt bei denen, die das paradigmatisch formulierten: Dostojewski und Nietzsche bezahlten einen hohen Preis, als sie ihre erschütternde Frage aussprachen, ob unter den Menschen alles erlaubt sei, wenn es keinen Gott gibt.
Die griechischen Philosophen befassten sich als Erste systematisch mit der Frage, wie moralische Prinzipien eigentlich begründet werden können, wenn man aus Beobachtung, Erfahrung und argumentierendem Nachdenken zu der Einsicht gelangt ist, dass sie nomothetisch – das heißt: gesetzt – sind und nicht als Tatsachen der Naturordnung anzusehen sind. Platon und Aristoteles vertraten den paradigmatischen Standpunkt, dass die (und nur die) moralischen Prinzipien Geltung beanspruchen können, die mit der Vernunft in Einklang stehen, wobei sie unter Vernunft noch nicht wie die Philosophen der Neuzeit ausschließlich die Vernunft des Individuums verstanden, sondern eine Vernunft des Ganzen, so etwas wie eine kosmologische Weltvernunft. Die Frage, die sich Philosophen schon seit jeher stellten und die zur Fragestellung der Ethik in der Moderne geworden ist, lautet: Wie können Moralprinzipien mit Geltungsanspruch formuliert, begründet und angewendet werden, wenn weder Naturordnung, Weltvernunft[43]oder göttliche Schöpfungsordnung als Legitimationsinstanzen (und gegebenenfalls sanktionierende Gewalten) geeignet sind?
Unter der Voraussetzung, dass man ›Ethik‹ als philosophische Theorie der Moral begreift, ist jedoch keineswegs eindeutig oder unumstritten, was unter dem Begriff zu verstehen sei. Ethik, schrieb der Soziologe Niklas Luhmann, ist die »Reflexionstheorie der Moral« (Luhmann 1989, 358). Diese Formel ist brauchbar, auch wenn sie nicht eindeutig ist (oder vielleicht ist sie es gerade deswegen). Dass Ethik die »Reflexionstheorie der Moral« ist, kann nämlich durchaus Verschiedenes bedeuten: In Ethiken wird systematisch über Sitten, Werte und normative Geltungsansprüche nachgedacht. Es wird über Kriterien sinniert, nach denen wir beurteilen können, ob Handlungen als moralisch gerechtfertigt gelten können oder zu missbilligen sind; es werden Fragen der moralischen Bewertung von Handlungen, Gütern oder Lebensformen erörtert. Ethik ist dann ein begrifflicher Reflexionszusammenhang, der sich auf Phänomene und Theorien aus dem Bereich des Moralischen bezieht. Der Satz, Ethik sei die »Reflexionstheorie der Moral«, kann aber auch etwas anderes heißen, nämlich dass Ethiken Theorien sind, die bestehende Sitten, Gebräuche und Wertordnungen widerspiegeln. Unter Ethiken werden dann Moralkodizes verstanden, also Lehrgebäude, die mehr oder weniger zusammenhängend beschreiben, was im Zusammenleben von Menschen üblich ist, was als gut und was als böse gilt. In diesem Verständnis besteht die Funktion von Ethik darin, den sozialen Zusammenhalt zu stabilisieren, indem den Individuen ein Set von Geboten und Verboten vorgehalten wird, das sie mittels [44]Gewöhnung seit frühster Kindheit verinnerlichen und möglich selten problematisieren sollten.
Tatsächlich liegen die Dinge philosophisch gesehen nicht so, wie Luhmann meinte: Ethik als Reflexionstheorie der Moral reflektiert ihren Gegenstand nicht bloß wie ein Spiegel, der keine begründete normativ-kritische Stellung zu seinem Gegenstand einnehmen kann. Vielmehr fragt philosophische Ethik nicht nur nach den Prinzipien und Geltungsansprüchen, die moralischen Überzeugungen jeweils zugrunde liegen; sie fragt vor allem, wie Moralprinzipien begründet werden und ob die Begründungen stichhaltig sind.
2.4 Doppelsinn von Reflexion
Gleichwohl bestehen zwei verschiedene, jeweils legitime Auffassungen davon, was ›Ethik‹ bedeutet, nämlich eine normative (oder: kritische) und eine funktionalistische Auffassung. Sie unterscheiden sich u. a. dadurch, was jeweils mit ›Reflexion‹ gemeint ist. Reflexion kann bedeuten, dass das denkende Ich sich auf sich selbst zurückbezieht. Vereinfacht ausgedrückt: Im Prozess der Reflexion denkt das Ich darüber nach, was es eigentlich bedeutet, ein denkendes Ich zu sein; darüber, inwiefern das denkende Ich durch kontinuierliches selbstbezügliches Denken zum Subjekt wird und inwieweit dieses kritische Selbstverhältnis des Subjekts sein Handeln bestimmt. Diese Bedeutung von ›Reflexion‹ ist für die Philosophie der Neuzeit