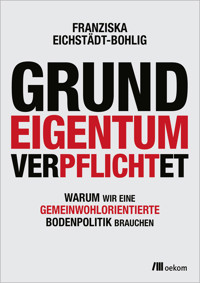
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In Deutschlands Städten bestimmen Spekulation und renditegetriebene Investoren zunehmend, wer wo wohnen und arbeiten kann. Die Folge: explodierende Mieten, steigende Boden- und Immobilienpreise, soziale Spaltung und der Verlust von immer mehr wertvollen Flächen. Die erfahrene Stadtplanerin und Politikerin Franziska Eichstädt-Bohlig analysiert die bodenpolitischen Fehlentwicklungen mit klarem Blick und macht deutlich: Die Wohnungsfrage kann nur zusammen mit der Bodenfrage gelöst werden. Eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Grundeigentumspolitik ist darum unabdingbar. Mit machbaren Reformvorschlägen zeigt sie, wie das aussehen könnte. Ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Gerechtigkeit, nachhaltige Stadtentwicklung und den Mut, Eigentumsrechte mit dem Wohl der Allgemeinheit zu verbinden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
natürlich oekom!
Mit diesem Buch halten Sie ein echtes Stück Nachhaltigkeit in den Händen. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie eine Produktion mit hohen ökologischen Ansprüchen:
100 % Recyclingpapier
mineralölfreie Druckfarben
Verzicht auf Plastikfolie
Finanzierung von Klima- und Biodiversitätsprojekten
kurze Transportwege – in Deutschland gedruckt
Weitere Informationen unter www.natürlich-oekom.de und #natürlichoekom
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München
oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Goethestraße 28, 80336 München
+49 89 544184 – 200
Lektorat: Katharina Spangler
Layout und Satz: Markus Miller
Korrektur: Silvia Stammen
Umschlaggestaltung: Stefan Hilden
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen
Dieses Werk ist ab dem 02.10.2026 lizenziert unter der Creative Commons Lizenz:
Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Diese Lizenz erlaubt das Teilen des Werks, gestattet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-98726-191-6
E-ISBN 978-3-98726-487-0
https://doi.org/10.14512/9783987264870
FRANZISKA EICHSTÄDT-BOHLIG
Grundeigentum verpflichtet
Warum wir eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik brauchen
Für die Mandatsträger*innen in Bund und Ländern, Kommunen und Kreistagen
Inhalt
VORWORT
EINLEITUNG – Über Grundeigentum, das zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll
Das Wirken der finanzialisierten Immobilienwirtschaft
Die neuen Wohnungsnöte
Zu viele Privilegien und zu wenig Gerechtigkeit
Zu wenig Verantwortung für Boden-, Natur- und Klimaschutz
Die Weisheit des Grundgesetzes
Die fehlenden Vorgaben zu Inhalt und Schranken des Grundeigentums
Ein neues Verständnis von Politik und Staatsaufgaben tut not
Teil I Grundeigentum, Finanzmärkte und Wohnversorgung
1 Citygrabbing oder die Finanzialisierung unserer Städte
Das Citygrabbing als Maßstab für Bodenpreise und Renditeansprüche
Die Eigentümerstruktur im Wohnungssektor
Die Macht der Finanzmärkte
Die großen Treiber der Immobilienspekulation
Die immobilienwirtschaftliche Ernüchterung im Jahr 2022
Exkurs: Die Geschichte des Berliner Kurfürstendammkarrees
WAS IST ZU TUN? – Das Fundament für verantwortliches Wirtschaften und verantwortliches Grundeigentum legen
2 Die Vermarktung des sozialen und gemeinnützigen Wohnens
Die Bedeutung der 1990 zerstörten Wohnungsgemeinnützigkeit
Der Ausverkauf der großen öffentlichen Wohnungsunternehmen
Die Demontage des sozialen Wohnungsbaus
Die wohnungspolitische Krise und die Illusion der Subjektförderung
Die Versuche der Wiedergutmachung
Exkurs: Der Berliner Volksentscheid »Deutsche Wohnen & Co enteignen«
WAS IST ZU TUN? – Die Bezahlbarkeit des Wohnungsbestands sichern und neues bezahlbares Wohnen behutsam entwickeln
3 Die Explosion der Bodenpreise
Die Dynamik der Immobilienpreissteigerungen seit der Finanzkrise 2008
Hochpreis-Angebote bei steigendem Bedarf an bezahlbaren Wohnungen
Die Innenentwicklung als Treiberin von Bodenpreissteigerungen
Die staatliche Legitimierung von Bodenspekulation und Bodenpreisspiralen
Der Ertragswert, der nicht zu erträglichen Werten führt
Die Angst vor der Immobilienpreisblase
WAS IST ZU TUN? – Ein neues Regelwerk zur Begrenzung der Bodenspekulation erarbeiten
4 Mietrecht und Mieteninflation
Die Wohnungs- und Mietenpolitiken nach 1945 in West- und Ostdeutschland
Zu hohe Kosten für Mieter und Wohnungskäufer, Staat und Kommunen …
Das Mietrecht ist ein Mieterhöhungsrecht
Die »ortsübliche Vergleichsmiete« – Stellschraube der Mietenspirale
Mietpreisbremse und Mietwucher: Wohnungssuchende als Zugpferde der Mietsteigerung
Die Modernisierungsumlage: Klimaschutz auf dem Rücken der Mieter
Die vielen Schlupflöcher zur Umgehung der ortsüblichen Vergleichsmiete
Der Kündigungsschutz und das Leben in Angst vor der Zwangsräumung
Die Eigentumsumwandlung: Extraprofite durch Mietervertreibung
Das Berliner Experiment »Mietendeckel«
Die »Vertragsfreiheit« der Gewerbemieter
WAS IST ZU TUN? – Ein Mietrecht schaffen, das bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum sichert
5 Die Steuerprivilegien des Grundeigentums
Die einen arbeiten, um zu leben, die anderen lassen ihr Geld »arbeiten«
Die steuerfreien Veräußerungsgewinne für privates Immobilieneigentum
Die Grunderwerbssteuer und der Share Deal
Die Grundsteuer als Bodenwertsteuer – und die Mieter zahlen die Zeche
Die Befreiung der Immobilienunternehmen von der Gewerbesteuer
Die steuerrechtliche Schieflage bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer
Deutschlands kleine Gewerbesteuer-Oasen
Steuervermeidung ist Steuerhinterziehung!
WAS IST ZU TUN? - Die Demokratie zerstörende Wirkung von Steuerprivilegien und geduldeter Steuerhinterziehung endlich ernst nehmen
Teil II Grundeigentum, Stadtentwicklung und kommunale Planungshoheit
6 Kommunale Planungshoheit und private Bodenwertabschöpfung
Das Planungsrecht als Spiegel widersprüchlicher Ziele
Die staatliche Legitimation der Bodenpreisspiralen beenden!
Kommunale Abschöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen ermöglichen
Bessere Vorkaufsrechte für die Kommunen
Mehr Geld und sinnvolle Steuerungsrechte für die Innenentwicklung
Privatinvestoren für den Bau von Sozialwohnungen mit in die Pflicht nehmen!
Mehr Grün und Regenwasser für unsere Städte und Siedlungsbereiche
Das Rückbaugebot in § 179 BauGB zu einem echten Gebot machen
WAS IST NEU ZU DENKEN? Mein Vorschlag für ein »städtebauliches Grundstücksverkehrsgesetz« für Großstädte:
7 Die kommunale Liegenschaftspolitik soll das Gemeinwohl stärken
Der strategische Grunderwerb als kommunale Daueraufgabe
Der Aufbau eines revolvierenden Bodenfonds
Der kommunale Zwischenerwerb von Bauland
Die gemeinwohlorientierte Vergabe kommunaler Grundstücke
Die Frage nach Erbbaurecht oder Verkauf von öffentlichen Liegenschaften
Kleine und große Schlüsselgrundstücke für neue Stadtimpulse
WAS IST ZU TUN? – Bund und Länder müssen den Kommunen mehr Wertschätzung und mehr finanziellen und rechtlichen Handlungsraum geben
8 Die Umwandlung von Boden in neue Siedlungsflächen konsequent einschränken
Die Vorgaben zur Begrenzung der Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen
Bisherige Initiativen zur Senkung des Flächenverbrauchs
Landesplanerische Vorgaben zur Flächeninanspruchnahme
Die Konzepte Neubaulandumlage und Flächenzertifikatehandel
WAS IST ZU TUN? – Mein Vorschlag: Neubaulandabgaben erheben und mit Bodenrenaturierung verknüpfen
FAZIT: Zehn Reformfelder warten auf politisches Handeln
Dem Leitbild einer sozial und ökologisch verantwortlichen Bodenpolitik folgen
Zehn Reformfelder gehören auf die politische Agenda
Die Forderungen von Wissenschaft, Mieterbewegung und Bürgerinitiativen
Ausblick
Glossar
DANK
Über die Autorin
VORWORT
Dieses Buch habe ich aus dem Blickwinkel einer Stadtplanerin geschrieben, die als Volksvertreterin über viele Jahre die politischen Grundlagen ihrer Arbeit mitgestalten durfte. Dabei habe ich gelernt, dass Fachpolitik neben praktischer Erfahrung auch politisches Denken und ein gesellschaftspolitisches Fundament braucht. Handlungsleitend ist für mich das Prinzip der demokratischen Mitverantwortung für soziale Gerechtigkeit und für ökologische Zukunftsfähigkeit. Diese Haltung ist die Grundlage, auf der ich die Grundeigentumsrechte analysiere und ihnen Vorschläge für eine gerechtere Bodenpolitik gegenüberstelle.
Wer sich auf die Suche nach den Regeln des Grundeigentumsrechts begibt, findet kein zusammenhängendes Rechtsgebiet. Die Grundeigentums- und Bodenpolitik fußt in Deutschland auf sehr unterschiedlichen Gesetzen und Regelungen – denen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Gesellschafts- und Unternehmensrechts, des Steuerrechts und des Planungsrechts, der Mieten- und Wohnungspolitik und natürlich auch der Liegenschaftspolitik der öffentlichen Hände.
Wissenschaft und Politik befassen sich meist nur mit bodenpolitischen Teilbereichen wie beispielsweise den Bodenpreisen, den Steuern oder der Flächeninanspruchnahme. Mein Anliegen ist es deshalb, die (Fehl-)Entwicklung der derzeit geltenden Grundeigentumsrechte im Zusammenhang darzustellen und die jeweilige Verantwortung des Gesetzgebers herauszuarbeiten. Denn daraus sind auch gesetzgeberische Änderungen ableitbar.
In den folgenden Kapiteln frage ich die unterschiedlichen Arbeitsfelder auf ihre Bedeutung für die Grundeigentumsrechte hin ab – und zwar schwerpunktmäßig in Hinblick auf städtisches und siedlungsbezogenes Grundeigentum. Grundeigentum in Landschaftsräumen und in der Agrar- und Waldwirtschaft klammere ich aus, um das ohnehin sehr komplexe Thema nicht zusätzlich zu überfrachten.
So unterschiedlich die einzelnen Arbeitsfelder und Instrumente sind, die Boden- und Grundeigentumspolitik folgt durchweg dem Leitbild, dass Boden ein marktwirtschaftliches Handelsgut ist, das für alle menschlichen und wirtschaftlichen Belange jederzeit und fast unbegrenzt verfügbar sein soll. Dabei werden den Grundeigentümern erstaunlich viele Privilegien gewährt und frau fragt sich, wo denn die Äquivalente für Menschen ohne Grundeigentum sind. Im Kern geht es immer wieder um das Recht auf die Durchsetzung von Bodenwertsteigerungen, was das Eigentum an Grund und Boden so elementar von anderen Konsum- und Gebrauchsgütern unterscheidet.
Nach den beiden Weltkriegen hat man zur Linderung von Wohnungsnot und zur Finanzierung von Kriegsfolgen die Eigentumsrechte beschnitten. Im Zuge von Wirtschaftswachstum und Globalisierung sind sie in den letzten Jahrzehnten wieder großzügig ausgeweitet worden. Das verstärkt die soziale Ungleichheit in unerträglicher Weise. Dabei sind nicht das selbst genutzte Grundeigentum und das kleine private Mietshaus für die Altersvorsorge problematisch, sondern die auf hohe Renditen ausgerichteten Unternehmen und Investoren, die ihre Geschäfte auf Kosten der Normalbevölkerung und der Nichteigentümer abwickeln.
Die Profitansprüche der auf Vermögens- und Kapitalverwertung ausgerichteten Unternehmen führen zu immer größerer Belastung und Überlastung der Menschen, die auf bezahlbare Wohnungen und bezahlbaren Gewerberaum angewiesen sind. Die bauliche Unterhaltung und Pflege von Haus und Grund leiden darunter. Und die Aufgabe, möglichst viel unzerstörten Boden zu erhalten und die Umwandlung von Agrarund Waldboden in Siedlungsflächen zu begrenzen, ignorieren die Verantwortlichen. Denn sie wollen immer mehr Neubau und nehmen dafür großzügige Raumverschwendung hin.
Besonders wichtig ist es, Wohnungspolitik und Bodenpolitik im Zusammenhang zu betrachten. Über viele Jahrzehnte haben die Akteure der Kapitalmärkte und Immobilienspekulanten ihre Geschäfte überwiegend mit dem Gewerberaum der großstädtischen Zentren gemacht. Dabei sind Preissteigerungen und die Kapitalverwertung an ihre Grenzen gestoßen. Die Folge: Die Mietwohnversorgung ist ein bedeutendes neues Spielfeld für finanzmarktorientierte Investoren geworden, ohne dass sich die Bundespolitik um angemessene Schutzinstrumente für die betroffene Bevölkerung kümmert. Im Gegenteil: Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit, die Einschränkung des sozialen Wohnungsbaus, die Privatisierung öffentlicher Wohnungen, großzügige Mieterhöhungsspielräume und letztlich die Politik der Niedrig- und Nullzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) – all das hat städtische Wohnungsbestände für renditeorientierte Investments interessant gemacht. So wird der Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum immer mehr die Grundlage entzogen, vor allem in den wachstumsstarken Stadtregionen.
Immer mehr Geld, das für bezahlbares Wohnen, für Investitionen in baulichen Klimaschutz und Barrierefreiheit nötig wäre, fließt in die Immobilienspekulation und die Wertabschöpfung der Finanzmärkte. Die Zahl der Mieterhaushalte, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, steigt von Monat zu Monat. Diesen wohnungspolitischen Scherbenhaufen mit etwas mehr Wohnungsneubau und ein paar Placebo-Gesetzen zum Mietrecht zu kitten, reicht nicht aus. Stark steigende soziale Ungleichheit trifft aktuell auf einen ebenso stark ansteigenden Handlungsbedarf für Klima- und Naturschutz. Vor diesem Hintergrund müssen wir den gewohnten Umgang mit Grundeigentumsrechten und den Gebrauch von Boden dringend überdenken.
Eine lebendige Demokratie braucht das verantwortliche Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Unser Gemeinwesen hat sich aber zu bequem in einer falschen Arbeitsteilung zwischen Staat, Markt und Bürgergesellschaft eingerichtet. Markt und Kapital haben ein Recht auf unbegrenzte Gewinne durchgesetzt und wollen vom Staat möglichst wenig reguliert werden. Der Staat soll aber für Infrastrukturen und Gemeinwohl sorgen und soll soziale Ungleichheit und ökologische Schäden kompensieren. Diese Arbeitsteilung überfordert den Staat immer mehr und reduziert die Zivilgesellschaft auf Konsumenten von Marktgütern einerseits und staatlichen Wohlfahrtsgütern andererseits.
So stehen Teile der zu Konsumenten erzogenen Gesellschaft ihrer Mitverantwortung für eine demokratische und sozial gerechte Politik zunehmend gleichgültig gegenüber. Der Staat ertrinkt in Subventionsleistungen für Wirtschaft und Bürger. Und die Forderung nach möglichst wenig staatlicher Regulierung führt bei den heutigen höchst komplexen Wirtschaftsbeziehungen und Ökologieanforderungen paradoxerweise zu immer kleinteiligeren und komplizierteren Rechtsvorgaben, also zu einem fortgesetzten Mehr an Regulierung, das kaum jemand noch durchschaut.
Das Grundgesetz macht mit Artikel 14 die sehr kluge Vorgabe, nach der (privates) Eigentum gewährt wird, es aber zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll. Der Gesetzgeber wird dezidiert aufgefordert, dafür Inhalt und Schranken zu bestimmen. Die folgenden Kapitel zeigen aber, wie dem Grundeigentum viele Privilegien zugesprochen werden, aber nur punktuell Mitverantwortung für das Allgemeinwohl abverlangt wird. Dieser Forderung des Grundgesetzes deutlich mehr Geltung zu verschaffen, als es derzeit der Fall ist, ist mein zentrales Anliegen in diesem Buch. Die Analyse der geltenden Eigentümerrechte verbinde ich mit Reformvorschlägen und Forderungen, wobei privates Eigentum nicht durch verstaatlichtes Grundeigentum ersetzt werden soll – es sei denn in Form einer aktiven öffentlichen Bodenvorratspolitik und durch verbesserte kommunale Vorkaufsrechte.
Es geht darum, den Auftrag des Artikels 14 Grundgesetz ernst zu nehmen und wirksam zu machen. Für mehr soziale Gerechtigkeit und für die ökologische Zukunftsfähigkeit sind Reformen und verstärkte Anforderungen an die gesellschaftliche Mitverantwortung der Grundeigentümer unabdingbar. Es geht um gemeinwohlorientierte Eigentümerstrukturen, um Eigentümervielfalt und Eigentümertransparenz. Übermäßige Gewinnansprüche und der Anstieg der Bodenpreise müssen begrenzt werden, verbindliche Regeln für mehr Gerechtigkeit zwischen Eigentümern und Nichteigentümern müssen gestärkt und geschaffen werden. Für Natur- und Klimaschutz kommt dem Erhalt des natürlichen Bodens eine sehr viel größere Bedeutung zu als bisher. Dazu mache ich Vorschläge und verweise auf die Forderungen von anderen politisch engagierten Akteuren. Es sind Vorschläge und Forderungen, die Handlungswillen und Mut zu neuem Denken verlangen. Aber ohne solchen politischen Mut verliert unsere Gesellschaft ihren sozialen und demokratischen Zusammenhalt und ihre Zukunftsfähigkeit.
Anmerkungen zur Lektüre:
Da sehr unterschiedliche Politikfelder auf den Umgang mit Boden und Grundeigentum einwirken, können die einzelnen Kapitel auch unabhängig voneinander gelesen werden. Dafür werden einige Sachzusammenhänge bei Bedarf wiederholt aufgerufen. Die Endnoten finden sich jeweils am Ende der einzelnen Kapitel.
Die genderdifferenzierende Sprache benutze ich nur in den seltenen Fällen, wo es mir wichtig ist, die Menschen ausdrücklich in ihren geschlechtsspezifischen Unterschieden anzusprechen. Generell nutze ich das generische Maskulinum, um Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen. Dies zum einen, um das Lesen dieses von der Sache her schwierigen Themas nicht zusätzlich zu verkomplizieren. Zum anderen, weil unsere Sprache zwar maskulin geprägt ist, die männliche Schreibweise sich aber formal nicht von »der Mann«, sondern von »der Mensch« ableitet. Dieses Buch handelt aber auch vom kapitalistischen Prinzip der Geld- und Kapitalvermehrung. Meines Erachtens ist das Leitbild des Kapitalismus stark von männlichen Denk- und Handlungsprinzipien geprägt: Heute jagt man(n) nicht mehr Hirsch und Hasen, sondern Geld und Vermögen. Es wäre irreführend, wenn ich das mit Begriffen wie die »Investor*innen« beschreiben würde, denn die vorherrschenden Politik-, Wirtschafts- und Eigentumsverhältnisse sind immer noch stark von männlichen Jagdinstinkten geprägt.
Franziska Eichstädt-Bohlig, Juni 2025
EINLEITUNG – Über Grundeigentum, das zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll
»Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen; eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern.«
Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 12.01.1967 – 1 BvR 169/63
Eigentlich dürfte es in Deutschland keine Probleme mit fehlendem Wohnraum geben. Wir haben 43,4 Millionen Wohnungen für knapp 84 Millionen Einwohner, also jeweils eine Wohnung für zwei Menschen. 46,5 Prozent der Haushalte leben im Eigenheim oder in einer Eigentumswohnung. Wir leisten uns 55,4 Quadratmeter Wohnfläche pro Einwohner.1 In vielen Großstädten und auch in den besonders teuren Metropolen München, Berlin, Hamburg oder Frankfurt am Main leben rund 50 Prozent der Haushalte als Singles in einer Wohnung. Das ist ein Wohlstand, um den uns die Menschen in vielen Teilen der Welt beneiden.
Die durchschnittliche Wohnraumversorgung verdeckt aber die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft. Während die einen überversorgt sind, finden andere keine bezahlbare Wohnung oder können die Last ihrer hohen Miete kaum schultern. Hinzu kommt die räumliche Ungleichheit. Während der Druck des Bevölkerungswachstums in wirtschaftsstarken Stadtregionen groß ist, kämpfen strukturschwache Regionen gegen die Abwanderung ihrer Jugend und den Verlust von Gewerbe, Schulen und Arztpraxen.
Bevölkerungszuwachs und Wirtschaftskonzentration werden in den Großstädten und Wachstumsregionen wahrscheinlich anhalten, zumal mit fortgesetzter Immigration und verstärkten Fluchtbewegungen nach Europa und Deutschland zu rechnen ist. Die Suche nach Raum für bezahlbares Wohnen, Gewerbe und öffentliche Infrastrukturen wird darum für viele Städte und Kommunen zur Daueraufgabe. Dies muss aber mit einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Gebäude und Grundstücke einhergehen, weil der Klimawandel die gewohnten Siedlungserweiterungen und die fortgesetzte Umwidmung von Agrar- und Naturboden in neues Bauland nicht länger erlaubt. Statt immer wieder Neubauland zu erschließen, muss die Weiterentwicklung des Siedlungsbestands Vorrang haben. Der Gebäudebestand muss energetisch und umweltverträglich modernisiert, CO2-neutral bewirtschaftet und vielfach für eine effizientere Raumnutzung um- und ausgebaut werden. Das sind Mammutaufgaben, denen sich die Politik und die Kommunen stellen müssen und die auch den kleinen und großen Grundeigentümern neues Denken und Handeln abverlangen.
Das Wirken der finanzialisierten Immobilienwirtschaft
Statt diese seit Jahren anstehenden Aufgaben mutig anzugehen, wurde und wird bislang vor allem die globale Marktliberalisierung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft politisch vorangetrieben. Der Ausverkauf der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft war der Türöffner für den Einstieg von angloamerikanischem und japanischem Kapital in die hiesige Wohnungswirtschaft. In der Eurokrise retteten Spanier, Italiener und Griechen ihr Geld in deutschen Immobilien. Mit den Niedrigzinsen kamen Investmentfonds, Pensionskassen und Vermögensverwalter aus aller Welt. Immobilienfonds, Aktiengesellschaften, Briefkästen in Steuerparadiesen rund um den Globus und ortskundige Glücksritter rissen sich bis 2022 darum, möglichst werthaltige Immobilien in hiesigen Großstädten zu kaufen, aufzuwerten und profitträchtig zu vermarkten. Das Geschäftsmodell der Finanzialisierung ist die permanente Spekulation auf Immobilienwertsteigerungen – sei es durch den Handel mit Immobilien, sei es durch forcierte Mietsteigerungen. Das ist mit dem Ziel, zugleich dem Allgemeinwohl zu dienen, nicht vereinbar.
Nun ist die spekulative Immobilienwirtschaft mit dem Ende der Niedrigzinspolitik ins Schlingern geraten. Immobilienpreise und Aktienwerte sind etwas gesunken, Insolvenzen belasten viele Gläubiger, Kreditinstitute bangen um ihre Forderungen, Fondsanleger ziehen ihre Anteile zurück. Ab 2023 zeichnete sich ab, dass die Immobilienblasen zwar nicht platzen, dass aber deutlich Luft abgelassen werden muss aus der extrem aufgeblähten Geschäftstätigkeit. Dabei warten schon die nächsten Investoren darauf, aus den Nöten und der Insolvenz der Konkurrenz neue Geschäfte zu machen. Größere Probleme machen die Überangebote an Büro- und Einzelhandelsimmobilien, bei Wohnungen verlassen sich die Kapitalanleger darauf, dass die Wohnraumnachfrage weiter steigt und Staat und Bürger die Zeche für ihre Profitansprüche bezahlen.
So machen die Immobilienhaie im Boom wie in der Krise ihre Geschäfte auf dem Rücken der Bevölkerung und des Gemeinwesens, treiben die Grundstückspreise unverantwortlich hoch und nennen das »soziale Marktwirtschaft«.
Der Mechanismus der neoliberal organisierten Finanzmärkte ist ein wesentlicher Treiber der sozialen und politischen Polarisierung der Gesellschaft.2 Die EU hat dieser Entwicklung seit den1980er Jahren durch Liberalisierungen des Banken- und Finanzmarktsektors den Boden bereitet, um ein starker Akteur in der globalen Konkurrenz der Finanzmärkte zu werden. Dafür wurden traditionelle Regeln des Handelsrechts und des Grunderwerbs aufgeweicht und der Verschleierung von Geschäften, Eigentumsrechten und Steuerpflichten große Spielräume gegeben. Nach der Finanz- und Eurokrise 2008 wurden den Banken etwas härtere Regeln abverlangt, aber die Finanzmärkte und Fondsverwalter dürfen ihre Geschäfte fast unverändert fortsetzen. Einige sind zu sehr mächtigen Schattenbanken herangewachsen.
Auf die sozialen und wohnungspolitischen Auswirkungen für die Bevölkerung und die Kommunen reagiert die Bundespolitik seit Jahren mit vollmundigen Versprechen, denen in der Praxis aber nur ein paar mietrechtliche Placebo-Gesetze und ein paar geförderte Neubauwohnungen folgen. Bezahlbare Wohnungen, bezahlbare Gewerbemieten und bezahlbare Grundstücke rücken für immer mehr Menschen in weite Ferne.
Die neuen Wohnungsnöte
Früher hat sich das globale Finanzkapital ausschließlich für besonders attraktive innerstädtische Büros, Hotels und Handelsimmobilien interessiert. Mit dem Kauf vormals gemeinnütziger Wohnungsunternehmen erweiterten einige Akteure ihre Geschäfte auf den privatisierten Mietwohnungsbestand und wurden immer mächtiger.
Private Kleineigentümer waren und sind traditionell langfristige Bestandshalter von Mietshäusern, die von ihrem Haus moderate, aber regelmäßige und lebenslang sichere Renditen erwarten. In dieser Form war und ist der private Mietwohnungsbestand das größte Potenzial für die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit bezahlbaren Mietwohnungen. Demgegenüber setzen die spekulativen Investoren auf wiederholten Kapitalumschlag und Renditesteigerung. Sie treiben Grundstückspreise in Höhen, die realwirtschaftlich oft nicht refinanziert werden können. Diese überteuerten Bodenpreise werden als Bodenrichtwerte zum Maßstab für die Grundstücksgeschäfte im Stadtteil und in der Region.
Im Neubau kann bezahlbarer Wohnraum nur durch umfassende staatliche Förderung oder durch Quersubvention und erhöhte Finanzbelastung anderer Immobilien geschaffen werden. Wenn die Hypotheken der Grundstücks- und Bauinvestitionen sinken und abgetragen sind, ist ein solide gebautes Haus preiswert. Dafür ist das langfristige Halten von Haus und Grund eine wichtige Voraussetzung. Die »Finanzialisierung« einer Immobilie führt demgegenüber zu neuen Kreditlasten und zwingt zur Verteuerung des vorhandenen Wohnungs- und Gewerberaums. Für die Mieter und Wohnungssuchenden bedeutet das einen großen Mietsteigerungsdruck und führt oft auch zu Schikanen und Verdrängung durch Eigentumsumwandlung und »Gentrifizierung«. So verliert der privateMietshausbestand seine Funktion der Wohnversorgung für die Mehrheit der Bevölkerung.
Zu viele Privilegien und zu wenig Gerechtigkeit
Das westdeutsche Gegenmodell zum Verstaatlichungssozialismus der DDR war das Eigenheim und das private Mietshaus in den Städten. Dabei erfährt das private Grundeigentum beachtliche Privilegien im Steuerrecht und durch das Planungsrecht, durch ansehnliche Mietsteigerungsrechte und vor allem durch die Bodenwertsteigerungen. Die Vergünstigungen für privates Grundvermögen und für gewerbliche Immobilienunternehmen unterscheiden sich, aber sie sind in beiden Fällen beachtlich! Diesen eigentumsrechtlichen Privilegien steht die unabdingbare Steuerpflicht auf Erwerbseinkommen und Konsumgüter gegenüber, die die Mehrheit der Nichteigentümer trifft.
Aus ihrer wohnungspolitischen Verantwortung hat sich die öffentliche Hand ausgerechnet zu der Zeit gestohlen, als Einkommen und Erwerbsarbeit stark flexibilisiert und unsicher wurden. Im Rausch von Deregulierung und Privatisierung wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus weitgehend beendet. Öffentliche Wohnungsunternehmen wurden an »Heuschrecken« verkauft. Für die Menschen in Ostdeutschland fiel die Zeit des »Aufbaus Ost« in die Hochphase neoliberaler Kapitalmarktgläubigkeit – Grund und Boden wurde schnellstmöglich privatisiert.
Seit 2014 sieht auch die Bundespolitik wieder wohnungspolitischen Handlungsbedarf, er ist allerdings sehr einseitig auf Neubaubedarfe ausgerichtet und nimmt die Mitverantwortung der Eigentümer für bezahlbare Wohnungsbestände nicht wirklich in den Blick. Bislang gibt es keine Bereitschaft zu grundlegenden politischen Reformen. So nimmt die Gerechtigkeitslücke zwischen den großen Grundeigentümern und den Nichteigentümern immer weiter zu.
Zu wenig Verantwortung für Boden-, Natur- und Klimaschutz
In Sonntagsreden und internationalen Erklärungen zum Klima- und Artenschutz sind wir groß. Aber die praktische Umsetzung ist immer noch zu zaghaft. Die Art und Weise, wie wir Boden versiegeln und Häuser, Siedlungen und Verkehrswege planen, bauen und nutzen, ist nach wie vor von zu wenig Verantwortung für Klima- und Umweltschutz geprägt. Das gilt für Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft gleichermaßen. Zu viel Boden wird für neuen Siedlungsbau beansprucht und wo ein Auto rollt und steht, haben Asphalt und Beton lebendigen Boden zerstört.
Täglich werden derzeit 52 Hektar Landwirtschafts- und Naturboden für neue Siedlungs- und Verkehrsansprüche umgenutzt.3 Hinzu kommt der steigende Flächenbedarf für Wind- und Solarenergie. Die Inanspruchnahme von neuem Bauland soll bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag und bis 2050 auf null Hektar sinken. Dafür gibt es bislang aber keine verbindliche Strategie – im Gegenteil: Die Mobilisierung von Bauland ist das Gebot der Stunde. Die notwendige Einschränkung der Ansprüche an neue Siedlungs- und Verkehrsflächen macht aber auch einen neuen Umgang mit den gewohnten Freiheiten des Grundeigentums notwendig. Wir brauchen Leitbilder einer neuen Raumsparsamkeit.
Das heutige Bauen ist allen Nachhaltigkeitszielen zum Trotz ökologisch schädlich. Die Herstellung von Zement, Beton und Stahl ist besonders energieaufwendig und klimaschädlich. Der Abbau von Kies, Bausand und Naturstein zerstört immer weitere Landschaftsräume. Baumaterialien werden chemisch behandelt und mit Plastik verklebt. Unmengen von Bauschutt belasten und zerstören wertvollen Boden. Das Weiternutzen und Neunutzen der vorhandenen Gebäude und das Recyceln von natürlichen Baustoffen müssen endlich zum Grundsatz gemacht werden, statt auf möglichst teuren Grundstücken möglichst billiges Bauen zu propagieren.
Nur mit grundlegenden Reformen der Boden- und Grundeigentumsrechte können wir die großen sozial-ökonomischen Ungerechtigkeiten einschränken und unsere Städte und Siedlungen für das Überleben im Klimawandel umbauen.
Die Weisheit des Grundgesetzes
Das Grundgesetz legt mit den unveräußerlichen Grundrechten in Artikel 1 bis 19 das Fundament für Menschenrechte, Freiheitsrechte und bürgerschaftliche Demokratie in Deutschland. In Artikel 14 und 15 setzt es den Maßstab für den Umgang mit Eigentum und gibt damit eine sehr kluge Verbindung von freiheitlichen Rechten und gesellschaftlicher Mitverantwortung vor. Das Grundgesetz bezieht sich hier auf alle Arten von Eigentum, eigentumsgleichen Rechten und Wirtschaftsmacht. Da aber die Verteilung und die Rechte des Grundeigentums von großer Bedeutung für alle hier lebenden Menschen sind – auch für die Nicht-Eigentümer! –, kommt den rechtlichen Vorgaben für das Grundeigentum eine besondere Bedeutung zu.4
Die Kernsätze des Grundgesetzes kann man nicht oft genug zitieren und allen politisch Verantwortlichen ins Stammbuch schreiben:
»Artikel 14 Grundgesetz (Eigentum – Erbrecht – Enteignung):
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.«
Und:
»Artikel 15 (Vergesellschaftung):
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß
der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.«
Auch weitere Hinweise des Grundgesetzes sind beachtenswert. Artikel 13 Grundgesetz, der die Unverletzlichkeit der Wohnung zum Gegenstand hat, macht strenge Vorgaben, um Eingriffe und Beschränkungen des unverletzlichen Wohnrechts zu minimieren. In Absatz 7 erlaubt er aber auch Eingriffe »zur Behebung von Raumnot«.
Und: Artikel 19 (3) Grundgesetz stellt fest: »Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.« Aber sind damit auch Holdings aus aller Welt und Briefkästen aus allen Steuerparadiesen gemeint?
Die Grundsätze des Artikels 14 sind einerseits eine Absage an den alten sozialistischen Traum der Überführung von Grund und Boden in Staatseigentum, andererseits schieben sie dem Leitbild der neoliberalen Ideologie einen Riegel vor, nach der Profitmaximierung die wichtigste Funktion des (Grund-)Eigentums sei. Ob mit Artikel 15 von den Vätern des Grundgesetzes auch Mietshäuser gemeint waren, wie es die Initiatoren des Berliner Volksentscheids »Deutsche Wohnen & Co enteignen!« 2021 interpretierten (siehe Exkurs: Der Berliner Volksentscheid »Deutsche Wohnen & Co enteignen« und die Sehnsucht nach der Rekommunalisierung von Wohnungen in Kapitel 2) oder ob das ausschließlich auf Naturschätze und Produktionsmittel bezogen sein soll, werden vielleicht irgendwann die Gerichte entscheiden.
Artikel 14 Grundgesetz legt das Fundament für die dialektische Verbindung von individuellen Eigentumsrechten und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Dieses »zugleich dem Allgemeinwohl dienen« muss meines Erachtens zum gesellschaftspolitischen Leitbild eines neuen demokratischen Miteinanders von Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft werden. Das ist zum einen für die Boden- und Grundeigentumsfrage von zentraler Bedeutung. Es muss aber auch grundsätzlich für den Umgang mit all den drängenden Aufgaben gelten, die uns der Klimawandel abverlangt. Das Allgemeinwohl muss die allseitige Mitverantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt ebenso umfassen wie die allseitige Mitverantwortung für wirksamen Klima-, Natur- und Ressourcenschutz!
Die deutsche Nachkriegsgeschichte hat gezeigt, dass das machbar ist. In den Jahren nach den beiden Weltkriegen gab es für Eigentümer strenge Auflagen zur Wohnversorgung der Allgemeinheit. Heute dagegen umfasst die Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums nur einige Regeln für den Kündigungsschutz und gewisse Obergrenzen für die Mietsteigerungen im Wohnungsmietrecht, ergänzt durch ein paar Sonderinstrumente wie den Milieuschutz und die Einschränkung von Zweckentfremdung. Angesichts der radikalen Marktliberalisierung und der Demontage der gemeinnützigen und sozialen Wohnversorgung erweisen sich diese Schutzrechte für viele Menschen als ein zu schwaches soziales Sicherungsnetz. Auch erlauben zahlreiche Schlupflöcher die Umgehung dieser allgemeinen Regeln. So führen die Vorrechte der großen Eigentümer zu einer permanenten Vermögensumverteilung von unten nach oben, während die soziale Verantwortung für die Wohnversorgung einseitig von Staat und Kommune und ihren Subventionen erwartet wird.
Die fehlenden Vorgaben zu Inhalt und Schranken des Grundeigentums
Ganz offensichtlich reichen die geltenden Gesetze nicht aus, um dem Verfassungsgebot der Sozialpflichtigkeit in wirksamer Weise Genüge zu tun. Im Gegenteil, die Vorrechte und Vergünstigungen, die den großen Grundeigentümern gewährt werden, konterkarieren den Auftrag des Artikels 14 (2) Grundgesetz in hohem Maße! Die Rituale der unternehmerischen Selbstverpflichtung zu Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) sind ein Tropfen auf den heißen Stein und bringen meist mehr unverbindliches Greenwashing als ernsthafte soziale und ökologische Nachhaltigkeit.
Seit mehreren Jahren engagieren sich in der EU junge Unternehmen für eine neue »Gemeinwohl-Ökonomie« und entwickeln Konzepte einer Verbindung von marktwirtschaftlichen mit gemeinwirtschaftlichen Elementen.5 Aber in aller Regel wird die Gemeinwohlverantwortung sehr einseitig als Staatsaufgabe definiert. Nun ist zweckgebundenes öffentliches Wirtschaften in vielen Bereichen der sozialen und technischen Infrastrukturen unabdingbar und es ist gut, wenn einige der im marktradikalen Rausch privatisierten Infrastrukturen wieder von öffentlichen Händen übernommen werden. Kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen mit ausreichenden Angeboten an bezahlbaren Wohnungen sind ebenso wichtig wie eine ausreichende öffentliche Bodenvorratspolitik.
Das heißt aber nicht, dass es keine Gemeinwohlverantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft gibt. Demokratische Gemeinwesen sind auf das konstruktiv unterstützende Mitwirken all ihrer Mitglieder, Nutzer und Wirtschaftsakteure angewiesen. Das vielfache Fehlen dieser Mitverantwortung wirkt zerstörerisch, und ein Staat, der alle Krisen und negativen Entwicklungen durch öffentliche Leistungen und öffentliche Subventionen mildern soll, ist bald gelähmt. Die Verantwortung für das Allgemeinwohl darf nicht einseitig auf den Staat verlagert werden, sondern muss auf breite Schultern verteilt sein und gemeinsam von Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft getragen werden.
Artikel 14 Grundgesetz spricht nicht von staatlichen Leistungen und Subventionen, sondern ausdrücklich von gesetzlichen Vorgaben, die Inhalt und Schranken für das Eigentum bestimmen. Das Grundgesetz fordert für das Zusammenwirken von Staat, Markt und Bürgergesellschaft keinen Subventionsstaat und keinen besonderen Schutz für Privilegien und Marktversagen. Leider wird diese Forderung des Artikels 14 Grundgesetz von vielen eigentumsverliebten Politikern und Juristen als unwichtige Nebensache betrachtet und bei den gewohnten politischen Leitbildern ausgeblendet.
Darum macht die Bundespolitik den Grundeigentümern möglichst wenige und wenig wirksame ordnungsrechtliche Vorgaben. Stattdessen sollen Marktanreize Wirtschaft und Gesellschaft zu politisch erwünschtem Verhalten bringen. Diese Strategie macht den Staat immer mehr zum Spielball ökonomischer Interessen und überfordert das Gemeinwesen finanziell ebenso wie organisatorisch. Gesetzeswerke und Subventionsprogramme werden immer komplizierter und undurchschaubarer. Sie werden bald wieder nachgebessert und sind bereits überholt, wenn die Verwaltung ihre Anwendung gelernt hat. Und über den vielen Anreizinstrumenten für diese und jene Wirtschaftslobby verliert die Politik selbst ihre Verantwortung für das Allgemeinwohl aus dem Blick.
Ein neues Verständnis von Politik und Staatsaufgaben tut not
Die Europäische Union und Deutschland haben sich der Globalisierung und der Finanzialisierung von Gütern der Daseinsvorsorge geöffnet, ohne das mit den Regeln des hier traditionell geltenden Handelsrechts, mit gesellschaftlicher Mitverantwortung und mit angemessenen Schutzmaßnahmen für die ansässige Bevölkerung zu verbinden. Nach internationalen Vereinbarungen für eine stärkere Regulierung der globalen Kapitalmärkte wird immer wieder gerufen, aber solche Forderungen sind mit jahrzehntelanger Geduld und sehr vielen Rückschlägen verbunden. Internationale Koordination ist gut und wichtig, sie ersetzt aber nicht das Handeln auf europäischer und nationaler Ebene.
Als das Kind 2008 in den Brunnen der Finanz- und Eurokrise gefallen war, mussten Staat und Steuerzahler die Karre aus dem Dreck ziehen. Den Finanzmärkten wurden nur ein paar halbherzige Regeln abverlangt, versüßt mit dem Geschenk niedrigster Zinsen. So erholten sich die finanzmarktorientierten Investoren schnell und fanden bald wieder alte und neue Wege, Kapital für die nächste Welle der globalen Vermögenskonzentration abzuschöpfen. Immobilien und Wohnungen in den Großstädten kamen da gerade recht. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase zeigt sich aber, wie aufgebläht die Strategien der Finanzialisierung von Unternehmen und Immobilien nach wie vor sind. Die Zahlen der Insolvenzen, Unternehmenskrisen und stillgelegten Großbaustellen nehmen noch immer kein Ende.
In ihrer selbst gewählten Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Wachstums- und Globalisierungsziel hat die nationale Politik die Aufgabe, für mehr Teilhabegerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt zu sorgen, arg aus dem Blick verloren.
Der Klima- und Naturschutz wurde und wird immer wieder verschleppt. Doch die vertanen Jahre und alle bisherigen Bequemlichkeiten rächen sich. Seit 2022 kulminieren der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der Nahostkrieg, Klimakatastrophen und Flüchtlingsströme, und der US-amerikanische Präsident D. Trump gießt mit seinem weltweiten Handelskrieg noch Öl in diese Feuer.
Die weltpolitische Instabilität, die Demokratiekrise und die klimapolitischen Handlungszwänge fordern alle gesellschaftlich und politisch Verantwortlichen auf, die Grundsätze und Ziele staatlichen Handelns neu zu justieren. In Zeiten globaler Marktliberalität dürfen wir nicht nur auf globale Wettbewerbsfähigkeit setzen. Wir brauchen auch eine Neubestimmung des Zusammenwirkens von Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft im nationalen und im europäischen Rahmen. Notwendig ist ein neues Verständnis von Wirtschaft und Konsum. Wir müssen weg von billiger Überflussproduktion und hin zu einer auf Sparsamkeit und langlebige, reparaturfreundliche Gebrauchswerte ausgerichteten Wirtschaft. Das gilt auch für unseren Umgang mit Haus und Grund.
Notwendig ist dafür ein verändertes Verständnis von Staat und Politik. Statt des neoliberal »schlanken« Staates brauchen wir durchaus einen starken Staat. Stark aber nicht im antidemokratischen, autokratischen und nationalistischen Sinne. Und auch nicht stark als Subventionsverteiler. Sondern stark darin, Regeln der demokratischen Mitverantwortung für das Allgemeinwohl von Wirtschaft und Gesellschaft vorzugeben und wirksam durchzusetzen. Das Allgemeinwohl erfordert dabei gleichermaßen Mitverantwortung für mehr soziale Gerechtigkeit, für internationalen Interessenausgleich und für Klima- und Naturschutz. Und das schnellstmöglich, denn die Zeit läuft uns davon.
Für diese soziale und ökologische Mitverantwortung müssen vor notwendigen Subventionen wirksame ordnungsrechtliche Instrumente stehen, die im boden- und wohnungspolitischen Spektrum Rechtsvorgaben schaffen für die Versorgung der hier lebenden und arbeitenden Bevölkerung mit angemessenen und bezahlbaren Wohnungen – sei es im selbst genutzten Eigentum oder zur Miete. Dazu gehört zum einen ein Mietrecht mit mehr Eigentümerverantwortung für soziale Gerechtigkeit und den sozialen Zusammenhalt, als das bisher der Fall ist, und zum anderen die Verantwortung der Grundeigentümer für größtmöglichen Schutz und die Renaturierung von Grundstücksflächen. Notwendig sind auch Investitionen in CO2-neutrale und umweltverträgliche Gebäude, was mit öffentlichen Subventionen unterstützt werden muss.
Die Kommunen brauchen stabile Finanzen und mehr städtebauliche Vorkaufsrechte zu tragbaren Preisen, damit sie langfristig ihrer Fürsorgepflicht für das Gemeinwesen sowie ihrer Verantwortung für den Klima- und Naturschutz und vielleicht auch mal wieder für die Schönheit unserer Städte und Dörfer nachkommen können.
All das erfordert für den Gebrauch von Raum, Grund und Boden eine andere politische Haltung als die gewohnten einseitigen Vorrechte der Eigentümer. Notwendig ist eine ethische Wertorientierung als Grundlage von Politik und Demokratie. Wir müssen das Wort »Wert« von seiner einseitigen Bindung an Geld- und Finanzwerte befreien. Wir müssen zwischen den Eigeninteressen und dem Allgemeinwohl neue Brücken bauen und den Wert unseres Planeten und der Natur als elementare Grundlage unseres menschlichen Lebens neu begreifen.
Die Neubelebung solcher Werte brauchen wir als Fundament für gesellschaftliche Reformen. Da es bei den Grundeigentumsrechten um sehr unterschiedliche Instrumente geht, ist das nicht mit der Novellierung von ein paar Paragrafen getan. Es geht um Reformen im Bürgerlichen Gesetzbuch, im Grundbuch- und Handelsrecht, es geht um das Wohnungs- und das Gewerbemietrecht, um das Steuerrecht und das Erbrecht, um das Planungsrecht und um neue Regeln der Bodenpreisbildung. Auf all diesen Ebenen muss der Gesetzgeber Inhalt und Schranken der Eigentümerrechte neu durchdenken und mit der Mitverantwortung für das Allgemeinwohl verbinden.
Nun wird der Aufschrei kommen, dass unser Land doch schon jetzt in zu viel Bürokratie erstickt. Tatsächlich aber ist es gerade der fehlende Mut zu allgemeinverbindlichen ordnungsrechtlichen Vorgaben, der vielfach zu einem Übermaß an Bürokratie führt! Statt einfacher Regelungen leiden Bund und Länder an zu vielen, zu detaillierten und zu oft wieder veränderten Einzelregelungen, die längst die Grenzen des organisatorisch Handhabbaren sprengen.
Machen wir uns also auf die Suche nach politischen Instrumenten, die das »zugleich« in Artikel 14 Grundgesetz ernst nehmen. Mit dieser Priorität wird die öffentliche Förderung von Sozialwohnungsbau und von Investitionen in den Klimaschutz weiterhin notwendig sein. Auch eine aktive kommunale Bodenvorratspolitik ist unerlässlich. Aber all diese öffentlichen Leistungen dürfen nicht wie bisher die Ausputzer für die globalisierte Immobilienspekulation sein.
Anmerkungen
1 Statistisches Bundesamt (Destatis) (2025): Wohnsituation privater Haushalte 2022 in Deutschland, destatis.de [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/ergebnisse_zusatzprogramm.html#].
2 Zur zerstörerischen Wirkung der kapitalmarktorientierten Wirtschaft für Demokratie und sozialen Zusammenhalt siehe u. a. Sandel, Michael J. (2025): Das Unbehagen in der Demokratie: Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben: eine Neuausgabe für unsere gefahrvollen Zeiten, Frankfurt am Main, FISCHER Taschenbuch, und Vogl, Joseph (2021): Kapital und Ressentiment: Eine kurze Theorie der Gegenwart, München, C. H. Beck.
3 Statistisches Bundesamt (Destatis) (2024): Erläuterungen zum Indikator »Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche« 2022 [https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile].
4 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (23.05.1949), GG.; siehe auch: Prantl, Heribert (2019): Eigentum verpflichtet: Das unerfüllte Grundgesetz, München, Süddeutsche Zeitung GmbH.
5 Siehe https://germany.econgood.org
Teil IGrundeigentum, Finanzmärkte und Wohnversorgung
In diesem Teil wird dargelegt, wie der Staat die vormals gemeinnützige und bezahlbare Wohnversorgung der kapitalmarktorientierten Immobilienwirtschaft überantwortet hat. Die treibt seither Bodenpreise und Mieten in unverantwortliche Höhen und genießt viele Steuerprivilegien und das Recht auf Steuerumgehung. Es zeigt sich: Profitorientierte Unternehmen sind für die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren Wohnungen nicht geeignet.
Eine auf mehr Gerechtigkeit und Gemeinwohl ausgerichtete Politik kann das ändern und eine sozial und wirtschaftlich ausgewogene und bezahlbare Wohnversorgung durchsetzen. Dafür müssen wir vor allem die Wirtschaftsregeln unserer Vorfahren neu beleben.
1. Citygrabbing oder die Finanzialisierung unserer Städte
»Je stärker Immobilien als Kapitalanlage fungieren, desto mehr sind sie den Bewegungen des Marktes ausgesetzt bis hin zu periodischen »Blasen« und eruptiven Entwertungen des Finanzmarktes. Je stärker das Wohneigentum vom Immobilienmarkt abhängt oder in die Kapitalverwertung einbezogen ist, desto mehr Menschen werden von diesen Preisbewegungen in ihrem Lebensstandard betroffen.«
Armin Hentschel, Peter Lohauß (2019):
Wohnungsmärkte und Wohnungspolitik, S. 292
Der Grunderwerb und das Bauen, Erneuern oder Umbauen eines Hauses sind immer sehr große Investitionen; verbunden mit einer entsprechend großen Kraftanstrengung für die Organisation und Durchführung ebenso wie für die Finanzierung und Verschuldung. Die Abzahlung der Kredite kann sich über dreißig Jahre hinziehen. Das solide Planen und solide (Um-)Bauen sind besonders wichtig, weil der Wert eines Hauses erst mit abbezahlten Krediten und einer möglichst langen Lebensdauer richtig zur Geltung kommt. Je mehr dieser Wert im Gebrauchswert gesucht wird, umso besser für das Haus und seine Nutzer. Je mehr der Wert aber primär im Kapitalwert steckt und dieses Kapital dem Haus auch mehrfach entzogen wird, umso größer wird die finanzielle Belastung für die Käufer und Mieter, die es letztlich als Gebrauchs- und Lebensraum nutzen.
Eigentümer, die primär am Gebrauchswert des Hauses interessiert sind, unterscheiden sich grundsätzlich von Eigentümern, die vor allem am Kapitalwert von Immobilien interessiert sind. Allerdings kann auch die Verknüpfung beider Ziele durch gute Pflege und Instandhaltung von Haus und Grund in Verbindung mit moderaten, aber langfristig sicheren Kapitalerträgen gelingen. Dafür stehen viele öffentliche Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und sehr viele traditionelle private Mietshauseigentümer. Auch die früheren gemeinnützigen Wohnungsunternehmen standen einmal dafür, zumal ihnen die Reinvestition der Erträge, die über vier Prozent Gewinn lagen, gesetzlich abverlangt wurde.
Über viele Jahrzehnte galt auch für private Mietshäuser, dass die Rendite nach dem Abtragen der Hypotheken moderate, aber langfristig sichere Einnahmen bringen sollte. Als angemessen galt meist eine Eigenkapitalverzinsung zwischen circa drei bis sechs Prozent. Die dauerhafte Bestandshaltung von Grundeigentum im Familienbesitz war und ist wesentlich für die Altersvorsorge und finanzielle Sicherheit und für bescheidenen oder auch größeren Wohlstand. Der Verkauf privater Grundstücke erfolgt in der Regel erst nach langjähriger Eigennutzung.
Moderne Investoren setzen dagegen auf über 20 Prozent Kapitalrendite und brauchen dafür die ständige Mobilisierung von Immobilienkapital. Das erfordert die größtmögliche Realisierung von Immobilienwertsteigerungen durch hohe Mieteinnahmen, durch wenig Instandhaltung, durch Eigentumsumwandlung und Wohnungsverkäufe oder durch Abriss des Bestands für hochpreisigen Neubau und letztlich durch möglichst teuren Weiterverkauf. »Globalisierung« heißt dabei nicht, dass die Mehrzahl der Investoren aus fernen Ländern kommt. Denn nach wie vor kommt der größte Teil aus Deutschland und Europa. Aber die Methoden der Wertabschöpfung folgen den angloamerikanischen Vorbildern, denen sich die EU und Deutschland angepasst haben, um mit der weltweiten Konkurrenz der Kapitalmärkte Schritt halten zu können.
Das Citygrabbing als Maßstab für Bodenpreise und Renditeansprüche
Finanzialisierte Immobilienunternehmen agieren räumlich und inhaltlich nur in den als lukrativ eingestuften Teilmärkten der Grundstückswirtschaft. Aber dieses Geschäftsmodell hat zu tiefgreifenden Veränderungen im renditeorientierten Grundeigentum insgesamt geführt, weil die hochgeschraubten Renditeansprüche zum allgemeinen Maßstab gemacht wurden. Der Druck auf die Durchsetzung von permanenten Preissteigerungen hat tendenziell alle Grundstücks-Teilmärkte erfasst und Kaufpreise und Wohnungsmieten ständig weiter hochgetrieben. Mit »Lage, Lage, Lage« preisen die Makler ihre Immobilien an, weil städtische Zentralitäts- oder Attraktivitätsmerkmale oder landschaftliche Lagequalitäten sehr viel mehr Preissteigerung und Gewinn bringen als die Qualität der Immobilie selbst. Das Investitionsziel ist die Abschöpfung von Lagequalitäten, die eine Stadt, ihre Bürger und ihre Wirtschaft über Jahrzehnte und Jahrhunderte geschaffen haben und die jedes Grundstück in der einen oder anderen Weise prägen.
Dabei muss man wissen, dass der Begriff der »Wertschöpfung« in keiner Weise garantiert, dass auf dem Grundstück neue investive Werte geschaffen werden. Wertschöpfung meint schlicht Wert-ab-schöpfung mit dem Ziel, einen Eigentumstitel zu Geld zu machen. Es geht also nicht um Wertschöpfung, sondern um die Abschöpfung von Geld und den Entzug von Wert.1
Mit der langen Tradition der dauerhaften Bestandshaltung mit moderaten Renditen und moderaten Investitionen zum Unterhalt der baulichen Anlagen wurde gebrochen. Die auf Finanzialisierung programmierten Bestandshalter arbeiten stattdessen mit dem permanenten Druck, durch weitere Mieterhöhungen zur Steigerung des Geldwerts von Haus und Grund beizutragen. Andere Investoren arbeiten als Immobilienentwickler ausschließlich mit Exit-Strategien: Sie erwerben wiederholt Mietshäuser, wandeln sie in Eigentumswohnungen um und verkaufen diese zügig. Beides geht zulasten von Mietern, zulasten der Käufer von selbstgenutztem Eigentum und zulasten der Kommunen.
Parallel zu diesen Formen des Citygrabbings geht es beim weltweiten Landgrabbing um das Horten von großen Agrarflächen zur Spekulation auf steigende Nahrungsmittelpreise für die weltweit wachsende Bevölkerung. Landgrabbing wird auch von einigen Staaten betrieben, um sich in fremden Ländern den Zugriff auf Grundnahrungsmittel für ihre Bevölkerung zu sichern.
Für das Citygrabbing waren neben besonders begehrten Tourismusregionen zunächst die Innenstädte der großen Metropolen am interessantesten, in Deutschland sind es die im Maklerjargon Big Seven oder A-Städte genannten sieben größten Städte Berlin, Hamburg, München, Frankfurt/Main, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Als hier in den Innenstädten die Potenziale an Gewerbeimmobilien und an Wohnimmobilien überwiegend ausgeschöpft waren, zogen die Investoren weiter in die Randlagen dieser großen Metropolen (die sogenannten B-Standorte in den Big Seven) und in die nächstgrößeren Städte, die von den Maklern angepriesenen hundert B-Städte. Dann haben sich die Spekulationswellen ausgebreitet bis ins weitere Umland, denn die gemachten Gewinne sollen an einem neuen Standort mit einem nächsten Projekt ja neue Gewinne bringen …
Investiert wird lieber in großstädtische Bestandsgebäude als in den Neubau, wenn diese bei geringerem Aufwand eine größere Wertsteigerung versprechen. Im Bestand werden gute Renditen vor allem durch Gentrifizierung erzielt. Die ansässigen Mieter werden verdrängt, um Platz zu schaffen für zahlungskräftigere Käufer oder Mieter oder auch zur Umwandlung von Wohnungen in Touristen-Appartements. Die Methoden der Mieterverdrängung sind immer ähnlich: überhöhte Mietsteigerungen bei Vernachlässigung des Gebäudeunterhalts, Herauskaufen einzelner Mieter, Ankündigung von überteuerten Modernisierungen und Eigentumsumwandlung. Bei besonders hartnäckigen Mietern kann es auch mal zu Feueralarm im Dachstuhl oder zu großem Wasserschaden kommen. Kurzum: Den ansässigen Wohnungs- und Gewerbemietern wird das Leben im Haus zur Hölle gemacht, bis sie ausziehen (müssen) und Haus und Wohnungen für finanziell besser gestellte Kundschaft hergerichtet werden.
In den Big-Seven-Städten konnten bis 2022 auch kleinere lokale Privateigentümer durch den Verkauf ihres Mietshauses zum dreißig- bis vierzigfachen Jahresrohertrag das Geschäft ihres Lebens machen. Seither sind die Preise auf den immer noch recht lukrativen fünfundzwanzigbis fünfunddreißigfachen Jahresrohertrag gesunken. Allerdings haben auch die dreisten Mieterhöhungen den Rohertrag stark erhöht. In den B-Standorten kann der Verkaufswert nach wie vor beim zwanzig- bis fünfundzwanzigfachen Jahresrohertrag liegen. Jahrzehntelang waren diese Mietshäuser zu vertretbaren Preisen, vielleicht zum Zwölf- bis Fünfzehnfachen des Jahresrohertrags, zu haben. Nun aber orientieren sich Mietshauseigner oder Erbengemeinschaften am Preisniveau der Finanzinvestoren und surfen mit entsprechenden Miet- oder Kaufpreisforderungen im Windschatten der professionellen Player. Der Verkauf von Eigentumswohnungen an Selbstnutzer ist eine besonders lukrative Form der schnellen Kapitalverwertung, die ein Mehrfaches der eingesetzten Investitionskosten einbringen kann und damit das Eigenkapital für den Kauf der nächsten Immobilie bildet.
Eine andere bei Neubauprojekten beliebte Methode sind die Weiterverkäufe von Grundstücken mit Baugenehmigung. Hat Investor A beim Bauamt die Genehmigung für eine sehr hohe Ausnutzung des Grundstücks durchgesetzt, verkauft er das Grundstück mit genehmigter Planung zu deutlich erhöhtem Preis an Investor B weiter. In Zeiten steigender Bodenpreise kann das Grundstück auch mehrfach mit Gewinn weitergereicht werden. In Zeiten sinkender Preise ist das aber ein schlechtes Geschäft.
Mit solchen Schneeballsystemen arbeiten sich manche Spekulanten hoch, einige übernehmen sich dabei und gehen eines Tages bankrott. In vielen Städten kennt man diese besonders gefürchteten Immobilienhaie. In Wien, Berlin, München und Hamburg war zuletzt die Firma Signa mit ihrem Haupteigentümer René Benko der Prototyp des Immobilienspekulanten, der sehr trickreich mit zu vielen und zu großen Schneebällen gleichzeitig gespielt hat – Signa war aber auf Gewerbe-Immobilien spezialisiert, nicht auf Wohnhäuser.
Das Schneeballsystem der Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen
Alteigentümer A
besitzt in der B-Stadt H. in mittlerer Lage ein schuldenfreies Mietshaus aus der Gründerzeit mit 10 Wohnungen zu je 100 m2 Wohnfläche.
Seine Mieteinnahmen betragen 8 €/m2 nettokalt monatlich zuzüglich Bewirtschaftungskosten.
Er erhält jährlich insgesamt 96.000 € an Mieteinnahmen und kalkuliert mit 16.000 € Jahresausgaben für Verwaltung und Instandsetzung.
Sein Jahresrohertrag liegt bei 80.000 €.
Er verkauft das Haus für 1,6 Millionen €, das ist das 20-Fache seines Jahresrohertrags.
Neueigentümer N
hat 1,3 Mio. € geerbt und kauft das Haus.
Er hat mit den
Erwerbsnebenkosten einen Aufwand von
1.900.000 €
Er entledigt sich der Mieter für
50.000 €
Er investiert in Bad- und Küchenerneuerung,
Fahrstuhlanbau + Pinselsanierung
650.000 €
Seine Gesamtkosten,
die er durch die Erbschaft und die Beleihung des Grundstücks finanziert, sind
2.600.000 €
Er verkauft die 10 modernisierten Wohnungen zu je 4.500 €/m2
4.500.000 €
So kann er 1,3 Mio. € Schulden für das erste Haus refinanzieren und hat einen Gewinn von 1.900.000 €.
Von diesem Gewinn kauft er ein größeres Mietshaus für 3 Millionen €, beleiht es mit 1,5 Mio. € und wandelt es nach derselben Methode in Wohneigentum um.
Eigene Modellrechnung zur Spekulation mit der Eigentumsumwandlung von Mietshäusern
Mit der Verdrängung von Mietern wird immer wieder neue Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen und bezahlbarem Gewerberaum erzeugt. Der akute Bedarf an bezahlbaren Wohnungen ist darum nur teilweise dem Zuzug von neuen Einwohnern geschuldet, er ist ebenso die Folge des Auslaufens der Sozialbindungen von vormaligen Sozialwohnungen, der gezielten und fortgesetzten Steigerung von Mieten und Immobilienpreisen im Bestand und der Gentrifizierung durch Eigentumsumwandlung und happige Preisforderungen für Eigentumswohnungen. Hinzu kommen in den touristisch begehrten Städten immer mehr untergenutzte Zweitwohnungen und die Umwidmung von Wohnraum in Ferienwohnungen.
Seit 2014 lautet die politische Antwort darauf vor allem Wohnungsneubau und neue Wohnungsbauförderung. Das ist zwar notwendig, aber wohnungs- und sozialpolitisch sehr einseitig. Denn für die in Deutschland lebenden 23 Millionen Mieterhaushalte wäre der Schutz bezahlbarer Bestandswohnungen durch ein stringenteres Mietrecht und die dauerhafte Unterbindung der Umwandlung von großstädtischem Mietwohnungsbestand in Wohneigentum der wichtigste Schritt.
Das Ergebnis all dieser Entwicklungen:
Mit der 1990 eingeleiteten neoliberalen Wende in der Wohnungswirtschaft ist vor allem in den Großstädten und den wachstumsstarken Stadtregionen die Grundstruktur der Wohnversorgung aus den Fugen geraten. Wie sehr dies ein Motor für gesellschaftliche Ungleichheit, Ungerechtigkeit und tiefe Unzufriedenheit ist, wird von Fachleuten immer wieder beanstandet, politisch in seinen Ursachen aber weitgehend ignoriert.
Es trifft aber nicht nur Wohnungsmieter. Vom Citygrabbing betroffen ist auch die Sicherheit und Zukunft von vielen Gewerbemietern. In Einkaufszentren und Innenstadtzentren leiden zu viele Gewerbemieter und Pächter unter überzogenen Miet- und Pachtforderungen für Einzelhandels- und Büroräume, Hotels und Gastronomiestandorte. Als Ursachen führen Verantwortliche gerne den Onlinehandel und vermehrte Homeoffice-Arbeit ins Feld und umgehen so die Diskussion über zu teure Gewerbemieten. Damit würde man ja den Standort der eigenen Stadt schlechtreden. Schließlich wird der Wert einer Innenstadt gerne am Geldwert ihrer Immobilien gemessen.
Auch für die Schieflage zwischen der notorischen Armut der Kommunen und den Wertsteigerungsansprüchen von Immobilieninvestoren ist die sehr einseitig auf private Spekulationsinteressen ausgerichtete Grundeigentumspolitik mitverantwortlich. Um bezahlbare Wohnungen zu sichern, bemühen sich die großen Städte dagegenzuhalten mit den leider nur punktuell wirksamen Instrumenten des Vorkaufsrechts (zu überteuerten Konditionen und inzwischen gerichtlich außer Kraft gesetzt, siehe §§ 24–28 BauGB), des Milieuschutzes (Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB), der Umwandlungsverordnung (nach § 250 BauGB neu, gültig bis Ende 2025) und dem Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Diese Instrumente erfordern großen bürokratischen und finanziellen Aufwand und sind nur Tropfen auf den heißen Stein. (Siehe hierzu Kapitel »Mietrecht und Mieteninflation«)
Mit der Steigerung von Mieten, Boden- und Immobilienkaufpreisen setzt die Kapitalmarktspekulation die großen Städte und die wachstumsstarken Regionen immer mehr unter Druck. Obwohl der quantitative Anteil der kapitalmarktabhängigen Investoren nicht sehr groß ist, wurden in den letzten fünfzehn Jahren so starke Spekulationswellen ausgelöst, dass der Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung auf den Grundstücksmärkten insgesamt deutlich nach oben verschoben wurde. Aber bislang werden weder die Ursachen dieser Entwicklung öffentlich diskutiert, noch gibt es ernsthaftes politisches Handeln zum Erhalt von bezahlbaren Grundstückspreisen und Mieten.
Stattdessen predigen Politik, Medien und Immobilienverbände seit Jahren unisono, dass die Wohnungsnöte der Menschen in den großen Städten und wirtschaftsstarken Regionen ausschließlich dem Bevölkerungszuwachs geschuldet sind und nur durch Bauen gelöst werden können. Das Ankurbeln von Wohnungsneubau soll Wohnungssuchende versorgen, was in wachstumsstarken Regionen durchaus notwendig ist. Aber gebetsmühlenartig wird die Forderung nach mehr Wohnungsbau seit Jahren mit der Behauptung verbunden, dass Mieten und Kaufpreise nicht weiter steigen würden, wenn endlich mehr Wohnungen gebaut würden. Immer wieder wird den Mietern in überteuerten Wohnungen versprochen, dass ihre Mieten sinken oder zumindest nicht mehr steigen würden, wenn am anderen Ende der Stadt viel gebaut wird. Doch dieses Versprechen ist schlicht irreführend – oder glaubt jemand ernsthaft, dass in München die Wohnungsmieten sinken, wenn morgen rund um München weitere tausend Neubauwohnungen aus dem Boden gestampft werden?
Mit dem Mantra »Bauen, Bauen, Bauen« schüren Politik und Immobilienverbände immer wieder Illusionen. Die Probleme der Wohnversorgung und der Boden- und Mietpreissteigerungen werden damit auf ein rein quantitatives Verhältnis von Bevölkerungszahlen und Wohnungszahlen reduziert. Dabei ist offensichtlich, dass es um einen immer größeren Bedarf an bezahlbaren Wohnungen geht, während auf der Angebotsseite die Zahl der Hochpreiswohnungen steigt.





























