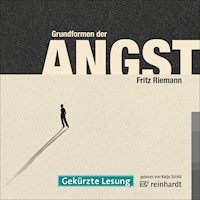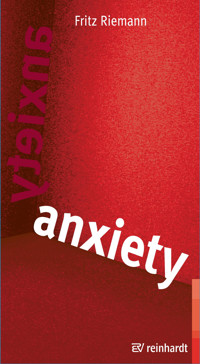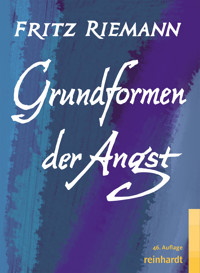
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer kennt nicht die Angst vor zu enger Bindung und die Angst vor dem Verlassenwerden? Wer hat nicht die Angst vor dem Ungewissen, aber auch die Angst vor dem Endgültigen durchlebt? Riemann nennt sie die vier Grundformen der Angst und entwickelt daraus eine Charakterkunde mit vier Persönlichkeitstypen. Zu jeder Persönlichkeitsstruktur werden das Verhältnis zur Liebe und zur Aggression, der lebensgeschichtliche Hintergrund und typische Beispiele aufgezeigt. Dieser Klassiker einer verständlichen Psychologie erreichte bislang eine Gesamtauflage von über 1 Mio. Exemplaren und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Fritz Riemann (1902 – 1979) war nach einem Studium der Psychologie und der Ausbildung zum Psychoanalytiker Mitbegründer des Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie in München (heute: Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie). Dort wirkte er als Dozent und Lehranalytiker und führte eine eigene psychotherapeutische Praxis. Seine Verdienste um die Psychoanalyse brachten ihm die Ehrenmitgliedschaft der »American Academy of Psychoanalysis« in New York. – »Grundformen der Angst« ist das berühmteste seiner Bücher, außerdem sind die Titel »Die Fähigkeit zu lieben« (Fritz Riemann) und »Die Kunst des Alterns« (Fritz Riemann und Wolfgang Kleespies) im Ernst Reinhardt Verlag erhältlich.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
ISBN: 978-3-497-01749-2 (Print)
ISBN: 978-3-497-61509-4 (PDF-E-Book)
ISBN: 978-3-497-61510-0 (EPUB)
46. Auflage, 1.023 Tsd.
6. Auflage der gebundenen Ausgabe
© 1961, 2021 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Satz: Rist Satz & Druck, Ilmmünster
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de Mail: [email protected]
Inhalt
Fritz Riemann. Eine Kurzbiografie
Von Ruth Riemann
Einleitung
Vom Wesen der Angst und von den Antinomien des Lebens
Die Angst vor der Hingabe
Die schizoiden Persönlichkeiten
Der schizoide Mensch und die Liebe
Der schizoide Mensch und die Aggression
Der lebensgeschichtliche Hintergrund
Beispiele für schizoide Erlebnisweisen
Ergänzende Betrachtungen
Die Angst vor der Selbstwerdung
Die depressiven Persönlichkeiten
Der depressive Mensch und die Liebe
Der depressive Mensch und die Aggression
Der lebensgeschichtliche Hintergrund
Beispiele für depressive Erlebnisweisen
Ergänzende Betrachtungen
Die Angst vor der Veränderung
Die zwanghaften Persönlichkeiten
Der zwanghafte Mensch und die Liebe
Der zwanghafte Mensch und die Aggression
Der lebensgeschichtliche Hintergrund
Beispiele für zwanghafte Erlebnisweisen
Ergänzende Betrachtungen
Die Angst vor der Notwendigkeit
Die hysterischen Persönlichkeiten
Der hysterische Mensch und die Liebe
Der hysterische Mensch und die Aggression
Der lebensgeschichtliche Hintergrund
Beispiele für hysterische Erlebnisweisen
Ergänzende Betrachtungen
Schlussbetrachtung
Fritz Riemann
Eine Kurzbiografie
Er wurde am 15. September 1902 in Chemnitz als mittlerer von drei Söhnen in eine großbürgerlich lebende Familie geboren. Vater und Großvater hatten dort eine Lampenfabrik gegründet. Sie fabrizierten Auto-, Motorrad- und Fahrradlampen. Autolampen vor allem für die benachbarten Wanderer-Werke. (Im Deutschen Museum in München steht noch ein Wanderer-Auto mit Riemann-Lampen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.)
Obwohl auch die Mutter aus einer Fabrikantenfamilie kam – ihr Vater stellte Webmaschinen her – fand sie sich mit dem großzügigen Lebensstil schwer zurecht. Sie fühlte sich mit der Verantwortung für das große Haus überfordert und klagte trotz Kindermädchen, Köchin, Diener, Gärtner über die viele Arbeit. Die Fabrik und das Haus, in dem Fritz Riemann aufwuchs, stehen noch. Das Haus war in DDRZeiten ein Mutter-Kind-Heim, wurde später für Parteifunktionäre restauriert und wird heute von mehreren Familien bewohnt.
Die Mutter verlor vor der Geburt der Söhne zwei Töchter, durch eine Totgeburt und eine Fehlgeburt. Sie war sehr unglücklich darüber und hoffte bei jeder folgenden Schwangerschaft auf ein Mädchen. Den Söhnen war sie eine gute Baby- und Kleinkind-Mutter. Sie tat sich aber schwer, sie zu Männern werden zu lassen. Dem jüngsten Sohn zog sie lange Mädchenkleider an. Spätestens er hätte eine Tochter werden sollen.
Der Vater war ein vitaler Patriarch mit selbstverständlicher Autorität, streng und manchmal jähzornig. Die Kinder fühlten mehr Respekt als Liebe zu ihm. Fritz war dem Vater äußerlich der Ähnlichste. Die Mutter sagte, er sei sein Lieblingssohn gewesen, was er aber selber nicht gespürt hatte. Man erwartete von ihm, dass er einmal die Nachfolge in der Fabrik antreten würde.
Der drei Jahre ältere Bruder Hans hatte schon früh die Rolle des »Professors«. Er war weniger vital, las viel, raufte nicht und setzte sich mit seinem überlegenen Wissen durch. Beide Brüder waren sehr musikalisch. Einen großen Teil ihrer brüderlichen Rivalität trugen sie vierhändig spielend auf dem Klavier aus. Es gab manchen Kampf dabei, aber das gemeinsame Musizieren verband sie über viele Jahre. Bruder Hans studierte Musik, wechselte dann zur Archäologie über und wurde später tatsächlich Professor. Die brüderliche Rivalität setzte sich in der Art ihrer Veröffentlichungen fort. Wenn Hans etwas schrieb, belegte er seine Darstellungen mit vielen Fußnoten, während Fritz seinen geistigen Vätern summarisch dankte und mehr Künstler als Wissenschaftler war, wenn er schrieb. In den kritischen Kollegen, die diesen zu wenig wissenschaftlichen Stil bemängelten, fand er seinen großen Bruder wieder.
Der sieben Jahre jüngere Bruder Heinz wurde ganz von der Mutter vereinnahmt und stand im Schatten der großen Brüder. Er war weniger begabt und versuchte gar nicht erst, es ihnen gleich zu tun. Er bewunderte die großen Brüder und nahm so an deren Leben teil.
Das stolze und selbstbewusste Leben der Familie, in dem der Vater der Fels in der Brandung schien, brach jäh zusammen, als der Vater schwer herzkrank wurde und bald darauf 46-jährig starb. Es war das Jahr 1912, Fritz war 10 Jahre alt.
Krankheit und Tod des Vaters erschütterten sein Lebensgefühl radikal. Er erlebte den bisher starken Vater qualvoll nach Luft ringend und sich vergeblich gegen die Krankheit aufbäumend. Mitleid und Entsetzen vermischten sich. Seine natürliche kindliche Lebensfreude wurde plötzlich mit Schuldgefühlen belastet. Er hätte doch Rücksicht nehmen sollen, erst auf den kranken Vater, dann auf die trauernde Mutter. Es war niemand da, der ihm half, das Chaos der Gefühle zu verarbeiten. Die Mutter war selbst verzweifelt, am Grab des Vaters schrie sie laut auf. Sie fand sich in einem Leben ohne ihren Mann nicht zurecht und leugnete seinen Tod, indem sie alles so ließ, wie es vorher war, und ein Museum aus dem Haus machte. »Wenn der Vater wiederkommt, soll er alles so wiederfinden, wie er es verlassen hat.« Die großen Räume im Erdgeschoß wurden nur noch gepflegt, aber nicht mehr benutzt. Den Söhnen war es verboten, den Flügel oder die Orgel zu spielen, auch noch, als der Älteste Musik studierte. Sie durften nur auf dem Klavier im ersten Stock spielen. Die Söhne sollten der Mutter den Vater ersetzen, in erster Linie für sie da sein und sich innerlich und äußerlich nicht von ihr entfernen. Freundschaften und Eigeninteressen betrachtete sie als Verrat. Die Mutter konnte den Söhnen nicht helfen, den Verlust des Vaters zu verarbeiten. Sie brauchte selbst Hilfe. Die Suche nach Möglichkeiten dazu war vielleicht die Wurzel der psychotherapeutischen Neigungen von Fritz Riemann.
Was Fritz in dieser Zeit half, war seine Begabung zum Humor. Wenn die Brüder auf der Empore der Eingangshalle, wo das Klavier stand, kleine Hauskonzerte veranstalteten, umrahmte Fritz den Abend mit humoristischen Versen. Mit seinem Humor konnte er auch die Mutter zum Lachen bringen.
Nach dem Abitur begann Fritz Riemann eine kaufmännische Lehre bei den Wanderer-Werken, mit dem Ziel, in die väterliche Fabrik einzutreten. Aber relativ rasch stellte sich heraus, dass er dort am falschen Platz war und seine Neigungen und Begabungen überhaupt nicht im Kaufmännischen lagen. Gegen den enormen Widerstand der Mutter setzte er schließlich durch, dass er in München Psychologie studieren durfte.
Zu dieser Zeit (1922) war der Lebensstil der Familie noch finanziell gesichert. Da die Mutter sich aber aus der Firma hatte auszahlen lassen, ging das Vermögen bei der Inflation verloren. Der Verkauf des Hauses brachte der Familie noch einmal eine größere Summe, die zwischen der Mutter und den Söhnen aufgeteilt wurde.
Das Studium in München enttäuschte. Die Psychologie anfangs der Zwanziger Jahre hatte ihren Schwerpunkt in der Experimentalpsychologie. Es war eine Psychologie ohne Seele. Kunst- und Literaturgeschichte zogen Fritz Riemann mehr an, aber ohne dass damit eine Berufsvorstellung verbunden war.
1924 verließ er die Universität. Er heiratete eine Mitstudentin, die gerade ihr Medizin-Studium abgeschlossen hatte, und ging mit ihr aufs Land, nach Pyrbaum in der Oberpfalz. Seine Frau baute dort eine umfangreiche Landarztpraxis auf. Er selbst lebte ein introvertiertes Leben und suchte im Privatstudium das Wissen, das er auf der Universität nicht gefunden hatte. Die Reste des väterlichen Vermögens erlaubten ihm, so zu leben, ohne die Notwendigkeit des Geldverdienens. Gelegentlich schrieb er humoristische Gedichte, die er selbst bei Busch und Morgenstern ansiedelte, von dene Einzelne gedruckt wurden. Viele haben psychologischen Inhalt und nehmen spätere Erkenntnis vorweg. Eine Kostprobe:
Tragikomik
Fragen, die man falsch gestellt,
Schafft man nicht mehr aus der Welt;
Man verbringt dann seine Tage
Grübelnd über solcher Frage,
Und man kanns noch Gnade nennen,
Stirbt man ohne zu erkennen
Daß man sich umsonst geplagt,
Weil man eben falsch gefragt.
Dann vermacht man – Trost im Sterben ! –
Jene Frage seinen Erben.
Fritz Riemann begann, Material für eine Carl-Spitteler-Biografie zu sammeln, ein Dichter, den er sehr liebte. Die ersten Zeilen von Carl Spittelers »Prometheus und Epimetheus« »Auf, laß uns anders werden als die Vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen« begleiteten ihn seit diesen Jahren. Er setzte sie in dem vorliegenden Buch als Motto über das Kapitel »Die schizoiden Persönlichkeiten«. Neben diesen Studien unterstützte er seine Frau bei der Ausübung ihrer Praxis als Landärztin, was damals einen ungleich höheren Einsatz erforderte als heute, mit nächtlichen Hausbesuchen, ambulanten Operationen, schwierigen Entbindungen. Das nächste Krankenhaus war weit weg.
Bei den privaten Studien stieß Fritz Riemann etwa gleichzeitig auf die Psychoanalyse und die Astrologie, eine Verbindung, die ihm ein lebenslanges Anliegen blieb. Das war es, wonach er gesucht hatte. Zum erstenmal entstand eine klare Vorstellung von einer Berufstätigkeit, die seinen Begabungen und Neigungen entsprechen könnte. In den letzten Jahren hatte ihn zunehmend die Panik ergriffen, wie es weitergehen sollte. Mit der Spitteler-Biografie kam er nicht vorwärts, das Studieren in Büchern befriedigte ihn nicht mehr, das restliche Vermögen schmolz dahin. Seine Frau ging in ihrer Praxis auf, sie wollte keine Kinder. Er hatte Angst, den Anschluss an das Leben zu verlieren.
1934 verließ er Pyrbaum und ging nach Leipzig. Er wurde gleichzeitig Schüler des Astrologen Herbert Freiherr von Klöckler und Lehranalysand der Psychoanalytikerin Therese Benedek. Seine Ehe wurde geschieden.
Therese Benedek war Jüdin, und die Lehranalyse wurde bald belastet durch die politische Entwicklung. Frau Benedek holte sich astrologischen Rat bei Fritz Riemann für ihre Auswanderungsüberlegungen. Es entstand eine fatale Wiederholung. Er erlebte die Lehranalytikerin hilfsbedürftig wie die Mutter, er musste seine eigenen Bedürfnisse angesichts ihrer schicksalhaften Belastungen zurückstellen, und es blieb keine Zeit, diese Übertragungsprobleme zu verarbeiten. Therese Benedek wanderte 1935 aus.
Die Dankbarkeit für die Erfahrungen in der Analyse bei Frau Benedek überwog jedoch. Er hatte durch sie Einblicke in seine familiären Verstrickungen erlebt und Ansätze einer Befreiung daraus. Therese Benedek hatte großes Vertrauen in die therapeutischen Fähigkeiten von Fritz Riemann und überwies ihm schon nach kurzer Zeit Patienten, die er unter ihrer Supervision behandelte. Als sie Leipzig verließ, gab sie Fritz Riemann beste Empfehlungen mit nach Berlin zur Fortsetzung seiner Ausbildung am dortigen psychoanalytischen Institut. Vielleicht aufgrund ihrer warmen Empfehlungen nahm man ihn dort an, obwohl er nichts vorzuweisen hatte als ein abgebrochenes Psychologie-Studium, seine begonnene Lehranalyse und erste praktische Behandlungsversuche.
In Berlin stürzte sich Fritz Riemann in die Arbeit mit dem Gefühl, unendlich viel nachzuholen zu haben. Er entwickelte eine Arbeitsintensität, die er von da an sein Leben lang beibehielt. Er gab während der Ausbildung über 1000 Behandlungsstunden, unentgeltlich, wie es damals noch üblich war. Die psychoanalytische Arbeitsgruppe innerhalb des Berliner Ausbildungsinstitutes konnte nur überleben durch den Zusammenschluss mit anderen Schulrichtungen. Es gab offizielle Lehrveranstaltungen, darüber hinaus traf sich die psychoanalytische Arbeitsgruppe zu sogenannten Katakombensitzungen, in denen das als jüdisch verurteilte Gedankengut Freuds vermittelt wurde. In den Augen der späteren Kritiker war es trotzdem durch die politische Situation zu Deformierungen der Freudschen Lehre gekommen, die sie hinter der internationalen Entwicklung zurückbleiben ließ, ein Vorwurf, der die Kollegen aus dieser Zeit schwer traf. Für seine Examensarbeit, die Darstellung der Behandlung einer Patientin mit zwanghaften Weinkrämpfen, erhielt er einen internationalen Preis.
Fritz Riemann war zu keiner Zeit Mitglied der nationalsozialistischen Partei oder einer ihrer Organisationen, dazu hatte er eine zu tiefe Abneigung gegen jegliche Form von Ideologie und Gleichschaltungen. Auf jegliche Tendenz zur Ideologie und Intoleranz reagierte er allergisch. Als in der Nachkriegszeit die deutschen Psychoanalytiker versuchten, wieder internationalen Anschluss zu finden, und dafür Zugeständnisse machten und sich als besonders treue Freudianer zu beweisen versuchten, blieb er dieser Entwicklung fern. Diskussionen um »die reine Lehre« der Psychoanalyse interessierten ihn wenig. Ihm war die Psychoanalyse als Werkzeug wichtig und nicht als Ideologie.
1939 heiratete er in Berlin ein zweites Mal, überstürzt nach nur sechswöchigem Kennen unter dem Eindruck des ausbrechenden Krieges. Seine zweite Frau war vom Typ her der genaue Gegensatz zu seiner ersten Ehefrau: Ihr war es wichtig, als Frau eine Rolle zu spielen. Das Zusammenleben gestaltete sich schwierig, vor allem dann im Nachkriegsalltag.
Fritz Riemann hatte damit gerechnet, sofort eingezogen zu werden. Die Psychoanalytiker wurden aber überraschend wie die Ärzte vom Militärdienst freigestellt. Erst im Herbst 1943 erfolgte die Einberufung. Er wurde als Sanitäter ausgebildet und kam nach Südrussland, wo schon der Zusammenbruch der Front begonnen hatte. Auf der endlosen Fahrt nach Russland hatte er das Gefühl, von da niemals wieder zurückzukommen. Als Sanitätsgefreiter auf einem vorgeschobenen Hauptverbandsplatz hinter der Front assistierte er einem Internisten, der schwerste Operationen durchführen musste, ohne dafür ausgebildet zu sein. Sie unterstützten sich in dem verzweifelten Versuch, so viel zu leisten, wie menschenmöglich war. Die körperliche Belastung war enorm. Das Operationszelt musste immer wieder abgebaut und nach langen Fußmärschen wieder aufgebaut werden. Es gab wenig Schlaf, tagsüber wurde marschiert, nachts operiert.
1944 bekam Fritz Riemann Flecktyphus, den er nur dank einer vorausgegangenen Impfung in einem rumänischen Lazarett überlebte. Abgemagert und entkräftet wurde er entlassen und ohne hinreichende Genesungszeit in Holland wieder eingesetzt. Seine ursprünglich robuste Konstitution hat er danach nicht wieder zurückgewonnen. In Holland kam er in englische Kriegsgefangenschaft, aus der er schon im frühen Herbst 1945 entlassen wurde.
Er traf die Familie – inzwischen waren drei Kinder geboren – bei Freunden im Allgäu. Die Berliner Wohnung war ausgebombt, der Rest der Habe bei der Flucht aus Schlesien verloren gegangen. Vom Allgäu aus versuchte er, in München eine neue Praxis aufzubauen; in einem viel zu kleinen geliehenen schwarzen Anzug und schwarzen Lackschuhen war er zwischen dem Allgäu und München unterwegs. Ein viertes Kind wurde geboren.
In München entstand ein Kreislauf von Problemen. Um vom Wohnungsamt ein Zimmer zu bekommen, sollte er einen Beschäftigungsnachweis vorlegen, für die Arbeitserlaubnis den Nachweis einer Wohnung. Eine zufällige Begegnung mit alten Bekannten verschaffte ihm dann ein Untermietzimmer. Es war kaum heizbar, er arbeitete fröstelnd in Decken gehüllt. Aber alte Berliner Patienten hatten ihn dort gefunden und waren der Grundstock seiner neuen Praxis.
Im Münchner Institut für Psychologische Forschung und Psychotherapie trafen sich schließlich durch den Krieg verstreute Kollegen. Sie taten sich zusammen und erhielten die Lizenz der amerikanischen Besatzung für den Wiederaufbau eines psychotherapeutischen Ausbildungsinstitutes, an dessen Aufbau Fritz Riemann beteiligt war und in dem er zunächst als Einziger im Kollegenkreis die Psychoanalyse vertrat. Er war bis wenige Jahre vor seinem Tod im Vorstand des Institutes, der jetzigen Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie. Er machte Lehranalysen und hielt Vorlesungen.
Die Vorlesungen wurden unter extremen Bedingungen in schlecht geheizten Schulräumen gehalten, aber das Interesse war groß. Bücher gab es nicht, nur wenige alte Bestände, die die Bombardements überlebt hatten. Für Fritz Riemann entsprachen diese Arbeitsbedingungen seiner Neigung, Theorie nicht aus Büchern, sondern aus der praktischen Erfahrung zu entwickeln und darzustellen. Diese breite Erfahrungsgrundlage schaffte er sich, indem er besessen arbeitete, über viele Jahre 11 – 12 Praxisstunden täglich. Einerseits um der großen Familie eine neue Existenzgrundlage zu schaffen, denn er stand an einem Nullpunkt, er hatte im Krieg alles verloren, andrerseits liebte er seine Arbeit, und jede Behandlung war ihm ein neues Abenteuer. Die ersten Vorlesungen erarbeitete er handschriftlich; die erste Schreibmaschine bekam er erst später geschenkt.
Verständlich, daß er unter diesen Bedingungen Psychoanalyse lehrte, wie sie sich ihm in der Praxis bewährt hatte. Rechtfertigungen für Abweichungen von der klassischen Psychoanalyse lagen ihm fern. Vielleicht war es der Einfluss der Astrologie, die ihm immer wichtig geblieben war, dass er seinen Schülern weniger ein anerkanntes Konzept der klassischen Psychoanalyse vermitteln, als ihnen zu ihren individuellen Entwicklungsmöglichkeiten verhelfen wollte. Das führte später zu großen Konflikten. Durch diese Haltung war seinen Schülern der Zugang zur Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung versperrt. Es gab heftige Vorwürfe, dass er sich nicht früh genug um die Anbindung der Ausbildung an die internationalen Standards bemüht hatte, nicht dafür gesorgt hatte, dass Kollegen nach München kamen, die das einseitig durch seine Therapeutenpersönlichkeit geprägte Bild der Psychoanalyse ergänzten und korrigierten. Viele Schüler blieben später gute Freunde, andere fanden ihren Weg über den »Vatermord«.
Die historische Entwicklung der Psychoanalyse in Deutschland ging einen anderen Weg, als Fritz Riemann ihn sich gewünscht hatte. Seine Vision einer Zukunft der Psychoanalyse lag in mehr Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Richtungen. Letztlich träumte er von einer Psychoanalyse, in der die Astrologie ihren Platz hatte. Das Allgemeingültige, Gesetzmäßige im Aufbau der Psyche, die Regeln der frühkindlichen Entwicklungsphasen bedurften für ihn der Ergänzung durch den Gegenpol der einmaligen, individuellen Persönlichkeit, wie sie sich für ihn im Geburtshoroskop eines Menschen darstellte.
1950 wurde die zweite Ehe geschieden. Fritz Riemann heiratete ein drittes Mal, eine Psychologin und spätere Therapeutin. Die beiden älteren Kinder gingen zum Vater, die kleineren blieben bei der Mutter. 1951 wurde noch ein Sohn geboren. In dieser Ehe war die gemeinsame geistige Welt ein wichtiger Bestandteil, das gemeinsame Erarbeiten von Konzepten, die kritische Durchsicht von Veröffentlichungen, die gemeinsame Lektüre von Büchern, das Diktat der Texte in die nun vorhandene Schreibmaschine.
Noch war das alltägliche Leben sehr behelfsmäßig. Oberhalb von Feinkost Käfer in München bewohnte die fünfköpfige Familie zweieinhalb Zimmer in Untermiete, von denen das eine von 8 Uhr früh bis 21 Uhr abends Praxiszimmer war. Die Praxiscouch war nachts das Ehebett. 1951 erweiterte sich der Lebensraum auf eine 80 qm große Drei-Zimmer-Wohnung, unter den Nachkriegsbedingungen ein stolzer Fortschritt. Die schönsten Jahre, 1955 – 1971, erlebte die Familie in einem gemieteten Haus am Isarhochufer.
Neben der umfangreichen Praxis, der Ausbildungs- und Vorstandstätigkeit hielt Fritz Riemann viele Vorträge, vor denen er meist unverhältnismäßig große Ängste hatte, Zweifel, ob das, was er zu sagen hätte, überhaupt von Bedeutung sei. Über Beifall und Erfolge konnte er sich anschließend mit großer Erleichterung herzlich freuen.
Im Jahr 1960 erreichte ihn die Einladung des Stuttgarter psychotherapeutischen Institutes zu einem Vortrag bei einer Tagung zum Thema »Angst«. Er nahm die Einladung an. Als er später den Vortrag in München wiederholte, saß der Lektor des Ernst Reinhardt Verlages, Dr. Brem, im Auditorium und sprach ihn an, ob er nicht Lust habe, ein Buch daraus zu machen. Er schrieb es. Spät abends nach der Praxis diktierte er seiner Frau das Buch in die Maschine. Der Verlag nahm das Manuskript an, und so erschien das Buch »Grundformen der Angst« in der 1. Auflage 1961. Es wurde anfangs wenig beachtet. Die Auflagen stiegen erst allmählich. Den Fachkollegen war das Buch nicht wissenschaftlich genug. Erst andere psychologisch interessierte Leser, denen die Anschaulichkeit der Darstellung ohne Überfrachtung mit Fachausdrücken gefiel, machten das Buch zu einem Erfolg. In der Ausbildung von Sozialarbeitern, Theologen, in der Telefonseelsorge und vielen anderen Bereichen wurde es zur bevorzugten Einführung zum Verständnis des Menschen in seinen Lebensproblemen. Viele Leser, die durch das Buch Zugang zum Verstehen und Lösen ihrer eigenen Schwierigkeiten gefunden hatten, schrieben ihm Briefe, die er alle persönlich beantwortete. 1971 erschien die 9. Auflage in einer überarbeiteten und erweiterten Form.
Ende der 60er Jahre verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Fritz Riemann. Ein Lungenemphysem und dadurch bedingte Herzinsuffizienz wurden diagnostiziert. Trotzdem wagte die Familie noch einen Hausbau und zog 1971 ins eigene Haus nach Unterföhring. Die letzten Jahre dort brachten eine Einschränkung der Aktivitäten. Die Praxis als das Herzstück seiner Arbeit führte er bis zuletzt. Er war dankbar, dass er seine körperlichen Beschwerden bei der Arbeit weniger spürte, und empfand die mit dem zunehmenden Alter größere Durchlässigkeit und Selbstvergessenheit in der Arbeit als Geschenk.
Im Juni 1979 wurde durch schmerzhafte Knochenmetastasen eine Krebserkrankung diagnostiziert, ungeklärt, von welchem Organ ausgehend. Es war ihm nicht wichtig, das durch Untersuchungen feststellen zu lassen. Er stellte sich aufs Sterben ein. Befreundete Ärzte und die Familie ermöglichten ihm, zu Hause zu sterben. Er lag 10 Wochen bis zu seinem Tod, mit großen Schmerzen. Trotzdem war es möglich, dass Freunde kamen, um Abschied zu nehmen. Es gab Stunden des Weinens und des Lachens. In schmerzfreien Intervallen bastelte er an Schüttelreimen. Der letzte, den er selbst aufschrieb, lautete »Sie verbarg mit leisem Weinen ihr Gesicht in weißem Leinen«.
Seine Frau und zwei seiner Kinder waren bei ihm, als er am 24. August 1979 mittags starb.
Ruth Riemann
Einleitung
Vom Wesen der Angst und von den Antinomien des Lebens
Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. Die Geschichte der Menschheit lässt immer neue Versuche erkennen, Angst zu bewältigen, zu vermindern, zu überwinden oder zu binden. Magie, Religion und Wissenschaft haben sich darum bemüht. Geborgenheit in Gott, hingebende Liebe, Erforschung der Naturgesetze oder weltentsagende Askese und philosophische Erkenntnisse heben zwar die Angst nicht auf, können aber helfen, sie zu ertragen und sie vielleicht für unsere Entwicklung fruchtbar zu machen. Es bleibt wohl eine unserer Illusionen zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können; sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Wir können nur versuchen, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln: Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Diese können uns helfen, Angst anzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, sie immer wieder neu zu besiegen. Methoden, welcher Art auch immer, die uns Angstfreiheit versprechen, sollten wir mit Skepsis betrachten; sie werden der Wirklichkeit menschlichen Seins nicht gerecht und erwecken illusorische Erwartungen.
Wenn nun auch Angst unausweichlich zu unserem Leben gehört, will das nicht heißen, dass wir uns dauernd ihrer bewusst wären. Doch ist sie gleichsam immer gegenwärtig und kann jeden Augenblick ins Bewusstsein treten, wenn sie innen oder außen durch ein Erlebnis konstelliert wird. Wir haben dann meist die Neigung, ihr auszuweichen, sie zu vermeiden, und wir haben mancherlei Techniken und Methoden entwickelt, sie zu verdrängen, sie zu betäuben oder zu überspielen und zu leugnen. Aber wie der Tod nicht aufhört zu existieren, wenn wir nicht an ihn denken, so auch nicht die Angst.
Angst gibt es auch unabhängig von der Kultur und der Entwicklungshöhe eines Volkes oder eines Einzelnen – was sich ändert, sind lediglich die Angstobjekte, das, was jeweils die Angst auslöst, und andererseits die Mittel und Maßnahmen, die wir anwenden, um Angst zu bekämpfen. So haben wir heute im Allgemeinen keine Angst mehr vor Donner und Blitz; Sonnen- und Mondfinsternisse sind für uns ein interessantes Naturschauspiel geworden, aber nicht mehr ein Angsterleben, denn wir wissen, dass sie kein endgültiges Verschwinden dieser Gestirne oder gar einen möglichen Weltuntergang bedeuten. Dafür kennen wir heute Ängste, die frühere Kulturen nicht kannten – wir haben etwa Angst vor Bakterien, vor neuen Krankheitsbedrohungen, vor Verkehrsunfällen, vor Alter und Einsamkeit.
Die Methoden der Angstbekämpfung haben sich dagegen gar nicht so sehr gewandelt. Nur sind an die Stelle von Opfern und magischem Gegenzauber heute moderne, die Angst zudeckende pharmazeutische Mittel getreten – die Angst ist uns geblieben. Die wohl wichtigste neue Möglichkeit der Angstverarbeitung ist heute die Psychotherapie in ihren verschiedenen Gestalten geworden: Sie deckt erstmalig die Geschichte der Angstentwicklung im Individuum auf, erforscht ihre Zusammenhänge mit individuell-familiären und soziokulturellen Bedingungen und ermöglicht die Konfrontation mit der Angst, mit dem Ziel fruchtbarer Angstverarbeitung durch Nachreifen.
Offenbar besteht hier eine der Ausgewogenheiten des Lebens: Gelingt es uns, durch Wissenschaft und Technik Fortschritte in der Welteroberung zu machen und dadurch bestimmte Ängste auszuschalten, zu beseitigen, tauschen wir dafür andere Ängste ein. An der Tatsache, dass Angst unvermeidlich zum Leben gehört, ändert sich dadurch nichts. Nur eine neue Angst scheint zu unserem heutigen Leben zu gehören: Wir kennen zunehmend Ängste, die durch unser eigenes Tun und Handeln gesetzt werden, das sich gegen uns wendet. Wir kennen die Angst vor den zerstörerischen Kräften in uns selbst – denken wir nur an die Gefahren, die der Missbrauch der atomaren Kräfte mit sich bringen kann, oder an die Machtmöglichkeiten, die durch Eingriffe in natürliche Lebensabläufe gegeben sind. Unsere Hybris scheint sich wie ein Bumerang gegen uns selbst zu richten; der Wille zur Macht, dem es an Liebe und Demut fehlt, der Wille zur Macht über die Natur und das Leben, lässt in uns die Angst entstehen, zu manipulierten, sinnentleerten Wesen gemacht zu werden. Hatte der Mensch früherer Zeiten Angst vor den Naturgewalten, denen er hilflos ausgeliefert war, vor bedrohenden Dämonen und rächenden Göttern, müssen wir heute Angst vor uns selbst haben.
So ist es wieder eine Illusion zu meinen, dass der »Fortschritt« – der immer zugleich auch ein Rückschritt ist – uns unsere Ängste nehmen werde; manche gewiss, aber er wird neue Ängste zur Folge haben.
Das Erlebnis Angst gehört also zu unserem Dasein. So allgemeingültig das ist, erlebt doch jeder Mensch seine persönlichen Abwandlungen der Angst, »der« Angst, die es so wenig gibt, wie »den« Tod oder »die« Liebe und andere Abstraktionen. Jeder Mensch hat seine persönliche, individuelle Form der Angst, die zu ihm und seinem Wesen gehört, wie er seine Form der Liebe hat und seinen eigenen Tod sterben muss. Es gibt also Angst nur erlebt und gespiegelt von einem bestimmten Menschen, und sie hat darum immer eine persönliche Prägung, bei aller Gemeinsamkeit des Erlebnisses Angst an sich. Diese unsere persönliche Angst hängt mit unseren individuellen Lebensbedingungen, mit unseren Anlagen und unserer Umwelt zusammen; sie hat eine Entwicklungsgeschichte, die praktisch mit unserer Geburt beginnt.
Wenn wir Angst einmal »ohne Angst« betrachten, bekommen wir den Eindruck, dass sie einen Doppelaspekt hat: Einerseits kann sie uns aktiv machen, andererseits kann sie uns lähmen. Angst ist immer ein Signal und eine Warnung bei Gefahren, und sie enthält gleichzeitig einen Aufforderungscharakter, nämlich den Impuls, sie zu überwinden. Das Annehmen und das Meistern der Angst bedeutet einen Entwicklungsschritt, lässt uns ein Stück reifen. Das Ausweichen vor ihr und vor der Auseinandersetzung mit ihr lässt uns dagegen stagnieren; es hemmt unsere Weiterentwicklung und lässt uns dort kindlich bleiben, wo wir die Angstschranke nicht überwinden.
Angst tritt immer dort auf, wo wir uns in einer Situation befinden, der wir nicht oder noch nicht gewachsen sind. Jede Entwicklung, jeder Reifungsschritt ist mit Angst verbunden, denn er führt uns in etwas Neues, bisher nicht Gekanntes und Gekonntes, in innere oder äußere Situationen, die wir noch nicht und in denen wir uns noch nicht erlebt haben. Alles Neue, Unbekannte, Erstmals-zu-Tuende oder Zu-Erlebende enthält, neben dem Reiz des Neuen, der Lust am Abenteuer und der Freude am Risiko, auch Angst. Da unser Leben immer wieder in Neues, Unvertrautes und noch nicht Erfahrenes führt, begleitet uns Angst immerwährend. Sie kommt am ehesten ins Bewusstsein an besonders wichtigen Stellen unserer Entwicklung, da, wo alte, vertraute Bahnen verlassen werden müssen, wo neue Aufgaben zu bewältigen oder Wandlungen fällig sind. Entwicklung, Erwachsen-Werden und Reifen haben also offenbar viel zu tun mit Angstüberwindung, und jedes Alter hat seine ihm entsprechenden Reifungsschritte mit den dazugehörenden Ängsten, die gemeistert werden müssen, wenn der Schritt gelingen soll.
Es gibt demnach völlig normale, alters- und entwicklungsgemäße Ängste, die der gesunde Mensch durchsteht und überwächst, deren Bewältigung für seine Fortentwicklung wichtig ist. Denken wir etwa an die ersten selbstständigen Laufschritte des Kindes, bei denen es erstmals die haltende Hand der Mutter loslassen und die Angst vor dem Alleingehen, vor dem Alleingelassenwerden im freien Raum überwinden muss. Oder denken wir an die großen Zäsuren in unserem Leben. Nehmen wir den Schulanfang, wo das Kind aus dem Schoß der Familie in eine neue und zunächst fremde Gemeinschaft hineinwachsen und sich in ihr behaupten soll. Nehmen wir die Pubertät und die ersten Begegnungen mit dem anderen Geschlecht unter dem Drang erotischer Sehnsucht und sexuellen Begehrens; oder denken wir an den Berufsbeginn, an die Gründung einer eigenen Familie, an die Mutterschaft und schließlich an das Altern und die Begegnung mit dem Tod – immer ist an einen Anfang oder vor ein erstmals zu Erfahrendes auch eine Angst gesetzt.
Alle diese Ängste gehören gleichsam organisch zu unserem Leben, weil sie mit körperlichen, seelischen oder sozialen Entwicklungsschritten zusammenhängen, mit der Übernahme neuer Funktionen in der Gemeinschaft oder der Gesellschaft auftreten. Immer bedeutet ein solcher Schritt eine Grenzüberschreitung und fordert von uns, von etwas Gewohntem, Vertrautem uns zu lösen und uns in Neues, Unvertrautes zu wagen.
Neben diesen Ängsten gibt es eine Fülle individueller Ängste, die nicht im obigen Sinne typisch für bestimmte Grenzsituationen sind, die wir deshalb bei anderen oft nicht verstehen können, weil wir sie bei uns selbst nicht kennen. So kann bei dem einen Einsamkeit schwere Angst auslösen, bei einem anderen Menschenansammlungen; ein Dritter bekommt Angstanfälle, wenn er über eine Brücke oder über einen freien Platz gehen will; ein Vierter kann sich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten; wieder ein anderer hat Angst vor harmlosen Tieren, vor Käfern, Spinnen oder Mäusen usf.
So vielfältig demnach das Phänomen Angst bei verschiedenen Menschen ist – es gibt praktisch nichts, wovor wir nicht Angst entwickeln können – geht es bei genauerem Hinsehen doch immer wieder um Varianten ganz bestimmter Ängste, die ich deshalb als »Grundformen der Angst« bezeichnen und beschreiben möchte. Alle überhaupt möglichen Ängste haben mit diesen Grundformen der Angst zu tun. Sie sind entweder Extremvarianten und Zerrformen von ihnen oder aber Verschiebungen auf andere Objekte. Wir haben nämlich die Neigung, nicht verarbeitete, nicht gemeisterte Ängste an harmlosere Ersatzobjekte zu heften, die leichter vermeidbar sind als die eigentlichen Angstauslöser, vor denen wir nicht ausweichen können.
Die Grundformen der Angst hängen mit unserer Befindlichkeit in der Welt zusammen, mit unserem Ausgespanntsein zwischen zwei großen Antinomien, die wir in ihrer unauflösbaren Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit leben sollen. Ich möchte diese beiden Antinomien an einem Gleichnis verdeutlichen, das uns in überpersönliche Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten einfügt, deren wir uns im Allgemeinen nicht bewusst sind, die aber dennoch wirklich sind.
Wir werden in eine Welt hineingeboren, die vier mächtigen Impulsen gehorcht: Unsere Erde umkreist in bestimmtem Rhythmus die Sonne, bewegt sich also um das Zentralgestirn unseres engeren Weltsystems, welche Bewegung wir als Revolution, »Umwälzung«, bezeichnen. Gleichzeitig dreht sich dabei die Erde um ihre eigene Achse, führt also die Rotation, »Eigendrehung« benannte Bewegung aus. Damit sind zugleich zwei weitere gegensätzliche bzw. sich ergänzende Impulse gesetzt, die unser Weltsystem sowohl in Bewegung halten wie diese Bewegung in bestimmte Bahnen zwingen: die Schwerkraft und die Fliehkraft. Die Schwerkraft hält unsere Welt gleichsam zusammen, richtet sie zentripetal nach innen, nach der Mitte strebend, aus, und hat etwas von einem festhalten und anziehen wollenden Sog. Die Fliehkraft strebt zentrifugal, die Mitte fliehend, nach außen, sie drängt in die Weite und hat etwas von einem loslassen, sich ablösen wollenden Zug. Nur die Ausgewogenheit dieser vier Impulse garantiert die gesetzmäßige, lebendige Ordnung, in der wir leben, die wir Kosmos nennen. Das Überwiegen oder das Ausfallen einer solchen Bewegung würde die große Ordnung stören bzw. zerstören und ins Chaos führen.
Stellen wir uns einmal vor, die Erde würde einen dieser Grundimpulse aufgeben. Gäbe sie z. B. die Revolution, die Umkreisung der Sonne, auf und würde nur noch die Rotation, die Drehung um die eigene Achse, vollziehen, würde sie die Größenordnung eines Planeten übersteigen und sich als Sonne gebärden, als Mittelpunkt, um den sich die anderen Planeten zu drehen hätten. Sie würde sich also nicht mehr in die ihr vorgeschriebene Bahn um die Sonne einfügen, sondern nur noch ihr eigenes Gesetz leben.
Gäbe die Erde dagegen die Rotation, ihre Eigendrehung, auf und würde sie nur noch um die Sonne kreisen, sänke sie von der Planetenstufe auf die eines Trabanten, eines Mondes herab, der Sonne immer die gleiche Seite zuwendend in größter Abhängigkeit. In beiden Fällen würde sie also ihre Planetengesetzlichkeit, abhängiges Sicheinfügen und dennoch unabhängige Eigendrehung zu haben, durchbrechen.
Weiter: Hätte die Erde keine Schwerkraft, das Zentripetale, so würde sie nur der Fliehkraft unterliegen und chaotisch zerbersten, aus der Bahn kommen, und vielleicht mit anderen Weltkörpern zusammenstoßen. Und würde sie schließlich nur der Schwerkraft gehorchen ohne den Gegenimpuls der Fliehkraft, des Zentrifugalen, müsste das zu völliger Erstarrung und Unveränderlichkeit führen oder zu passivem Aus-der-Bahn-gezogen-Werden durch andere Kräfte, denen sie keine eigene Kraft entgegenzusetzen hätte.
Und nun zu dem Gleichnis: Nehmen wir einmal an – was eigentlich sehr nahe liegt – dass der Mensch als Bewohner unserer Erde und als winziges Teilchen unseres Sonnensystems auch dessen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei, und dass er damit die beschriebenen Impulse als unbewusste Triebkräfte und zugleich als latente Forderungen in sich trage, so führt uns das zu sehr überraschenden Entsprechungen. Wir brauchen nämlich nur jene Grundimpulse auf der menschlichen Ebene ins Psychologische zu übersetzen, also nach ihren Entsprechungen im seelischen Erleben zu fragen, dann stoßen wir auf die erwähnten Antinomien, zwischen denen unser Leben ausgespannt ist und, wie wir sehen werden, zugleich auf jene Grundformen der Angst, die im Zusammenhang damit stehen und so einen tieferen Sinn bekommen.
Der Rotation, der Eigendrehung, entspräche psychologisch sinngemäß die Forderung zur Individuation, also dazu, ein einmaliges Einzelwesen, ein Individuum zu werden. Der Revolution, der Bewegung um die Sonne als unserem Zentralgestirn, entspräche die Forderung, sich einzuordnen in ein größeres Ganzes, unsere Eigengesetzlichkeit, unser eigenes Wollen zu begrenzen zugunsten überpersönlicher Zusammenhänge. Damit hätten wir die erste Antinomie umschrieben, die die gegensätzlichen Forderungen enthält, dass wir sowohl wir selbst werden als uns in überindividuelle Zusammenhänge einfügen sollen.
Dem Zentripetalen, der Schwerkraft, entspräche auf der seelischen Ebene unser Impuls nach Dauer und Beständigkeit; und schließlich dem Zentrifugalen, der Fliehkraft, entspräche der Impuls, der uns immer wieder vorwärts, zur Veränderung und Wandlung treibt. Damit haben wir auch die andere Antinomie umschrieben: Sie enthält die wiederum gegensätzlichen Forderungen, dass wir nach Dauer und andererseits nach Wandlung streben sollen.
Nach dieser kosmischen Analogie sind wir vier grundlegenden Forderungen ausgesetzt, die wir als einander widersprechende und doch zugleich sich ergänzende Strebungen in uns wiederfinden. In wechselnder Gestalt durchziehen sie unser ganzes Leben und wollen in immer neuer Weise von uns beantwortet werden.
Die erste Forderung, in unserem Gleichnis der Rotation entsprechend, ist, dass wir ein einmaliges Individuum werden sollen, unser Eigensein bejahend und gegen andere abgrenzend, dass wir unverwechselbare Persönlichkeiten werden sollen, kein austauschbarer Massenmensch. Damit ist aber alle Angst gegeben, die uns droht, wenn wir uns von anderen unterscheiden und dadurch aus der Geborgenheit des Dazugehörens und der Gemeinsamkeit herausfallen, was Einsamkeit und Isolierung bedeuten würde. Bei aller Breite, in der wir durch Rasse, Familien- und Volkszugehörigkeit, durch Alter, Geschlecht, durch unseren Glauben oder unseren Beruf usf. bestimmten Gruppen angehören, denen wir uns verwandt und vertraut fühlen, sind wir doch zugleich Individuen und damit etwas Einmaliges, von allen anderen Menschen deutlich Unterschiedenes. Das kommt schon in der bemerkenswerten Tatsache zum Ausdruck, dass allein unser Daumenabdruck genügt, um uns von jedem anderen Menschen unverwechselbar zu unterscheiden und eindeutig zu identifizieren. So gleicht unsere Existenz einer Pyramide, deren breite Basis sich aus Typischem und Gemeinsamkeiten aufbaut, die aber zur Spitze hin sich immer mehr aus den verbindenden Gemeinsamkeiten herauslöst und im einmalig Individuellen endet. Mit dem Annehmen und Entwickeln unserer Einmaligkeit, mit dem Individuationsprozess, wie C. G. Jung diesen Entwicklungsvorgang genannt hat, fallen wir aus der Geborgenheit des Dazugehörens, des »Auch-wie-die-anderen-Seins« heraus, und erleben die Einsamkeit des Individuums mit Angst. Denn je mehr wir uns von anderen unterscheiden, umso einsamer werden wir und sind damit der Unsicherheit, dem Nichtverstanden-, dem Abgelehnt-, u. U. dem Bekämpftwerden ausgesetzt. Riskieren wir aber andererseits nicht, uns zu eigenständigen Individuen zu entwickeln, so bleiben wir zu sehr im Kollektiven, im Typischen stecken und bleiben unserer menschlichen Würde etwas Entscheidendes schuldig.
Die zweite Forderung, in unserem Gleichnis der Revolution entsprechend, ist die, dass wir uns der Welt, dem Leben und den Mitmenschen vertrauend öffnen, uns einlassen sollen mit dem Nicht-Ich, dem Fremden, in Austausch treten sollen mit dem Außer-unsSeienden. Es ist damit gemeint: die Seite der Hingabe – im weitesten Sinne – an das Leben. Damit ist aber verbunden alle Angst, unser Ich zu verlieren, abhängig zu werden, uns auszuliefern, unser Eigensein nicht angemessen leben zu können, es anderen opfern und in der geforderten Anpassung zu viel von uns selbst aufgeben zu müssen. Es geht hier also vor allem um die Seite unserer Abhängigkeiten, um unser »Geworfensein«, und darum, dass wir trotz dieser Abhängigkeiten und Gefährdungen unseres Ichs, die uns unsere Ohnmacht fühlen lassen, uns dem Leben zuwenden, uns aufschließen sollen. Riskieren wir das nicht, bleiben wir isolierte Einzelwesen ohne Bindung, ohne Zugehörigkeit zu etwas über uns Hinausreichendem, letztlich ohne Geborgenheit und werden so weder uns selbst noch die Welt kennen lernen.
Wir sind mit dieser ersten Antinomie auf die eine paradoxe Zumutung gestoßen, die das Leben uns auferlegt: Wir sollen sowohl die Selbstbewahrung und Selbstverwirklichung leben als auch die Selbsthingabe und Selbstvergessenheit, sollen zugleich die Angst vor der Ich-Aufgabe wie die Angst vor der Ich-Werdung überwinden.
Und nun zu den beiden anderen Forderungen, die wiederum im polaren Verhältnis des Widerspruches und der Ergänzung stehen, wie die eben beschriebenen:
Die dritte Forderung, in unserem Gleichnis dem Zentripetalen, der Schwerkraft entsprechend, ist, dass wir die Dauer anstreben sollen. Wir sollen uns auf dieser Welt gleichsam häuslich niederlassen und einrichten, in die Zukunft planen, zielstrebig sein, als ob wir unbegrenzt leben würden, als ob die Welt stabil wäre und die Zukunft voraussehbar, als ob wir mit Bleibendem rechnen könnten – mit dem gleichzeitigen Wissen, dass wir »media vita in morte sumus«, dass unser Leben jeden Augenblick zu Ende sein kann. Mit dieser Forderung zu dauern, uns in eine ungewisse Zukunft zu entwerfen, ja, überhaupt Zukunft zu haben, als ob wir damit etwas Festes und Sicheres vor uns hätten – mit dieser Forderung sind alle Ängste gegeben, die mit dem Wissen um die Vergänglichkeit, um unsere Abhängigkeiten und um die irrationale Unberechenbarkeit unseres Daseins zusammenhängen: die Angst vor dem Wagnis des Neuen, vor dem Planen ins Ungewisse, davor, sich dem ewigen Fließen des Lebens zu überlassen, das nie stillsteht und auch uns selbst wandelnd ergreift. Das liegt wohl in dem Ausspruch, dass niemand zweimal in den gleichen Fluss steigen könne – der Fluss und auch man selbst ist stets ein anderer. Würden wir aber andererseits auf die Dauer verzichten, könnten wir nichts schaffen und verwirklichen; alles Geschaffene muss in unserer Vorstellung etwas von dieser Dauer haben – sonst würden wir gar nicht anfangen, unsere Ziele zu verwirklichen. So leben wir immer, als ob wir glaubten, unbegrenzt Zeit zu haben, als ob das endlich Erreichte stabil wäre, und diese uns vorschwebende Stabilität und Dauer, diese illusionäre Ewigkeit, ist ein wesentlicher Impuls, der uns zum Handeln treibt.
Und schließlich die vierte Forderung, im Gleichnis dem Zentrifugalen, der Fliehkraft entsprechend. Sie besteht darin, dass wir immer bereit sein sollen, uns zu wandeln, Veränderungen und Entwicklungen zu bejahen, Vertrautes aufzugeben, Traditionen und Gewohntes hinter uns zu lassen, uns immer wieder vom gerade Erreichten zu lösen und Abschied zu nehmen, alles nur als Durchgang zu erleben. Mit dieser Forderung, uns immer lebendig weiterzuentwickeln, uns nicht aufzuhalten, nicht zu haften, dem Neuen geöffnet und das Unbekannte wagend, ist nun die Angst verbunden, durch Ordnungen, Notwendigkeiten, Regeln und Gesetze, durch den Sog der Vergangenheit und Gewohnheit festgelegt, festgehalten zu werden, eingeengt, begrenzt zu werden in unseren Möglichkeiten und unserem Freiheitsdrang. Es droht also hier letztlich, im Gegensatz zur vorbeschriebenen Angst, wo der Tod als Vergänglichkeit erschien, der Tod als Erstarrung und Endgültigkeit. Würden wir aber den Impuls zur Wandlung, zum Wagnis des Neuen, aufgeben, so blieben wir im Gewohnten haften, einförmig schon Daseiendes wiederholend und festhaltend, und die Zeit und die Mitwelt würde uns überholen und vergessen.
Damit haben wir die andere Antinomie skizziert, die weitere Zumutung des Lebens an uns: dass wir zugleich nach Dauer und nach Wandlung streben sollen, dass wir dabei sowohl die Angst vor der nicht aufzuhaltenden Vergänglichkeit wie die Angst vor der unausweichlichen Notwendigkeit überwinden müssen.
So haben wir vier Grundformen der Angst kennen gelernt, die ich noch einmal zusammenstellen will:
1. Die Angst vor der Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt;
2. Die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt;
3. Die Angst vor der Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt;
4. Die Angst vor der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt.
Alle möglichen Ängste sind letztlich immer Varianten dieser vier Grundängste und hängen mit den vier Grundimpulsen zusammen, die ebenfalls zu unserem Dasein gehören und sich auch paarweise ergänzen und widersprechen: Als Streben nach Selbstbewahrung und Absonderung, mit dem Gegenstreben nach Selbsthingabe und Zugehörigkeit; und andererseits als Streben nach Dauer und Sicherheit, mit dem Gegenstreben nach Wandlung und Risiko. Zu jeder Strebung gehört die Angst vor der Gegenstrebung. Und doch, wenn wir noch einmal auf unser kosmisches Gleichnis zurückgreifen, scheint eine lebendige Ordnung nur möglich zu sein, wenn wir eine Gleichgewichtigkeit zwischen diesen antinomischen Impulsen zu leben versuchen. Eine solche Gleichgewichtigkeit bedeutet indessen nicht etwas Statisches, wie man meinen könnte, sondern sie ist voll ungemeiner innerer Dynamik, weil sie nie etwas Erreichtes, sondern etwas immer wieder Herzustellendes ist.
Dabei müssen wir beachten, dass die Art der jeweils erlebten Angst und ihr Intensitätsgrad in großem Maße abhängig sind sowohl von unserer mitgebrachten Anlage, von unserem »Erbe«, als auch von den Umweltbedingungen, in die wir hineingeboren werden; sowohl von unserer körperlichen und seelisch-geistigen Konstitution also, wie auch von unserer persönlichen Biografie, der Geschichte unseres Gewordenseins. Denn auch unsere Ängste haben eine Geschichte, und wir werden sehen, von wie großer Bedeutung dafür unsere Kindheit ist. So ist Angst bei jedem Menschen durch Anlage und Umwelteinflüsse mitgetönt, was zum Teil auch erklärt, warum uns manche Ängste anderer schwer einfühlbar sind – sie entstanden bei ihnen aus Lebensbedingungen, die von den unseren zu sehr abwichen.
Anlage und Umwelt – zu welcher neben der Familie, dem »Milieu«, auch die Gesellschaft gehört – können also bestimmte Ängste begünstigen, andere zurücktreten lassen. Der weitgehend gesunde Mensch – der in seiner Entwicklung nicht Gestörte – wird im Allgemeinen mit den Ängsten umgehen und sie vielleicht auch überwinden können. Der in seiner Entwicklung Gestörte erlebt Ängste sowohl intensiver als auch häufiger und eine der Grundformen der Angst wird bei ihm das Übergewicht haben.
Schwer belastend und krank machend kann eine Angst werden, wenn sie entweder ein gewisses Maß übersteigt oder wenn sie zu lange anhält. Am schwersten belastend sind Ängste, die zu früh in der Kindheit erlebt werden, in einem Alter, wo das Kind noch keine Abwehrkräfte gegen sie entwickeln konnte. Immer wenn eine Angst durch Intensität oder Dauer zu groß wird oder wenn sie uns in einem Alter trifft, wo wir ihr noch nicht gewachsen sind, kann sie schwer verarbeitet werden. Der aktivierende positive Aspekt der Angst fällt dann fort; Entwicklungshemmungen, Stehenbleiben oder auch Zurückgleiten in frühere, kindlichere Verhaltensweisen sowie Symptombildungen sind die Folge. Verständlicherweise werden wir nicht altersgemäße Angsterlebnisse sowie zu große Angstquantitäten, die das Maß des Erträglichen übersteigen, besonders im Kindesalter antreffen. Das schwache, in der Entwicklung begriffene Ich des Kindes kann gewisse Angstquantitäten noch nicht verarbeiten; es ist dafür auf die Hilfe von außen angewiesen und wird Schädigungen davontragen, wenn es mit solchen übergroßen Ängsten alleingelassen wird.
Beim Erwachsenen können seltenere Ausnahmesituationen wie Krieg, Gefangenschaft, Lebensgefährdungen, Natur- und sonstige Katastrophen, aber auch innerseelische Erlebnisse und Prozesse ebenfalls seine Toleranzgrenze für Ängste überschreiten, sodass er mit Panik, mit Kurzschlusshandlungen oder Neurosen darauf reagiert. Unter normalen Bedingungen hat aber der Erwachsene dem Kinde gegenüber eine viel reichere Auswahl an Antwortmöglichkeiten und Gegenkräften gegen die Angst: Er kann sich wehren, seine Situation durchdenken und die Angstauslöser erkennen; er kann vor allem verstehen, woher seine Angst stammt; er kann sie mitteilen und so Verständnis und Hilfe bekommen, und er kann die möglichen Gefährdungen richtig einschätzen. All das steht dem Kind noch nicht zur Verfügung; je kleiner es ist, desto mehr ist es nur Objekt seiner Ängste, ihnen hilflos ausgeliefert, ohne Wissen, wie lange sie anhalten werden und was alles geschehen kann.
Wir werden sehen, wie das Überwertigwerden einer der vier Grundängste – oder, von der anderen Sicht her gesehen, das weitgehende Aufgeben eines der vier Grundimpulse – uns zu vier Persönlichkeitsstrukturen führt, zu vier Arten des In-der-Welt-Seins, die wir in Abstufungen alle kennen und an denen wir alle mehr oder weniger akzentuiert Anteil haben. Diese Persönlichkeitsstrukturen sind also zu verstehen als einseitige Akzentuierung in Bezug auf die vier Grundängste. Je ausgeprägter und einseitiger die zu beschreibenden Persönlichkeitsstrukturen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie aufgrund frühkindlicher Entwicklungsstörungen entstanden sind. Dementsprechend wäre es als ein Zeichen von seelischer Gesundheit anzusehen, wenn jemand die vier Grundimpulse in lebendiger Ausgewogenheit zu leben vermöchte – was zugleich bedeutete, dass er sich auch mit den vier Grundformen der Angst auseinandergesetzt hat.
Die vier Persönlichkeitsstrukturen sind zunächst Normalstrukturen mit gewissen Akzentuierungen. Wird indessen die Akzentuierung zu ausgesprochener Einseitigkeit, erreicht sie Grenzwerte, die als Zerrformen oder Extremvarianten der vier normalen Grundstrukturen zu verstehen sind. Wir stoßen damit auf die neurotischen Varianten der Strukturtypen, wie sie die Psychotherapie und Tiefenpsychologie in den vier großen Neuroseformen der Schizoidie, der Depression, der Zwangsneurose und der Hysterie beschrieben hat. Diese neurotischen Persönlichkeiten spiegeln also jeweils nur in zugespitzter oder extremer Form allgemein menschliche Daseinsformen, die wir alle kennen.
Es handelt sich damit letztlich um vier verschiedene Arten des Inder-Welt-Seins; bei ihrer Schilderung will ich die Folgen jener Einseitigkeit von noch durchaus gesund zu nennenden Erscheinungsformen über leichtere, schwere bis zu den schwersten Störungen beschreiben. Konstitutionell entgegenkommende Anlagen sollen dabei berücksichtigt werden; vor allem aber wird unser Interesse den lebensgeschichtlichen Hintergründen gelten.
Zuvor noch eine Zwischenbemerkung: Soweit die Beschreibung der vier Persönlichkeitsstrukturen den Charakter einer Typenlehre anzunehmen scheint, unterschiede sich diese von anderen Typologien insofern, als sie – vorwiegend auf psychoanalytischen Erkenntnissen und Erfahrungen der Psychotherapie und Tiefenpsychologie aufbauend – weniger fatalistisch und endgültig festlegend wäre als vergleichsweise aus der Konstitution oder dem Temperament abgeleitete Typen; die Letzteren stellen sich als schicksalhaft gegeben und unabänderlich dar – sie sind nur hinzunehmen. Mir geht es hier um anderes.
Nicht nur, weil ich einen bestimmten Körperbau habe, bin ich so oder so, sondern weil ich eine bestimmte Einstellung, ein bestimmtes Verhalten zur Welt, zum Leben habe, das ich aus meiner Lebensgeschichte erworben habe, prägt das meine Persönlichkeit und verleiht ihr bestimmte strukturelle Züge. Was daran schicksalhaft ist – die mitgebrachte psychophysische Anlage, die Umwelt unserer Kindheit mit den Persönlichkeiten unserer Eltern und Erzieher sowie die Gesellschaft mit ihren Spielregeln, in die wir hineingeboren werden – ist in gewissen Grenzen durch uns selbst zu gestalten, kann verändert werden, ist jedenfalls nicht nur ein Hinzunehmendes. Die hier gemeinten Persönlichkeitsstrukturen wollen als Teilaspekte eines ganzheitlichen Menschenbildes verstanden werden. Die Nachentwicklung zunächst schicksalhaft ungenügend entwickelter, vernachlässigter, fehlgeleiteter oder überfremdeter und unterdrückter Teilaspekte unseres Wesens kann die erworbene Struktur verändern und vervollständigen zugunsten jener vorschwebenden Ganzheit oder Reife, Abrundung, in dem Ausmaß, wie es der Einzelne für sich zu erlangen vermag.
Wir gehen also hier von vier allgemeingültigen Grundeinstellungen und Verhaltensmöglichkeiten aus gegenüber den Bedingungen und Abhängigkeiten unseres Daseins, wobei uns das kosmische Vorbild der lebendigen Ordnung und Ausgewogenheit scheinbar unvereinbarer Gegensätze vorschwebt.
Das Beibehalten der Begriffsbezeichnungen aus der Neurosenlehre für die vier Strukturtypen, auch für den sogenannten Gesunden, hat praktische Vorteile, weil bei diesen Begriffen immer zugleich die lebensgeschichtliche Entstehung und die neurotische Variante mitgesehen werden kann; zugleich haben sie sich inzwischen so weit eingebürgert, dass eine Neubenennung überflüssig erscheint. Der Leser wird das vermutlich bald verstehen, wenn ihm die Begriffe der Schizoidie, Depression usf. aus der Schilderung geläufig und plastisch in seiner Vorstellung geworden sind.
Ich habe es in diesem Buch vermieden, die im Schrifttum meist anzutreffende Unterscheidung zwischen Angst und Furcht aufzugreifen. Sie war mir für mein Grundkonzept unwesentlich; zudem erscheint sie mir auch nicht zwingend und überzeugend genug, wie es in der Unsicherheit der Verwendung beider Begriffe im üblichen Sprachgebrauch zum Ausdruck kommt: Wir sprechen sowohl von Todesangst wie von Todesfurcht und können die beiden Begriffe nicht ohne Gewaltsamkeit differenzieren. Der gewöhnlich gemachte Unterschied, Furcht auf etwas Bestimmtes, Konkretes zu beziehen, Angst dagegen auf etwas Unbestimmtes, mehr Irrationales, mag eine gewisse Berechtigung haben, ist aber auch nicht immer stichhaltig, wie etwa bei der Gottesfurcht, die nach obiger Unterscheidung Gottesangst heißen müsste. Ich habe daher bewusst darauf verzichtet, eine begriffliche Trennung von Angst und Furcht hier vorzunehmen.
Dieses Buch ist geschrieben, um dem Einzelnen leben zu helfen, um ihm mehr Selbst- und Fremdverständnis zu vermitteln und um die Wichtigkeit unserer Anfangsjahre für unsere Entwicklung deutlich zu machen. Es ist auch geschrieben, um den Sinn zu wecken, wiederzuerwecken, für die großen Zusammenhänge, denen wir eingefügt sind und von denen wir, wie ich meine, Wesentliches lernen können.
Die Angst vor der Hingabe
Die schizoiden Persönlichkeiten
»Auf, laß uns anders werden als die Vielen,
die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen.«
Spitteler