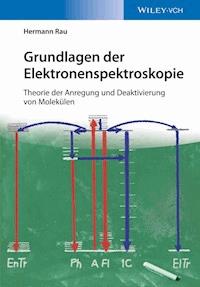
66,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Quantenmechanische Aspekte der Erzeugung und Deaktivierung angeregter Elektronenzustände stellen die theoretische Grundlage der Elektronenspektroskopie dar. Ausgehend vom Experiment wird zunächst die Beschreibung von Molekülzuständen durch Wellenfunktionen eingeführt. Didaktisch geschickt folgt eine ausführliche Diskussion der Erzeugung von angeregten Zuständen, zusätzlich wird auch das Thema "optische Aktivität" erläutert. Die verschiedenen Kanäle der Deaktivierung angeregter Zustände werden umfassend diskutiert, mit einem besonderen Schwerpunkt auf strahlungsloser Deaktivierung durch Elektronenübertragung. Aufbauend auf langjährigen Vorlesungsnotizen optimal zum vorlesungsbegleitenden Lernen, Dank des modularen Aufbaues aber auch zum punktuellen Nachschlagen und Auffrischen von Wissen geeignet!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Autor
Impressum
Vorwort
Einleitung
1: Experimentelle Daten
1.1 Was beobachtet man bei Versuchen zur UV/VIS-Spektroskopie?
1.2 Zusammenfassung
Teil I: Zustände
2: Der Zustandsraum
2.1 Materiewellen und Wellenfunktionen
2.2 Zustände
2.3 Beschreibung von Molekülzuständen durch Wellenfunktionen
2.4 Symmetrie
2.5 Zusammenfassung
Teil II: Absorption – Erzeugung von angeregten Zuständen
3: Anregung von „reinen“ Zuständen
3.1 Die zeitabhängige Störungstheorie
3.2 Der Störoperator Ĥ′ des Strahlungsfeldes
3.3 Die Störung eines molekularen Systems durch ein elektromagnetisches Wechselfeld
3.4 Vibronische Zustände, Franck-Condon-Prinzip
3.5 Verbindung zur praktischen Spektroskopie
3.6 Optische Aktivität
3.7 Zusammenfassung
4: Mischung von Zuständen durch Störpotenziale
4.1 Zeitunabhängige Störungstheorie
4.2 Schwingungsinduzierte Übergänge
4.3 Singulett-Triplett-Übergänge
4.4 Molekülaggregate
4.5 Induzierte Optische Aktivität
4.6 Zusammenfassung
Teil III: Deaktivierung angeregter Zustände
5: Der angeregte Zustand
5.1 Eigenzustände und Nichteigenzustände
5.2 Deaktivierungsprozesse
5.3 Zusammenfassung
6: Deaktivierung durch Strahlung
6.1 Der Anregungszustand
6.2 Stimulierte Emission
6.3 Spontane Emission
6.4 Verbindung zur praktischen Spektroskopie
6.5 Lichtverstärkung
6.6 Zusammenfassung
7: Strahlungslose Deaktivierung
7.1 Internal Conversion
7.2 Intersystem Crossing
7.3 Energieübertragung
7.4 Elektronenübertragung
7.5 Zusammenfassung
Anhang A: Die zeitliche Entwicklung eines präparierten Zustands unter einer Störung
Anhang B: Berechnungen
B.1 Umrechnung der Formel
B.2 Berechnung der Absorptionswahrscheinlichkeit
Anhang C: Übergänge eines Systems von einer auf die andere Potenzialfläche
Anhang D: Ableitung der Schwingungsfunktion χ
n
(ξ) nach der Koordinate
Anhang E: Skizze der Entwicklung der Formel von Levich und Dogonadze
Anhang F: Fermi’s Golden Rule
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
List of Tables
2: Der Zustandsraum
Tab. 2.1 Größen der klassischen und Operatoren der Quantenphysik
Tab. 2.2 Die Spinfunktionen eines Zweielektronensystems.
Tab. 2.3 Symmetrieelemente und Symmetrieoperationen.
Tab. 2.4 Charakterentafeln der Punktgruppen C
2h
und C
2v
.
Tab. 2.5 Irreduzible Darstellungen der HMOs von trans- und cis-Butadien.
Tab. 2.6 Die Darstellungen der niedrigsten Anregungszustände von trans- und cis-Butadien.
Tab. 2.7 Charakterentafel der Punktgruppe D
6h
.
Tab. 2.8 Hückel-MOs Φ aus AOs φ für Benzol.
4: Mischung von Zuständen durch Störpotenziale
Tab. 4.1 Wirkung der Spinoperatoren auf Singulett- und Triplettzustände.
Tab. 4.2 Die pseudoskalaren Darstellungen der Punktgruppen.
Tab. 4.3 Coulomb-Potenziale zweier nicht überlappender Ladungsverteilungen A und B [7].
Pages
cover
contents
ii
iii
iv
ix
xi
xii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
173
174
175
176
177
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Beachten Sie bitte auchweitere interessante Titel zu diesem Thema
Atkins, P.W., de Paula, J.
Physikalische Chemie
5. Auflage
2013
Print ISBN: 978-3-527-33247-2; auch in elektronischen Formaten verfügbar,
ISBN: 978-3-527-68289-8
Atkins
Physikalische Chemie
Set aus Lehrbuch und Arbeitsbuch, 5. Auflage
2013
Print ISBN: 978-3-527-33568-8; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Wedler, G., Freund, H.
Lehrbuch der Physikalischen Chemie
6. Auflage
2012
Print ISBN: 978-3-527-32909-0; auch in elektronischen Formaten verfügbar,
ISBN: 978-3-527-68288-1
Wedler, G., Freund, H.
Lehrbuch der Physikalischen Chemie
Set aus Lehrbuch und Arbeitsbuch, 6. Auflage
2012
Print ISBN: 978-3-527-33428-5; auch in elektronischen Formaten verfügbar
Grundlagen der Elektronenspektroskopie
Theorie der Anregung und Deaktivierung von Molekülen
Hermann Rau
Autor
Hermann Rau
Brunnwiesenstr. 5
72074 Tübingen
Deutschland
Alle Bücher vonWiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegendenWerkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information derDeutschenNationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine vonMaschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-33903-7
ePDF ISBN 978-3-527-69269-9
ePub ISBN 978-3-527-669267-5
Mobi ISBN 978-3-527-69268-2
Vorwort
Dieses Buch wendet sich an Leser, die wissen möchten, wie man die Phänomene Absorption, optische Aktivität, Emission und strahlungslose Deaktivierung beschreibt und „versteht“. Das Buch vermittelt, interpretiert und hinterfragt Ideen, Modelle und Entwicklungen der Original- und Sekundärliteratur, die dort oft zu kurz ausgeführt sind, und stellt sie durch die zentrale Denkfigur Zustandsraum in einen Zusammenhang; allerdings ist dieses Buch keine Monografie. Man merkt am Stil des Textes und manchen Abbildungen, dass das Buch aus Vorlesungen entstanden ist, die einzelnen Kapitel sind nicht streng aufeinander bezogen und manches ist, wo nützlich, redundant. Zusammenfassungen ermöglichen eine schnelle Orientierung über den Inhalt der einzelnen Kapitel.
Größere Moleküle sind sehr komplexe Systeme gekoppelter Oszillatoren, was ihre Beschreibung kompliziert macht. Die Modellbildung ist in diesem Bereich nicht ohne mathematische Verfahren möglich, die über die im normalen Chemie-Curriculum erworbenen hinausgehen. Es wird jedoch stets versucht, die physikalische Wirklichkeit, die durch die Mathematik gespiegelt wird, deutlich zu machen. Dies gibt eine Leitlinie, auch wenn man auf die mühsame Prozedur verzichtet, alle mathematischen Schritte einzeln nachzuvollziehen.
Das Buch beschränkt sich auf die Darstellung der Theorie der von heute aus gesehen schon als „klassisch“ zu bezeichnenden Spektroskopie. Für die Theorie der „modernen“ Spektroskopie, bei der die zeitliche und räumliche Kohärenz im Vordergrund steht, bildet es eine Grundlage.
Tübingen, im Mai 2015Hermann Rau
Einleitung
Ziel dieser Vorlesungsnotizen
Die Daten des Absorptionsspektrums und des Emissionsspektrums liefern die Grundlage für die Beschreibung der Molekülzustände. Die Beschreibung wird durch die Quantenmechanik geleistet. Die Theorie dazu, die hier im Zentrum steht, ist die der Wellenmechanik, wie sie Erwin Schrödinger begründet hat. Molekülzustände werden durch Wellenfunktionen beschrieben, die häufig durch die Variable ψ bezeichnet werden. Die Vertrautheit mit ψ-Funktionen und die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen, ist Ziel dieser Vorlesungen: Es soll das Gebäude der Molekülbeschreibung durch die Wellenmechanik begriffen werden. Es soll ein „Verständnis“ für die Vorgänge bei Elektronenübergängen zwischen den Zuständen in Molekülen entwickelt werden. Es ist nicht angestrebt, die Fähigkeit zu entwickeln, eigene quantenmechanische Rechnungen durchzuführen.
Wir werden uns zunächst mit den atomaren und molekularen Zuständen befassen, ihren Eigenschaften und dann mit den Übergängen zwischen diesen Zuständen. Dabei werden auch verschiedene Störungen, die Schwingungskopplung, die Spin-Bahn-Kopplung und die Excitonkopplung behandelt sowie der Einfluss der Chiralität des Systems auf die Spektren.
Für die Absorption und Emission bei der Wechselwirkung von Strahlung und Materie ist ein umfassendes Modell entwickelt worden. Dabei darf nie vergessen werden, dass es sich hier um Beschreibungsprobleme handelt, für die die mathematische Formulierung die einzige mögliche ist, wenn man quantitative Aussagen machen möchte: Es kommt also darauf an, die Ergebnisse der Experimente in ein mathematisches Modell umzuformen. Solche Modelle sind billige und willige Konstrukte, sie erlauben auch Voraussagen über das bisher Bekannte hinaus, gewissermaßen eine Extrapolation. Mathematische Modelle sind aber nur nützlich, wenn sie experimentell überprüfbar sind, ergeben sich Widersprüche zur Wirklichkeit, so muss ein Modell erweitert oder ganz ersetzt werden.
Das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn ein Zug mit konstanter Geschwindigkeit in einen Tunnel fährt, kann man nach dem mathematischen Modell t = s/v den Zeitpunkt des Erscheinens des Zugs am anderen Ende vorherbestimmen. Kommt er immer früher oder später, so braucht man eine Korrektur am mathematischen Modell, z. B. durch zusätzliche Glieder in der mathematischen Darstellung. Die schwierige Aufgabe ist es dann, den Grund für die Abweichungen vom einfachen Modell zu finden. Das könnte z. B. eine Steigung oder ein höherer Luftwiderstand im Tunnel sein. Abweichungen vom vorliegenden Modell sind fruchtbar, sie führen zu weiteren experimentellen und theoretischen Fragen.
Mit diesem Text werden auch die Grundlagen gelegt, die für das Verständnis der Kurzzeitspektroskopie und der kohärenten Spektroskopie nötig sind.
1Experimentelle Daten
UV/VIS-Spektroskopie oder Elektronenspektroskopie nennt man die Messung, Auswertung und Deutung der Phänomene der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung des sichtbaren und ultravioletten Spektralbereichs mit Materie. Diese Vorlesungen beschränken sich auf die Elektronenspektroskopie an Molekülen bei zeitlich kontinuierlicher Anregung.
1.1 Was beobachtet man bei Versuchen zur UV/VIS-Spektroskopie?
Bei der Absorption von Licht beobachtet man die Abschwächung der Intensität eines Lichtstrahls beim Durchgang durch eine Probe, deren Ausmaß, Frequenzabhängigkeit und Polarisation für das Probenmaterial charakteristisch ist. Die Absorption ist normalerweise wellenlängenabhängig, sie wird durch einen Graphen, das Absorptionsspektrum, dargestellt, in dem die Extinktion E (engl. absorbance A)
(dimensionslos) als Funktion der Wellenlänge λ aufgetragen ist. I0 ist die auf die Probe auffallende Strahlungsintensität1), I die Intensität der Strahlung nach Durchgang durch die Probe. Besonders bei verdünnten Lösungen, wo das Lambert-Beer’sche Gesetz
gilt, ist die Verwendung des Extinktionskoeffizienten ελ (l mol−1 cm−1), also der auf die Einheitskonzentration (in mol l−1) und Einheitsschichtdicke (in cm) bezogenen Extinktion, die bessere Darstellung.2) Manchmal wird auch der Absorptionsquerschnitt eines Moleküls als σ = (ln 10/NA)ε (cm2) als Absorptionsmaß herangezogen.
Der Graph E = f(λ) bzw. E = f() ist das Absorptionsspektrum, das für jeden Stoff eine charakteristische Eigenschaft ist. Die Darstellung in Wellenlängen λ ist nicht energielinear, deshalb werden die Spektren oft in Wellenzahlen = 1/λ (in cm−1) dargestellt, denn dann entspricht einem bestimmten Abschnitt auf der Wellenzahlenskala der gleiche Energiebetrag unabhängig davon, ob das UV- oder IR-Spektralgebiet betrachtet wird. In der Wellenlängendarstellung sind die Absorptionsbereiche im UV im Vergleich zur Wellenzahlendarstellung visuell schmaler, im roten Spektralgebiet ist es umgekehrt. Trotzdem ist die Wellenlängenskala weit verbreitet, wahrscheinlich, weil die Spektren bei Gitterspektrometern in Wellenlängen direkt anfallen.
Im Spektrum von Molekülen lassen sich bestimmte mehr oder weniger gut gegeneinander abgegrenzte Wellenlängengebiete feststellen. Ein solches Absorptionsgebiet wird Bande genannt, es entspricht einem bestimmten Elektronenübergang, wie wir später besprechen werden. Dieser Elektronenübergang bestimmt auch die Größe E bzw. ε, oft auch selbst Intensität genannt. Die Intensität kann für dieselbe Probe über Zehnerpotenzen variieren, weshalb sie oft logarithmisch aufgetragen wird (Abb. 1.1). Man spricht von „verbotenen“ und „erlaubten“ Übergängen. Die Absorptionsintensität einer Bande kann auch in der Größe Oszillatorstärke
Abb. 1.1 Absorptionsspektren (a) schematisch log ε vs. (b) Anthracen (—), trans-Azobenzol(---), linear E vs. λ.
gefasst werden. f ist dimensionslos, und in der Zahl vor dem Integral sind nur Naturkonstanten zusammengefasst.
Wird nicht natürliches, sondern linear polarisiertes Licht, d. h. Licht, dessen elektrischer Feldvektor nur in einer, der Polarisationsebene, schwingt, für die Absorptions- oder Emissionsspektroskopie eingesetzt, so kann man unter Ausrichtung der Moleküle der Probe relativ zur Polarisationsrichtung des Lichts (Fixierung des molekularen und äußeren Koordinatensystem gegeneinander) verschiedene Absorptionsintensitäten für verschiedene Polarisationsrichtungen beobachten (Abb. 1.2). Die dimensionslose Polarisation
Abb. 1.2 Absorption eines Cyaninfarbstoffes in Polyvinylalkohol-Folie (—). Bei Festlegung des molekularen und äußeren Koordinaten-system gegeneinander durch Streckung der Folie: lineare Polarisation des Lichts (---) parallel und (…) senkrecht zur Streckrichtung. Polarisation der längstwelligen Bande in Richtung der Längsachse, der kürzerwelligen senkrecht zur Längsachse.
wird dann durch die unterschiedliche Absorption eines linear polarisierten Lichtstrahls und des um 90° gedrehten Pendants gemessen. Bei linear polarisiertem Licht erhält man eine Information über die Richtung der Ladungsverschiebung im Molekül beim Elektronenübergang, die Polarisationsrichtung des Übergangs.
Bei Verwendung von zirkular polarisiertem Licht erhält man Information über eine Moleküleigenschaft namens Chiralität. Es wird eine Größe Circulardichroismus definiert, die molare Elliptizität, die die Differenz der Absorption von links- und rechtspolarisiertem Licht charakterisiert
mit der gebräuchlichen historisch bedingten Einheit grad cm2 dmol−1, [Θ] kann auch negativ sein. Der Graph [Θ] gegen Wellenlänge oder Wellenzahl ist das CD-Spektrum (Abb. 1.3). Auch hier gibt es, analog zur Oszillatorenstärke (1.3), eine Angabe über die CD-Intensität durch Integration über die CD-Bande: die Rota-torstärke
Abb. 1.3 Absorptions-(—) und CD-Spektren (…) eines chiralen Ru[methylbipyridyl]2+-Komplexes.
R hat die Dimension Debye ⋅ Bohr’sches Magneton (C2 m3 s−1), die Zahlen vor dem ersten Integral enthalten wieder nur Naturkonstanten.
Bei Emissionsspektren wird die Intensität der ausgesandten Strahlung ebenfalls in Abhängigkeit von Wellenlänge oder Wellenzahl dargestellt (Abb. 1.4). Die Emissionsintensität, Iem(λ) ist ein Ausdruck für die Zahl der ausgesandten Lichtquanten. Das gemessene Iem(λ) wird als Emissionsspektrum meist direkt (d. h. relativ zu einem bestimmten Wert, z. B. dem Wert des Maximums) aufgetragen. Es ist also, im Gegensatz zum Absorptionsspektrum, ein Graph von Quanten bzw. deren Energie gegen die Wellenlänge. Durch eine Zusatzmessung an einem Standardstoff kann man die integrierte relative Emissionsbande einer Probe auf die bekannte absolute des Standards beziehen, also wieder ein Verhältnis herstellen. Bezogen auf die Anregungsintensität ist dieses dann die dimensionslose Quantenausbeute Q. Bei der Emission ist auch die Lebensdauer τ des angeregten Zustandes eine wichtige Messgröße. Sie ist maximal, wenn die Emission die einzige Art der Deaktivierung des angeregten Zustands ist. Diese Lebensdauer wird die natürliche oder Strahlungslebensdauer τ0 genannt, sie hängt mit der Übergangswahrscheinlichkeit zum angeregten Zustand und damit mit der Absorptionsintensität zusammen:
Abb. 1.4 Absorptions- und Fluoreszenzspektrum von Benzol in Lösung. Man beachte die Spiegelbildsymmetrie.
Je intensiver die Absorptionsbande, d. h. je größer die Absorptionswahrscheinlichkeit, desto größer auch die Emissionswahrscheinlichkeit, desto kürzer also auch die Strahlungslebensdauer. Die gemessene Lebensdauer τ kann kleiner sein und sogar gegen null gehen, wenn andere Deaktivierungskanäle so effektiv sind, dass die Emission gelöscht wird. Die Lebensdauer hängt mit der Emissionsquantenausbeute zusammen:
In einigen Versuchsanordnungen wird auch die Intensität oder Winkelverteilung der Lichtstreuung gemessen, z. B. bei der Raman-Spektroskopie.
Die Spektren sind ein Abbild der Energielagen der Elektronenzustände im atomaren oder molekularen System. Atomspektren sind reine Elektronenspektren. Dagegen bestimmen im Molekül nicht nur die Elektronenbewegungen das Spektrum, sondern auch Schwingungen der Atome gegeneinander und Rotationen des Gesamtmoleküls, die alle ebenfalls als Zustände charakterisiert werden können. Mit geringer Erfahrung kann man auf den ersten Blick zwischen einem Atom- und einem Molekülspektrum unterscheiden: Das Atomspektrum ist ein Linienspektrum, das Molekülspektrum zeigt breitere Absorptions- oder Emissionsbanden (Abb. 1.5). Dies hat seinen Grund darin, dass ein einzelnes Atom keinen Partner hat, gegen den es schwingen kann und dass auch die Rotationen des Atoms nicht angeregt sind. Interessiert man sich nur für die Elektronen- plus Schwingungsbewegungen, so spricht man von vibronischen Zuständen, einer Kombination von Elektronen- und Schwingungsbewegungen. Mit ihnen werden wir uns hier beschäftigen.
Abb. 1.5 Termschemata und Spektren von Atomen und Molekülen (schematisch). Die Energieskala des eindimensionalen Termschemas ist die „y“-Achse, im Spektrum ist es die x-Achse.
Die Elektronen-, Schwingungs- und Rotationsbewegungen sind wenig gekop-pelt, sodass sie sich praktisch nicht beeinflussen. Das liegt daran, dass sich die in den Spektren manifeste Energie der drei Bewegungsarten um je ca. eine Zehner-potenz unterscheiden. Elektronen- und Schwingungsbewegungen können sich so, cum grano salis, unabhängig voneinander verändern. Die Kombination von Elektronen- und Schwingungsanregung ergibt die Banden im Absorptionsspektrum. Jedoch muss nicht bei jeder Absorption von Strahlung die Elektronen-bewegung beteiligt sein, auch reine Schwingungsanregungen sind möglich. Da dann der Elektronenübergang mit dem größten Energieanteil fehlt, liegen solche Anregungen im Infrarotbereich. Die verschiedenen Schwingungsübergänge im elektronischen Grundzustand ergeben das Infrarotspektrum. Bei genauer Analyse stellt man jedoch fest, dass die drei Bewegungsarten doch ein wenig gekoppelt sind. Die Kopplungsenergie kann als eine Störung berücksichtigt werden. Aus Störungen ergeben sich generell wichtige Informationen über das untersuchte System.
Die Informationen, die man aus den Absorptions- und Emissionsspektren erhält, sind also:
die Lage der Linie oder Bande,
die Intensität der Linie oder Bande,
die Form der Absorptionsbande,
die Polarisation der Linie oder Bande,
bei Emissionsspektren die Lebensdauer des angeregten Zustands,
bei Streuspektren die Wellenlängenabhängigkeit des Streulichts.
Es ist nun Aufgabe der Theorie der Spektroskopie, aus diesen experimentellen Informationen ein Bild der Energiezustände zu konstruieren. Die Energie der Zustände wird in einem eindimensionalen Diagramm, dem sogenannten Termschema aufgetragen, das in den Spektren gespiegelt ist. Dies ist in Abb. 1.5 schematisch gezeigt. Die Änderung ihrer Besetzung, d. h. die Übergänge zwischen den Zuständen, wird durch Pfeile angezeigt, wobei die Pfeillänge der Übergangsenergie entspricht. Die Übergänge unter Beteiligung von Strahlung (Absorption und Emission) werden durch gerade Pfeile, die strahlungslosen Übergänge durch geschlängelte Pfeile angezeigt (siehe auch Abb. 5.1). Denn Veränderungen der Elektronenbewegungen sind nicht nur in Wechselwirkung mit Licht möglich, es gibt auch strahlungslose Übergänge, z. B. die thermische Anregung des Natriumatoms in einer Flamme, die sich durch die Emission des angeregten Natriumatoms manifestiert, die die Flamme gelb färbt, oder die Umwandlung von absorbiertem Licht in Wärme, wie es die Erwärmung von Gegenständen im Sonnenlicht erfühlbar macht.
Die Spektren eines molekularen Systems können durch Veränderung der äußeren Bedingungen beeinflusst werden, z. B. durch das Lösungsmittel, durch andere Moleküle in der Probe, durch die Temperatur oder durch elektrische und magnetische Felder. Die Veränderung der Absorption und Emission und vor allem der Emissionslebensdauer unter diesen Einflüssen ist in den meisten Fällen das Ziel der Untersuchungen und gibt wertvolle Informationen über das jeweilige molekulare System.
1.2 Zusammenfassung
UV-VIS-Spektroskopie oder Elektronenspektroskopie nennt man die Messung, Auswertung und Deutung der Phänomene der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung des sichtbaren und ultravioletten Spektralbereichs mit Materie. Diese Wechselwirkung ist für das Probenmaterial charakteristisch.
In den Absorptionsspektren wird die Absorption von Licht durch die molekulare Probe in Abhängigkeit von dessen Wellenlänge oder Wellenzahl dargestellt. Bei Verwendung von linear polarisiertem Licht erhält man Informationen über die Richtungsabhängigkeit der molekularen Absorption, bei Verwendung von zirkular polarisiertem Licht Informationen über die Chiralität des Moleküls. In den Emissionsspektren wird die Intensität der vom angeregten Molekül ausgesandten Strahlung ebenfalls in Abhängigkeit von Wellenlänge oder Wellenzahl und Polarisation dargestellt. Angeregte Moleküle haben eine begrenzte Lebensdauer, es gibt eine Reihe von Prozessen, durch die ein angeregtes Molekül deaktiviert werden kann, ihr Anteil wird durch die jeweilige Quantenausbeute angegeben. Die Spektren eines molekularen Systems können durch Veränderung der äußeren Bedingungen beeinflusst werden, zum Beispiel durch das Lösungsmittel, durch andere Moleküle in der Probe, durch die Temperatur oder durch elektrische und magnetische Felder.
Die Spektren sind ein Abbild der Eigenschaften von Energiezuständen im atomaren oder molekularen System. Es ist Aufgabe der Theorie der Spektroskopie, aus diesen experimentellen Informationen ein Bild der Zustände und des Übergangs des Systems zwischen ihnen zu konstruieren.
1
Intensität ist allgemein eine Leistung, die durch eine Fläche tritt (Einheit: J m
−2
s
−1
). Die Lichtintensität ist mit der elektrischen Feldstärke der Lichtwelle durch verbunden, wobei
c
die Lichtgeschwindigkeit und
ε
0
die Dielektrizitätskonstante bedeutet. Die Intensität ist frequenzabhängig.
E
λ
bzw.
ε
λ
in (
1.2
) sind also Verteilungsfunktionen.
2
Die Einheit l mol
−1
cm
−1
stammt aus dem cgs-Maßsystem. Die Umrechnung ins SI-System ist 1l mol
−1
cm
−1
= 10
−1
m
2
mol
−1
. Die SI-Einheit wird praktisch nie verwendet. Auch die Einheit des Absorptionsquerschnitts
σ
(cm
2
) ist keine SI-Einheit.
Teil IZustände
2Der Zustandsraum
2.1 Materiewellen und Wellenfunktionen
2.1.1 Quantelung
Es ist eine Eigenheit von stabilen atomaren und molekularen Systemen, dass sie nur in ganz bestimmten Zuständen mit ganz bestimmter Energie und ganz bestimmten sonstigen Eigenschaften existieren. Zustände mit anderen Eigenschaften als sie einer dieser Zustände hat, gibt es nicht dauerhaft. Übergänge zwischen diesen Zuständen sind sprunghaft, die Energieänderungen haben ganz bestimmte Werte, Energie kann also nur in ganz bestimmten Mengen aufgenommen und abgegeben werden. Man spricht von einer Quantelung der Energie dieser Systeme, ihre deutlichste Manifestation sind die diskreten Absorptions- und Emissionsspektren. Aber auch die anderen Eigenschaften, z. B. der Drehimpuls des atomaren Systems, ändern sich sprunghaft. Dies folgt zwingend aus den Experimenten.
Die Quantelung wird zwar am deutlichsten im Austausch von Energie in diesen Systemen, es gibt jedoch in der Translationsenergie auch eine kontinuierlich veränderliche Energie mikroskopischer Systeme. Jede beliebige Geschwindigkeit eines Elektrons, Atoms oder Moleküls ist prinzipiell möglich, solange sich das System frei bewegen kann und sich nicht in einem beschränkten Raum befindet. Ein Elektron in einem Elektronenstrahl kann je nach durchlaufener Beschleunigungsspannung jede kinetische Energie annehmen, ein Elektron, das sich im eingeschränkten Raum eines Metallkristalls bewegt, unterliegt Quantenbedingungen (Energiebänder).
Denn eigentlich ist die Wirkung, Energie mal Zeit, die gequantelte Größe, die nur in Vielfachen des Planck’schen Wirkungsquantums h = 6,626 ⋅ 10−34 Js auftritt. Bei stationären Systemen spielt die Zeit keine Rolle, deshalb ist hier auch die Energie gequantelt.
In der klassischen Physik beobachtet man meist keine Quantelung, die meisten klassischen Systeme können Energie in beliebigen Portionen austauschen, z. B. kann ein Kreisel kontinuierlich beschleunigt werden. Dieses Quantenverhalten unterscheidet mikroskopische (gequantelte) und makroskopische (klassische) Systeme. Es gibt aber auch in der klassischen Physik Systeme, die sich wie Quantensysteme verhalten: schwingfähige Systeme endlicher Ausdehnung, sogenannte Oszillatoren. Auf diesen können sich stehenden Wellen oder Schwingungen mit ganz bestimmten Eigen- oder Resonanzfrequenzen ausbilden, die durch die Geometrie des Oszillators bestimmt sind: Eine Saite bestimmter Länge kann nur bestimmte Töne und deren Obertöne erzeugen, ebenso eine Membran oder eine Orgelpfeife. Diese Anschaulichkeit der klassischen Oszillatorensysteme werden wir uns für das Verständnis der Quantelung der atomaren und molekularen Systeme zunutze machen, indem wir sie auf die der klassischen Physik fremde „Materiewelle“ anwenden.
Wenn man Mikroteilchen, die durch eine sehr kleine Masse gekennzeichnet sind (Elektron 9,109 ⋅ 10−31 kg, Wasserstoffatom 1,6722 ⋅ 10−27 kg), neben Teilcheneigenschaften auch Welleneigenschaften zuschreiben kann, dann findet man einen zwanglosen Zugang zu den Quantenbedingungen. Diese Denkfigur kann tatsächlich verwendet werden, dies ist experimentell gesichert. Man kann mit Teilchenstrahlen Interferenzerscheinungen feststellen, ein eindeutiger Beweis für ein Wellenverhalten. Umgekehrt kann man auch der Strahlung als Wellenerscheinung korpuskulare Eigenschaften zuschreiben: Licht kann sich in Wechselwirkung mit Materie auch als Teilchen, Photon, manifestieren. Beide Bilder sind gleichberechtigt, sie werden je nach Bedarf benutzt. Oft verwendet man eine Sprache, die Begriffe aus Wellen- und Teilchenbereich mischt, z. B. „die Wellenlänge eines Photons“ oder „die Polarisation eines Photons“.
Ein Mikroteilchen ist kein klassisches Teilchen, wie wir es aus unserer Lebensumgebung kennen. Die konstituierenden Eigenschaften eines Teilchens sind die gleichzeitige Lokalisierbarkeit des Teilchens im Volumenelement Δx Δy Δz und Bestimmung seiner Bewegungsgröße Geschwindigkeit oder Impuls Δpx Δpy Δpz. Diese sind im klassischen Fall exakt bestimmbar, d. h., die Δ-Größen gehen gegen null. Die Einschränkung der Teilcheneigenschaften bei Mikroteilchen wird durch die Heisenberg’sche Unschärferelation angegeben: Bei Mikroteilchen sind Ort und Impuls nicht mehr gleichzeitig exakt messbar, sondern nur bis auf eine „Unschärfe“:
Mikroteilchen können sich durchaus wie Teilchen mit einem Impuls p verhalten, das zeigen Stoßexperimente. Sie können sich aber auch wie Wellen mit einer Wellenlänge λ und einer Frequenz ν verhalten, das zeigen Interferenzerscheinungen wie Elektronenbeugungsaufnahmen an Kristallen. Wenn die Mikroteilchen Teilchen- und Welleneigenschaften zeigen, dann muss zwischen diesen ein Zusammenhang bestehen.
Diesen gibt die De Broglie’sche Formel λ = h/p: Die Wellenlänge der Materie-wellen hängt mit dem Teilchenimpuls zusammen. Die Interferenzerscheinungen können z. B. durch die Beschleunigung der Elektronen in einem Strahl beeinflusst werden, je schneller die Elektronen, desto kleiner die Materiewellenlänge.
Dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus ist ein konzeptionelles Problem, das allerdings nur darin besteht, dass wir aus der klassischen Physik wissen, was ein Teilchen und was eine Welle ist, und dass die beiden etwas Verschiedenes sind. Klassisch ist das richtig, ein Teilchen ist ein Stück Materie, eine Welle ist eine Bewegungsart. Im Mikroteilchenbereich gibt es aber etwas, was je nach den Bedingungen den Begriffen Teilchen oder Welle entspricht. Da uns ein übergeordneter Begriff fehlt, müssen wir an den Begriffen Teilchen und Materiewelle festhalten und sie der Situation entsprechend benutzen, was nach einiger Gewöhnung nicht schwer fällt.
Mit der Vorstellung der Materiewelle und die räumliche Beschränkung des Elektrons auf ein atomares oder molekulares System können wir, cum grano salis, die Erkenntnisse über klassische Oszillatoren, z. B. die Dichteschwingungen der Luft in einer Orgelpfeife, auf die Mikrosysteme übertragen. Der stationäre Zustand eines molekularen Systems wird durch stehende Wellen des Elektrons im eingeschränkten Raum des atomaren oder molekularen Systems bestimmt. Dadurch wird die Verteilung der Bindungselektronen, gewissermaßen eine Raumladung zwischen den Kernen, festgelegt. Nach den Quantenbedingungen sind nur ganz bestimmte Raumladungsverteilungen des Elektrons zu erwarten, die wie die Töne bei den Orgelpfeifen in bestimmter Beziehung zueinander stehen, vor allem definierte Energieunterschiede aufweisen.
Aber nicht nur die Elektronenzustände, sondern auch die Schwingungen der Kernbausteine gegeneinander, die Rotation des gesamten Moleküls, die Polarisation aller Kerne etc. zeigen die Quanteneigenschaften. Alle diese Eigenschaften können ebenfalls als Eigenschaften stationärer Schwingungszustände oder-moden im Gesamtsystem angesehen werden und nur ganz bestimmte Werte annehmen. Glücklicherweise sind, wie erwähnt, die Energien der Elektronenverteilung, der Schwingung, der Rotation oder der Kernpolarisation stark verschieden und diese verschiedenen Bewegungsarten wenig gekoppelt. Deshalb kann man sie praktisch getrennt beobachten: Es liegen die Elektronenspektren im UV/VIS-Bereich, die Schwingungsspektren im infraroten Bereich, die Rotationen im Mikrowellen-, die Kernpolarisationen im Radiowellenbereich. Es können jedoch mit geeigneter Strahlungsenergie verschiedene dieser Bewegungsarten unabhängig simultan angeregt werden, z. B. Elektronen- und Schwingungszustände, wie bereits bei der Besprechung der Spektrenformen beschrieben.
Für die Elektronen in einem atomaren oder molekularen System ist die weitere Quanteneigenschaft, der Spin, wichtig, der eine relativistische Erscheinung ist. Er hat in der klassischen Physik keine Entsprechung, aber er beeinflusst die räumliche Verteilung der Elektronen.
2.1.2 Die elektronische Ψ-Funktion
In diesen Vorlesungen stehen die Elektronenspektren im Mittelpunkt. Jeder Zustand hat eine eigene Elektronenverteilung. Man beschreibt den einzelnen gequantelten Zustand i durch eine mathematische Funktion, die kennzeichnende Ψi-Funktion, eine Funktion, die eine räumliche und eine zeitliche Komponente hat. Diese Ψ-Funktion ist eine fantastische Funktion, aus der alle messbaren Informationen über den Elektronenzustand i abgeleitet werden können. Was aber ist diese fantastische Funktion? Sie kann nicht einfach die Energiefunktion oder die Drehimpulsfunktion sein, da sie gleichzeitig sowohl die Information über die Energie und den Drehimpuls enthält und außerdem (mathematisch) komplex sein kann. Diese Funktion repräsentiert keine physikalische Welle, obwohl sie eine Wellenfunktion ist, sie beschreibt die möglichen Zustände des Systems und hat Wahrscheinlichkeitscharakter. Sie hängt im allgemeinen Fall von den Raumkoordinaten (Ortsfunktion) und der Zeit ab.
Nicht nur die Elektronensysteme, auch die Schwingungen und Rotationen können durch solche Funktionen charakterisiert werden. Wir wählen
φ
,
Φ
,
Ξ
,
Δ
für Elektronenfunktionen,
X,
χ
,
ν
für Schwingungsfunktionen,
ρ
für Rotationsfunktionen (spielen hier allerdings keine Rolle),
σ
=
α
oder
β
für die Spinfunktionen,
Θ
=
Φ
⋅
χ
für vibronische Funktionen,
Ω
=
Θ
⋅
σ
für die Spin-Bahn-Funktion,
Ψ
und
ψ
für zeitabhängige und zeitunabhängige Gesamtfunktionen
und
dann, wenn wir allgemein von Wellenfunktionen reden.
Zwei Fragen drängen sich auf:
Wie kann eine solche, keine physikalische Größe darstellende Funktion diese zentrale Bedeutung haben?
Wie bekommt man aus dieser Funktion die physikalischen Eigenschaften?
Damit wir diese Frage angehen können, müssen wir uns zunächst mit der Ψ-Funktion selbst beschäftigen.
2.1.2.1 Der Zugang zur Ψ-Funktion
Wellenerscheinungen sind periodisch in Raum und Zeit. Sie werden in der klassischen Physik durch die allgemeine Schwingungsgleichung beschrieben:
c′ ist die Phasengeschwindigkeit der Ausbreitung der Welle. Mit k, dem Wellenvektor 1/λ, und ν, der Frequenz, ist die Lösung der Gleichung u = A ⋅ e2πi(kr−vt). Dabei ist u die schwingende physikalische Größe, z. B. der elektrische Feldvektor einer elektromagnetischen Welle oder die Aufwölbung der Oberfläche unter der Wirkung einer Oberflächenwelle. Durch diese allgemeine Formel ist das Charakteristische der Schwingung als eine Bewegungsart beschrieben, die z. B. eine elektromagnetische oder eine mechanische sein kann. Über die Art von u, die Größe von c′ und über die geometrischen Bedingungen wird der spezielle Fall erfasst.
Werden frei fliegende Mikroteilchen als Materiewellen aufgefasst, so gibt es auch für sie eine allgemeine Schwingungsgleichung, die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung: Diese axiomatische Gleichung wurde von Erwin Schrödinger 1926 aus allgemeinen Überlegungen zum nicht relativistischen Quantenproblem aufgestellt:
Ψ ist die Wellenfunktion, genauer die Amplitude der den Elektronen, dem Proton etc. zugeordneten Materiewelle, m die Teilchenmasse. Die Ψ-Funktion ist, wie erwähnt, keine physikalische, also keine mechanische oder elektrische Welle und ist selbst nicht messbar. Sie beschreibt jedoch die möglichen Zustände des Systems.
Die Analogie der beiden Gleichungen 2.2 und 2.3 ist unverkennbar, die Schrödinger-Gleichung unterscheidet sich jedoch vor allem darin von der klassischen allgemeinen Schwingungsformel, dass in ihr die 1. Ableitung nach der Zeit steht, in der klassischen Schwingungsformel die 2. Ableitung. Dies korrespondiert mit einem wesentlichen Unterschied von klassischen und Materiewellen: Den Materiewellen sind Teilchen mit Ruhemasse zugeordnet, dagegen gehorchen Teilchen, die keine Ruhemasse haben, der klassischen Gleichung. Eine Oberflächenwelle oder ein Ton sind nicht existent, wenn sie sich nicht ausbreiten. Auch Photonen haben keine Ruhemasse: Eine Lichtwelle, die sich nicht ausbreitet, deren Photonen sich nicht bewegen, kann es nicht geben.
Die Schrödinger-Gleichung in der Form von (2.3) enthält eine Zeitabhängigkeit und scheint sich für die Beschreibung von stationären Zuständen nicht zu eignen. Wellensysteme können aber doch stationär sein, nämlich dann, wenn sie auf einen bestimmten Raum beschränkt sind und darin stehende Wellen ausbilden, man denke wieder an die Resonanzschwingung einer Saite bestimmter Länge. Aber auch dann hat der Zustand noch eine zeitliche Komponente: Stehende Wellen können je nach System, auf dem sie sich ausbilden, verschiedene räumliche Erscheinungen darstellen, aber die zeitliche Funktion ist immer die einer harmonischen Schwingung und durch Sinus- oder Kosinusfunktionen oder (nach der Euler’schen Formel) durch Exponentialfunktionen mit imaginärem Exponenten zu beschreiben. Stehende Materiewellen können also wie klassische durch das Produkt einer räumlichen und einer zeitlichen Funktion beschrieben werden:
Da die Frequenz ein Energiemaß bei Wellen ist, scheint die Energie des stationären Zustands, den Ψ beschreibt, allein durch die Zeitfunktion gegeben zu sein.
Die Ψ-Funktion wurde als die Amplitude der Materiewelle bezeichnet, deren Gestalt bei einer stationären Materiewelle durch den nur noch ortsabhängigen Teil ψ beschrieben wird. Dieser behält seine Form bei, ändert aber seinen Wert mit der Zeit, kehrt also periodisch mit der Frequenz in der e-Funktion sein Vorzeichen um. Andererseits wurde in der Einleitung die Ψ-Funktion als eine fantastische Funktion bezeichnet, die alle Information über die Eigenschaften eines Zustands enthalte. Wie ist das alles zu verstehen?
Wenn die Ψ-Funktion alle Eigenschaften eines Zustands enthalten soll, also sowohl die Ladungsverteilung im Atomzustand als auch die Energie und den Drehimpuls, dann kann sie selbst nicht eine solche Eigenschaft direkt darstellen, sie ist eben keine physikalische Welle. Die einzelnen Eigenschaften müssen durch eine „Anfrage“ an die Ψ-Funktion gewonnen werden. Diese Anfragen werden durch sogenannte Operatoren realisiert1): Man wendet den Energieoperator, den Drehimpulsoperator, oder den Dipoloperator auf die Ψ-Funktion an, um die Energie, den Drehimpuls oder das Dipolmoment zu gewinnen (wie das im Einzelnen geschieht, werden wir später sehen).
Ein ähnliches Problem kennen wir aus dem täglichen Leben, natürlich cum grano salis. Ein Mensch wird durch seinen Namen charakterisiert. Durch diesen Namen sind alle seine Eigenschaften festgelegt. Da gibt es solche, die ohne Weiteres messbar sind wie die Größe oder das Gewicht. Menschen haben aber auch abstrakte Eigenschaften, z. B. Ehrlichkeit. Wie kann man diese feststellen und vielleicht gar messen? Direkt kann sie nicht gemessen werden. Trotzdem gibt es auch für die Ehrlichkeit ein Maß. Man muss den Menschen genügend oft in Situationen bringen, in denen er die Ehrlichkeit zeigen muss, also ihn seine Steuererklärung erstellen lassen oder ihn zu einem peinlichen Sachverhalt befragen. Mit diesen Operationen können Sie die Ehrlichkeit schließlich statistisch abschätzen. Oder, um den Lernerfolg einer Unterrichtseinheit festzustellen, muss der Lernende in eine Situation gebracht werden, in der er seine Fortschritte zeigen kann. Die Pädagogen sprechen von der Operationalisierung von Lernzielen, der Lernerfolg kann gemessen werden, z. B. bei Tests. Dieses Beispiel beleuchtet einen anderen Aspekt dieser Operationalisierung: Bei zwei Tests desselben Studenten können die Ergebnisse differieren, erst bei vielen Tests erhält man eine verlässliche Information, die als Erwartungswert bezeichnet wird. Wenn ein Mensch absolut ehrlich ist, erhält man bei jeder Operationalisierung denselben Wert, wenn der Student im Zustand der Allwissenheit ist, erhält er bei jedem Test die maximale Punktzahl: Der Erwartungswert ist scharf.
Die Verwendung von Operatoren ist auch nicht auf die Quantenphysik beschränkt. Ein Beispiel aus der klassischen Physik ist die Bestimmung der elektrischen und magnetischen Feldvektoren E und H der elektromagnetischen Welle aus dem Vektorpotenzial A durch
mit den Operatoren rot und −(∂/∂t). Dabei steht A gewissermaßen hinter den Feldstärken und enthält die Information über beide, beschreibt also beide gleichzeitig mit. Dies ist analog zum Informationsgehalt der Ψ-Funktion.
Die große Frage ist nun: Wie bekommt man diese fantastische Wellenfunktion?
Dazu kehren wir zur Schrödinger-Gleichung zurück für ein System, in dem im Gegensatz zum frei fliegenden Teilchen auch ein zeitlich konstantes Potenzial V (x, y, z) eine Rolle spielt, also z. B. bei dem Elektron im sphärischen Potenzial eines Wasserstoffatomkerns oder bei einem beweglichen Elektron im Potenzial eines Kristalls, der als dreidimensionaler Potenzialkasten angesehen werden kann. Damit ist das Elektron eingesperrt, die Randbedingungen sorgen dafür, dass sich stehende Wellen ausbilden können. Gleichung 2.3 muss um das Potenzial erweitert werden zu:
Es ist verständlich, dass die Lösung dieser Gleichung eine andere Ψ-Funktion ergeben muss als die von (2.3). Die Funktion Ψ ist für stehende Wellen nach (2.4) anzusetzen. Damit lässt sich die Zeit- und Ortsabhängigkeit separieren, die Separationskonstante ergibt die Gesamtenergie E:
Wenn wir diese Gleichung als Anfrage an die Ψ-Funktion in Bezug auf die Energie verstehen wollen, so können wir (−h/(2πi)) ⋅ ∂/∂t als einen Energieoperator ansehen, der nur auf die Zeitkoordinate wirkt und der uns aus der Ψ-Funktion einen Frequenz- bzw. Energiewert liefert.
Wenn (2.4) und (2.6) in (2.5) eingesetzt werden, dann kann man mit e2πiνt dividieren und erhält die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung:
oft geschrieben als:
Die Schrödinger-Gleichung (2.7) verbindet also für stationäre Materiewellensysteme nicht nur die Zeitfunktion, sondern auch die Ortsfunktion mit der Energie des stationären Zustands. Und mit (2.7) haben wir einen Operator, den man auf die Ortsfunktion anwenden muss, um die Energie des Zustands, der durch diese Funktion beschrieben wird, aus der Funktion zu erhalten:
wobei V(x, y, z) als multiplikativer Operator das Potenzialfeld beschreibt. Dieser Operator, der nur auf die Ortskoordinaten wirkt, ist ebenfalls ein Energieoperator, er wird Hamilton-Operator genannt und mit Ĥ bezeichnet. Der Differenzialteil wird oft mit Δ bezeichnet, sodass
Die Gleichung (2.8) ist verwandt mit der Gleichung für die Gesamtenergie eines klassischen Teilchens in der Hamilton’schen Formulierung (deshalb der Name Hamilton-Operator, engl. Hamiltonian):
Und tatsächlich sind die Operatoren der Quantenphysik ableitbar aus den Gleichungen der klassischen Physik für Ort, Impuls und Energie. Man setzt:
Tab. 2.1 Größen der klassischen und Operatoren der Quantenphysik
Klassische Größe
Operator
x, y, z
Ort
x·, y·, z·
multiplikativer Operator
P
x
,
P
y
,
P
z
Impuls
Differenzialoperator
E
Gesamtenergie
oder
Differenzialoperator
Differenzial- und multiplikativer Operator
L
x
=
yp
z
−
zp
y
L
y
·L
z
Drehimpuls
Differenzialoperator
Die Operatoren sind dimensionsbehaftet und haben die Dimensionen ihrer klassischen Analoga.
Mithilfe des Hamilton-Operators kann die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung in einer Art Kurzform geschrieben werden:
Damit diese einfache Form möglich und physikalisch sinnvoll ist, sind einige mathematische Anforderungen an die Wellenfunktion und den Operator zu stellen:
Die Wellenfunktion muss im ganzen Raum endlich, eindeutig und stetig (differenzierbar) sein. Dies sind Eigenschaften, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion hat. Tatsächlich kann man das Produkt
als die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des der Materiewelle zugeordneten Teilchens im Volumenelement
d
x
d
y
d
z interpretieren
.
Die Wellenfunktion wird
normiert
, sodass oder, wenn man wie üblich, das Tripel
x
,
y
,
z
durch
τ
ersetzt:
Auch dies ist durch die Wahrscheinlichkeitseigenschaft begründet: Das Teilchen muss sich irgendwo im Raum aufhalten. Der Normierungsfaktor N muss so gewählt werden, dass die Normierungsbedingung erfüllt ist.
Weil aus der
ψ
-Funktion eine physikalische und damit reelle Größe gewonnen werden soll, muss der Operator die mathematische Forderung
erfüllen, er muss selbstadjungiert oder hermitesch sein. Hermite’sche Operatoren haben nur reelle Erwartungs- und Eigenwerte.
Die Eigenfunktionen von hermiteschen Operatoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal zueinander:
Energie- und Impulsoperatoren haben diese Eigenschaften.
Dann kann man den
Erwartungswert
(aus vielen Messungen) einer beobacht-baren Variablen
P
durch ihren Operator in folgender Weise aus der
Ψ
-Funktion erhalten:
Der Erwartungswert ist dann ein scharfer Wert, wenn die Funktion ψ ein Eigenwert des Operators ist (siehe Abschn. 2.2.1): Der Erwartungswert der Energie eines stationären Elektronenzustands ist scharf, er kann durch eine einzige Messung ermittelt werden.
Nur wenn die ψ-Funktion diese mathematischen Eigenschaften hat, ist sie geeignet zur Beschreibung der physikalischen Tatsachen. Auffällig ist, dass in diesem Anforderungsprofil für die ψ-Funktion immer eine quadratische Form vorkommt. Dies hat seinen Grund darin, dass die ψ-Funktion selbst eben keine physikalische Größe darstellt, dass sie sogar mathematisch komplex oder imaginär sein kann. Das Quadrat einer komplexen Größe ist das Produkt dieser Größe (z. B. ψ) mit ihrer konjugiert komplexen (ψ*), und es ist immer reell und stellt damit eine prinzipiell messbare Größe dar.
2.2 Zustände
2.2.1 Die Lösungen der Schrödinger-Gleichung
Gleichung 2.7 kann auch in die meist übliche Form
gebracht werden. Diese Form ist deshalb so interessant, weil Gleichungen wie diese in der Mathematik bekannt sind. Sie lassen sich nämlich nur für bestimmte (reelle) Energiewerte E lösen. Es gibt also nur Paare von Eigenwerten E und Eigenfunktionen ψ, für die die Gleichung gilt. Wählt man zu einer ψ-Funktion einen anderen Energiewert, so ist die Gleichung nicht erfüllt. Man bekommt also aus der Energiegleichung die Energieeigenwerte und die zugehörigen Eigenfunktionen gleichzeitig. Der Energieoperator ist hermitesch, d. h., die Eigenwerte sind reell und die Eigenfunktionen zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal zueinander. Die Gleichung beschreibt damit, wie verlangt, das physikalische Phänomen der Quantelung.
Wenn die Schrödinger-Gleichung (2.11) gelöst werden kann, erhalten wir viele Paare von Energiewerten und Eigenfunktionen. Die Gleichung lässt sich tatsächlich in einigen Fällen exakt lösen. Es sind dies die Fälle der Ein-Elektronen-Systeme, des Wasserstoffatoms, der Atomionen wie He+ oder Be2+ etc. und des Wasserstoffmolekülions . Dies hat seinen Grund darin, dass es bei diesen Problemen für das PotenzialV angepasste Koordinatensysteme gibt und die Ein-Elektronen-Funktionen durch drei unabhängige stehende Wellen in die Koordinatenrichtungen zusammengesetzt werden können.2) Die Kombination von Wellen, die sich gleichzeitig und unabhängig ausbilden, wird in Übereinstimmung mit dem Wahrscheinlichkeitscharakter der Wellenfunktionen durch einen Produktansatz für die Gesamtwellenfunktion realisiert, in gleicher Weise wie oben die Orts- und Zeitabhängigkeit für stehende Wellen angesetzt wurde. Damit kann auch die Ortsfunktion in drei Teilfunktionen separiert werden, analog zur Trennung der Orts- und Zeitfunktion. Für das zentralsymmetrische Wasserstoffatom erstrecken sich diese drei Wellen in radialer, Nord-Süd- und circumferentialer Richtung (dem Äquator entlang):
Die Schrödinger-Gleichung kann mit diesem Ansatz in drei Gleichungen separiert und für das Wasserstoffatom mit dem Potenzial einer Ladung im Radialfeld V = −e2/4πε0r exakt gelöst werden.
Abb. 2.1 Die energieärmsten Orbitale (s, p, d) des Wasserstoffatoms.
Die Lösungen für das Wasserstoffatom sind bekannt (Abb. 2.1). Sie werden durch die Quantenzahlen Hauptquantenzahl n (n = 1, 2, …, ∞), Nebenquantenzahl l (l = 0,1, 2…, n − 1) und magnetische Quantenzahl m (m = 0, ±1, …, 2l + 1) gekennzeichnet und können durch Konturlinien bildlich dargestellt werden. Die Formen der Konturen werden durch die Neben- und magnetischen Quantenzahlen bestimmt. Man nennt diese Darstellungen und oft die Zustände selbst Orbitale. Negative und positive Vorzeichen im Bereich der Ortsfunktionen geben eine Phasenbeziehung zwischen diesen Bereichen an, sie wechseln nach einer Schwingungsperiode. Die Frequenz dieses Vorzeichenwechsels ist von der Energie des Zustands abhängig, die beim Wasserstoffatom ihrerseits nur von der Hauptquantenzahl n abhängt. Alle Eigenfunktionen zur gleichen Hauptquantenzahl gehören zum gleichen Energiewert, man sagt, diese Funktionen seien entartet. Oft wird auch ψ*ψ, die Elektronendichteverteilung, dargestellt. Dann enthält der Raum innerhalb der Konturlinien einen hohen Anteil der gesamten Elektronendichte, meist 95 %. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Wellenfunktionen exponentiell nach außen abfallen und damit die Elektronendichte innerhalb der Konturlinien nicht konstant ist und auch außerhalb der Konturlinien einen bestimmten Wert hat. Dies ist wichtig, wenn Wechselwirkungen mit anderen Atomen zu beachten sind.
Die Orbitale in Abb. 2.1 sind errechnet. Ihre Quadrate entsprechen möglichen Ladungsverteilungen verschiedener Energie im Kernfeld, es sind unendlich viele, die z. B. beim Wasserstoffatom durch die drei Quantenzahlen charakterisiert sind. Die tatsächliche Energie des Systems wird dadurch bestimmt, welche von den möglichen Ladungsverteilungen ein Elektron annimmt. Man sagt dann, ein Orbital sei besetzt. Bei Mehr-Elektronen-Systemen ist die Gesamtenergie dadurch bestimmt, wie sich die Elektronen auf die Orbitale verteilen. Näherungsweise kann die Gesamtladungsverteilung durch eine Überlagerung der Ladungsverteilung der Elektronen in den besetzten Ein-Elektronen-Orbitalen dargestellt werden, und näherungsweise kann man die Gesamtenergie als Summe der Energien der besetzen Ein-Elektronen-Orbitale darstellen. Je mehr Elektronen zu berücksichtigen sind, desto schlechter ist diese Näherung, weil die Elektronen nicht nur das Feld des Kerns „sehen“, sondern die Elektronenwechselwirkung einen beträchtlichen Teil zur Gesamtenergie beisteuert und das Potenzial um den Term ∑i, je2/4πε0rij vervollständigt werden muss. In Molekülen muss der Hamilton-Operator neben der kinetischen Energie der i Elektronen sowohl die anziehende Wechselwirkung aller Elektronen i mit allen (eventuell verschieden geladenen (zeffaα)) Kernen α als auch die Abstoßungsenergie aller Elektronen i und j untereinander enthalten:
Ĥi ist der sogenannte Ein-Elektronen-Operator.
Weil der Energieoperator hermitesch ist, erhält man bei der Lösung eine Reihe von orthogonalen und normierten Eigenfunktionen ψi, die Zuständen steigender Energie Ei entsprechen. Auch für Moleküle (viele Elektronen) hat die Schrödinger-Gleichung orthonormale Lösungen, nur kann die Gleichung wegen des Wechselwirkungsgliedes nicht mehr exakt gelöst werden. Die Gesamtheit dieser Eigenfunktionen bildet für das jeweilige System ein Orthogonalsystem mit den Eigenschaften eines vollständigen Satzes.
Es wird hier sehr stark mathematisch argumentiert. Zur Erinnerung: Dies ist im Sinne des oben erwähnten mathematischen Modells, das experimentell bestätigt ist. Dennoch muss man sich des Beschreibungscharakters des Modells bewusst sein, wenn man z. B. sagt, aus der Form der Schrödinger-Gleichung resultiere die Quantelung. Dies sagt nichts anderes als dass diese Mathematik zur Beschreibung geeignet ist.
2.2.2 Der vollständige Zustandsraum
Aus der Schrödinger-Gleichung bekommt man im optimalen Fall alle exakten Energien und Eigenfunktionen der stationären Zustände. Die Eigenfunktionen sind normiert oder normierbar und orthogonal. Die Eigenschaften dieses vollständigen Orthogonalsystems der Eigenfunktionen sind hilfreich bei der Beschreibung des Zustands eines molekularen Systems. Denn die Eigenfunktionen spannen den Zustandsraum des Systems auf.
In dieser Betrachtungsweise haben die Eigenfunktionen die dieselbe Eigenschaften wie Koordinaten. Man kann es am besten am Beispiel der räumlichen Koordinaten verstehen. Die drei Einheitsvektoren in x-, y- und z-Richtung i, j, k bilden einen vollständigen Basissatz. Sie sind orthogonal zueinander, denn das Skalarprodukt je zweier dieser Vektoren ist null. Es gibt keinen weiteren Vektor im Raum, der zu diesen dreien orthogonal ist. i, j, k spannen unseren erlebten Raum auf, in dem es keinen Vektor gibt, der nicht durch eine Linearkombination, eine gewichtete Summe aus diesen drei Vektoren, dargestellt werden könnte:
Abb. 2.2 Der dreidimensionale Raum: (a) Koordinatensystem für einen Punkt; (b) gedrehtes Koordinatensystem.
Es gibt für uns dreidimensionalen Wesen kein Entkommen aus diesem Raum.
Die Angabe kartesischer Koordinaten x, y, z für einen Punkt (Abb. 2.2a) ist aber nicht die einzige Art, die Lage des Punkts im Raum zu beschreiben. Koordinatensysteme können gedreht (Abb. 2.2b





























