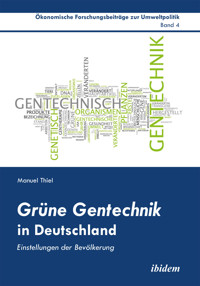
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ökonomische Forschungsbeiträge zur Umweltpolitik
- Sprache: Deutsch
Kaum ein anderes Thema bewegt seit Jahren die öffentliche und fachwissenschaftliche Diskussion gleichermaßen und polarisiert dabei so stark wie die 'Grüne Gentechnik'. Die um ihren Nutzen und Schaden entbrannten Debatten erfassen verschiedene wissenschaftliche Fachdisziplinen, die Politik, Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen, die Kirche und die Medien ebenso, wie sie die Bevölkerung mit ihren Vorstellungen über die Beschaffenheit der Natur und der Lebensmittelerzeugung betreffen. Dabei haben sich die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Grünen Gentechnik über die Jahre verhärtet, und es ist ein ideologischer Streit entbrannt, der auch vor der Wissenschaft nicht Halt gemacht hat. Die Auseinandersetzungen und auch die Berichterstattung sind vorwiegend geprägt von undifferenzierten Betrachtungen und einer emotionalen Aufladung des Themas. Für die Bevölkerung stellt sich vor allem die Frage, wem man überhaupt glauben oder vertrauen kann. In diesem Spannungsfeld gibt Manuel Thiels Buch einen wertvollen Überblick über die Vielseitigkeit und Komplexität des Themas Grüne Gentechnik, liefert Fakten für ein besseres Verständnis des Themas und schärft gleichzeitig den Blick dafür, dass eine ernsthafte, differenzierte Auseinandersetzung keinesfalls in simplen Schwarz-Weiß-Kategorien enden kann. Nicht zuletzt durch die gründliche thematische Aufarbeitung hilft es auch jenseits des Fachpublikums dabei, sich im Spannungsfeld Grüner Gentechnik zu orientieren und Kontroversen besser zu verstehen. Insgesamt besticht das Buch vor allem durch seine systematische Strukturierung und klare, schnörkellose Darstellung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
„Wir würden viel weniger Streit in der Welt haben, nähme man die Worte für das, was sie sind – lediglich die Zeichen unserer Ideen und nicht die Dinge selbst.“
Danksagung
Wennletztlich das Schreiben einer Dissertation eine recht einsame Arbeit ist, so kann diese aber ohneBegleitungundUnterstützungkaum erfolgreich sein.Demgemäß haben viele Personen zum Gelingenund erfolgreichen Endedieser Arbeit beigetragen.An erster Stelle gilt der Dank meinen Betreuern Prof. Dr. Steffen Kühnel, Prof. Dr. Rainer Marggraf undJun.-Prof. Dr.Ulf Liebe. Sie habenauf vielfältigeWeisemit wertvollen Ratschlägen und steter Diskussionsbereitschaftwesentlichzum EntstehendieserArbeitbeigetragen. Ich verdanke Ihnengroßzügige Freiräume, in denenPlatz für eigene Ideen war,aber auch viele Denkanstöße, diemeinen Blick stetig erweitert haben.Daneben bin ich meinen KollegInnender Abteilung Umwelt- und Ressourcenökonomikzu großem Dank verpflichtet. Ohne den Austausch, dievielenspannenden Diskussionen undHilfestellungen bei den kleinen und größeren Problemen im Laufe der Dissertationszeit wäremir viel entgangen.Ich hatte das Glück, mehrere„Generationen“von DoktorandInnen kennen zu lernen, sie alle namentlich aufzuführen wärejedochzu weit reichend.Aber auch all denUngenannten giltmein Dank.Besonderserwähnenmöchte ichKatharina Raupach undJörg Cortekar, mit denen ich das Vergnügen hatte, im Laufe der Jahre ein Büro zu teilen, was mich sehr bereichert hat. Ebenso hervorzuheben sind Christine Niens und Kristin Schröder, ohne dieich sicherhäufiger verzweifelt wäre. Christine Schwenkner (vormals Schnorrer)sei an dieser Stellegleichsamfür allesgedankt wie Antje Wagener, die mich immer fröhlich zu stimmen gewussthat.
Zudemgilt dem gesamten Team derGöttinger Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften,insbesondere aber Dr. Bettina Roß, meinbesondererDank für ihre Unterstützung und ihr Verständnis beim Beenden dieser Arbeit.Darüberhinaus danke ichbesondersHenning Hotopp, Heinrich Hasselmann und Leif Heimfarthdafür, dasssieneben ermutigenden Gesprächen auchdafür Sorge getragen haben, dassder Ausgleich zur Schreibarbeitnicht zu kurz kam.DankseiaußerdemgerichtetandasBundesministerium für Bildung und Forschung, das innerhalb der Sozial-ökologischen Forschung große Teile der Arbeit im Rahmen desinterdisziplinärenProjektesGeneRisk(FKZ:07VPS14-F) ermöglicht hat sowieanalle TeilnehmerInnender Befragung.
Tiefer Dank gebührtmeinen Eltern, die nie gefordert, mich gleichwohl aber immer gefördert und unterstützt habenund denen ich sehr viel verdanke.Speziell an ConnyHöhneein großes Dankeschön, dass sie mich in all den Jahren liebevoll begleitet und entlastet hat.
Vorwort
Kaum ein anderes Thema bewegtseit Jahrendie öffentliche und fachwissenschaftliche Diskussion gleichermaßenund polarisiert dabei so stark wie die Grüne Gentechnik.Dieum ihren Nutzenund Schaden entbranntenDebatten erfassenverschiedene wissenschaftliche Fachdisziplinen, die Politik, Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen, die Kirche und die Medienebenso wiesiedie BevölkerungmitihrenVorstellungen über die Beschaffenheit der Natur und der Lebensmittelerzeugung betreffen. Dabei haben sich die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern derGrünen Gentechniküber die Jahre verhärtet und es ist ein ideologischer Streit entbrannt, der auch vor der Wissenschaft nicht Halt gemacht hat.Die Auseinandersetzungen und auch die Berichterstattung sind vorwiegend geprägtvonundifferenzierten Betrachtungenund einer emotionalen Aufladung des Themas.Für die Bevölkerungstellt sich vor allem die Frage, wemmandabeiglauben oder vertrauen kann.
Die Diskussionen um Grüne Gentechnik werdenmeistselektiv geführt undlassen außer Acht, dass oft nicht diese Technik oder Verfahren an sichabgelehnt werden, sondern vielmehr eine grundlegende Kritik an der gegenwärtigen Lebens- und auch Produktionsweise unserer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht wird. So ist Deutschlands Bevölkerung prinzipiell weder technikängstlich oder gar technikfeindlich. Die Nutzung der Gentechnik im medizinischen Bereich ist beispielsweise gemeinhin akzeptiert. Wird aber diegleicheTechnik im Nahrungsmittelbereich genutzt,wandelt sichdieAkzeptanzzueinermehrheitlichenAblehnung. Dazu tragen,neben tatsächlichem Wissensmangel um Grüne Gentechnik an sich auch fehlende bis verzerrte Vorstellungen über die landwirtschaftliche Praxis und Nahrungsmittelerzeugung bei.Gleichzeitig werden aber sehr elementare Überzeugungenund Werte der Bevölkerungdurch dieses Thema berührt. Im Kern geht esvor allem um die Frage, in welcher Art Gesellschaft, mit welcher Produktionsweise, welchen Naturbildern sowiewelchem Umgang mit der Naturundnatürlichen Ressourcen wir leben möchten.DabeispiegelndieDiskussionen umGrüne GentechnikexemplarischTeilaspekte aktuellergesellschaftlicher Debattenwider.
Diese Arbeit möchte einen Überblick über die Vielseitigkeit und Komplexität des Themas Grüne Gentechnik geben und dabei gleichzeitig den Blick dafür schärfen, dass dieser Bereich der Gentechnik bei einer ernsthaften Auseinandersetzung keinesfalls mit einer einfachen Pro- oder Contra-Antwort enden kann. Dabei richtet sich die Arbeitin weiten Teilenexplizit auch an eine breitere Leserschaft über die akademische Fachgemeinschaft hinaus.
Die Nutzung der Grünen Gentechnik mag eine gravierende Änderung auch in unserem Verständnis vonNatur undLandwirtschaft darstellen, doch sollte sie vorurteilsfrei im Hinblick auf ihren Nutzen und Schaden beurteilt werden.Dogmatismus und Denkverbotesind dabei schlechte Ratgeber.
An dieser Stelleseinoch darauf verwiesen, dass für Unzulänglichkeiten oder Mängelin dieser Arbeit selbstverständlichallein der Autorverantwortlich zeichnet.Darüber hinaus wird in dervorliegenden Arbeit versucht, derVerschleierung der asymmetrischen Geschlechterverhältnisse durch das generische MaskulinumRechnung zu tragen. Wo dies nicht geschieht, wurde im Sinne einerverbesserten Lesbarkeitdem Maskulinumder Vorrang gegeben, ohne dabei jedochdenfemininen Genuszu ignorieren odereineWertigkeitzuimplizieren.
Göttingen, imJuli2013Manuel Thiel
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
ASCalternativenspezifische Konstante
BCHBiosafety Clearing-House
BMUBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BtBacillus thuringiensis
BVLBundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
CBDBiodiversitäts-Konvention (Convention on Biological Diversity)
CEChoice Experiment(e)
dfFreiheitsgrad(e)(degrees of freedom)
DNADesoxyribonukleinsäure(deoxyribonucleic acid)
EBEurobarometer
EFSAEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit(European Food Safety Authority)
EGGenTDurchfGEG-Gentechnik-Durchführungsgesetz
EuGHEuropäischer Gerichtshof
GenTGGesetz zur Regelung der Gentechnik-Gentechnikgesetz
GenTPflEVVerordnung über die gute fachliche Praxis bei der Erzeugung gentechnisch veränderter Pflanzen - Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung
GESISLeibniz-Institut für Sozialwissenschaften(ehem.Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V.)
GRGeneRisk
GVgentechnisch verändert
GVOgentechnisch veränderte/r Organismus/Organismen
GVPgentechnisch veränderte Pflanze(n)
ISAAAThe International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications
MARmissing at random
MCARmissing completely at random
MNARmissing not at random
NGONichtregierungsorganisation(Non-Governmental Organization)
OECDOrganisationfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(Organisation for Economic Co-operation and Development)
RUTZufallsnutzentheorie (Random Utility Theory)
SEUsubjektiv erwarteterNutzen(subjective expected utility)
TDMTailored-Design-Method
TPBTheorie des geplanten Verhaltens/Handelns (Theory of Planned Behavior)
UBUmweltbewusstsein in Deutschland
UBAUmweltbundesamt
WGGWissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik
WTOWelthandelsorganisation (World Trade Organization)
ZUMA
Kurzzusammenfassung
Dieso genannteGrüneGentechniksteht seit vielen Jahren im Mittelpunkt verschiedener Kontroversen und Debatten. Häufig ist dabei vonderAblehnung in der Bevölkerung die Rede. Diese Arbeit betrachtet auf einer vergleichsweise breiten Datenbasisdie Entwicklung und den Verlauf der Meinungen und Bewertungen der deutschen Bevölkerung zu Grüner Gentechnik und ihren Anwendungsbereichen. Es kann gezeigt werden, dass zwar meist eine deutlich kritische Haltung, aber keinesfalls pauschale Ablehnung existiert.Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten werden durchaus differenziert bewertet. So istinsbesondereder Bereich der Lebensmittel sehr sensibel, währendbeispielsweisegentechnisch verändertePflanzen zur Medikamentenherstellung eher akzeptiert werden, ebenso wie lebensmittelferne Anwendungen insgesamt. Wennauch die allgemeinen Meinungen zuGrüner Gentechnikoftmals von deutlicher Unentschlossenheit und Skepsis geprägtsind, findet sichin der Regel für alle Facetten eine differenzierende Betrachtung, die deutlich macht, dass häufig Risikoerwägungen eine zentrale Rolle spielen,aber je nach Situation unterschiedlich ausfallen können.Zudem kann gezeigt werden, dass Grüne Gentechnik im Verhältnis zu weiteren, als risikoträchtig wahrgenommenen Bereichennicht an erster Stelle steht. Sie nimmt zumeist eine Mittelposition ein.
Außerdem stellt die Arbeit die Ergebnisse eines Verkaufsexperimentes mit verschiedenen Erzeugnissen unter Verwendung Grüner Gentechnik vor. Auch hier zeigt sich deutlich, dass es keine pauschale Ablehnung gibt.Esbestehenklareproduktspezifische Effekte derart, dass trotz einer eindeutigen Kennzeichnung nicht alle Erzeugnisse gleichermaßenhinsichtlich des Einsatzes Grüner Gentechnik bewertet werden.Neben scheinbar besonders sensiblen Produkten scheint ihr Einsatz besonders im Bereich lebensmittelferner Anwendungen stärker akzeptiert.Von den„klassischen“Erklärungsgrößen der Soziodemographie gehen insgesamt betrachtet unterschiedliche, meist schwache oder keinerlei Effekte aus.Zusammengefasst kann über verschiedene Aspekte und Bereiche Grüner Gentechnik hinwegim Regelfallein differenzierendes Bild gezeigt werden. Vor diesem Hintergrund stellt die Arbeitunter anderemeinen Beitrag für dasVerständnis der heterogenen Literaturlage dar, daje nach FokussituationsspezifischeBewertungen Grüner Gentechnik in derBevölkerungermittelt werden.
ExecutiveSummary
For years the so called green genetic engineering has been the subject of controversies and debates. Often times these discussions revolve around the rejection of green genetic engineering by the population. Based on a comparatively wide data base the present work looks at the development of opinions and valuations regarding green genetic engineering and its fields of application for Germany. It can be shown that even though a lot of people think critically about genetic engineering in agriculture most of them do not reject the whole concept in general. This means that the attitude towards green genetic engineering differs depending on the sector it is being used in. Regarding the food sector the usage of genetic engineering usually causes very sensitive reactions by customers, whereas the usage of genetically modified plants to manufacture medicines is widely accepted. This is a tendency that applies for most of all non-food related sectors. Regarding the whole idea of green genetic engineering the general opinion is mostly driven by indecisiveness and skepticism. But besides this general tendency regarding genetic engineering, which often revolves around security considerations, it can be shown that differentiating views can be found for every aspects of its use. The present work also shows that green genetic engineering is not received as a particularly dangerous sector, rather compared with other risky sectors it usually ranks midfield.
Additionally the current work includes the results of a sales experiment featuring various genetically modified products. It turns out that these products are not being generally rejected, but that different products are being judged differently, despite a clear labeling concerning the use of genetically modified organisms. Besides seemingly extra sensitive products (especially in the food sector) there are products where the usage of genetic engineering receives broader acceptance. On the whole, “classical” sociodemographic factors do not seem to have any major influence. In conclusion this work shows how highlydifferentiated the various aspects and sectors of green genetic engineering are being received. Within this context this work is looking to contribute to the understanding of the heterogeneous state of research where situation-specific evaluations of genetic engineering in agriculture are captured.
IEinleitung
Es gibt gegenwärtig wenige andere Themen, die derart stark polarisieren undbei denen die Auseinandersetzungen so erbittert geführt werden, wie bei derGrünenGentechnik. Von Befürwortern wird sie als die Lösung für eine Vielzahl der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, vor allemfürdie Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung undals Möglichkeit,derRessourcenverknappung entgegenzuwirken, gesehen(z.B.BASFo.J.; BASFet al.2003). In dieser Sichtweise stellt Grüne Gentechnik lediglich die nächste Stufeder Anpassung von Pflanzen an die menschlichen Bedürfnisse, alsoder Pflanzenzüchtung, dar(z.B.BMVEL2003;Handelsblatt2005). Grüne Gentechniksoll beispielsweise Pflanzen mit höheren Erträgen, verbessertenResistenzengegen Schädlinge,Anbauvereinfachungenoder auch auf die industrielle Verwendunghin optimiertePflanzeneigenschaftenerbringen(z.B.KWSo.J.;BVL2008;DieWelt2008). Darüber hinaus hat sie die Entwicklung von stresstoleranten Pflanzen zum Ziel, die z.B. an Extremstandorten mit viel Hitze und/oder wenig Wasser und Nährstoffen gedeihenkönnen(z.B.BVL2008;Focus2009;TransGen2009b). Hierfür werdenvor allem in den so genanntenEntwicklungsländern großeMöglichkeiten gesehen.Für die Verfechter der Grünen Gentechnik bietet sie unter anderemnebenVereinfachungen und Effizienzgewinnenauf der Anbauseiteauchdie Möglichkeit, auf gleich bleibenden Flächen einen höheren Ertrag zu erzielen oder weitere Flächen für den Anbau zu erschließen, die bislang für diesen nicht geeignet waren.Ferner werden auch explizitfür die Verbraucherseitepotentielle Vorteile verfolgt,z.B. Pflanzen mit einer verbesserten Nährstoffzusammensetzung, eine Reduzierung allergener LebensmittelinhaltsstoffeoderauchspeziellangereicherteProdukte mitgesundheitsfördernden Wirkungen(z.B.TransGen2004; Sauter 2006).
Die Gegnerder GrünenGentechnikhingegen sehen zum einen nicht den Bedarf an dieser Art der Pflanzenzüchtung, vielmehr sei auch die konventionelle Züchtung in der Lage, Ertragssteigerungen, Resistenzen und Stresstoleranzen zu erzeugen(z.B.Greenpeace2004). Zum anderen überwiegen für sie eindeutig die Gefahren und negativen Auswirkungen der Grünen Gentechnik. Dazugehörenvorrangigdas Risiko unerwünschter Nebeneffekte durch die Manipulation des Erbgutsund die steigende Abhängigkeit der Landwirte von den Agro-Konzernen durchz.B.patentrechtlich geschütztes Saatgut(z.B.Greenpeace2005b;VZBW2008).Zu den befürchteten Folgewirkungen zählt zum einen eine Gefahr für die Umwelt, dadie Gentechnik beim Transfer des Erbguts nicht länger an Artgrenzen gebunden ist undsich gentechnisch veränderte Pflanzen (GVP)dahermit unabsehbaren Folgenin derNatur ausbreiten könnten(z.B.Nabu2005;BÖLW& Campact2009). Zum anderenwerden auch für den Menschen durch den Verzehr von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) undGVPgroße Risiken gesehen. Diessind vorallemneueoder stärker ausgeprägteAllergien, aberauchbislangnicht abschätzbareGefahren durch die Aufnahme gentechnisch veränderter(GV)DNA über dieNahrungwerden angenommen(z.B.Greenpeace2007a;Umweltinstitut München2008).Betrachtet man diese sehr konträren Standpunkte, so wundert es kaum, dass Diskussionenüber die Grüne Gentechnik häufigvehement und emotionalgeführt werden.So sindvor allem die öffentlichen Diskussionen von medienwirksamen Aktionen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)begleitet, die ein deutlich negatives Bild der Grünen Gentechnik zeichnen.Mitunter entsteht gar der Eindruck, dassdie Debatten um dieses Themafasteine Art religiösenCharaktergewonnen haben.
Aber nicht nur in der öffentlichen Diskussion finden sich die gegensätzlichen Lager der Grünen Gentechnik. Auch in der Wissenschaft hat ein mitunter energischer Disput Einzug gehalten.Im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen auch hier die Fragen nach der Notwendigkeit und dem Nutzen Grüner Gentechnik sowie deren Gefahren und Folgen für die Natur, den Menschen und die Gesellschaft.Allerdingswerden in einem Großteil derfachwissenschaftlichen Debattenfür dieVerbraucherseiteVorteiledurch Grüne Gentechnikfür möglich gehalten(z.B.Anderson et al.2006;Giannakas & Yiannaka2008). Die potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und die Natur bleiben jedoch stark umstritten (z.B.Brookes & Barfoot 2006;Middelhoff et al.2006;Moch2006;Breckling 2008;EFSA2008a).
Auch in der Politik gibt es keinen einheitlichen Standpunkt zur Grünen Gentechnik. Auf europäischer Ebene, auf der sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden als auch die direkte Zulassung von GVO erfolgt, sind regelmäßig kontroverse Einschätzungen und Standpunkte der zuständigen Gremien und Kommissionen zu finden(z.B.LME2008b;TransGen2009a;TransGen2013a). Ähnlich verhält es sichin derdeutschenPolitik.Es gibtkeineklareLinie im Umgang mit Grüner Gentechnik. Während vor allem Bündnis 90/Die Grünen und Die Linkenach wie vorein Verbot von Grüner Gentechnikfordern(Bündnis 90/Die Grünen 2009;Die Linke 2009; Bündnis 90/Die Grünen 2013; Die Linke 2013),befürwortet dieFDPeine transparenteund verantwortungsvolleFörderung (FDP2009a;FDP2013).Während sich die SPD zunächst nicht eindeutig festlegen wollte und besonders die Sicherung der Wahlfreiheit in den Vordergrund stellte (SPD 2009), positioniert sie sich inzwischen deutlicher und lehnt Grüne Gentechnik explizit ab(SPD2013).Die CDUlegtsicheher in der Tendenzfest. So werden allgemein vor allem die Notwendigkeit der Sicherheitsforschung (CDU/CSU 2009)und die Leistungsfähigkeit bei wichtigen Zukunftstechnologiensowie Aspekte der Kennzeichnungbetont (CDU/CSU2013). Einzelne Parteimitglieder beziehen jedoch deutlichePositionen für oder wider Grüne Gentechnik.Das bekannteste Beispielfür einen grundlegenden Richtungswechsel im Umgang mit Grüner Gentechnik istdie CSU, die mit ihrem aktuellen ParteivorsitzendenHorst Seehofer, dem ehemaligenBundesministerfür Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,für viele Diskussionen gesorgt hat. So wurde die Grüne Gentechnik in HorstSeehofers Amtszeit als Bundesminister noch alswichtige,zukunftsträchtige Technologiegesehenund gefördertsowie ihre Koexistenz mit anderen Bewirtschaftungsformen angestrebt(z.B.Financial Times Deutschland 2006;Focus 2006). Mit seinem Wechselvon der Bundes-in die Landespolitikals Ministerpräsident BayernsimOktober 2008, wandelte sich seine Einstellungzueinerstarkkritischen Sicht auf die Grüne Gentechnik und er setzt sichnachdrücklichfür eingentechnikfreies Bayernein(z.B.Süddeutsche Zeitung 2008b).SeineNachfolgerin im Amt der Bundesministerinfür Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Parteikollegin Ilse Aigner, setzte denneuen Kursfort.Zuletzt hat sieim April 2009mit sofortiger Wirkung den Anbau von GVP in Deutschland verboten(BMELV2009a).Begründet wird dies mitdem Vorsorgeprinzipund dem Schutz derGesundheit der VerbraucherInnenundderUmwelt vorpotentiellen Gefahren.Dieser sehr gentechnikkritischen Einstellung steht die Einschätzungder im Frühjahr 2013 zurückgetretenenBundesbildungsministerin Annette Schavan(CDU)entgegen.Ihrer Meinungnach kann Deutschland nicht auf Grüne Gentechnik verzichten (z.B. BMBF 2007;Financial Times Deutschland 2009).Wenn ihre Nachfolgerin Johnna Wanka (CDU) wie angekündigt den Kurs forstsetzt, bleibt es dabei: es sind beim Thema Grüne Gentechnikauch zwischen den Bundesministerien(siehe auchMüller-Röber et al.2007)und innerhalb der Union von CDU/CSU deutlich gegensätzliche Positionen vertreten.
In diesem konträren und unsteten Umfeldliegt vermutlich ein wichtiger Grund für die Verunsicherung der VerbraucherInnenund der Bevölkerung insgesamt. So zeigen Meinungsumfragenzumeistdas gleiche Bild:Die bundesdeutsche BevölkerungistGrüner Gentechnikund unter ihrer Verwendung hergestelltenProduktengegenübereherkritisch eingestelltund lehnt siemeistmehrheitlich ab(z.B.Dialego2009;Forsa2009a;Forsa2009b;IfD2009).Diese Ablehnung ist primär durch gesundheitliche Bedenken beim Verzehr derartiger Produkte und vermutete negative Auswirkungen auf die Natur beim Anbau der entsprechenden Pflanzen begründet. Grüne Gentechnik wird in der öffentlichen Wahrnehmung vorrangig als risikoträchtig, unkontrollierbarund ein Eingriff in die Natur wahrgenommen. Sie widerspricht den Vorstellungen weiter Teile der Bevölkerung über„natürliche“Nahrungsmittelproduktion.
Andererseits zeigenwissenschaftliche Studien und Verkaufsexperimente, dassGV-Produktegekauft werden, wenn sie angeboten werden(z.B.Lusket al.2005;Hartl2007).Diesauchdann, wenn sie explizit als„gentechnikhaltig“gekennzeichnet sind.
Vor diesem Hintergrund setztsich diese Arbeitdas Ziel, aus einem möglichst breiten Blickwinkeldas Themaan sichzu beleuchten, also aufzuzeigen, wie vielschichtigdieHintergründe, Anwendungsbereiche und Regulierungen,aber auch dieDebattenbeiGrüne Gentechniksind.Gleichsam setzt sich die Arbeit das Zielherauszuarbeiten, warum es trotzlanger und umfangreicher ForschungkaumeindeutigeBefundegibt.Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der Betrachtung derFaktoren, diefür die Bewertung Grüner Gentechnik von besonderer Bedeutung sind. Die Einstellungen und Einschätzungen der bundesdeutschen Bevölkerung bezüglich Grüner Gentechnik werden mittels einer vergleichsweise breiten Datenbasis imZeitraumvon 1996 bis 2008 betrachtet. Hierzu wird auf quasi-amtliche Erhebungen zurückgegriffenunddiese durch eigene Daten aus einem Drittmittelprojekt ergänzt.Letztere basierenaufeinerZufallsstichprobe aller volljährigen EinwohnerInnender Bundesrepublik Deutschland und wurden inschriftlich-postalischer Formeinschließlich einesMethodenexperimentszur Incentive-Wirksamkeit bei dieser Erhebungsformgeneriert. Zudem ist ein mikroökonomisch fundiertes Auswahlexperiment(„Verkaufsexperiment“)integriert, das auf einem hypothetischen Markt das potentielle Kaufverhalten der befragten Personenbei unterschiedlichen Erzeugnissen aus bzw. unter Verwendung von GVO und GVPerhebt. In der Summe resultiertaus denAnalysenüber mehrere Datenquellenein umfassenderes Bildder Grünen Gentechnikals bei Einzelbetrachtung der Quellen.Zudem schließen die BetrachtungendieBevölkerungssicht auf verschiedeneFacettenGrüner Gentechnikundderen Einordnung im Vergleich zuanderen,potentiell risikoträchtigen Bereichenein.Die Ergebnisse stellen einen Beitragfür das Verständnis der oft konträren Forschungsresultate in den Bereichen derBevölkerungs- bzw.Verbrauchereinstellungenund des KonsumentenverhaltensbeiGV-Produkten darund verdeutlichen, dass monokausale Betrachtungen und undifferenzierte Bewertungen weder zielführend sind, noch der mehrheitlichen Sicht der Bevölkerung gerecht werden.
Im Anschluss an dieseÜbersichtzurthematischenAusrichtung unddeninhaltlichen Zielender Arbeitwerden inKapitelIIzunächstdie Hintergründe der Grünen Gentechnikgenauer ausgeführt(2.1). Es wird aufgezeigt, was Gentechnik allgemein und Grüne Gentechnik im Speziellen ausmacht, ehe die aktuelle Situation und gegenwärtigen Regelungenweltweit, besonders aber in Europa und Deutschlandnähererläutertwerden(2.2). Daran schließtsich eine Darstellung der verschiedenen Problembereiche der Grünen Gentechnikan(2.3).KapitelIIIwidmet sichder individuellen Ebene und betrachtet zunächst allgemein Einstellungen und Präferenzen (3.1). Darauf folgteine ausführliche Literaturbetrachtung, die über die internationale Forschung und Europa dann speziell auf Befunde aus und für Deutschland eingeht (3.2).
Die Beschreibung der verwendeten Datenquellen und methodischenHintergründe erfolgt inKapitelIV. So werden die sowohl quasi-amtlichen Datenbasen desEurobarometers(4.1) und die Studien zumUmweltbewusstsein in Deutschland(4.2) ausführlich vorgestellt als auch die Daten des DrittmittelprojektesGeneRisk(4.3). Zudem werden alle Daten an entsprechender Stelle einer kritischen Betrachtung unterzogenund das Analysevorgehen dargestellt (4.4).Den umfangreichsten Teil bildet die Ergebnisdarstellung und Interpretation der Sekundäranalysen der verschiedenen Datenquellen inKapitelV.Hierwerden dieDatenanhand der BereicheGesellschaftliche Dimension(5.1),Individuelle Dimension(5.2) undRisikobewertung(5.3) Grüner Gentechnikdargestellt. Sie werden durch vergleichende Analysen (5.4) und die Ergebnisse des Verkaufsexperiments ergänzt(5.5). Am Ende des Kapitels werden alle Befunde in einer Synthese zusammengeführt (5.6).Die Schlussbetrachtungen des KapitelsVIbilden die Diskussion und ein Fazit der Arbeit (6.1) sowie abschließende Hinweise und ein persönliches Resümee des Autors (6.2).Am Ende stehen die GliederungspunkteQuellennachweise(KapitelVII) und Anhang(KapitelVIII), woneben ergänzenden und weiterführenden Übersichten auch derFragebogen des GeneRisk-Projektes sowiezusätzliche Berechnungen zu finden sind.
IIThematischerHintergrund
Die moderne Biotechnologie und Gentechnik gelten als Schlüsseltechnologien unseres Jahrhunderts. Die wesentlichen Anwendungen erfolgen in den Bereichen der Medizin und Pharmazeutik, der Land- und Forstwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und der Umwelttechniken. Darüber hinaus finden biotechnologische Verfahren Anwendung invielenIndustrieprozessen und der Abfallwirtschaft. Wenn auch häufig die Begriffe nicht trennscharf verwendet werden und einige Überschneidungen existieren, soll zunächst kurz auf eineErklärungvon Biotechnologie und Gentechnik eingegangen werden.Dabei wird sich dieser Abschnitt auf die fürdenweiterenVerlaufnotwendige Detailtiefe beschränken. Für ausführlichere und weiterführende Informationen zu Hintergründen und Detailaspekten der Biotechnologie sei stellvertretend aufKempken & Kempken(2006)undRenneberg(2007)verwiesen.
Im Anschluss an die naturwissenschaftlich-technischen Hintergründe wirddieGrüneGentechnikgenauer betrachtetsowiederen Situation weltweit,und in Deutschland im Besonderen,dargestellt.Hierbei liegt ein Fokus auf den gesellschaftlichvorrangigdiskutierten Aspekten der Grünen Gentechnik, z.B.dem Anbautransgener Pflanzeninsgesamt und der Kennzeichnung von Lebensmitteln, die unter deren Verwendung hergestellt wurden. Anhand der Frage, warum ein Großteil derbundesdeutschenBevölkerung Grüner Gentechnikgegenüber sehr skeptisch ist, erfolgt die Eingrenzung desUntersuchungsfeldes.Wenngleich sich der Kern vieler Debatten um Grüne Gentechnik seit deren Aufkommen oftmals nicht wesentlich geändert hat, so ist dennoch viel Bewegung in den Diskussionen und Entscheidungen in diesem Kontext. Daherfokussiertdieses Kapitelvorrangigauf denim Rahmen der Datenbasen betrachtetenZeitraumvon 1996 bis 2008. Auf Änderungen späteren Datums wird bei entsprechender Relevanz anjeweiligerStelle verwiesen.
2.1Was ist(Grüne)Gentechnik?
2.1.1Begriffsklärung
Unter dem Begriff der Biotechnologie wird im Allgemeinendie Umsetzung von Erkenntnissen aus Biologie und Biochemie in technischebzw.technisch nutzbare Elementefür die industrielle Produktionverstanden(z.B.Rehm & Präve1994;Deckwer et al.1999).DieOrganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD) definiert Biotechnologie als
„die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen, Teile von ihnen, ihre Produkte oder Modelle von ihnen zwecks Veränderung von lebender oder nichtlebender Materie zurBereitstellung von Wissen,Gütern undDienstleistungen“ (OECD2005: o.S.)[1].
DieEinsatzmöglichkeiten der Biotechnologie sind sehr vielfältig und nicht auf ein Gebiet beschränkt. Sozählen z.B.Mikroorganismen, die während der Bierherstellung den Zucker der Gerste(bzw. des Gerstenmalzes)zu Alkohol vergärenoder in Kläranlagen zur Schmutzwasserreinigung eingesetzt werden gleichsam zur Biotechnologie.Biotechnologie als solche wird von Menschen bereits seit Jahrhundertenz.B.bei der Herstellung von Brot, Bier und Wein angewandt(wenn anfänglich wohl eher unbewusst).In dermodernen Biotechnologiehingegenfinden vor allem Methoden der Gentechnik und Molekularbiologie Anwendung.
Gentechnik wird gemeinhin definiert als die Methoden und Verfahren der Biotechnologie, mit denen gezielte Eingriffe in das Erbgut möglich sind.Hacker(2001)verstehtGentechnik als „ein Methodenspektrum, mit dessen Hilfe Geneisoliert und neu kombiniert (kloniert) werden können“ (Hacker2001:194).Gentechnische Verfahren haben einen Eingriff auf der Ebene derDesoxyribonukleinsäure(DNA) zum Gegenstand. Aus diesen Eingriffen resultiert zunächst rekombinante DNA, aus der danngentechnisch veränderte Organismen (GVO)[2]hergestellt werdenkönnen (Madigan & Matinko2006).Für die Übertragung der Erbinformationen existieren verschiedene Methoden. Dabei werden entweder direkte Methoden (Mikroinjektion, Mikroprojektilbeschuss) oder so genannte Vektoren (Viren, Bakterien) genutzt (Sachse & Gassen1996;Regenass-Klotz2004;Renneberg2007)[3].Eine Definition des Begriffs GVO findet sich z.B. in verschiedenen europäischen und nationalen Rechtsvorschriften. Die europäische Richtlinie über die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt versteht darunter „einen Organismus,mit Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist“ (EU2001/18/EG: 4). Das deutsche Gentechnikrecht definiert GVOetwas ausführlicherals
„ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen,dessen genetischesMaterial in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt; ein gentechnisch veränderter Organismus ist auch ein Organismus, der durch Kreuzung oder natürliche Rekombination zwischen gentechnisch veränderten Organismen oder mit einem oder mehreren gentechnisch veränderten Organismen oder durch andere Arten der Vermehrung eines gentechnisch veränderten Organismus entstanden ist, sofern das genetische Material des Organismus Eigenschaften aufweist, die auf gentechnische Arbeiten zurückzuführen sind“ (GenTG 2008: 4).
Dabei wird einGen, das mit gentechnischen Verfahren in das Erbgut eines Organismus eingebracht wurdealsTransgenbezeichnet. Transgene Organismen sind gentechnisch veränderte Organismen, die Gene von anderen Arten enthalten.Als Adjektiv wird der Begriff häufigfür gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen gebraucht, seltener auch als Synonym für GVO(bioSicherheit2009a).
Allgemeinkannmittels GentechnikbestimmtesErbgut auf gewünschte Eigenschaften hin verändertbzw.diesemneue Eigenschaften hinzugefügtwerden. Dabei ist der Transfer der Eigenschaften im Gegensatz zu konventionellen Verfahren oder Kreuzungen nicht länger andie Verwandtschaft zwischen den Artengebunden.Durch den Einsatzgentechnischer Verfahren kannsomit eineÜbertragungvonGenmaterialauch über Artgrenzen hinweg erfolgen(Menrad et al.2003;Kempken2005)[4].Zu denZielengentechnischer Arbeitenzählenz.B.vielseitige medizinische Anwendungen,die Veränderung von Saatgutoderdie Optimierung industrieller Prozesse.Außer der Veränderung von Erbanlagen ist aucheine präzise Analyse des ErbgutsmittelsGentechnikmöglich.Zu den bekanntesten Anwendungen zählendie Identifizierung von Tätern in Strafverfahren(„genetischer Fingerabdruck“)oder Vaterschaftsnachweise (z.B.Kempken & Kempken2006)[5].Kurz gesagt istdie Gentechnik ein Teilgebiet der Biotechnologie undbezeichneteine Reihe von Methoden zur Isolierung, Übertragung oder gezielten Veränderung des Erbguts.DieBiotechnologie umfasst einen weiteren Bereichundbezieht sich aufdie Umsetzung sämtlicher biologischer und biochemischer Erkenntnisse hinsichtlich deren technischenVerwendbarkeit.Verfahrenstechnisch sind(moderne) Biotechnologie und Gentechnik häufig nicht mehr voneinander zu trennen,so dass dieBegriffeoft synonym verwendet werden[6].
2.1.2Die Farben der Gentechnik
Da Bio- und Gentechnologierechtweit gefassteBegriffe sind undsich dieNutzungsmöglichkeitenauf zahlreiche unterschiedliche Technologiesektoren beziehen,hat sich anhand der Anwendungsbereiche und Ziele eineDifferenzierung herausgebildet, wenngleichdiesenicht immer trennscharfist.Die bislang größten Anwendungsgebiete der Gentechnik sind der medizinische Bereich, verschiedene industrielle Prozesse sowie der Agrarsektor. Entsprechend diesen Anwendungen wird nach Roter, Weißer(häufigauchGrauer)und Grüner Gentechnik differenziert. NachKemme(1996)geht diesdarauf zurück, dass bei der Roten Gentechnik die Farbe des Blutes der Säugetiere, das als Ausgangsmaterial für die Isolierung der DNA dient, diesem Anwendungsbereich den Namen gab.Von derFarbe der Bakterienkulturenleitet sich der Nameder Grauen Gentechnikab.Die grüne Farbe des pflanzlichen Gewebesist der Namensgeber der Grünen Gentechnik, die sämtliche gentechnischeAnwendungenbei der Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln sowie der Produktion landwirtschaftlicher Rohstoffebezeichnet.Darüber hinaus wird mitunterzusätzlich nach Blauer, Braunerund Gelber Biotechnologie differenziert.Tabelle1gibt eine Übersicht derverschiedenenEinteilungenvon Biotechnologiebzw.Gentechnik.Die Differenzierung nach Roter, Blauer und Grüner Gentechnik ist vergleichsweise eindeutig. Der Fokus der Blauen Gentechnik liegt auf der technischen Verwendung von Prozessen und Organismen der marinen Biologie. Der Hauptanwendungsbereich von Weißer, Grauer, Brauner und Gelber Gentechnik sind Industrieprozesse. Diese detaillierten Unterteilungen sind erst in jüngerer Zeit entstanden und noch nicht eindeutig definiert, wie auch die Farbzuordnung weniger intuitiv ist. Häufig wurden und werden sämtliche biotechnologischen Anwendungen für industrielle Zwecke unter Weißer oder auch Grauer Biotechnologie zusammengefasst. Mit zunehmender Spezialisierung bilden sich jedoch mehr Bereiche innerhalb der Obergruppe „Industrieprozesse“ heraus. NachLippold(2006) kann folgende Abgrenzung vorgenommen werden: Auch wenn die Bezeichnungen Graue und Weiße Biotechnologie weiterhin oft synonym verwendet werden, so werden vor allem Prozesse mit Hilfe von GVO der Weißen Biotechnologie zugeordnet, während klassische Vorgänge wie beispielsweise die Fermentierung zur Grauen Biotechnologie zählen.
Tabelle1:UnterteilungvonBiotechnologie und Gentechnik
Quelle:eigene DarstellungnachLippold2006.
Zweig
Anwendungsbereich
Rote Biotechnologie/Gentechnik
Medizin, Pharmazeutik
Grüne Biotechnologie/Gentechnik
Pflanzenbiotechnologie, Landwirtschaft
Weiße Biotechnologie/Gentechnik
Industrieprozesse:Umwelttechnik
Graue Biotechnologie/Gentechnik
Industrieprozesse:Abfallwirtschaft
Braune Biotechnologie/Gentechnik
Industrieprozesse: Umweltschutz
Gelbe Biotechnologie/Gentechnik
Industrieprozesse:Lebensmittelgrundstoffe
Blaue Biotechnologie/Gentechnik
Meeresprodukte, Meeresbiologie
Häufig werden auch alle Bestrebungen, Biotechnologie für den Umweltschutz zu nutzen unter Graue Biotechnologie subsumiert, wobeifür diesen Anwendungsbereichmittlerweileoftder Begriff Braune Biotechnologiezu finden ist.Vereinzelt wird auch von Gelber Biotechnologie gesprochen, die dann als Biotechnologie der Lebensmittel oder der chemischen Herstellung von Grundstoffen definiert wird.Jedoch ist die Abgrenzung von GelberBiotechnologie noch nicht schlüssig erfolgt, da die beiden zugeordneten Bereichebislangzu den Feldern der Grünen und Weißen Biotechnologie zählen.
Aber auch innerhalb der drei Hauptgruppen der Biotechnologie (Rote/Weiße/Grüne) existieren Überschneidungen und ein teilweiserMangel an Trennschärfe. Sowerden beispielsweise mittels Weißer Gentechnik vieleFuttermittelzusätze, Vitamine sowieZusatz- und Hilfsstoffe für die Lebensmittelindustriehergestellt, obwohl üblicherweise die Grüne Gentechnik mit Nahrungsmitteln assoziiert wird.Auch gentechnisch veränderte Fische zählen bislang zur Grünen Gentechnik, wobei ggf. eine Zuordnung zur Blauen Biotechnologie schlüssigerwäre.Darüber hinaus werden gentechnisch veränderte Kartoffeln explizit für die industrielle Weiterverarbeitung optimiert, so dass auch hier dieAnwendungsbereicheGrüner und Weißer Gentechnikineinander übergehen. Auch zur Roten Gentechnik gibt es fließende Grenzen. So sindgentechnisch veränderte Pflanzen(GVP)[7]für medizinische Anwendungen (z.B. Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten) in der Entwicklung[8].Aufgrund der Vielzahl der Unteraspekte ist eine weitere Differenzierung derBio- und Gentechnologie wahrscheinlich (Lippold2006)[9].
2.1.3Wichtige geschichtliche Daten zurGentechnik
Der Mensch nutzt die (klassische) Biotechnologie schon seit dem Altertum bei beispielsweise Gärungsprodukten. Aber auch Eingriffe in das Erbgut von Pflanzen finden bereits seit Jahrhunderten statt. So wurde z.B. vor ca. 8000 Jahren in Mexiko eine einheimische Pflanze(Teosinte)domestiziertundmit natürlich vorkommenden Mutationen kombiniert, so dass die Vorläufer der heutigen Mais-Sorten entstanden (z.B.Kempken2005).Im weiteren Verlauf der Geschichte bis hin zur Gegenwartwarund isteseinZiel der Pflanzenzüchtung,Pflanzen mit bestimmten erwünschten Eigenschaftenzu erzeugen. Dabei beruhen die Verfahren zumeist aufwiederholterAuslesebzw. Kreuzung sowieder anschließenden Vermehrung derentsprechenden Pflanzen(z.B.Kemme& Sachse1996)[10].Bei diesen Vorläufern dermodernen Pflanzenzüchtung mittelsGentechnik enthielten dieveränderten Organismenjedoch keine rekombinanteDNA.
Als wichtige Meilensteine der modernen Biotechnologieund deren Verlaufwerden üblicherweise folgende Etappengenannt(TransGen2003;Regenass-Klotz2004;Conrad2005;Kempken2005;Renneberg2007):Den Grundstein für die modernen Verfahren der Pflanzenzüchtung legte die Vererbungslehre von Gregor Mendel.Ein weiterer wichtiger Schritt war die Entdeckungder Doppelhelixstrukur(und dieweitereEntschlüsselung) derDNA.Die Anfänge der modernen Biotechnologiebzw. Gentechnikliegen in den 1970erJahren.In diesen Jahren gelang es Forschern, Sequenzen vom Ende eines Genoms abzutrennen undein erstes genetisch verändertes,rekombinantes Bakterium zu erzeugen. 1977 wurde erstmals ein menschliches Protein in einem Bakterium gentechnisch hergestellt. Ebenso wurden in diesenJahrenMethoden zur effizienten DNA-Sequenzierung entwickelt. In dieser Zeit wurdeauchdie Basis für die Grüne Gentechnik geschaffen, indem es gelang,fremdeGene inZellkulturen vonPflanzen einzuschleusen.1980 wurde das erste Patent auf einen GVO beantragt. Das erste gentechnisch veränderte Medikament war Insulin und kam 1982 in den USA auf den Markt.Als erste transgene Pflanze wuchs Tabak 1983 in einem Gewächshaus in den USA.Die ersten Patente aufGVPwurden 1983ebenfalls in den USA vergeben.Ein Jahr später wurde der genetische Fingerabdruck entwickelt.Gegen Ende der 1980er Jahre wurde dann das erste Patent auf ein gentechnisch verändertes Tier (Maus) vergeben.Die ersten Freisetzungen von GVP (transgene Petunien) in Deutschlandfanden1990 statt. Im selben Jahr wurde die weltweit erste Gentherapie am Menschen durchgeführt und 1994 kam das erste gentechnisch veränderte Gemüse, eine Tomate(Flavr Savr®-Tomate, die so genannte „Anti-Matsch-Tomate“), auf den Markt[11].1996verursachte das erste geklonte Säugetier, das SchafDolly,öffentliche Kontroversenund esbegann der kommerzielle Anbau von GVP.Bereits 1998 waren international 48 GVP bzw. ihre Produkte zugelassen.In diesem Jahr begann auch in Europa der kommerzielle Anbau von GVP mitGV-Mais.Im Herbst desselbenJahreswurdeein Zulassungsmoratorium für GVPin der EUbeschlossen, das bis 2003 andauerte[12].Ab 2005fandauch in Deutschlandder kommerzielle Anbau vonGV-Maisstatt, ehe dieser im Frühjahr 2009wiederuntersagt wurde.Seit März 2010 ist zudem der Anbau einer GV-Kartoffel (Amflora) mit veränderter Stärkezusammensetzung für die industrielle Verwendung in Europa zugelassen.
Dieser kurzeAbrissgeschichtlicher Eckdatender Gentechnikistgewissnichterschöpfend, da vor allem auch im medizinischen und industriellen Sektor beständig weitereEntwicklungengemacht wurden. Er zeigt aberdie schnelle Entwicklung,die Bandbreitein diesem Bereichund die teilweisewechselnden Rahmenbedingungenauf[13].Dabeisei noch darauf hingewiesen,dasssämtliche gentechnischen Anwendungen über verschiedene Vorschriften und Richtlinien streng geregeltsind.Obwohltechnisch geseheninden verschiedenenAnwendungsgebieten der Gentechnikähnliche Verfahren zum Tragen kommen,gibt es in vielen Bereichen wenig bis kaum Diskussionen über deren Nutzung,so vor allem bezüglich der Roten Gentechnik und der industriellen Nutzung von GVO. Der Einsatz in anderen Gebieten, vor allem der Grünen Gentechnik,wird jedoch sehr kontrovers gesehen.Der folgende Abschnittgehtdaherausführlicher auf die Hintergründe und Rahmenbedingungen der Grünen Gentechnik ein.Nebeneinem kurzen internationalen Überblickliegt der Schwerpunktaber auf der Situation in Deutschland und Europa.
2.2Wieist die gegenwärtigeSituation?
So sehr auch kontroverse Diskussionen über Gentechnik allgemein und Grüne Gentechnik im Besonderen geführt werden, so wenig lässt sich bestreiten, dass die moderne Biotechnologie längst Alltag ist.Im medizinischen Bereich ist sie neben diagnostischen Verfahren auch bei der Herstellung von Humaninsulin essentiell.Aus einem Großteil heutiger Industrieprozesse ist sieebenfallsnicht mehr wegzudenken. Neben den bereits erwähnten Anwendungen von beispielsweise (GV-) Mikroorganismen bei Gärungsprozessen undder Käseherstellung, beruhen auchvieleweitere Alltagsprodukte wieWaschmittelauf der Verwendung vonGV-Enzymen[14].Ebenso sind invielen LebensmittelnZusatzstoffe oder Enzymeaus GV-Mikroorganismenenthalten. Dazuzählen z.B.Brot,Backwaren, Backmischungen,Fertig- und Tiefkühlprodukte sowiepflanzliche Fette bzw.Öle in Süßwaren.Allerdings sind weder direkt in den Enzymen, noch in den resultierenden Lebensmitteln GV-Mikroorganismen vorhanden (z.B.TransGen2009c).
Über Mikroorganismen hinausgehend hatauchGrüne Gentechnikin DeutschlandlängstEinzug gehalten, wobei sie weltweit zumeist noch stärker genutztwird.So bestehen unter anderemFuttermittel auf dem Weltmarkt häufig aus GVP und Deutschland ist auf deren Import angewiesen. Wenn auch gegenwärtig kein Anbau von GVP in Deutschlandstattfindet, so dürfen dennochverschiedeneGVP importiert und zu Lebens- und Futtermittelzwecken weiterverarbeitet werden(siehe auchEuropäische Kommission2013).Allerdings sind in deutschen Supermärkten faktisch keine Produkte zu finden, die deutlich als„gentechnikhaltig“zu erkennen wären.Zum einen veranlasst eine starke Verbraucherablehnung die Lebensmittelhändler dazu,ein möglichst gentechnikfreies Warensortimentanzubieten, zum anderen fallenZutaten undZusatzstoffe, die unter Verwendung von GV-Mikroorganismen erzeugt wurden sowieFuttermittel aus GVP nicht unter die Kennzeichnungspflicht.Trotz der Klonung von verschiedenen Tierarten gibt es bislang (und auch auf mittelfristige Sicht) keine GV-Nutztiere. Die meisten der bisherigen Versuche,in Nutztiere Gene mit neuen Eigenschaften einzuführen wurden aufgegeben oder sind gescheitert.Es gibtlediglicheinige GV-Tiere,in derenMilchdrüsen Pharmawirkstoffegebildet und in die Milch ausgeschüttet werden(z.B.TransGen2009c)[15].Zusammengefasst beschreibtHucho(2006) die aktuelle Situation in einer prägnanten These:
„Es ist noch nichts entschieden. Außer daß wir die Gentechnologie nicht wieder ‚abschaffen’ können, ist alles offen: vor allem ist in weiten Bereichen unklar, ob sie uns nützen oder belasten wird. Das heißt wir diskutieren nicht mehr darüber, ob wir die Gentechnologie wollen, sondern wir müssen Potential und Umgang mit dieser Technologie abschätzen und in den Griff bekommen“(Hucho2006:13).
2.2.1Die Grüne Gentechnik imÜberblick
Unter dem BegriffGrüne Gentechnik, häufig auch Pflanzenbiotechnologie, werden sämtliche Anwendungengentechnischer Verfahren in der Pflanzenzucht sowie der Futter- und Lebensmittelproduktion verstanden. NachPickardt(2002a) bezeichnet Grüne Gentechnik „Wissenschafts- und Anwendungsbereiche, in denen pflanzliche Organismen (in erweiterter Form […] werden auch Mikroorganismen miteinbezogen) das Ziel gentechnischer Veränderungen darstellen“ (Pickardt2002a:3).Dabei zähltneben der landwirtschaftlichen Rohstoffproduktion auch die gentechnische Veränderung von Nutztieren zum Anwendungsbereich Grüner Gentechnik (z.B.BVL2008).Zu betonen ist, dass auch dieEntschlüsselungundAnalyse vonGeneneiner Pflanzenartsowieein vertieftes Verständnis von StoffwechselprozessenzuGrüner Gentechnikgehörenund nicht einzig die gentechnische Veränderung von Erbgut oder die Schaffung transgener Pflanzen. Im Zentrum der Diskussionen steht aber zumeist ausschließlichletzterer Aspekt.
Die Ziele, die mittels gentechnischer Verfahren verfolgt werden, unterscheiden sich prinzipiell wenig von denen der konventionellen Pflanzenzüchtung. Allerdingsgestatteterst die Gentechnik
„[…]eine direkte Steuerung der Veränderung des Erbgutes und den Austausch genetischer Informationen nicht nur innerhalb einer Art, sondern auch zwischen völlig verschiedenen Organismen. Die Grüne Gentechnik ermöglicht so den Zugriff auf neue Eigenschaften, die mit klassischer Züchtung nicht zu erreichen wären“ (BVL2008:6).
Diese Einschätzungist allerdingsnicht unumstritten.Eine insgesamt sehr zentrale und strittige Frage ist, ob Grüne Gentechnik ein gänzlich neues und potentiell gefahrenbehaftetes Verfahren oder lediglich eine Weiterentwicklung der schon seit Jahrtausenden stattfindenden Selektion und Züchtung von Pflanzen und Tieren durch den Menschen darstellt.
Als wichtige Ziele, die mit gentechnischen Verfahren verfolgt werden, zählen typischerweise die Verbesserung der Erträge und der Produktqualität sowie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge, Herbizide und Witterungseinflüsse. Weiterhin wird eine Veränderung der Inhaltsstoffe von Nutzpflanzen angestrebt (mehrVitamine,bessere oder gesündere Fettsäurezusammensetzung). Außerdem wirdan Pflanzenmit reduziertem Allergie- und/oder Unverträglichkeitspotential gearbeitet (z.B.BVL2008)[16].Dabei wird zumeist zwischen so genanntenInput-TraitsundOutput-Traitssowie Pflanzen (oder Grüner Gentechnik) der ersten und zweiten Generation unterschieden.Input-Traitsbezeichnenagronomische Merkmale, die auf eine Verbesserung der Anbaueigenschaften zielen. Dazu zählen z.B. Herbizid- und Insektenresistenzen von GV-Nutzpflanzen. Entsprechende gentechnische Veränderungen stehen im Zentrum der Grünen Gentechnikder ersten Generation.
Die zweite Generation zielt hingegen vorrangig auf eine Veränderung der Qualitäts- und Produkteigenschaften von Pflanzen, die Output-Traits. Zu diesen gehören beispielsweise dieOptimierung der Zusammensetzung vonProteinen,Ölen, Kohlenhydraten, Vitaminenund Antioxidantien.Aber auch eine veränderte Haltbarkeit von Pflanzen oder die Reduzierung von Allergenen sind den Output-Traits zugeordnet.Hierbei ist neben der Anpassung der Pflanzen an industrielle Bedürfnisse (wie z.B. die Papier- oder Stärkeindustrie) vor allem der Verbraucherder Adressatder Veränderungen der Pflanzen[17].Die erste Generation der Grünen Gentechnik zieltalsoauf Vorteile für die Produzentenseite von GVP, die zweite Generation konzentriert sich mehr auf die Verbraucherseite (zu der sowohl industrielle Abnehmer[18]als auch KonsumentInnen von Nahrungsmitteln zählen), wobeider FokusaufPflanzenliegt, die als Futter- oder Lebensmittel verwendet werden.Die Ziele und Anwendungen gentechnischer Pflanzenzüchtung lassen sich nachHucho et al.(2005) wieinTabelle2gezeigtzusammenstellen[19].Viele dieser Ziele bzw. Anwendungen können in Kombination vorkommen, so z.B. eine gleichzeitige Herbizid- undInsektenresistenzvon Pflanzen, die bereits die Marktreife erlangt hat. Seit 2010 ist in den USA ein GV-Mais mit acht veränderten Genen zugelassen, der gleichzeitig gegen mehrere Schädlinge und verschiedene Herbizide resistent ist (SmartStax)[20].
Tabelle2:Züchtungsziele und Anwendungsbereiche gentechnischerPflanzenzüchtung
Quelle:Hucho et al.2006:295.
Input-Traits
Output-Traits
Resistenz gegen
Schadinsekten,Nematoden,
OptimierungderZusammensetzung von
Kohlenhydraten,Aminosäuren,
Pilze,
Fettsäuren,
Bakterien,
sekundären
Viren,Herbizide.
Pflanzeninhaltsstoffen
inkl. Vitaminen.
Toleranz gegenüber
Trockenheit, Hitze,
Reifeverzögerung
Kälte, salzigem oder
saurem Boden,
Schwermetallen.
verbesserte Stickstoffaufnahme
Verarbeitungseigenschaften
verbesserte Nährstoffeffizienz
Haltbarkeit/ Lagerungseigenschaften
Hybridzüchtung (männliche Sterilität)
Produktion nachwachsender Rohstoffe
Herstellung rekombinanter Proteine zu therapeutischen Zwecken (Antikörper, Enzyme, Impfstoffe)
Ziel:
Ziel:
Verbesserung agronomischer Eigenschaften
Verbesserung der Produkteigenschaften
Die Zulassung von SmartStax zum Import und zur Verarbeitung könnte auch in Europa in baldiger Zukunft erfolgen, gegenwärtig ist die Sicherheitsbewertung abgeschlossen, die diesem Mais dieselbe Sicherheit wie konventionellem Mais bescheinigt.Auch verschiedene weitere Kombinationen aus Input- und Output-Traits sind prinzipiell möglich. Allerdings befindet sich ein großer Teil dieser Ziele noch im Stadium der Forschung oder ist gerade erst in der Entwicklung. Dies trifft vor allem für Veränderungen bei den Output-Traits, aber auch bzgl. abiotischer Stresstoleranzen zu.
Viele Entwicklungen in diesenBereichensindzwarbereits weit fortgeschritten,bis zur Markteinführung bzw. dem großflächigen Einsatz werden aber meist noch Jahre vergehen.Ehe es zu einem großflächigen Einsatz bzw. Anbau kommt, sind viele Prüfungen und Kontrollen zu durchlaufen sowie weitere rechtliche Vorgaben zu erfüllen.Üblicherweise vergehen mindestenszehnJahrevonder Entwicklungbis zur Markteinführung.Große Erwartungen werden vor allem in Toleranzen gegen abiotischen Stress gesetzt, da derartige Pflanzen in Zeiten der Ressourcenknappheit und des Klimawandels zur Ressourcenschonung und der Erschließung von bislang ungeeigneten Flächen zur Nahrungsmittel- und Energieproduktion beitragen könnten.Abgesehen von Versuchsanbauten und Freisetzungen liegenaberfaktischnurfür die Input-TraitsHerbizid- und Insektenresistenz(und deren Kombination)Erfahrungen aus dem großflächigen Anbau vor.Bei Herbizidresistenzen wird Pflanzen mittels gentechnischer Verfahren ein Gen zugefügt, das sie unempfindlich gegen bestimmte Herbizide macht. Wirddanndas entsprechende Herbizid eingesetzt,nehmendie Pflanzen keinen Schaden, während die Unkräuter (bzw. Beikräuter) bekämpft werden. Produziert eine Pflanze aufgrund zugefügter Gene Giftstoffe, die auf bestimmte Insekten wirken, spricht man vonInsektenresistenz. Eine ausführlichere Darstellung dieses Konzepts findet sich in Abschnitt2.2.3.
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über dieEntwicklungdes kommerziellen Anbaus von GVPweltweit, in Europa undinDeutschland.
2.2.2Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen:weltweit
Seit dem Beginn des kommerziellen Anbaus von GVP im Jahr 1996 steigen die weltweiten Anbauflächen jährlich.Zumeist nimmt auchin den Ländern, in denen GVP angebaut werden, derenAnteilan der Gesamtflächestetigzu.Die folgenden Darstellungen gehen schwerpunktmäßig auf das Jahr 2008 ein, da dieser Zeitpunkt den Bezugsrahmen fürden empirischen Teil (siehe KapitelIV) markiert, ohne dabei jedoch neuereErgebnisseauszublenden.
Die Agro-Biotechnologie-AgenturISAAA(The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications)[21]erstellt jährlich einen Statusbericht zum weltweiten Stand der Agro-Biotechnologie, der,wenngleich nicht unumstritten, so doch die umfassendste Zusammenstellung zur Anbausituation von GVP ist.Zu denStaatenmit den größten Anbauflächen zählenseit längeremdie USA, Argentinien, Brasilien, Indien und Kanada[22]. Aber auch in China, Paraguay und Südafrika werden auf jeweilsmehreren Millionen HektarGVPausgebracht (James2011,2012). 2008 wurdenbeispielsweisein 25Staaten insgesamt auf 125Millionen HektarGVPkommerziell angebaut.Damit wurden GVP von 13,3Millionen Landwirten weltweit genutzt.Dies bedeutet gegenüber 2007 eine Steigerung von knapp 10% der Fläche mit GVP sowie eine Zunahme um 1,3Millionen Landwirte (James2008).Dieser Trend setzt sich kontinuierlich fort, so dass 2010 weltweit rund 148MillionenHektarGVP in 29Ländern von etwa15,4Millionen Landwirtenkommerziell kultiviert wurden (James2010)[23].Die gemäß der Entwicklungstrends der letzten Jahre zu erwartende Zunahme des weltweiten Anbaus (z.B.FAO2011;USDA2011)bestätigt sichauchfür 2011und 2012.Nachrund 160Millionen Hektarim Jahr 2011 wurden 2012weltweitrund 170Millionen HektarGVPangebaut(James2011,2012).Zudem wurden 2012 erstmals in den so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern mehr GVP kultiviert als in den Industrieländern (James2012).
Zu den wichtigsten Pflanzen der kommerziellen Nutzung zählen Sojabohnen, Mais, Raps und Baumwolle. Aber auch der Anbau von GV-Zuckerrüben nimmt stark zu.Anhang1gibt eine Übersichtzur Anbausituation und der Verteilung der Flächen auf die einzelnen Länder für das Jahr 2008. Im Trend bleibt diese Verteilung erhalten, die mengenmäßig größten Zuwächse finden sichin der Regelin denHauptanbaustaaten.Rund80% des weltweiten Anbaus von GVP finden in drei Staaten (USA, Argentinien, Brasilien) statt. Betrachtet man die neungrößten Anbaustaaten, so decken siefast98% desgesamten Anbausvon GVP ab.Der Anteil Europas ist im weltweiten Verhältnis als marginal zu bezeichnen (siehe Abschnitt2.2.4).
Bei den vierHauptkulturartenmitgentechnischenVeränderungen liegt der Anteil an GVPzum Beispiel für 2008zwischen rund 20% und 70%der gesamten weltweiten Nutzfläche der jeweiligenArt(Tabelle3)[24].
Tabelle3:Anbauflächen weltweit nach Sorten
Quelle: Darstellung nachJames2008.
Gesamtfläche
(Millionen Hektar)
Fläche GVP
(Millionen Hektar)
Anteil GVP
Sojabohnen
91
65,8
72%
Mais
161
37,3
23%
Baumwolle
33
15,5
47%
Raps
28
5,9
21%
Die dominierende gentechnische Veränderung ist dabei eine reine Herbizidtoleranz, die über 60% der Flächen mit GVP ausmacht. Auf mehr als 15% der Flächen mit GVP sindInsektenresistenzen vorzufinden, kombinierte Herbizid- undInsektenresistenzen auf gut 20% der Flächen (James2008, 2010). Davon entfällt der Großteil der Herbizidresistenz auf Soja, Zuckerrüben und Raps. DieInsektenresistenzist vor allem bei Mais und Baumwolle zu finden, wobei der Trend bei diesen beiden Arten in Richtung Mehrfachresistenzen bzw. kombinierte Resistenzen geht. So war zum Beispiel in den USA für 2008 die größte Zunahme im Bereich von kombiniertem Mais zu verzeichnen, der über Resistenzen gegen zwei Pflanzenschädlinge (Maiszünsler und Maiswurzelbohrer) und eine gleichzeitige Herbizidtoleranz verfügt (James2008).
In den Folgejahrenhaben die Flächen(und GVP-Anteile)vor allem bei diesen vier Sorten zugenommen. Insbesondere bei Sojabohnenund Baumwollemachen GVP2012nunmehr rund 80% des weltweiten Anbaus aus(James2011, 2012).
Wie eingangs erwähnt, ist gegenüber den Zahlen der ISAAA kritischanzumerken, dass sie zum Teil etwas von der tatsächlichen Situation abweichen können bzw. gewisse Unschärfen aufweisen. Sowurdenfür Deutschland oftmalsdie für den Anbau von GVP angemeldeten Flächen aufgeführt, von denen aber üblicherweise ein Teil zurückgezogen wurde, so dass der tatsächliche Anbau auf einer geringeren Fläche stattfand. So wurden 2008 rund 4500Hektar für die Bewirtschaftung mit GVP gemeldet, von denen dann knapp 3200Hektartatsächlich dafür genutzt wurden(BVL2009b).Allerdings sind diese Abweichungen auf der Ebene der internationalen Gesamtzahlen eher als marginal zu betrachten[25].Der Bericht der ISAAA ist der umfassendste seiner Art zum weltweiten Stand und Vergleich der Grünen Gentechnik.
2.2.3Grüne Gentechnik in Europa und Deutschland
Um die Grüne Gentechnik werden in Europa und speziell in Deutschland spätestens seit dem ersten offiziellen Importvon GVP(GV-Sojabohnen) im Jahr 1996 heftige Kontroversen geführt. Mit dersteigendenweltweiten Verbreitung und Nutzungvon GVP nehmenauch die Debatten weiter zu.Das bekannteste Beispiel der Grünen GentechnikhierzulandeistGV-Maismit dem Input-TraitInsektenresistenz, so genannterBt-Mais.Bei diesemMais wurden dessen Erbgut DNA-Sequenzen des BodenbakteriumsBacillus thuringiensis(Bt) hinzugefügt[26]. Dieses Bakterium produziert ein Gift, das schädlich fürInsekten(vor allemder Ordnungen der Käfer, Schmetterlinge und Zweiflügler)ist, aber als harmlos für andere Lebewesen angesehen wird(z.B.Wenzel2005).Diese Wirkung des Bakteriums ist bereits seit langer Zeit bekannt und wird sowohl im konventionellen Pflanzenschutz als auch in der biologischen Landwirtschaft genutzt(z.B.BVL2008;Pickardt2002b).
DieVorteilevon Bt-Präparaten liegen nebeneiner prinzipiellenUnschädlichkeit für Säugetiere und Menschen in ihrer spezifischen Wirkung. Einzelne Varianten des Bt-Toxins können zielgerichtet gegen die jeweiligen Schädlinge einer Kulturart eingesetzt werden, ohnedieNützlinge zu gefährden(z.B.Renneberg2007).Die Präparate müssen maschinell auf die Felder ausgebracht werden, was neben der Bestimmung für den optimalen Ausbringungszeitpunktdes Pflanzenschutzmittelsauch mit weiterem Aufwand und Kosten verbunden ist[27].An dieser Stelle setzt das Konzept des Bt-Mais an. Durch das in das Erbgut des Mais eingebrachte Bakterium exprimiert dieser nun eigenständigeinBt-Toxin, so dass keine Bt-Präparate mehr ausgebracht werden müssen. Dieses Konzept findet vor allem Anwendungbei zwei Hauptschädlingen im Maisanbau, dem Maiszünsler und dem Maiswurzelbohrer sowie beiBaumwollschädlingen.Auch bei weiteren Kulturarten wird daran gearbeitet, das Bt-Konzept für die Schädlingsbekämpfung einzusetzen, so z.B. bei Kartoffeln,Apfelbäumen oder Kohl (z.B.TransGen2006).Dass dieses Konzept nicht unumstritten ist und welche Schwierigkeiten gesehen werden,wird inAbschnitt2.3.2ausgeführt.In der öffentlichen, teilweise aber auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung (primärin Deutschland undinEuropa) werdenoftsämtliche gentechnischen Veränderungen an Maisunterdem Begriff Bt-Mais zusammengefasst.Dies ist insofern nicht trennscharf, da es neben den auf dem Bt-Konzept basierenden Veränderungen auch herbizidresistenten Mais gibt.Weilaber bislangnur insektenresistenter Maisinnerhalb der EUangebaut werden darf, kann diese Verallgemeinerungvorwiegendim Kontext mit Importen bzw. der internationalen Situation zu Ungenauigkeiten führen[28].
Weiterhin ist festzuhalten, dass es nichtdenBt-Mais gibt. Vielmehr ist es so, dass bei der Entwicklung von GVPzunächst eine Pflanzenzelle transformiert wird mit dem Ziel, dasGenkonstrukt in das Genom der Pflanze zu integrieren.Dabei wird jede erfolgreiche Transformation alsEventbezeichnet und mit einem bestimmten Kürzel versehen.Einzelne Eventskönnen sich bisweilen starkvoneinanderunterscheiden.Als GVO gilt jede Pflanzenlinie, die auseinem bestimmten Event hervorgeht.Das jeweilige Event kanndannspäter in verschiedene Sorten eingekreuzt werden(BioSicherheit2009b).Da es neben verschiedenen Events auch mehrere Maissorten gibt, in die die verschiedenen Events eingebracht werden können, existieren faktisch unterschiedliche Bt-Mais-Sorten, die aber üblicherweise anhand des Events charakterisiert werden[29]. Zu dem bekanntesten Event, das auch in vielen Maissorten zu finden ist, gehört MON810 der Firma Monsanto[30].Dabei GV-Maisinnerhalb der EU ausschließlich der Anbau von Bt-Mais der Linie MON810 erlaubt ist, beziehen sich gewöhnlich alle Aussagen zu Bt-Mais in Europa auf diesen(auch wenn in anderen Ländern weitere Bt-Maislinien zugelassen sind).Mais dieser Linie ist resistent gegen den Maiszünsler und exprimiert eigenständig ein Bt-Toxin, dass die Larven dieses Fraßschädlings abtötet[31].
Bis 2010 warausschließlich der Anbau von Bt-Mais MON810 innerhalb der EU erlaubt[32]und dieserwurdevorrangig alsKörner- oder Silomaisunmittelbarals Tierfutterverwendet[33].Seit März 2010 kann auch die GV-KartoffelAmflorafür kommerzielle Zwecke angebaut werden. Allerdings dürfen eine VielzahlweitererGVP eingeführt und zu verschiedenen Zwecken genutzt werden. Dies betrifft sowohl weitere Bt-Maislinien als auch GVP wie Raps, Baumwolleoder Soja, für die keine Anbauzulassung in der EU vorliegt[34]. Diese dürfen dann beispielsweise für Lebens- und Futtermittelzwecke verwendet oder weiterverarbeitet werden(z.B.Europäische Kommission2013).Eine aktuelle Übersicht der in der EU zugelassenen GVO bzw. GVP findet sich auf den Seiten der Europäischen Kommission (Europäische Kommission2013).Auf längere Sicht ist davon auszugehen, dass neben Bt-MON810undAmfloraweitere GVP eine Anbauzulassung in der EU erhalten werden, da bereits mehrere entsprechende Anträge vorliegen, die zum Teilschondie Prüfungen und Sicherheitsbewertungen durchlaufen haben. Allerdingssind sich die europäischen Staatenbei Fragen der Grünen Gentechnik, vor allem der Zulassung von GVO und GVP, häufig nicht einig, so dass dieentsprechendenVerfahren über lange Zeiträume andauern können.
Die unterschiedlichen Einstellungen der europäischen Staaten zu Grüner Gentechnik zeigen sich auch bei einem anderen Punkt: So ist zwar der Anbau von Bt-MON810 innerhalb der EU erlaubt und darf nach geltendem Rechtnicht von den Mitgliedsstaaten untersagt werden, es sei denn, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine Gefahr für den Menschen oder die Natur annehmen lassen(EU 2001/18/EG). Trotz derwiederholten Unbedenklichkeitseinschätzungvon MON810 durch dieEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit(EFSA)[35]gelten derzeitnationale Anbauverbotez.B.inÖsterreich, Frankreich, Ungarn und Griechenland (Agra-Europe 2009a) sowie seit Ende März 2009 in Luxemburg.Auch in Deutschland erreichte die Diskussion um Anbauverbote im Frühjahr desselben Jahres einen neuen Höhepunkt. So wiesAgrar- und VerbraucherschutzministerinAigner bereits im Februar 2009 darauf hin, dass „die Grüne Gentechnik […] dem Menschen hierzulande bisher keinen erkennbaren Nutzen [bringt]“ (Berliner Zeitung 2009). Rund zwei Monate später, im April 2009, verhängte sie mit sofortigerWirkung ein Anbauverbot für MON810 in der Bundesrepublik Deutschland (BMELV 2009a).Unter Berufung auf die so genannte Schutzklausel des Europäischen Gentechnikrechts(Artikel 23 der Richtlinie 2001/18/EG)in Verbindung mit dem deutschenGentechnikgesetz(GenTG) (§ 20Abs. 2)wird somit dasRuhen der Genehmigung von MON810 angeordnet[36].
Derartige nationaleVerbotesind bereits mehrfachvon derEFSAüberprüft worden, die aktuellen Ergebnisse der Sicherheitsforschungbieten danach aberkeine Anhaltspunkte für eine Rücknahme derAnbauzulassung von MON810(z.B. EFSA 2008b)[37].Das derzeit in Deutschland geltende Verbot wurdein mehreren Instanzenprinzipiellbestätigt undsomit sind die Klage imEilverfahren und der Einspruch der Firma Monsantoabgelehnt(NOVG2009)[38].Um derartigen nationalen Bestrebungen Rechnung zu tragen, wird auf Ebene der EU auch eine Re-Nationalisierung der Zulassung und des Anbaus von GVP diskutiert, siehe hierzu ausführlicher Abschnitt2.2.5.Es bleibt abzuwarten, ob die aktuellen Anbauverbote(und Re-Nationalisierungstendenzen)wie beimMoratorium 1998zu einer Auseinandersetzung vor der Welthandelsorganisation (WTO) führen, da die Verbotegegenwärtignur den Anbau, nicht aber den Import und die Zulassung weiterer GVO und GVP betreffen. Damalshatten die USA und zwölf weitere Staaten(mit den USA, Kanada und Argentinien als Beschwerdeführern)dasEU-Moratorium als unzulässigen Verstoß gegen das Welthandelsabkommengesehen und die WTO angerufen. Diese Verfahrengegen die EUsindteilweise noch immer anhängig (z.B. seitensderUSA und Argentinien),wobei aber auch gütliche Einigungen zu verzeichnen sind, so zuletzt mit Kanada (Agra-Europe2009c;EU2009b)[39].
Zusammenfassend lässt sich die Situation in Deutschland und Europa folgendermaßen beschreiben: Die Grüne Gentechnik hat Einzug gehalten, aber ihr Einsatz ist sehr zögerlichund findet vor allem in den Bereichen der Zusatzstoffe und (importierter) Futtermittel statt.Im Supermarkt ist für den Endverbraucher davon bislang bis auf importierte Lebensmittel faktischwenig zu merken, daüblicherweise auf kennzeichnungspflichtige Produkte(siehe Abschnitt2.2.5)verzichtet wird. Innerhalb der EUdürfen verschiedene GVO bzw. GVP importiert und verwendet werden, der Anbau ist aberprinzipiellauf Bt-Mais der Linie MON810 begrenzt.Die GV-KartoffelAmflorawurde kurzzeitiginbegrenztem Umfang kultiviert, 2012 wurde ihre Vermarktung eingestellt.Der Umgang mit Grüner Gentechnik ist sehr unterschiedlich, so dasstrotz eines gemeinsamen europäischen RechtsrahmensineinigenMitgliedsstaaten GVP angebaut werden, in anderen hingegen nationale Anbauverbotegelten.Die





























