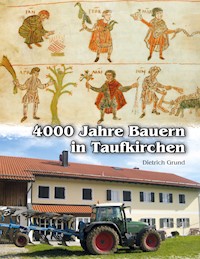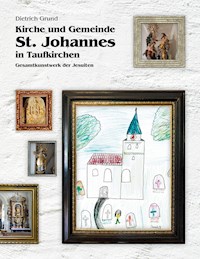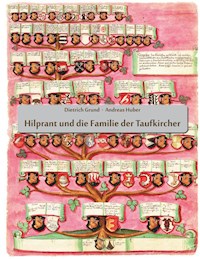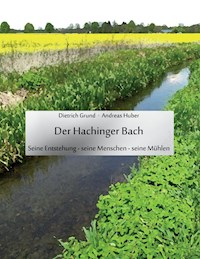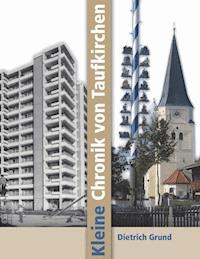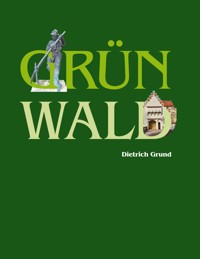
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es geht um die Geschichte der Gemeinde Grünwald im Isartal mit den Herzögen, den Wäldern, der Jagd und der Fischerei.
Das E-Book Grünwald wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Isar,Grünwalder Forst,Isarflößerei,Geschichte,Ortsgeschichte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 43
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Grünwald
Grünwald ist heute für viele Menschen ein Synonym für Reichtum. Vor 100 Jahren war Grünwald noch ein Bauerndörfchen wie viele …
Karl Valentin (alias Valentin Ludwig Fey, 1882–1948) behauptete in Grünwald im Isartal hätten früher „edle Ritter g´haust“. Das stimmt nicht ganz. Aber immerhin, es waren Grafen und Herzöge, die hier dem Jagdvergnügen oblagen und auch Politik machten…
Das Portal
Inhalt
Vorzeit
Frühgeschichte
Missionszeit
Mittelalter
Neuzeit
Die Burg
Baustoff Holz
Die Jagd
Die Fischerei
Waldliebe
Waldpflege
20. Jahrhundert
Literatur
Bildnachweis
Vorzeit
Geologen beschreiben so die Anfänge: „Die Landschaft Südbayerns … wurde und wird geprägt durch das junge Faltengebirge der Alpen. In der ausgehenden Tertiärzeit [vor 2,5 Millionen Jahren] brachten breite Flüsse den Verwitterungsschutt des langsam aufsteigenden Gebirges ins Vorland. In der nachfolgenden Quartär-Zeit … quollen die Eismassen der Gletscher mehrfach aus den Alpentälern und lieferten wiederum Gesteinsschutt weit in das Vorland ... Die von Gletscherschmelzwässern aus den Moränenwällen nordwärts ausgewaschenen Schotter aber formten die weite Ebene um München.“1
Vor 10.000 Jahren, mit dem Ende der Eiszeit, erhielt die Landschaft dann mit den Moränenhügeln, den Mooren und Schotterflächen und den wenigen Gewässern ihre kaum noch veränderte Gestalt.
Grünwald Parkgarage, Grabungen 2000 u. 2009, Urnenfelderzeit 13. bis 9. Jahrhundert vor Christus2
In der Schotterebene entwickelten sich nach Moosen, Flechten, Büschen schließlich riesige Wälder. Grabungen im Bereich des Gymnasiums im Jahr 2013 zeigten sog.
Hockergräber aus der Bronzezeit (2200-1500 v. Chr.). Danach lösten sich in ununterbrochener Folge Hügelgräber, Urnengräber und die Reihengräber des Frühmittelalters ab.
1 Broschüre „Sand, Kies und Knochen, München 1978, S. 4
2 CAROLA METZNER-NEBELSICK (HG.), EINBLICKE IN DIE VORGESCHICHTE GRÜNWALDS, MÜNCHEN 2016
Frühgeschichte
Kurz vor Christi Geburt hatten die Römer das Voralpengebiet erobert. Die Provinz nannten sie Raetien nach dem hier ansässigen Stamm der Räter. Vom späteren Augsburg ausgehend bauten sie zur Landeserschließung und als Transportwege drei ostgerichtete Staatsstraßen. Teilweise benutzten sie dabei Trassen der Vorzeit.
Die Hauptstraßen kreuzten bei Grünwald, Oberföhring und Freising die Isar.
Nach dem Abzug der Römer herrschte für knapp 50 Jahre (489-536) eine bedeutende ostgotische, arianische Fürstenfamilie beim heutigen Unterhaching über unser Gebiet. Ihre überreich ausgestatteten Gräber wurden dort gefunden3.
536 übergab der Ostgotenkönig das ehemals römische Rätien an die Könige des aufstrebenden Frankenreiches, die sich aus macht-politischem Kalkül taufen ließen. In dem Gebiet (Dukat) regierte um 550 im Auftrag des Frankenkönigs Childebert I. reg. 511 - 558) der „fränkische Dux Garibald (nach 500 - 593).“4
Er gebot über alles Land einschließlich der Wälder, die großteils zu königlichen Forsten erklärt wurden. Hier durfte nur der Adel jagen, während den Bauern lediglich erlaubt war, ihr Vieh zum Grasen in den Wald zu treiben.
Grünwalder Forst
Aus „Zugeroasten“ formte sich seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts innerhalb weniger Jahrzehnte der Stamm der Bajuwaren5.
„Landnahme, Landesausbau und Rodung folg[t]en hier rasch aufeinander (Diepolder).“
Sie war im Wesentlichen am Ende der Agilolfingerzeit im Jahr 788 abgeschlossen.
Die Agilolfinger waren eine königsnahe, großfränkische Adelsfamilie. Sie stellte in Bayern und Schwaben die frühen Herzöge.
Sie erschlossen durch Herzogshöfe und neue Klöster das Land.
Tassilo III. (748 – 788) regierte wie ein König. Er besiegte die heidnischen Karantanen und erweiterte sein Herrschaftsgebiet nach Süden und Osten.
Der erste bekannte Bayernherzog in der Mitte des 5. Jahrhunderts war Garibald. Im Jahr 716 bekam Herzog Theodo vom Pabst die Erlaubnis in Salzburg, Regensburg, Freising und Passau Bistümer zu errichten. Der Wanderbischof Korbinian wirkte ab 724 (vor 1300 Jahren) in Freising.
3 Archäologische Staatssammlung, Katalog der Ausstellung Karfunkelstein und Seide, München 2010
4 Gertrud Diepolder, Das Hachinger Tal – Fiskus Haching in Bayerische Vorgeschichtsbl. Jg. 75, München 2010, S. 189
5 Brigitte Haas-Gebhart, Die Baiuvaren, Verlag Fr. Pustet, Regensburg 2013
Missionszeit
Um das Jahr 720 nach Christus rief Herzog Grimohald II. (reg. 702 - 723) den Wanderbischof Korbinian an seinen Hof in Freising. Korbinian wurde um 670 – 680 bei Paris geboren und starb um 724 – 730 in Freising. Seine Mutter war Irin, der Vater ein Franke. Das Jahr 720 gilt als Gründungsjahr des Bistums Freising, welches sich zu einem bedeutenden christlichen Zentrum entwickelte. Er begründete auch das Kloster in Kues (Südtirol). Die Legende sagt, ein Bär habe das Pferd des Heiligen getötet und zur Strafe musste dann der Bär sein Gepäck tragen.
Bonifatius, „der Apostel der Deutschen“ und Nachfolger Korbinians (um 673 bis um 754), bewegte Papst Leo III. (res. 795 – 816) das Erzbistum Salzburg zu errichten und ihm die Bistümer Freising, Neuburg, Passau, Regensburg und Säben (Südtirol) zu unterstellen.
Unter dem drittnächsten Nachfolger Arbeo (764 – 783) erlebte die Diözese eine erste Blüte. Laut einer der Freisinger „Traditionen“ (Schenkungsbücher) weihte der Kirchenherr 778 persönlich die Kirchen in Pullach und Oberbiberg. Sie wurden mit ihrem Besitz an die Zentralkirche in Freising überschrieben. .
Gaudi-Floßfahrt Wolfratshausen - München
Zusammen mit „Genossen“ hatten Rihheri und Wuolfhart die Eigenkirche in Oberbiberg gebaut, Husina und Irminpald das Gotteshaus in Kreuzpullach.6 Eine stattliche Reihe von Adeligen beurkundete die Schenkungen der „Privatkirchen“.
Die Freisinger Bischöfe erwarben nach und nach einen beträchtlichen Grundbesitz. Sie zählten Ländereien im Süden bis zur Halbinsel Istrien ihr Eigentum.