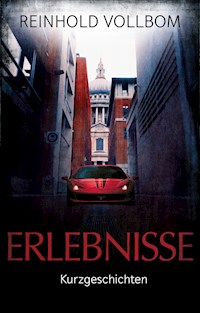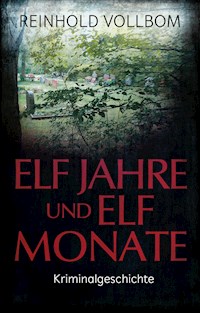Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
24 Kriminalgeschichten voller Spannung, Scharfsinn und Witz. Geschichten von kleinen und großen Verbrechen, von Heimtücke, Betrug und von Hinterlistig-Durchdachtem, das im Täter schlummert und ihn früher oder später zur Bestie werden lässt. Und ausgefuchste Ermittler die, scharfsinnig und geschickt, diesem Bösen ein Ende bereiten. Oft ist es das Ermittler-Duo, mit Kommissar Steffen und seinem Assistenten Kröger, die auch die kniffligsten Fälle der Mordkommission erfolgreich entwirren und die Täter verzweifeln lassen. Eine Geschichte klärt auf: Nicht immer muss man in der Sauna schwitzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhold Vollbom
Grüße von Charon
4.Gruß
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Hinweis zum Titel Grüße von Charon
Tod im Rückwärtsgang
Tödliche Erbschaft
Opfer der Liebe
Tote können nicht schreiben
Wenn Liebe tötet
Die Rache des Bruders
Verschollen in Afrika
Kurzes Erwachen
Der Polizeibericht
Ungeduldige Erben
Die Verpflichtung
Bankgeschäfte
Das Versprechen
Die Reifeprüfung
Verrechnet
Partnertausch
Geliebt und gehasst
Mörderischer Plan
Der Kronzeuge
Im Varieté
Eiskalt serviert
Vier Pfoten und ein Mord
Todeskälte in der Sauna
Am Scheideweg
Impressum neobooks
Hinweis zum Titel Grüße von Charon
In der griechischen Mythologie ist Charon der düstere, greise und unbestechliche Fährmann, der die Toten in einem Binsenboot über den Fluss Acheron (andere Fluss-Namen sind Lethe und Styx) zum Eingang des Hades (Unterwelt) übersetzt. Auf die Fähre durfte nur, wer die Begräbnisriten empfangen hatte. Die Überfahrt musste mit einer Geldmünze bezahlt werden. Die Münze wurde den Toten unter die Zunge gelegt.
Tod im Rückwärtsgang
»Hi, Paul. Ich habe gehört, du fährst heute nicht?!«
Paul Jäckel knurrte dem Kassierer, am Eingang des Fahrerlagers, eine unverständliche Antwort zu. Logisch fährt er heute nicht, sonst wäre er längst hier gewesen. Außerdem hätte er dann auch nicht diesen abgetragenen blauen Monteuranzug angehabt, in dem er seine beiden Hände tief vergraben hatte.
Heute war der entscheidende Renntag, an dem die Fahrer der Tourenwagenklasse alles aus sich herausholen würden. Nur die Besten qualifizierten sich hier im Vorlauf. Jeder der in dieser Klasse Rang und Namen hatte, begab sich heute an den Start. Nur er nicht. Nachdem ihm der Technische Leiter aus seinem Lager vorgestern den Laufpass gegeben hatte. Sparen, hatte man ihm gesagt. Weil ein Sponsor aus dem Tourenwagen-Lager ausgestiegen war, hieß es haushalten. Einer der beiden Fahrer blieb damit auf der Strecke. Und das war er, Paul Jäckel. Obwohl alle wussten, dass er, aufgrund seines Alters, von keinem anderen Fahrer-Lager eine neue Chance erhalten würde. Hier zog sich ein Riss durch sein Leben. Dies allein war die Schuld von Ricky. Ricky, dem man ihm gegenüber stets den Vorzug gab.
Paul Jäckel stand nun mitten im Fahrerlager. Um ihn herum herrschte hektisches Treiben. Wie auf einem riesengroßen baumbepflanzten Parkplatz befanden sich überall Tourenwagen der unterschiedlichsten Modelle. Bei den meisten ragten die geöffneten Motorhauben himmelwärts. Mit emsigen Bewegungen waren Monteure dabei letzte Änderungen an den hochstilisierten Motoren vorzunehmen.
Nur eines konnte Paul Jäckel wieder dorthin zurückbringen, wo seine Welt war: Ein Wunder oder der plötzliche Tod des Kontrahenten. Da er an Wunder nicht glaubte, blieb ihm nur der zweite Weg. Hämisch grinsend umklammerte die rechte Hand im Monteuranzug die Fernbedienung, welche das Problem lösen sollte. Die Linke hingegen umfasste den Empfänger mit dem schmalen Röhrchen, in dem der Sprengstoff untergebracht war. Nun kamen ihm seine Kenntnisse aus der Militärzeit zugute, – und auch das bisschen Sprengmittel, das er seinerzeit unbemerkt abzweigte.
Die halbe Nacht hatte er gegrübelt, wie er es anstellen konnte, dass Ricky durch einen bedauerlichen tödlichen Unfall ums Leben kam. Und schließlich fiel ihm die Lösung unversehens ein. In einem Spielwarengeschäft kaufte er sich einen ferngesteuerten eindrucksvoll aussehenden Rennwagen. Den Empfänger aus dem Spielzeugauto baute er aus. Der diente ihm als Zündmechanismus für das Sprengstoffröhrchen. Die Aufgabe der knetbaren hochexplosiven Masse war es, eine Kleinstexplosion auszulösen. Vorausgesetzt der Sprengstoff war im Rennwagen korrekt platziert, würde dies eine folgenschwere größere Explosion auslösen. Eine derartige Detonation, dass der Fahrer keine Möglichkeit mehr hatte das Fahrzeug lebend zu verlassen. Und auch die Reste seines Zündmechanismus würden hierbei unwiederbringlich vernichtet.
Paul Jäckels Gedanken liefen sich heiß. Du wirst mir nicht mehr im Wege stehen, schoss es ihm durch den Kopf. Sein Blick glitt an den Rand der Senke, in der das Fahrerlager eingebettet war. Dort zog sich die Rennstrecke, in einer unübersichtlichen Kurve, um das Lager herum. Sobald Ricky das dritte Mal in diese Kehre hineinfuhr, würde er den Steuerknüppel der Fernbedienung nach hinten zum Körper ziehen. Bis zu dem Punkt mit der Bezeichnung Rückwärtsgang. Gleich darauf würde das Ansaugteil der Benzinpumpe zerbersten und Feuer fangen. Der Wagen einen Augenblick außer Kontrolle geraten, von der Fahrbahn abkommen und im selben Moment explodieren. Explosion und Abdriften von der Rennstrecke wäre ein und dasselbe. Unterschätzt, er hat die Kurve einfach unterschätzt. Ricky galt als risikoreicher Fahrer. Sein Erfolg kam nicht von ungefähr. Paul Jäckel war mit sich vollauf zufrieden. Die vielen freiwilligen Jahre beim Militär, wo man ihn teilweise für ähnliche Aufgaben ausbildete, hatten auch ihr Gutes, fand er.
Mit einem Mal blieb er abrupt stehen. Etwa zwanzig Meter vor ihm befand sich Rickys Fahrerlager. Er schien tatsächlich allein zu sein. Die Mechaniker waren bereits an den Boxen. Schließlich stand das erste Rennen kurz bevor. Jetzt schwang sich Ricky in den Wagen. Paul musste sich sputen. Eilig griff er in seine Brusttasche. Er zog ein Mobiltelefon hervor, tippte eine Nummer ein und wartete ab. Er wusste das Ricky, bis kurz vor Rennbeginn, sein Handy bei sich trug. Warum er das machte, hatte bisher noch keiner herausgefunden, – aber er tat es.
Zwischen den hin und her hetzenden Mechanikern der anderen Teams, die erst zum zweiten Rennen dran waren, sowie Fahrern und Schaulustigen, fiel Paul Jäckel mit seinem Mobiltelefon nicht auf. »Ricky?!«, knurrte er mit verstellter Stimme ins Handy. »Hier ist die Einfahrt zum Fahrerlager. Sie wissen doch, die Durchfahrt kurz vor der Brücke. Jemand macht hier mächtig Rabatz. Er behauptet, Sie zu kennen. Am besten Sie kommen mal vorbei. – Ja, ich weiß, dass Rennen beginnt in einer knappen halben Stunde. Aber ich habe den Eindruck, dass es viel Ärger gibt, wenn Sie hier nicht gleich aufkreuzen.« Sofort darauf beendete Paul Jäckel durch betätigen einer Taste das Gespräch.
Mit einem Blick zu Ricky hinüber, erkannte er, dass dieser fluchend aus dem Fahrzeug sprang. Mit eiligen Schritten schlug er die Richtung ein, aus der er gerade kam. Ein Blick auf seine Armbanduhr. In zwei Minuten würde Ricky wissen, dass ihm jemand einen Streich spielte. Weitere zwei Minuten würde er benötigen, um hier zu erscheinen. Dann jedoch musste Paul Jäckel bereits wieder von der Bildfläche verschwunden sein.
In diesem Augenblick begab sich Ricky mit strammen Schritt und deutlich verärgertem Gesichtsausdruck an ihm vorbei. Er brauchte sich nicht zur Seite zu drehen, um von ihm nicht bemerkt zu werden. Hierzu starrte Ricky viel zu verbissen vor sich hin.
Noch ein reflexartiger Blick zur Uhr. Wenige Sekunden später stand er vor dem Tourenwagen Rickys. Der Wagen war ihm vertraut. Jeder Handgriff würde sitzen. Er war im Begriff, sich auf den Boden zu setzen, um unter die Rennmaschine zu kriechen, als ihn eine piepsige Stimme von der Seite ansprach.
»Ist der Wagen kaputt?«
Direkt neben ihm stand ein etwa achtjähriger Junge und sah ihn erwartungsvoll an. »Nein, nein, alles klar«, entgegnete Paul forsch. »Du musst da jetzt weggehen. Der Wagen wird hier gleich herausgefahren.«
»Fährst du den? Ist dein Freund schon zu den Boxen gegangen?«
Paul Jäckel sprach nun mit scharfem Unterton in der Stimme. »Verschwinde jetzt! Geh zu deinem Vater und sieh dem beim Reparieren der Autos zu.«
Der Kleine kicherte vor sich hin.
»Was ist?!«, fragte er ärgerlich. »Was gibt es da zu lachen?«
»Mein Vater fährt kein Rennauto. Der verkauft am Stand Bratwürste.«
»Himmel, Herr Gott, dann helfe ihm dabei!« Nervös fiel sein Blick auf den dahinrasenden Sekundenzeiger.
Der Junge konnte den spontanen Wutausbruch Paul Jäckels nicht einordnen und sah ihn überrascht und fragend an.
»Mein Gott, noch mal! Nun lass mich doch allein. Ich habe hier zu tun.« Schweißperlen bildeten sich auf der Stirn. Dann griff er in die Brusttasche seines Monteuranzuges, in der sich neben dem Telefon auch die Brieftasche befand. »Du magst doch sicherlich Autos, nicht wahr?!« Mit einer hastigen Handbewegung zauberte er einen größeren Geldschein heraus und gab ihm den Jungen. »Dort hinten habe ich einen Stand gesehen, an dem man Souvenirs und auch Spielzeugautos kaufen kann. Hier, nimm das Geld und kaufe dir etwas dafür. Deinem Vater werde ich nachher erklären, dass das in Ordnung geht. Also los, hopp! Verschwinde!«
Mehr aus Überraschung, als aus Freude, griff der Kleine den Geldschein und verschwand in der Menschenmenge.
Wieder fiel Paul Jäckels Blick auf die Uhr. Diesmal jedoch hektischer und nervöser als zuvor. Glücklicherweise konnte er sich an den eben von ihm beschriebenen Stand erinnern. Selbst, wenn der Junge sofort zurückkommen würde, hätte er nun die nötige Zeit, die er brauchte. Gleich darauf lag er unter dem Fahrzeug. Wie im Schlaf ertasteten seine Hände im Halbdunkel die von ihm gewünschte Stelle. Zündmechanismus und Sprengstoff waren eine Einheit. Diese wurden von ihm mit einem Nylonband nahe der Benzinpumpe befestigt. Ein wärmetauglicher, sofort härtender Metallkleber sorgte zusätzlich für einen untrennbaren Sitz.
Nachdem er gleich darauf wieder unter dem Tourenwagen hervorkam, fiel sein Blick zuerst auf die Uhr. Knapp, aber geschafft, schoss es ihm durch den Kopf. Dann drehte er sich blitzartig um und verließ die Stelle in entgegengesetzter Richtung, aus der er gekommen war. Keine Sekunde zu früh. Im selben Augenblick bemerkte er Ricky, wie dieser fast im Laufschritt den gepflasterten Weg zu seinem Wagen zurücklief. Sein Gesicht war puterrot vor Zorn.
Paul tupfte sich mit dem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn. Danach atmete er zweimal kräftig durch und verließ vergnüglich schlendernd das Lager. Wenige Meter weiter, auf der Anhöhe, setzte er sich bequem hin. Der Rest war, seiner Meinung nach, ein Kinderspiel.
Da, wo die Wagen mit der niedrigsten Geschwindigkeit in die Kurve fuhren, postierte sich Paul. Hier war der günstigste Abstand von seiner Fernbedienung zum vorbeirauschenden Rennwagen. Die Explosion würde Ricky, kurz vor dem Verlassen der Kurve, auf der äußeren Bahn erwischen. Dort gab es keine Zuschauer. Unbeteiligte konnten somit nicht verletzt werden.
Die nächste halbe Stunde verging wie im Fluge. Eine metallische Lautsprecherstimme drang, von der etwa dreihundert Meter entfernten Tribüne, klar und deutlich zu ihm herüber. Es war so weit. Paul Jäckel zog mit geruhsamer Bewegung die Fernbedienung aus seinem Monteuranzug. Hierbei verhielt er sich so unauffällig wie möglich. Schließlich musste er davon ausgehen, dass er unbeabsichtigt von irgendjemand an der Rennstrecke mit dem Fernglas beobachtet wurde. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben. Mit einer flinken Handbewegung zerrte er die Antenne aus dem postkartengroßen schwarzen Kästchen. Gleich darauf steckte er die Fernbedienung, mit dem Antennenstab voran, durch ein Loch in der Hosentasche wieder zurück. Der kühle Metallstab berührte seine angespannten Beinmuskeln. Sein Zeigefinger huschte über die Bedieneroberfläche der Fernsteuerung. Er fühlte und betätigte den Schiebeschalter zum Einschalten des Gerätes. Genüsslich und selbstzufrieden umklammerte seine Hand den kurzen Steuerhebel. Ein knapper Ruck, an dem kleinen Stab mit der Kugel obendrauf, wenn der Wagen von Ricky vorbeifuhr. Und der perfekte Mord nahm seinen Lauf.
Paul Jäckel hörte das Röhren der Rennmaschinen kurz vor der Startfreigabe. Die Worte aus dem Lautsprecher klangen nun rascher und lauter, als noch vor wenigen Minuten. Die Namen aller Teilnehmer des ersten Laufes wurden in hastiger Reihenfolge über den Lautsprecher mitgeteilt. Ohne besondere Aufmerksamkeit hörte er der blechernen Stimme zu. Sofort darauf wurde um Ruhe gebeten. Die Motoren heulten in einer letzten Verzweiflung auf, um ihre Energie explosionsartig freizugeben.
»Verflixt noch mal«, schimpfte Paul plötzlich überrascht, »warum zum Teufel hat er Rickys Namen nicht erwähnt …?«
»Weil ich mich kurzfristig auf den zweiten Lauf umschreiben lassen habe«, ertönte es mit milder Stimme auf einmal hinter ihm.
Paul fuhr erschrocken herum: Ricky! Er musste irgendetwas sagen, aber die Kehle war wie zugeschnürt. Nicht ein Wort drang über seine Lippen.
»Hat es dir die Sprache verschlagen?«
»Was machst du hier? Ich dachte, du fährst im ersten Lauf mit?!« Nur mühsam gewann Paul seine Stimme wieder.
»Dachte ich auch. Aber dann war da so ein Anruf, der mich von meinem Wagen weglockte. Da habe ich allerdings noch an einen Böse-Jungen-Streich geglaubt. Stutzig wurde ich erst, als so ein Knirps mit einem Rennauto zu mir kam und sich nach meinem Freund erkundigte. Er wollte sich für das tolle Auto bedanken, dass er sich von dem geschenkten Geld gekauft hatte. Aber alle Freunde waren bereits an den Boxen. Und plötzlich tauchte da so ein Freund auf, der sich die wenigen Minuten zunutze machte, die ich vom Wagen weggelockt wurde?! Seltsam, nicht Paul?« Er schmunzelte sein Gegenüber mit einem hintergründigen Lächeln an.
»Tja …«
»Dann ließ ich mir meinen Freund beschreiben«, spöttelte Ricky. »Auf dich bin ich nicht gekommen, weil mir der Kleine etwas von einem Mann im Monteuranzug erzählte. Also, dachte ich mir, gehe ich auf die Anhöhe. Von hier aus hat man einen guten Überblick über das Fahrerlager. Und da sehe ich auf einmal meinen alten Teamkollegen Paul. Oder war er es doch nicht? Und während ich noch am Überlegen war, ob du es sein könntest oder nicht, stutzte ich ein weiteres Mal. Die Fernbedienung, du hast die Antenne aus der Fernsteuerung gezogen und das Gerät in deine Tasche zurückgesteckt. Und da dachte ich mir, das muss der Paul sein, das kann kein anderer sein.«
Paul Jäckel fiel auf die Schnelle keine Erklärung für sein Verhalten ein. Durch das lärmende Röhren der Rennmaschinen hatte er nicht mitbekommen, wie Ricky sich ihm von hinten näherte. Auf jeden Fall musste er abwarten, was der von ihm wollte. »Warum konnte das kein anderer sein, den der Junge gesehen hat?« Paul sah Ricky verständnislos an.
»Weil du mir mal von deiner Militärzeit erzählt hast, wo du per Fernsteuerung Fahrzeuge in die Luft jagen musstest. Genau das fiel mir in diesem Moment wieder ein. Lass uns zum Lager zurückgehen.«
In scheinbar freundschaftlicher Gemütlichkeit schlenderten sie die Anhöhe hinunter.
»Und nun gib mir die alberne Fernbedienung, Paul.«
Dieser wollte protestieren, überlegte es sich aber kurzfristig anders und drückte ihm das schwarze Kästchen in die Hand.
Wie beiläufig schob Ricky die Antenne in das Gehäuse zurück und entfernte die Batterien aus dem Gerät. »Wenn wir am Wagen angekommen sind, baust du das wieder aus, was immer du mir da eingebaut hast. Klar?!« Die Frage war mit derartigem Nachdruck gestellt, dass sie keine andere Antwort zuließ.
»Wie kommst du darauf, Ricky, dass …«
Der Angesprochene blieb abrupt stehen und baute sich drohend vor Paul auf. »Hör mir zu, du verdammter Mistkerl. Ich könnte jetzt die Polizei rufen und dich hoppnehmen lassen. Für mehrere Jährchen wärst du dann aus dem Verkehr gezogen. Hast du das kapiert?!« Sein feuchter Atem schlug Paul ins Gesicht. »Stattdessen bekommst du von mir die Chance deine Wahnsinnsidee rückgängig zu machen.«
»Was … was verlangst du hierfür?«
Sekundenlang sah Ricky sein Gegenüber wortlos an, bis er wutschnaubend entgegnete: »Egal wo immer ich mich aufhalte, du wirst mindestens mehrere hundert Kilometer davon entfernt sein. Hast du verstanden?! Ich will dich nie wiedersehen. Und komme nicht auf die Idee, einen zweiten Versuch zu starten, das würde dir nicht bekommen. Noch heute werde ich bei einem Notar hinterlegen, an wem sich die Polizei wenden kann, sollte mir jemals ein Unglück zustoßen.« Fauchend stieß er Paul vor die Brust. »Und jetzt sieh zu, dass du das Ding aus meinem Wagen ausbaust. In einer Stunde beginnt der zweite Lauf.«
Gleich darauf erreichten die beiden Rickys Abstellplatz im Fahrerlager. Wortlos setzte Paul Jäckel sich auf die Erde und schob sich unter den Wagen.
»Da ist ja dein Freund«, ertönte plötzlich wieder die piepsige Stimme des Jungen.
Paul warf einen neugierigen Blick unter dem Wagen hervor. Vor ihm stand der Knabe mit einem nagelneuen Rennwagen, eingeklemmt zwischen Arm und Oberkörper. »Sieh zu, dass du Land gewinnst«, knurrte er den Kleinen an.
Der Junge entfernte sich mehrere Meter. Danach stellte er das Spielzeugauto vor seinen Füßen ab und sah verständnislos zu den beiden hinüber.
»Komm, zieh Leine.« Mit einem künstlichen Lächeln und einer entsprechenden Handbewegung, wies Ricky den Knaben an, zu verschwinden. Dann sah er durch die metallischen Innereien des Motorraumes hindurch und beobachtete Paul, der dabei war das Nylonband zu zerschneiden.
»Verflixt«, fluchte dieser mit verärgertem Gesichtsausdruck. »Ich habe das Röhrchen mit Metallkleber befestigt. Das Zeug hängt bombenfest dran.« Kaum das er die Worte ausgesprochen hatte, biss er sich auf die Lippen. Warum musste er auch ausgerechnet bombenfest sagen?!
»Aua!«, schrie er plötzlich lautstark und schmerzhaft. »Mein Knie.« Paul Jäckel neigte, unter dem knappen Zwischenraum des Wagens, seinen Kopf zur Seite. Das Spielzeugauto des Jungen war direkt an sein Knie gefahren. »Sag dem Kerl, dass er das blöde Ding hier wegnehmen soll!«, schrie er. Im selben Moment fiel sein Blick auf den Jungen. Der war nun noch weiter als zuvor, von den beiden entfernt. Paul stutzte. Er sah wieder zu dem Spielzeugauto an seinem Knie. Es war das gleiche Modell des Spielzeugautos, das er für den Anschlag gekauft hatte. Sein Blick stierte auf das Stückchen Antenne, das aus dem Spielzeugauto herausragte und unter dem Fahrgestell des Tourenwagens klemmte. Erschrocken sah er zu dem Jungen hinüber, der aus einiger Entfernung die beiden beobachtete. Wenn seine Augen auch nicht mehr so scharf wie früher waren, so konnte er aber das postkartengroße schwarze Kästchen in der Hand des Knaben entdecken. »Die Fernbedienung des Spielzeugautos vom Jungen!«, schrie er durch den Motorraum Ricky entgegen.
»Keine Panik«, beruhigte der ihn. »Die Fernbedienung gehört zum Spielzeugauto des Jungen.« Bei diesen Worten wendete sich Ricky dem Kind zu und rief: »Nimm endlich dein Auto und verschwinde hier.«
Die Augen von Paul Jäckel waren urplötzlich sperrangelweit aufgerissen. Mit einer nie gekannten Lautstärke schrie er unter dem Wagen hervor: »Nicht den Rückwärtsgang …!«
Knappe fünfzehn Minuten später hatte die Polizei den Unglücksort abgesperrt. Es konnte nie geklärt werden, wie es zu dieser folgenschweren Explosion kam, bei der zwei erfahrene Tourenfahrer ums Leben kamen.
Tödliche Erbschaft
Simone Raider warf einen flüchtigen Blick auf die Uhr im Armaturenbrett. Richtig, fiel es der Blondine mit den schulterlangen Haaren und den hellblauen Augen wieder ein, die ist ja kaputt. Wie so vieles an diesem Vehikel, dachte sie. Jedenfalls wird es so zwischen Frühstück und Mittag sein. Sie konnte sich also Zeit lassen. Tante Luise hatte sie und ihre beiden Cousins erst zum Mittagessen eingeladen.
Die schmale, von Laubbäumen gesäumte Straße führte Simone Raider in eine elegante Vorstadtsiedlung. Hier lebten nur wohlhabende Bürger, so wie ihre Tante Luise. Immer wieder dachte sie an den Brief, den sie von ihr vor einigen Tagen bekam. Von der Beendigung des Familienzwistes war da die Rede. Von der Zeit die Wunden heilte. Hierbei klang ihr noch der genaue Wortlaut in den Ohren, mit der ihre Tante sie und ihre Cousins vor zehn Jahren hinausschmiss: Bequemes Gesindel, Nichtsnutze und Ähnliches mehr, warf sie ihnen an den Kopf. Auslöser für diesen Gefühlsausbruch war ein schiefgelaufenes Projekt, in das einer ihrer Cousins eingestiegen war. Tante Luise kam zufällig dahinter, dass es ihr Geld war, das er sich unter falschem Vorwand von ihr borgte. Daraufhin kam es zu dieser erschütternden Veränderung bei der Tante. Fast ihr ganzes Vermögen vermachte sie testamentarisch einem Kloster, nicht weit von hier. Ihr Anwalt setzte damals sie und ihre beiden Vettern telefonisch hierüber in Kenntnis. Sogar der Pflichtanteil wurde, durch einen Kniff des Rechtsanwalts, auf ein Minimum reduziert. Der Traum von Simone Raider, vom vielen Geld, platzte seinerzeit wie eine Seifenblase.
Noch geraume Zeit danach ärgerte sie sich über die ungerechte Behandlung ihrer Tante. Hinzu kam, dass sie ihre Cousins, Achim und Sebastian, nicht mochte. Zumindest auf diese beiden trafen die Beschimpfungen zu, fand sie. Aber Tante Luise hatte oft genug deutlich gemacht, dass sie mehr für die Jungen über hatte, als für sie.
Wenn einer der beiden, Achim oder Sebastian, etwas Positives leistete, wurden die zwei von ihrer Tante gelobt. Vielleicht, weil sie Zwillinge waren. Von ihr war dann nie die Rede. Hatte einer von denen etwas ausgefressen, wurden sie alle drei getadelt. So war Tantchen nun mal. Und wir nahmen es gelassen hin, überlegte sie. Schließlich wollte damals keiner sein Erbe aufs Spiel setzen. Sie seufzte. Das lag nun viele Jahre zurück. Sie, und ihre gleichaltrigen Cousins, waren Anfang dreißig. Und nun sollte der Traum vom legendären Glück wieder wahr werden. Ihre wasserblauen Augen funkelten bei diesen Gedanken siegessicher.
Da Tante Luise eine Frau der Tat war, lud sie auch gleich eine Vertreterin des Klosters ein. So deutete sie es zumindest in ihrem Brief an. Dort wird die Enttäuschung sicherlich groß sein, wenn sie erfahren, dass sich die in Aussicht gestellte Erbschaft auf ein Bruchteil reduziert.
Kurz darauf hielt Simone Raider auf dem Vorplatz des Herrenhauses ihrer Tante. »Bekomme ich mein altes Zimmer, Sven?« Fragend sah sie den greisenhaft wirkenden Diener an. Nachdem dieser nicht reagierte, stellte sie die gleiche Frage nochmals, nur wesentlich hörbarer.
Erschrocken, jedoch freundlich lächelnd, sah sie der Diener an. »Gewiss, Frau Raider, ich arbeite noch immer.«
Sie vermied es, weitere Fragen zu stellen.
»Ich bin erfreut, dich nach all den Jahren wiederzusehen.« Die krächzende, aber selbstbewusste Stimme, wollte so gar nicht zu den scharf gesprochenen Worten passen, mit der ihre Tante sie empfing.
Das schneeweiße, gewissenhaft gekämmte Haar der über Achtzigjährigen ließ ihre Nichte es ahnen. An ihrer übergroßen Pingeligkeit hatte sich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich nichts geändert. Erst auf dem Weg ins Besucherzimmer bemerkte sie die Gehhilfe, auf die sie sich beim Fortbewegen stützte.
»Hast du dich über meinen Brief gewundert, Simone?«
»Ja«, gab diese unumwunden zu.
»Nun«, sprach die greise Dame ein wenig bedächtig, »lange werde ich es nicht mehr machen.« Einen lautlosen Protest der anderen würgte sie mit einer kritischen Handbewegung ab. »Ich weiß, wovon ich rede. Zehn Jahre ist es her, glaube ich, als ich euch hier raus warf. Immerhin, ich hatte meine Gründe.« Belehrend hob sie den Zeigefinger ihrer rechten Hand. »Einer alten Dame einfach so das Geld aus der Tasche zu ziehen, das konnte ich mir nicht gefallen lassen.«
Simone Raider sah nur stur geradeaus. Sie hat sich nicht geändert, schoss es ihr durch den Kopf.
»Andererseits war es sehr einsam in den letzten Jahren um mich herum. Wie schön wäre es doch, überlegte ich, wenn ich die Welt in Frieden verlassen könnte. Aber die Kontakte gab es nun nicht mehr. Ich wollte, dass unsere Familie wieder das wird, was sie einmal war. Hoffentlich verstehst du mich. So holte ich Erkundigungen über euch ein. Wie war ich doch überrascht, als ich hörte, wie brav und strebsam ihr alle geworden seid. Na ja, ihr musstet ja wohl. Denn schließlich haben euch meine gelegentlichen Geldspritzen gefehlt.« Die letzten gesprochenen Worte klangen ein wenig spöttisch. »Du hast dich zur Krankenschwester ausbilden lassen, nicht wahr?!«
Simone Raider nickte.
»Jedenfalls bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es sinnvoller wäre, das Geld in der Familie zu lassen. Aber ich will auch nicht, dass die Ordensschwestern leer ausgehen. Ich habe euch geschrieben, weil ich meinen Nachlass klären möchte. Du weißt ja, der größte Teil ist angelegt in Aktien, Firmenanteilen, Immobilien und all so ’n Kram.« Sie klopfte mit der rechten Hand behutsam auf den Tisch neben ihr und fuhr fort. »Heute wird mein Vermögen verteilt und morgen wird es notariell beglaubigt. Danach gilt das bisherige Testament nicht mehr. Eine leitende Schwester aus dem Orden habe ich ebenfalls eingeladen. Sie darf ihre Wünsche äußern. Ich mache euch lediglich die Auflage, nicht gleich alles zu versilbern. Von den Gewinnanteilen ist man in der Lage gut zu leben, wie du siehst.«
Simone machte sich nichts vor. Nur zu gut wusste sie, dass Achim und Sebastian die besten Stücke zugesprochen bekommen würden. So war sie nun mal. Der Orden würde sich gewiss mit einem unbedeutenden Erbteil zufriedengeben müssen. Plötzlich stutzte sie. »Hast du auch Conny eingeladen? Ist sie noch in Australien?«
»Ja, ich habe dort meine Erkundigungen eingezogen, aber nichts Näheres über deine Schwester gehört. So wie man mir berichtete, ist sie bereits vor einiger Zeit gestorben. Lass sie.« Mit einer ärgerlichen Handbewegung wollte sie das Thema wechseln. »Seitdem sie damals aus der Schule abgehauen ist, hat keiner mehr was von ihr gehört. Sie ist tot, hörst du?!«
Draußen war das Geräusch eines bremsenden Autos zu hören.
Luise Stupweiser drehte sich ruckartig um und eilte, auf ihren Stock stützend, zum Hauseingang. »Die Jungen kommen!«
Durch das Fenster zum Vorplatz beobachtete Simone Raider wie die beiden Kerle aus einem sündhaft teuren Fahrzeug ausstiegen. Sie knirschte mit den Zähnen. »Denen geht es nur darum Tantchen zu imponieren«, murmelte sie halblaut vor sich hin. Sie hatte zwar keinen Kontakt zu den beiden, allerdings war sie über die Art, wie sie ihre Geschäfte machten, bestens informiert. Wer die Regionalpresse studierte, wusste das Achim und Sebastian Gerster von einem Konkurs in den anderen schlitterten. Ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit schien das nicht zu schaden. Sie hasste das lockere und lässige Auftreten ihrer Cousins. Das überhebliche, über allen Wassern stehende Getue. Simones Pupillen wurden plötzlich stecknadelkopfgroß. Sie verabscheute diese eingebildeten und anspruchsvollen Pinkel über alles.
»Oh, unsere Base hat sich genauso wenig verändert, wie Tantchen. Was meinst du, Achim?« Sebastian Gerster sah seinen Zwillingsbruder, mit einem Augenzwinkern, fragend an.
Simone Raider entgegnete nichts. Sie warf den beiden ein freundliches Lächeln zu. So schwer es ihr auch fiel. Tante Luise mochte die Jungen. Das hatte sie zu akzeptieren, wollte sie nicht unnötig einen Streit heraufbeschwören, aus dem sie nur als Verliererin hervorgehen konnte.
»Sieh mal, wen wir unterwegs aufgegabelt haben, Simone.« Achim Gerster trat einen Schritt zur Seite und ließ eine in Ordenstracht gekleidete Schwester eintreten.
»Die leitende Oberin konnte leider nicht selber kommen«, erklärte die Klosterfrau mit entschuldigender Stimme.
Das faltenreiche Gesicht von Luise Stupweiser verriet Enttäuschung. Gleich darauf sah sie zur Uhr. »Sven!« Es war mehr ein Schrei, als der Ruf nach ihrem Diener. »Sven, haben Sie ihr Hörgerät wiedergefunden?« Nachdem der Diener sie nur freundlich lächelnd ansah, sprach sie weiter. »Also noch nicht wiedergefunden.« Den nächsten Satz betonte sie besonders bruchstückhaft und lautstark. »In einer halben Stunde tragen Sie bitte das Essen auf.« Und zu den anderen gewandt fuhr sie fort: »Wer sich noch etwas frisch machen möchte, hat jetzt Gelegenheit hierzu.«
Bis auf Luise Stupweiser verließen alle das Besucherzimmer. Die Falten in ihrem Gesicht verzogen sich zu einem bescheidenen Lächeln. Genauso hatte sie sich die erste Zusammenkunft nach all den Jahren vorgestellt. Alles lief wie geplant.
Simone Raider war nur kurz im Bad. Vorsichtig um sich schauend schritt sie den Flur entlang. Hierbei warf sie in dieses und jenes Zimmer einen Blick. Alles war noch genauso wie früher. Gleich darauf begab sie sich ins Esszimmer. »Sie hier, Schwester?« Überrascht sah sie zu der Klosterfrau hinüber.
Diese schrak sichtlich zusammen. »Ich, äh, finde den Raum nicht mehr, in dem wir vorhin waren«, stotterte sie ein wenig verlegen.
»Zwei Türen weiter links.«
»Danke! Danke, vielmals.« Mit zwei, drei flinken Schritten schlug die Nonne die genannte Richtung ein.
Simone Raider sah ihr grübelnd hinterher.
Sebastian und Achim Gerster hielten sich in der Bibliothek auf, wo sie die Tageszeitungen flüchtig durchblätterten.
Der altbekannte Gong ertönte. Die Gäste begaben sich ins Esszimmer. Luise Stupweiser kam mit der Ordensfrau freundlich plaudernd als letzte hinzu. Nachdem alle Platz genommen hatten, betrat der Diener das Zimmer.
Die Gastgeberin winkte ihn zu sich. Bückend hielt dieser, wie von seiner Herrin befohlen, sein Ohr in die Nähe ihres Mundes. »Den Wein, Sven!«, krächzte sie ihm lautstark ins Ohr.
Dieser schrak zusammen. »Ich muss erwähnen, dass ich mein Hörgerät wiedergefunden habe«, sprach er und richtete sich auf, um den Wein in die Gläser zu füllen.
»Ein edler Tropfen«, versicherte Luise Stupweiser den Anwesenden. »Ich allerdings werde auf meinen liebgewordenen Brauch nicht verzichten und als Aperitif nur ein Glas Cherry trinken.«
»Ich, äh ... ich möchte keinen Wein, Frau Stupweiser.« Höflich schmunzelte die Ordensfrau der Gastgeberin zu. »Für mich ein Glas Wasser, bitte.«
Simone Raider und ihren Cousins kam die Antwort sehr gelegen. Hatte sich ihr Erbanteil in diesem Augenblick sicherlich erhöht. Ein gefülltes Glas Wein unberührt stehen lassen, darüber hätte Tante Luise kein Wort verloren. Ihr aber einen Korb zu geben, das gehörte sich nicht. So war sie nun mal.
»Nun dann.« Luise Stupweiser hob ihr Glas mit dem Cherry zum Anstoßen.
Ihre beiden Neffen und ihre Nichte erhoben die Weingläser. Die Ordensschwester tat es ihnen nach. Mit dem Glas Wasser in der Hand und einem verklemmten Lächeln im Gesicht.
Eine winzige Rotweinwelle benetzte die Lippen von Simone Raider. Sie achtete darauf, den Wein nicht in den Mund zu bekommen. Sie mochte keine alkoholischen Getränke. Ob ihre Tante das in all den Jahren mitbekommen hatte, wusste sie nicht. Sie ließ den Inhalt vom Glas stets unberührt. Gleich darauf stellte sie ihr Weinglas zurück und sah freundlich lächelnd zu ihren Cousins hinüber. Die saßen ihr am Tisch direkt gegenüber.
Diese erwiderten ihr Lächeln mit närrischen Grimassen. Nachdem sie ihre Arme gestikulierend hinzunahmen, wurde ihre Tante wachsam.
»Also, Achim und Sebastian, bewahrt eure Albernheiten bis nach dem Essen auf. Hört ihr!« Die letzten beiden Worte ihrer Tante klangen schon fordernd.
Doch die Bewegungen ihrer Neffen wurden zunehmend rasanter. Aus ihren aufgerissenen Mündern drangen kaum hörbare, glucksende Laute. Gleich darauf rissen beide, wie verabredet, ihre Augen sperrangelweit auf. Sofort hielten sie schlagartig in ihren Bewegungen inne und fielen, wie vom Blitz getroffen, zu Boden.
Es war mucksmäuschenstill im Raum.
»Was hat das zu bedeuten?!« Mit einem krächzenden Aufschrei sprang Luise Stupweiser von ihrem Stuhl auf. »Spinnt ihr?« Sie merkte rasch, dass dies keine gewollte Einlage ihrer Neffen war. Mit einem Blick zu Simone forderte sie hastig von ihr: »Du bist Krankenschwester, nicht wahr?! So tu doch was!«
Bedächtig begab sich Simone Raider auf die andere Seite vom Tisch. Dann bückte sie sich über die am Boden gekrümmt daliegenden Vettern. Sie sah in die geweiteten Pupillen. Ihre Hand suchte den Puls. Das Ohr legte sie auf die Stelle des Oberkörpers, unter der das Herz lag. Schließlich stellte sie sich wieder aufrecht hin. Mit einem Blick zu ihrer Tante schüttelte sie kaum sichtbar den Kopf.
»Soll das heißen, sie sind tot?« Voller Schrecken sah sie sich im Kreis um.
»Du musst die Polizei holen, Tante Luise. Vermutlich war der Wein in ihren Gläsern vergiftet.«
»Aber du hast doch auch von dem Rotwein getrunken! Oder etwa nicht?«
Schwerfällig wendete sich ihr Kopf zum Esstisch. Ihre Augen starrten zum Glas mit dem Rotwein respektvoll hinüber. »Nein, ich habe wie immer nur so getan, als ob ich trinke. Ich mag keinen Alkohol.«
◊
Kommissar Steffen sah mit mürrischer Miene zu seinem Fahrer hinüber. »Sag mal, Kröger, kannst du mit dem Lutschen nicht aufhören, solange wir hier zusammen im Auto sitzen?«
Dieser schmunzelte. »Aber, Chef, Salmiakpastillen sind gesund und regen das Denkvermögen an.« Provozierend hielt er ihm seine angebrochene Tüte hin.
Knurrend sah der Kommissar aus dem Seitenfenster. Mehrere Sekunden später wendete er sich wieder um. »Da vorn ist es.« Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. »Vermutlich wird es sich um irgendeinen Fehlalarm handeln. Na, mal sehen.«
»Glauben Sie das wirklich, Chef? Da stehen nämlich zwei Rettungswagen vor der Tür.«
Luise Stupweiser kam den beiden Kriminalbeamten, auf ihren Stock stützend, entgegen. Mit aufgerissenen Augen sprach sie: »Der Wein ist schuld …«
Kommissar Steffen beruhigte sie. Sofort darauf führte er ein ausgiebiges Gespräch mit dem Notarzt. »Irgendeine giftige Substanz im Rotwein, meinen Sie, Doktor? Wie kommen Sie darauf?«
»Nachdem uns die Hausherrin sagte, dass sie umfielen, als sie den Wein getrunken hatten, habe ich mal am Glas gerochen. Es kam mir eine kleine Wolke entgegen, die verflixt nach bitteren Mandeln roch. Blausäure oder so etwas Ähnliches.«
»Wir werden es im Labor untersuchen lassen.«
»Die Nichte ist mit dem Schrecken davongekommen. Sie trinkt kein Alkohol. Nur ihrer Tante zuliebe ließ sie sich das Glas füllen. Aber das klären Sie am besten mit ihr selber. Für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Die beiden Zwillingsbrüder waren auf der Stelle tot. Die starke Dosis des Giftes führte zu einem sofortigen Stillstand des Atmungsapparates. Sie erstickten qualvoll. Nach meinen Schätzungen hätte das Gift ausgereicht eine ganze Fußballmannschaft ins Jenseits zu befördern.«
Kröger sprach in der Zwischenzeit mit dem Diener. Gleich darauf gab er seinem Vorgesetzten eine kurze Stellungnahme.
Kommissar Steffen sah grübelnd zu ihm hinüber. »Irgendjemand hätte die Küchentür, die nach draußen führt, geöffnet, sagt der Diener? Von den Anwesenden will es keiner gewesen sein?! Hm … – Na ja, vielleicht hat er es nur vergessen und die Tür selber geöffnet. Der Jüngste ist er ja nicht mehr.«
»Aber immerhin fünf Jahre jünger als seine Arbeitgeberin.«
Zusammen hörten sie sich den Grund der Begegnung an. Luise Stupweiser gab den beiden Kriminalbeamten eine knappe Schilderung der Zusammenhänge.
»Sie wollten also ihr Testament zugunsten Ihrer Familienmitglieder ändern, Frau Stupweiser?« Die Feststellung des Kommissars klang tonlos und trocken.
»Ich sagte es Ihnen bereits.«
»Eine Testamentsänderung wäre also zu Lasten des Klosters vorgenommen worden, deren Institution heute und hier durch Schwester Angelika vertreten wird, richtig? – Und beim Tod Ihrer Familienmitglieder wäre alles beim alten geblieben, auch richtig? – Aha. Nun, dass Ihre Nichte den Anschlag überlebte, ist purer Zufall. Der Täter wird wahrscheinlich versuchen seinen Fehler zu korrigieren. Ansonsten nützt ihm der Tod der beiden Brüder gar nichts.« Mit einem Blick zu Simone Raider sprach er weiter. »Bis wir den Mörder haben, müssen Sie auf der Hut sein.«
Die Angesprochene raffte sich auf. »Es ist doch nur der Orden, der von unserem Tod profitiert. Demnach müsste ein Vertreter des Ordens der Giftmischer sein …«
»Mein Gott …« Die Ordensschwester würgte die Worte mühsam hervor. »Sie halten mich doch nicht dieser Tat für fähig?«
Es dauerte lange bis Kommissar Steffen eine Antwort gab. »Dieser ganze Vorgang hier erinnert mich eher an den Ablauf eines zweitklassigen Fernsehkrimis.«
»Wie wird denn sonst gemordet, Herr Kommissar?« Luise Stupweisers krächzende Stimme hörte sich provozierend an.
»Nicht so kompliziert«, war die prompte Antwort. »Wenn das Kloster, als Nutznießer, nicht auf den bisherigen Erbanteil verzichten will, warum brachte man dann gleich drei Personen um? Den fehlgeschlagenen Mord, an Ihrer Nichte, zähle ich mal mit. Es wäre doch viel einfacher gewesen, Sie zu töten, Frau Stupweiser. Ein einzelner Mord. Der, mit etwas Geschick, als Alterstod getarnt werden könnte. Keiner hätte Verdacht geschöpft. Alles wäre prima gelaufen. Wir werden uns also noch einmal eingehend mit Ihnen über eventuelle Tatmotive unterhalten müssen. Wer weiß, vielleicht übersehen Sie oder wir irgendetwas.« Danach sprach Kommissar Steffen alle Anwesenden an: »Ich bitte Sie, dass Esszimmer zu verlassen. Mein Assistent und ich werden den Tatort nach Spuren untersuchen. Jeder bleibt bitte für sich allein. Bis wir Näheres wissen, ist dies aus Sicherheitsgründen notwendig.«
»Dann lege ich mich in meinem Zimmer etwas hin. Sie können Sven nach mir Schicken, wenn Sie fertig sind.« Im Gehen hielt Luise Stupweiser noch einmal an und drehte sich neugierig um. »Nach was suchen Sie eigentlich?«
»Polizeigeheimnis.« Kommissar Steffen warf ihr ein knappes, kurzes Lächeln zu.
»Und wenn Sie nichts finden?«, wollte Simone Raider wissen.
»Das wäre schön«, entgegnete der Kommissar. »Dann kennen wir auch den Mörder.«
Sie stutzte. »Machen Sie, was Sie wollen. Ich setze mich derweil draußen vor die Tür an die frische Luft.«
»Ich werde in der Bibliothek auf Ihre Anweisungen warten«, sprach die Ordensschwester mit auffällig nervöser Stimme. »Kann ich mein Mineralwasser mitnehmen?«
»Das geht leider nicht. Lassen Sie sich vom Diener ein neues Glas bringen.«
Nachdem Kommissar Steffen mit Kröger allein war, begab er sich zum Esstisch hinüber und schnupperte an den Gläsern. »Die Rotweingläser der Gerster-Brüder sind etwa zur Hälfte geleert. Sie haben genau, wie das volle Glas von Simone Raider, diesen aufdringlichen Mandelgeruch, von dem der Notarzt sprach.« Dann sah er sich die geöffnete Rotweinflasche näher an. Er schnupperte an deren Öffnung, lobte die gute Lage der Rebe und sprach zu seinem Assistenten: »Nun gut, Kröger, dann wollen wir mal anfangen zu suchen.« Kommissar Steffen nahm eine Stoffserviette vom Tisch und sah sich suchend im Raum um.
»Darf man fragen, Chef, wonach Sie suchen?«
»Das fragst du mich, Kröger?!« Kommissar Steffen tat überrascht. »Du bist doch derjenige, der diese seltsamen Salmiakpastillen isst, die das Denkvermögen anregen.«
Kröger knurrte etwas Unverständliches vor sich hin. Dann sah er scheinbar teilnahmslos aus dem Fenster zum Vorplatz hinaus.
Kommissar Steffen legte seine Hand freundschaftlich auf Krögers Schulter. »Hübsche Dame, diese Simone Raider, so wie sie da draußen auf der Bank sitzt, nicht wahr?« Da sein Assistent wie versteinert stehenblieb und nicht antwortete, fuhr der Kommissar fort. »Also, Kröger, pass mal auf. Die Sache ist ganz einfach …«
Etwa eine halbe Stunde später richtete sich der Kommissar mühsam vom Teppich auf. »Das war die letzte Möglichkeit. Du hast auch nichts, oder?«
Sein Assistent schüttelte den Kopf.
»Prima. Der Rest ist Routine. Sorge mal bitte dafür, dass die sich alle hier wieder einfinden. – Ach, ich sehe, Frau Raider kommt schon wieder zurück. Genug frische Luft geschnappt, meine Dame?«
»Ich bin froh, wenn das hier alles vorbei ist.«