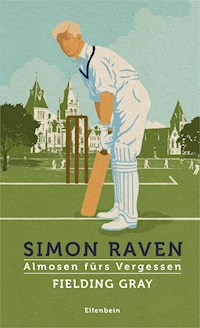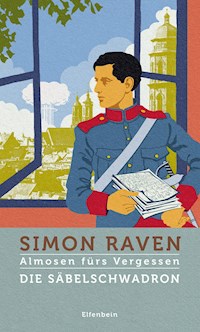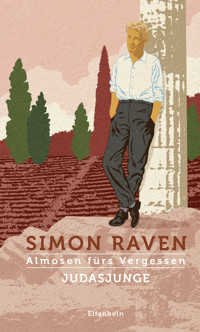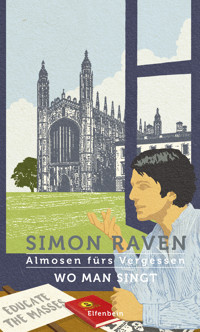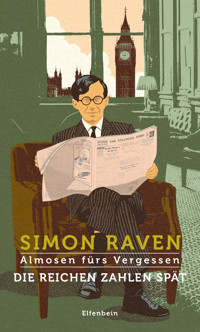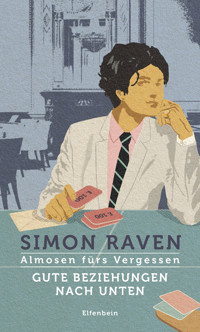
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Almosen fürs Vergessen
- Sprache: Deutsch
Während manch einer sich an der Côte d'Azur oder in Venedig auf den sonnigen Promenaden dahintreiben lässt und an den Spieltischen das Glück herausfordert, rumort es im heimischen London in der Konservativen Partei: Der Parlamentssitz für Bishop's Cross soll 1959 neu vergeben werden, und die beiden jungen Konkurrenten könnten unterschiedlicher nicht sein. Es herrscht alles andere als Einigkeit, und Sir Edwin Turbot, politisches Urgestein der Konservativen, hat zudem den ebenso raubeinigen und trinkfreudigen wie hochadeligen Parteifreund Marquis Canteloupe in Schach zu halten, der auf seine alten Tage revolutionäre Schrullen entwickelt und in »staatlich subventionierte Erholung für alle« zu investieren gedenkt. Damit nicht genug, steht Turbot ein gesellschaftliches Großereignis, die Hochzeit seiner Tochter ins Haus — unpassenderweise mit einem linksintellektuellen Bestsellerautor, der weder von standesgemäßer Herkunft noch besonders wohlerzogen ist. Als dann auch noch ein kompromittierender Brief auftaucht, der die wahre Rolle der Regierung in der kürzlich erst ausgestandenen Sueskrise enthüllt, ist jegliche Gediegenheit dahin, und es beginnt eine wilde Jagd. Simon Raven (1927—2001) führt im fünften Band seiner Romanreihe »Almosen fürs Vergessen« vergnügt die Machtspiele derjenigen vor, die gerne auf dem gesellschaftlichen Parkett die Geschicke anderer lenken, sich dabei aber zu Beginn der 60er Jahre nicht mehr nur den angestammten Gegnern, sondern neuen, unerwarteten und mitunter pikanten Entwicklungen und Widrigkeiten ausgesetzt sehen. Und er zeigt, dass die Strippen ganz oben niemals ohne die Freunde ganz unten gezogen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Raven
Gute Beziehungen nach unten
Roman
Aus dem Englischen übersetzt
von Sabine Franke
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1965unter dem Titel
»Friends in Low Places« bei Anthony Blond, London.
Band 5 des Romanzyklus »Almosen fürs Vergessen«
Copyright ©Simon Raven, 1998
First published as part of »Alms for Oblivion«:
Volume 1 by Vintage, an imprint of Vintage.
Vintage is part of the Penguin Random House
group of companies.
Die Übersetzung dieses Bandes wurde
freundlicherweise vom Deutschen Übersetzerfonds
im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR«
mit Fördermitteln der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien ermöglicht.
© 2022 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-041-0 (E-Book)
ISBN 978-3-96160-011-3 (Druckausgabe)
1
glücksspiel
»Jesus im Himmel«, sagte Mark Lewson, »was für ein elend langweiliger Ort das hier ist.«
»Du musst ja nicht bleiben«, sagte Angela Tuck.
Sie saßen in Menton an der Promenade, wo sie eine halbe Stunde nach Mittag Champagner-Cocktails tranken, an einem Sonntag im April 1959.
»Ich möchte aber doch bei dir sein, meine Liebe. Es trifft sich so gut! Wir können uns gegenseitig in unserer Trauer trösten.«
»Tuck ist schon vor fast drei Jahren umgekommen«, sagte Angela Tuck, »und man musste mich weder damals noch seither deshalb trösten.«
»Du bist herzlos, das ist dein Problem. Ich brauche Trost. Es ist erst ein paar Wochen her, dass mir meine geliebte Frau ins Paradies vorangegangen ist, und das hat mich nicht nur in einer Hinsicht tiefunglücklich zurückgelassen.«
»Wie ist sie denn eigentlich gestorben, Mark? Du hast dich da eher bedeckt gehalten.«
»Der Alkohol, meine Liebe. Selbst der Sarg hat noch nach Gin gerochen. Das hat bei ihren drögen Verwandten mächtig Anstoß erregt.«
»Die sind den ganzen Weg nach England gekommen für die Beerdigung?«
»Ihre beiden Schwestern. Um zu schauen, ob noch was vom Geld übrig ist.«
»War aber nicht so?«
»Da war ohnehin nie viel gewesen. Als der alte Graf Monteverdi gestorben ist, nachdem er ja den Großteil seines Lebens in England verbracht hatte, da hat er ungefähr hunderttausend hinterlassen, sicher angelegt, wie man so schön sagt, und ein paar wertvolle Gemälde und ein kleines Grundstück in Rom. Felicitys Anteil – das waren nach Abzug der Erbschaftssteuer knapp über zwanzig Mille, ein kleiner Sisley und drei Dalís, und eine Wohnung an der Piazza Navona.«
»Sollte für den Anfang eigentlich reichen«, sagte Angela.
»Hat’s aber nicht.« Mark kicherte. »Die zwei Schwestern sind damals nach Tivoli zurückgegangen und haben sich dort frommen Taten gewidmet. Felicity blieb in England und hat sich mir gewidmet. Sie war fünfzehn Jahre älter als ich, stimmt schon, aber ich dachte, was soll’s, ist ’n gutmütiges Kalb, und man sagt, dass sie ’ne Menge Geld hat. Wie üblich hatte ›man‹ übertrieben. Wir waren kaum mit den Flitterwochen durch, da hat sie verkündet, dass schon Schluss ist mit den Schein-chen.«
»Zwanzigtausend?«
»Ich hatte ’ne kleine Jacht gekauft. Mir hatte ja keiner gesagt«, erklärte Mark trotzig, »dass es bloß zwanzig Mille sind und nicht mehr.«
»Da war sie bestimmt rasend.«
»Genau! Rasend in mich verliebt.«
Das wundert mich nicht, dachte Angela. Prüfend wanderte ihr Blick über das engelhafte Gesicht mit dem stumpfen, verworfenen Kinn, das dunkle, wellige Haar, den Torso, schmal, aber fest unter dem geblümten Hemd, die Botticelli-Beine unter den kurzen weißen Flanellhosen. All das begutachtete sie, ein paar andere Dinge kamen ihr auch noch in den Sinn, und sie kam zu dem Schluss, dass eine Frau, die fünfzehn Jahre älter war als er, sich bestimmt rasend in Mark Lewson verliebt haben konnte, so rasend, dass sie ihr gesamtes Vermögen dafür hergab, ihm eine Jacht zu kaufen. Aber ich, dachte sie, bin nicht fünfzehn Jahre älter als er, sondern nur fünf. Von mir wird er nicht viel kriegen, und selbst das muss er sich erst mal verdienen. Genau genommen bin ich nicht mal sicher, ob er nicht schon mehr als genug bekommen hat.
»Was ist aus der Jacht geworden?«, fragte sie.
»Mit Verlust verkauft, als die Dinge schwierig zu werden begannen.«
»Wirklich Pech!«
Du miese Sau, dachte Mark Lewson. Ich weiß doch, dass das ganze Geplauder über Felicitys Geld mir eigentlich bloß sagen soll, dass ich von dir keins bekommen werde. Du würdest dich noch auf der Folterbank an das Bisschen klammern, das Tuck dir überlassen hat. Und besser ist’s, dass du das Geld schön festhältst, Schätzchen, denn noch fünf Jahre, und das wird’s gewesen sein mit dir. Bestehst ja schon jetzt bloß noch aus Krähenfüßen und Gewabbel, und in neun von zehn Nächten: Zahnspülung mit billigem Brandy. Du hast ein Riesenglück, dass ich für Bett, Bewirtung und ein Taschengeld zu haben bin, weil ich nun mal grade eine Pechsträhne habe. Aber ich bin nur auf der Durchreise. Irgendwas wird sich auftun, wie immer, und dann heißt’s winke-winke, Angela Tuck, für dich und deine hängenden Titten.
Bis dahin aber mach das Beste draus, solange wir Bett und Tisch teilen.
»Lass uns noch einen bestellen«, sagte er.
»Du hattest schon drei.«
»Ich werde nach dem Essen meinen Teil erfüllen, falls es das ist, was dich beunruhigt.«
Die schmalen Augen blitzten, und er ließ das stumpfe Kinn in simulierter Lust erzittern. Die Botticelli-Beine weit gespreizt. Mit einer plötzlichen Welle der Erregung brach ihr kurz der Schweiß aus, und Angela entschied, dass sie doch noch nicht ganz fertig mit ihm war.
»In Ordnung«, sagte sie, als Lewson einen Kellner heranwinkte und auf die leeren Gläser zeigte, »aber nur noch einen. Die sind teuer.« Sie reichte ihm zwei Scheine über den Tisch, zwei alte Tausend-Francs-Scheine. »Und was war dann«, sagte sie, »nachdem du die Jacht verkauft hattest?«
»Eine Weile sind wir zurechtgekommen. Dann waren die Dalís dran. Dann der Sisley. Am Ende die Wohnung. Danach hatten wir bloß noch ihren Familiennamen und den Titel. Geborene Monteverdi. Contessa – oder Contessina, für sentimentale alte Männer. Hat dabei geholfen, wenn wir uns Schecks haben auszahlen lassen.«
»Nicht für lange, möchte ich wetten.«
»Länger, als du denkst. Wir sind selten lange wo geblieben.«
»Und am Ende?«
»Am Ende ist sie gestorben.«
»Just als sie ihre Schuldigkeit getan hatte.«
Mark grinste.
»Es war die Trinkerei, meine Liebe. Die Trinkerei und der englische Winter.«
»Ich will’s dir mal glauben … da du ja alles Übrige so offenherzig erzählt hast.«
»Dir würde ich nichts vorflunkern, meine Liebe. Du bist hart im Nehmen.«
Das war ein ernstgemeintes Kompliment. Mark Lewson sagte die Wahrheit und fand es sehr erleichternd, dieses eine Mal nicht an die jakobinisch-verwinkelten Verwicklungen seiner selbsterfundenen Geschichten gebunden zu sein. Nicht, dass er die Unbeschwertheit, die in dieser ungewohnten Freimütigkeit lag, willentlich gewählt hatte; es war vielmehr so, dass Angela – dafür hatte er ein Gespür – auf seine Lügen, so brillant sie oft sein mochten, weder reinfallen noch sich von ihnen beeindrucken lassen würde. Was noch nicht bedeutete, dass er ihr aus Respekt die Wahrheit sagte. Es war einfach so, dass es keinen Zweck hatte, ihr irgendwas anderes zu erzählen.
»Du bist hart im Nehmen«, wiederholte er. »Hast sozusagen eine spezielle Begabung dazu, ein Luder zu sein.«
Und nach dreieinhalb Champagnercocktails, dachte er, siehst du dabei gar nicht mal so schlecht aus. Also beugte er sich zu ihr rüber, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern, woraufhin sie sich vor Entzücken auf ihrem Sitz wand.
»Nach dem Essen«, sagte sie, um Beherrschung bemüht. »Sie hat dir also überhaupt nichts hinterlassen?«
»Nichts als einen Namen, den wir in der Hälfte aller Hotels in Europa in Verruf gebracht haben.«
»Was gedenkst du jetzt also zu tun?«, fragte sie ihn, nicht ohne Anteilnahme.
»Was zu essen und mich danach ordentlich zu vergnü-gen.«
»Und anschließend?«
»›Genug, dass ein jeglicher Tag …‹«
»Aber der morgige Tag …«
»Da du danach fragst«, sagte er, »ich brauche irgendeinen guten Kniff. Etwas, womit ich arbeiten kann, so, wie ich damals bei den Schecks den Namen der Contessa ins Spiel bringen konnte. Irgendeine Idee. Deswegen habe ich Menton auch so über. Hier gibt’s einfach nichts, und wie denn auch!«
»Ruhe und Frieden gibt’s hier. Und man kann sparsam leben.«
»Kann ich alles nicht gebrauchen!«
»Wir müssen mal sehen, dass wir was für dich auftun können«, sagte Angela.
Angela hatte die vergangenen zwei Wochen mit Mark Lewson genossen und war ihm – bliebe alles andere unverändert – eigentlich wohlgesonnen. Jedoch waren mit Mark andere Dinge, alles andere als unveränderlich, nicht zu vereinbaren; und ungeachtet des offenkundigen und wachsenden Kribbelns, das sie in diesem Augenblick verspürte, wusste Angela, die eine erfahrene Frau war, dass sie ihn in höchstens ein paar Tagen loswerden musste. Er stellte eine Bedrohung dar: für sie, für ihr Geld, für ihr kleines Haus in der Stadt. Loswerden, das musste sie ihn demnach; wenn sie ihm dabei aber zugleich noch einen Dienst erweisen konnte, so war das so viel besser für alle beide: Sie konnten als Freunde auseinandergehen, und keiner hätte dabei einen Schaden. Sie würde, sie konnte ihn nicht mit Geld abwimmeln. Sie musste das für ihn finden, was er »einen guten Kniff« nannte. Vielleicht sollte sie sich für den Anfang einmal diese Geschichte durch den Kopf gehen lassen, die sie von Max gehört hatte … Einen Kniff – und ich kann kneifen, dachte sie bei sich selbst und kicherte.
»Was ist denn so komisch?«
»Sag ich dir vielleicht später. Mittagessen!«
Hinter den geschlossenen Fensterläden war das Schlafzimmer, das nach Norden hin lag, kühl und heimelig. Angela schlief, all ihre Gelüste gestillt, den Nippel ihrer linken Brust zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, wie eine Göttin bei Rubens, die sich vor aller Welt anschickt, Milch in den offenen Mund eines Engelchens zu spritzen. Mark Lewsons Mund stand offen, aber nicht in Erwartung von Angelas Milch: Er klappte ihm immer auf, wenn er nachdachte. Gerade war dies der Fall, weil er sich fragte, ob er wohl Angelas Handtasche auf der Frisierkommode öffnen, zwei der vier Zehntausend-Francs-Scheine, die er vor dem Essen darin gesehen hatte, entnehmen und dann aus dem Schlafzimmer und aus dem Haus verschwinden konnte, ohne Angela aufzuwecken, die, wenngleich hochbefriedigt, einen leichten Schlaf hatte. Obwohl dieser Plan, der auf einen Besuch der nachmittäglichen Spielsitzung im Casino hinauslief, dafür sorgen würde, dass ein bisschen etwas los war, etwas, womit man der sonntäglichen Stagnation in Menton beikommen konnte, sprach auch einiges dagegen. Zum einen hatte Mark fürs Spielen eigentlich nicht viel übrig und verlor auch meistens, und darüber hinaus würde Angela, selbst wenn er das Geld später zurückbrachte, nahezu sicher herausfinden, dass er es sich genommen hatte. Sie würde sehr unangenehm werden, ihn wahrscheinlich sogar rauswerfen. Dieser Gedanke schreckte ihn jedoch inzwischen immer weniger, da Angelas Auftreten in den letzten paar Tagen ohnehin zunehmend darauf hindeutete, dass sie ihn rauswerfen würde. Bevor er die Contessa geheiratet hatte, hatte Mark ausgiebig Erfahrung mit solcherlei vorübergehenden Aufenthalten sammeln können. Er konnte die Zeichen lesen wie ein Wilderer, der weiß, welches Wetter heraufzieht, und alles deutete auf ein baldiges Ende dieses besonderen Idylls hin. Also zur Hölle damit, dachte er: Ich hab ja nichts zu verlieren!
Schritt eins: sich vorsichtig vom Bett erheben, Zentimeter für Zentimeter, damit es kein verräterisches Knarzen von sich gab. Das war leichter gesagt als getan, denn das Bett, ein riesiges und uraltes, von jenseits der Grenze importiertes letto matrimoniale, neigte sehr dazu, zu quietschen, und wenn man sich darauf mit Angela vergnügte, so hörte sich das jedes Mal an wie tief im Schoß eines Windjammers, den eine steife Brise gerade vor sich hertrieb. Aber Mark wusste sich geschickt zu bewegen, hatte er doch einen Großteil seines Lebens damit verbracht, sich solche Fähigkeiten anzutrainieren; nach mehrmaligem unauffälligem Verlagern seines schmalen Gesäßes baumelten beide Beine an der Seite des Bettes hinab, und mit einer abschließenden langsamen Drehung des Oberkörpers verließ er es sicher und lautlos. Angela, immer noch in der Pose einer Frieden und Fülle verkörpernden Göttin, schlief weiter.
Schritt zwei: die Tasche öffnen und das Geld an sich nehmen. Wo er sowieso schon dabei war, konnte er auch gleich alles nehmen. (Gab ja nichts zu verlieren.)
Schritt drei: die Tür öffnen, eine fast genauso lärmende Vorrichtung wie das Bett. Hier war das Glück auf seiner Seite: Angela hatte sie in der fieberhaften Eile ihrer nach dem Essen aufwallenden Lust halb offenstehen lassen.
Schritt vier: über den kleinen Gang zum Ankleidezimmer hinüberschleichen und sich dort angemessen rausputzen. (Das Casino war zwar klein und freundlich, duldete jedoch kein zwangloses Tenue.) Ein Glück, dass er seine Kleidung nicht im Schlafzimmer aufbewahrte. Also nun: den hellgrauen Anzug, das rosarote Hemd, den Ehemaligenschlips der Etonabsolventen (Blendwerk, mit dem er sich bereits so lange zeigte, dass er inzwischen fast selbst glaubte, in Eton gewesen zu sein), und die dunklen Wildlederschuhe. Haare, Eau de Cologne, Mundwasser. (Da es zu den Unannehmlichkeiten des Lebens, das er führte, gehörte, dass er sich nie lange genug an einem Ort aufhielt, um sich einen Zahnarzt zu suchen, hatte er schlechte Zähne, übles Zahnfleisch und, wie er durchaus wusste, entsetzlichen Mundgeruch.) Zigaretten. Seinen Pass. Und das (Angelas vierzigtausend Francs inbegriffen) war alles.
Schritt fünf: wieder am Schlafzimmer vorbeigehen, die Treppe hinunter und zum Haus hinaus. Nun würde sie ihn kaum noch aufhalten können, aber er wollte das Spiel trotzdem ruhig weiterspielen: Wenn er unbemerkt rausgelangte, gewann und die vierzigtausend zurückstecken konnte, ohne dass sie etwas davon mitbekam, umso besser. Dann würde er vielleicht noch eine weitere Woche hier bleiben können. Auf Zehenspitzen ließ er das Schlafzimmer hinter sich, war erfreut, ein grässliches Schnarchen zu hören, rutschte das kurze Treppengeländer hinunter, öffnete die Eingangstür, ließ das Schloss nicht einrasten, so dass er sich selbst wieder hineinlassen konnte (Angela weigerte sich, ihm einen Schlüssel zu überlassen), und trat in den blauen und stickigen Nachmittag hinaus.
* * *
Angela Tuck träumte, dass sie wieder zurück in Indien war, oben in den Bergen bei Oute, an dem Tag vor fast fünfzehn Jahren, als sie kamen, um ihren Vater zu verhaften. Sie saßen da, sie und ihr Vater, und tranken vor dem Mittagessen einen Gin. Da sie Golf gespielt hatte und sehr durstig war, trank sie ihren mit Limettensaft und viel Soda. Als sie gerade den ersten Schluck nehmen wollte, sagte ihr Vater: »Genieß ihn, Mädel. Viele wird’s nach dem hier vielleicht nicht mehr geben.« Erneut hob sie ihr Glas, doch das war jetzt mit einem Mal leer, abgesehen von einem kleinen Eiswürfel, der das gekippte Glas entlangrutschte und ihr die Lippen verbrannte.
»Alles futsch!«, sagte ihr Vater in einem Tonfall, den er früher im Kinderzimmer verwendet hatte. Er beugte sich vor und begann sie zu kitzeln, eines ihrer Lieblingsspiele, als sie klein gewesen war. Doch dann klopfte es kurz laut an der Tür des Bungalows, die Hände ihres Vaters ließen von ihr ab, und in dem Moment, bevor sie aufwachte, erkannte Angela, dass sie ihm schließlich doch noch auf die Schliche gekommen waren und jetzt hier waren, um ihn mitzunehmen.
Was sie auch tatsächlich getan hatten, dachte sie bei sich, verschwitzt, mit trockenem Mund, hellwach. Fingierte Gehaltsabrechnungen – es war ein Wunder, dass das so lange keiner bemerkt hatte. Aber zerbrich dir wegen ihm nicht den Kopf, er liegt tot und von niemandem beweint in seinem Grab in Hongkong. Das Klopfen an der Tür. Das halb leere Bett neben ihr.
»Mark?«, rief sie.
Es war klar, was passiert war. Er war leise aus dem Zimmer geschlüpft und hatte sie dabei aufgeweckt. Sie erhob sich vom Bett, um ihre Handtasche zu kontrollieren. Vierzigtausend, die kleine Ratte. Aber sei’s drum: Wenn er auf immer weg war, waren vierzigtausend dafür kein allzu verheerender Preis; und sollte er doch wiederkommen und so tun, als wäre nichts geschehen, hatte sie einen guten Grund, ihm den Laufpass zu geben. Sie dachte ohne Groll an ihn, als sie mit der Handtasche ins Bett zurückkehrte, wo sie sich eine Zigarette anzündete, sie wieder ausdrückte, erneut an ihren Vater in Oute dachte, sich wehmütig an die schönen Renntage und die grünen Fairways auf dem Golfplatz erinnerte und in einen leichten Schlummer verfiel, aus dem sie unverzüglich erwachte, als es, zehn Minuten später, unten an der Tür klingelte.
* * *
Die Casinobesucher in Menton sind immer schon ein leicht berechenbares Völkchen gewesen. Da nur um niedrige Einsätze gespielt wird, in keinem grandiosen Ambiente, und die Croupiers zumeist nicht mehr junge, liebenswürdige Herren sind, die hier ein beschauliches Leben verbracht haben, klug genug, nicht nach Höherem zu streben, und zu ehrlich, um tief zu sinken, hat der Ort nach und nach eine familiäre Atmosphäre angenommen, so dass selbst der Casinodetektiv eine etwas steife Geselligkeit an den Tag legt, wie die Gouvernante beim Beaufsichtigen einer Teegesellschaft von lauter wohlgesitteten Kinderlein. Womit die Stammgäste gemeint wären, dauerhaft hier lebende Damen und Herren der gehobenen englischen Mittelschicht samt einigen verkniffen schauenden Französinnen, Vertreterinnen des hiesigen Handelsbürgertums, die allesamt, Engländer wie Franzosen, sowohl untereinander wie auch für den Casinodirektor und die Angestellten gute Bekannte sind.
Wenn wir die ethnische Kluft einmal ignorieren, lassen sich bei den Stammgästen zwei Gruppen ausmachen: diejenigen Gäste, die kommen, wenn das Casino nachmittags um zwei Uhr öffnet, und diejenigen, die – schlauer – erst nach einem frühen Abendessen eintreffen. Beide Gruppen setzen sich, kaum dass sie eingetreten sind, am Roulette-Doppeltisch nieder und verlassen diesen nicht mehr, bis er um zwei Uhr morgens geschlossen wird; wobei diejenigen, die ihre für diesen Tag eingeplanten Mittel verspielt haben, recht gern einfach sitzen bleiben, um zuzusehen, und gar nicht daran denken, ihre Plätze aufzugeben und sie Spielern mit ernsteren Interessen zu überlassen, von denen durchaus (selbst in Menton) gelegentlich welche auftauchen.
»So wie immer« ist demnach der Leitspruch des Casinos, und sowohl die Angestellten als auch die Kunden halten sich treu und brav daran. Die einzige Abweichung davon ist auch schon so wie immer: Jeden Sonntagnachmittag treffen beide Gruppen statt um zwei beziehungsweise um halb neun um halb fünf ein, um den Tee einzunehmen und sich so auf das große Ereignis der Woche einzustimmen: zwei Stunden, in denen Chemin de fer gespielt wird, von fünf bis sieben, ein Zeitraum, der nie verlängert wird, selbst wenn die Spieler noch so inständig darum bitten – zweifelsohne aus der Befürchtung heraus, die Kinderchen sonst zu überreizen und die mustergültige Disziplin zu stören, die den Rest der Woche über zu herrschen hat. Doch in den anberaumten Stunden von fünf bis sieben ist etwas erlaubt, das fast schon an Anarchie grenzt: Zu den ungefähr sechs Stammgästen, die reich genug sind, sich die höheren Einsätze leisten zu können, gesellen sich zwei oder drei Außenseiter an den Chemmy-Tisch (ein zartbesaiteter Italiener vielleicht, der den Lärm und das Gedränge in den Sälen von San Remo abstoßend findet, und ein oder zwei Ortsansässige, die Geld unterschlagen haben und ihre Beute nun eiligst im diskretesten Etablissement, das sich finden lässt, aufs Spiel setzen); während der Rest der Stammgäste, froh, der Tyrannei des Rouletterads für kurze Zeit einmal zu entkommen, drum herumsteht und kiebitzt, und gelegentlich einen gutmütigen Bankier bedrängt, Einsätze von ein paar hundert Francs aus dem Publikum anzunehmen.
Als dieses allwöchentliche Sonderprivileg gerade beginnen sollte, betrat Mark Lewson den Salon. Der chef de partie, wie es die Tradition vorschrieb der sanftmütigste und verkümmertste aller vorhandenen Croupiers, hatte sich immerhin genügend Instinkt für seine Profession bewahrt, dass er aufgrund von Marks Erscheinungsbild Geld witterte; und da noch ein Stuhl frei war, lächelte er und winkte ihn heran, kokett, aber auch gebieterisch, wie ein weltläufiger Onkel, der einem »mal einen guten Tipp« geben will – wie man den Tripper schneller loswird oder Vorabinformationen zu irgendwelchen Aktien, die neu auf den Markt kommen sollen. Mark beeindruckte solche Bonhomie nicht, aber er erkannte, dass ihm der noch freie Stuhl sehr gelegen kam, schließlich musste er sofort loslegen, wenn er auch nur eine leise Chance haben wollte, zurückzusein, bevor Angela aufwachte. Er grinste wie ein juveniler Vampir, überreichte dem Croupier Angelas vierzigtausend, erhielt im Gegenzug Plaques und Jetons, bestellte sich eine Flasche Champagner bei einem Kellner, der aus der Übung zu sein schien, zündete sich einen Stumpen an und setzte sich.
Der leere Platz, den er eingenommen hatte, war Platz Nummer fünf, genau gegenüber vom Croupier. Zu seiner Linken saß eine ausladende Französin, in deren Damenbart kleine Krümelchen Zuckerguss hingen; zu seiner Rechten ein alternder, distinguierter Engländer (Schriftsteller? Dichter? Universitätsprofessor?) mit langem und verstörend jugendlich wirkendem Haar, einem hoch schließenden Marlborough-Anzug, Kläppchenkragen und Fliege. Die Französin schaute Mark an, als müsste sie beurteilen, ganz objektiv, ob er wohl essbar war oder nicht; der Engländer lächelte sehr lieb und murmelte etwas über das frühlingshafte Wetter. Das Spiel begann. Die ersten drei Bankhalter verloren jeweils beim ersten Coup, und der Kartenschlitten stand nun bei der Französin, die zehntausend Francs in die Bank einlegte – deutlich mehr, als an diesem Tisch normalerweise zusammenkam.
»Banco«, sagte Mark – und verlor, Naturel, gegen eine Acht.
»Banco!«, sagte er wieder, und wieder verlor er gegen eine Acht, Naturel.
»Sie haben Pech, mein Junge«, sagte der Schriftsteller-Professor und tätschelte mitleidig Marks Haarschopf. »Wenn Sie nicht dranbleiben wollen, werde ich selbst es mal versuchen.«
Mark wollte nicht dranbleiben. Er hatte bereits drei Viertel seines Kapitals verloren und musste die ihm verbleibenden zehntausend sorgsam verwenden, wenn er überhaupt überleben wollte.
»Sehr gerne!«, sagte er.
»Banco«, flötete sein Nachbar, wobei ihm mehrere Halsläppchen über den Kläppchenkragen hinausqollen.
Die Französin stieß vier Worte aus, wie eine scharfe Maschinengewehrsalve, die sie gezielt auf die falschen Zähne des Croupiers abfeuerte. Nein, antwortete dieser, die Madame könne nach den hiesigen Hausregeln nicht einen Teil ihres Gewinns en garage stellen, erst wenn sie als Bankhalterin bereits drei Coups gespielt hätte. Die Madame, die die Regeln ebenso gut kannte wie ihren Ehenamen, ließ verlauten, dass dies »effroyable« sei, sie die Bank aber dennoch weiter halten werde.
»Banco«, wiederholte der Marlborough-Anzug und gewann schließlich mit einer Zwei gegen Madames Baccarat.
Die Bank ging nun an Mark, der das Minimumbanco von zweitausend setzte, die er sofort mit einer Naturel-Acht an die Naturel-Neun des Marlborough-Anzugs verlor, woraufhin er einen weiteren mitleidigen Tätschler aufs Haupt erhielt. Drauf und dran, sich mit dem brennenden Ende seines Stumpens bei ihm zu revanchieren, besann er sich noch einmal darauf, dass ihm nur noch achttausend Francs blieben und er besser seine guten Beziehungen nicht gefährdete. Im Gegenzug für das Recht, ihn bis zum Ende der Spielrunde zu tätscheln, würde ihm Kläppchenkragen vielleicht was leihen oder ihm einen Scheck ausschreiben. Diese Frage wurde immer vordringlicher, nachdem die Bank rasch am Tisch die Runde gemacht hatte, erneut bei Mark angekommen war und ihn gleich darauf die fünftausend Francs kostete, die er übereilt gesetzt hatte. Nur noch dreitausend übrig (und den Champagner musste er auch noch bezahlen).
Kläppchenkragens dürre Hand schob nun fünftausend auf den Tisch, um damit die eben übernommene Bank zu eröffnen. Der alte Idiot hatte eine Glückssträhne und machte richtig Kasse.
»Kann ich mit einsteigen?«, fragte Mark. »Halbe-halbe?«
Hoffnungsvoll bot er zweitausendfünfhundert, womit ihm nur noch eine jämmerliche Marke übrig blieb, die wie ein Stück Hotelseife aussah, fünfhundert Francs wert.
»Geht leider nicht, mein guter Junge. Spiele nie mit dem Geld anderer Leute. Gibt am Ende nur üble Streitereien, Sie wissen schon.«
Der Marlborough-Anzug gewann daraufhin zehnmal hintereinander und bekam, als ihn das Glück schließlich verließ, nahezu zweihunderttausend Francs vom Croupier ausgezahlt. Hätte mich alt Itzig mitmachen lassen, dachte Mark böse, ich wär’ fein raus, nichts wie weg und schuldenfrei dazu gewesen. Und jetzt hat der alte Mistkerl auch noch die Dreistigkeit und tätschelt mir schon wieder das Haar.
»Ich hab mein Scheckbuch hier«, begann er beiläufig. »Wir Engländer untereinander …«
Die Hand wurde ohne Eile von Marks Kopf genommen.
»Versuchen Sie’s an der Kasse.« Die Hautlappen baumelten wie zwei Gesäßhälften, von der Kinnritze getrennt. »Die kennen sich damit aus. Ich habe es eher mit der Antike – nicht so mit Zahlen.«
Gewandt sortierten und zählten die blassen Hände die schimmernden bijoux, die ihm der Croupier mit dem Rechen zuschob. Mark begann zwischen den Beinen zu schwitzen. Nur noch dreitausend übrig. Er war am Ende. Zurück zu Angela? Peccavi? Gott, du siehst so sexy aus, dass ich’s gar nicht erwarten kann? Wie satt er es hatte, an dieses verdammte Weib gekettet zu sein; wäre sie nicht so geizig, all das hier wäre gar nicht passiert.
In der Zwischenzeit war schon eine weitere Bank mit hohen Einsätzen eröffnet. Der Nachbar zur Rechten des Haartätschlers führte die Glückssträhne seines Vorgängers, wie es oft der Fall ist, noch weiter. Nach seinem sechsten Gewinn besprach sich dieser neue Bankier mit dem Croupier; ein großer Stapel Jetons und Plaques wurde daraufhin zur einen Seite befördert, ein zweiter, noch größer, verblieb in der Mitte.
»Cent mille pour la banque.«
»Banco!«, sagte Mark spontan. Vielleicht würden sie ihn ja spielen lassen, ohne das Geld sehen zu wollen; wobei er zur Strafe, falls er verlor, wahrscheinlich ins Zuchthaus wanderte. So stand es in einem von Flemings Romanen, möglicherweise würden sie ihn aber einfach bloß rauswerfen und es dabei belassen. Jedenfalls war das hier eine Maßnahme.
»Banco«, sagte er noch mal.
Von den Kiebitzen kam ein erfreutes Raunen: Banco bei hunderttausend war ein seltenes Vergnügen. Der Haartätschler schaute ausdruckslos, die weibliche Kuchenesserin skeptisch, der Rest der Spieler erwartungsvoll. Das verkümmerte Croupiershirn begann noch einmal zu rattern. Der ihm verbliebene Instinkt, der ihn dazu gebracht hatte, Mark an den Tisch zu bitten, hatte ihm gesagt, dass der junge Mann vielleicht sechzigtausend wert war. Nicht mehr. Aber der Champagner, die Unbekümmertheit angesichts all dessen, was er verloren hatte …? Andererseits der ziemlich abgetragene Anzug, sein angelegentliches Flüstern mit dem englischen Professor … Was sollte man davon halten? Nein, entschied er, das Geld war zuerst zu zeigen.
»M’sieur … l’argent?«
»Immer noch dieselbe alte Tour, Lewson?«, sagte eine weiche Stimme in Marks Ohr. »Diesen hier spendiere ich Ihnen, unter der Bedingung, dass Sie mir dafür danach Ihren Platz überlassen. Egal, ob Sie gewinnen oder verlieren.«
Eine malvenfarbene Plastikmarke, die 100 000 Francs verhieß, tauchte neben Marks rechter Hand auf. Der Professor lächelte jovial. Die Kuchendame zupfte mit der gewohnheitsmäßigen Unbekümmertheit eines Dragonerobersts an ihrem Oberlippenbart herum. Mark bekam zwei Karten: eine Zehn und einen König – was null ergab. »Carte, s’il vous plaît.« Der Bankier deckte nun seinerseits seine Karten auf, zeigte, dass er eine Sieben und einen Buben hatte, und schnippte Mark eine Acht rüber. »Je reste.« »Sept pour la banque et« – Marks beide ersten Karten aufdeckend – »huit pour m’sieur.« Es war ausgestanden. Mark erhielt eine zweite malvenfarbene Plastikmarke, seinen Gewinn, und drehte sich zu seinem wohltätigen Spender um.
Obwohl er ihn erst ein einziges Mal getroffen hatte, drei Jahre zuvor und nur kurz, hätte er gar nicht anders gekonnt, als ihn wiederzuerkennen, nach den vielen Fotografien, die seither in der Presse erschienen waren: den Impresario des Glücksspiels, Max de Freville. Die tiefen Furchen, die sich von der Nase aus nach unten schwangen, waren einfach unverwechselbar. Was jedoch machte de Freville hier, bei einem schäbigen kleinen Spiel in Menton? De Freville, der eine halbe Million schwer war (so wurde erzählt), der selbst schon lange nicht mehr spielte, der nur noch diskrete Spiele um sehr viel Geld organisierte und sich seinen Teil vom Gewinn nahm?
»De Freville?«
»Meinen Einsatz hätte ich gern zurück, wenn Sie nichts dagegen haben. Und meinen Platz.«
Mark erhob sich, gab de Freville eine der beiden malvenfarbenen Plastikmarken und steckte sich die andere in die Tasche. Schuldenfrei, nichts wie weg und fein raus – mit sechzigtausend! Zeit, heim zu Angela zu gehen und das Geld zurückzulegen, das er sich geborgt hatte. Doch hielt ihn die Neugier zurück. Es passierte nicht jeden Sonntagnachmittag, dass einem eine so namhafte Person wie Max de Freville begegnete, dessen Anwesenheit hier nach einer Erklärung schrie. Dazu kam, dass er es beachtlich fand, dass de Freville sich seinen Namen und seinen Ruf so genau gemerkt hatte, obwohl sie sich (buchstäblich) nur flüchtig im Dunkeln begegnet waren. Nachdem er abgewartet hatte, bis de Freville im zweiten Coup seine Bank verloren hatte, wollte Mark es wagen:
»Ich hab Sie bestimmt drei Jahre nicht gesehen. Nicht seit diesem Ball bei Donald Salinger. Was tun Sie denn ausgerechnet hier, in Menton?«
»Ich komme her, wann immer ich kann. Riecht ein wenig nach dem Grabe der Mittelschicht, was mir gut gefällt. Und im Landesinneren gibt es ein paar ganz nette Dinge zu se-hen.«
Mit der Hand wies er aus dem Casino hinaus und über die Berge hinweg, weit in die Provence hinein.
»Ich meine gehört zu haben, Sie hätten das Spielen aufgegeben?«
»Habe ich auch.« Die Stimme klang leicht verwaschen, als käme sie aus großer Ferne, unter vielen in erbarmungslosen Jahren angesammelten Schichten Ennui und Bedauern hervor. »Ich sitze hier nur, damit Sie nicht in Schwierigkeiten kommen – und um denen hier eine Chance zu geben, ihr Geld zurückzugewinnen. Beruflich bedingte Gewissenhaftigkeit. Ich kann einfach nicht zusehen, wie ein Platz ohne Vorwarnung plötzlich frei wird. Aber sobald die Runde um ist, gehen wir. Mehr können sie meines Erachtens nicht verlangen.«
»Sie sind wegen mir hergekommen?«
»Wegen Angela. Ich bin vorhin bei ihr reingeschneit, und sie hat mir von Ihnen erzählt. Banco. Wie es aussieht, will sie Sie loswerden, und da ich für ein paar Tage hierzubleiben gedenke, will ich das ebenso. Sie dachte, dass Sie vielleicht für immer auf und davon wären, aber da habe ich gesagt, nicht Sie, Leute wie Sie sind nie verschwunden, bevor sie nicht das Letzte rausgeholt haben. Also habe ich mich angeboten, mich ein bisschen nach Ihnen umzuschauen. Und da Sie noch hier sind …«
»Sie wissen ja, was Sie dagegen unternehmen können.«
»Carte … Und habe es auch schon getan. Sie können die malvenfarbene Plaque eintauschen, Angie ihre vierzigtausend geben und den Rest behalten. Was alles Weitere angeht, würde ich Sie, wenn es nach mir ginge, rauswerfen und Schluss.« Er schob einen Stapel Jetons, die er eben verloren hatte, über den Tisch. »Aber Angie meint, sie schuldet Ihnen ein bisschen mehr für die vergnügliche Zeit, die Sie ihr bereitet haben. Sie möchte, dass Sie irgendwo ›im Geschäft‹ sind, wie sie es nennt. Glücklicherweise können wir Ihnen da zu etwas verhel-fen.«
»In Ihrem Geschäft?«, sagte Mark eifrig.
»Bei mir dürften Sie noch nicht mal den Boden im Klo wischen, Lewson. Nein. Ich habe das letzte Mal, als ich hier war, eine interessante Geschichte gehört, aus der sich für Sie eine Beschäftigung ergeben könnte. Wenn Sie von mir entsprechend eingeführt werden.«
Das Blech klickerte aus dem Schlitten. De Freville erhob sich, verbeugte sich vor der französischen Dame und nickte dem Marlborough-Anzug zu seiner Rechten zu.
»Kommen Sie«, sagte er zu Mark. »Bringen Sie die Plaque zur Kasse, bezahlen Sie Ihren Schampus, und dann auf zu Angie.«
Während Mark und de Freville unterwegs waren zu Angelas Villa, war sie selig und liebevoll dabei, einen üppigen English Tea vorzubereiten – denn das war, wie sie wusste, de Frevilles Lieblingsmahlzeit.
Die Beziehung zwischen Angela und de Freville, inzwischen von zweijähriger Dauer, war kurios. Ihren Ausgangspunkt hatte sie mit einem zufälligen Aufeinandertreffen auf der Promenade von Menton genommen, wo Angela über einen algerischen Teppich gestolpert war, der am Rande des Gehwegs feilgeboten wurde. Sie war der Länge nach hingeknallt, hatte sich beide Knie böse aufgeschlagen, einen kleinen Schock sowie eine große Blamage erlitten und war sehr erleichtert gewesen, als ein großer, schweigsamer und taktvoller Engländer ihr aufgeholfen, den Staub von ihr abgeklopft und sie auf einen Stuhl befördert hatte, um ihr einen Drink zu spendieren. Von ihrem eigenen linkischen Auftritt aus der Fassung gebracht und vom Alkohol leicht enthemmt hatte sie ihm, um ihre Beschämung ein wenig zu vernebeln, von ihrem kürzlich eingetretenen Witwendasein berichtet, und über die Beweggründe, die sie nach Menton geführt hatten (ein von einer wilden, ungewissen Jugend herrührendes Bedürfnis nach Ruhe, gepaart mit einem noch vorhandenen Restbedürfnis, jederzeit in der Umgebung wildes Treiben verfügbar zu wissen). Da de Frevilles Motive für seine häufige Anwesenheit an diesem Ort ganz ähnliche waren, hatte sich sogleich eine vorsichtige Sympathie zwischen ihnen entsponnen. Sie waren daraufhin herumspaziert, zusammen abendessen gegangen, hatten über das hiesige und das häusliche Leben gesprochen, sich über den Preis von Fisch und das unverschämte Verhalten der Schalterbeamten in französischen Banken ausgetauscht, eng, aber unaufgeregt miteinander getanzt, und waren schließlich, inzwischen von uneingeschränkter gegenseitiger Sympathie getragen, miteinander zu Bett gegangen, leidenschaftslos und ohne den Akt vollziehen zu wollen.
Denn obwohl de Freville mit Angela das letto matrimoniale teilte, weil sie beieinander sein wollten, blieb ihre Beziehung rein platonisch. Das Einzige, was beiden immer gefehlt hatte und was beide nun im anderen fanden, war innere Ruhe – die friedvolle Aussicht auf ein geruhsames, unbekümmertes und unspektakuläres Voranschreiten des Tages von seinem Beginn an durch seine Alltäglichkeiten hindurch bis zu seinem Ende, wenn sie sich ins Bett zurückzogen, dort Seite an Seite lagen, einfach bloß die Berührung des anderen suchend, so unschuldig und leicht hinwegschlummernd wie zwei Kinder, für die der kommende Tag nichts als gute Kost und liebevolles Umsorgtwerden bereithält. Nach fünf auf diese Weise verbrachten Tagen, wenn de Freville zu seinen Geschäften zurückkehren musste, nahmen sie beide ihren üblichen Lebenswandel wieder auf: de Freville die ruhelose und immer mühseligere Überwachung seiner Spieltische in London, Angela die tägliche Suche nach dem nächtlichen Gebieter über ihre Fleischeslust. Beide wussten sie, was der andere in der eigenen Abwesenheit tun würde; beide hatten Mitleid und Verständnis füreinander; beide erwarteten freudig, aber ohne ihr Leben derweil zu ändern, dass sie sich in Menton wiedersehen konnten und erneut zusammen und zufrieden waren. Obwohl die gesamte Küste rauf und runter Freunde von ihnen in ihren Villen saßen, besuchten sie diese nur selten, da der Bann nur in Menton zu bestehen schien und eine Reise selbst von nur wenigen Kilometern umgehend eine Missstimmung entstehen ließ und sie sich unbehaglich miteinander fühlten. Aus diesem Grund war auch keine Rede von einer Heirat, von einem dauerhaften Zusammenleben, wohin auch immer das Schicksal sie verschlagen würde: Ihre Verbindung sollte nicht mehr sein als eine regelmäßig wiederkehrende Ruhe-Kur, eine Behandlung, die man durchaus öfter suchen konnte, der man sich jedoch nicht dauerhaft hingeben durfte, ohne dabei dem Leben selbst zu entsagen.
De Frevilles unerwartete Ankunft zu einer Zeit, in der Angela eigentlich noch auf Lewson-Kost war, brachte weder ihn noch Angela in Verlegenheit. Es bedeutete schlicht und einfach, dass Lewson nun umgehend zu verschwinden und das Feld zu räumen hatte. Da dieser Ausgang der Dinge ohnehin wünschenswert war und da de Freville ihr nun Beistand leisten konnte, falls Mark sich weigern würde, war das Eintreffen des Ersteren in doppelter Hinsicht günstig. Sogar in dreifacher – denn de Freville wusste viel mehr als Angela über derlei kleine »Geschäfte« Bescheid, wie sie Mark eines zu präsentieren hoffte, damit dieser nach seiner Abreise aus seiner Zwangslage herausfand. Jetzt also, dachte sie am Küchenfenster stehend und beobachtend, wie die beiden sich näherten, können wir vernünftig über die ganze Angelegenheit sprechen und ihn dann vor die Tür setzen, bevor es dunkel wird. Ich frage mich, wo Max ihn wohl gefunden hat …
Nachdem sie darüber aufgeklärt worden war und sie ihre vierzigtausend Francs zurückerhalten hatte, setzten sie sich gemeinsam zum Tee hin.
»Also gut«, sagte Angela. »Dank Max’ Hilfe hast du jetzt sechzigtausend Francs in der Tasche. Von jetzt an bist du also auf dich allein gestellt. Aber eins können wir noch für dich tun. Erzähl’s ihm, Max.«
Sie nahm es mit dem Hantieren mit der Teekanne sehr genau, als wären sie auf dem Internat und sie die Ehefrau des dem Haus vorstehenden Lehrers beim Abschiedstee für einen Jungen, der gezwungen war, die Schule zu verlassen, weil sein Vater bankrott und im Gefängnis gelandet war. Max, dem hier der Part des dem Haus vorstehenden Lehrers zukam, lehnte sich vor, nahm seinen Tee dankend mit einem gravitätischen Nicken entgegen und begann behutsam und durchaus teilnahmsvoll seinen Plan für Marks Zukunft zu erläutern.
»Ich habe einen Freund«, sagte Max, »einen griechischen Spieler namens Stratis Lykiadopoulos, der wegen seines kühlen Kopfes und seiner würdevollen Erscheinung sehr gefragt ist, wenn es darum geht, als Bankier für die großen Baccarat-Syndikate zu spielen. Zu allem Übrigen gilt er noch als jemand, der einfach Glück hat, und die Jungs mit dem fetten Geld sind über alle Maßen abergläubisch.«
»Wie Napoleon bei seinen Marschällen?«
»So in der Art. Aber wie selbst der glückreichste der Marschälle ist auch Lykiadopoulos nicht gegen Fehlentscheidungen gefeit. Es ist zwei Jahre her, dass er während eines Spiels einen Scheck über drei Millionen Francs zum damaligen Wert von einem Franzosen namens Jacques des Moulins angenommen hat. Bis sich herausstellte, dass der Scheck nicht gedeckt war, war des Moulins längst über alle Berge, und mein Freund musste, da er auf eigenes Risiko gehandelt hatte, die drei Millionen für das Syndikat wieder beschaffen – wobei das Syndikat ihm allerdings auch erlaubte zu versuchen, den Betrüger mithilfe seines weitverzweigten Netzes von Syndikatsagenten aufzuspüren. Des Moulins wurde schließlich in Beirut ausfindig gemacht, in ziemlich schlechter Verfassung. Obwohl eindeutig feststand, dass von ihm kein Geld zu bekommen war, machte sich Lykiadopoulos, der sich stets für die Wechselfälle des Lebens interessiert hat, auf den Weg, um den Mann zu treffen und sich von ihm seine Geschichte erzählen zu lassen. Offenbar war dieser von Beruf ein recht aussichtsreicher Diplomat gewesen, der allerdings aus dem Dienst entlassen oder vielmehr entfernt worden war, nachdem er den siebzehnjährigen Sohn eines Ministers verführt hatte, bei dem er die Funktion eines Privatsekretärs, wie wir es wohl nennen würden, bekleidet hatte. Seines Lebensunterhalts wie auch des Berufes beraubt, hatte er sich dem Glücksspiel zugewandt, so seine Ersparnisse durchgebracht und dann mit dem versuchten coup de déshonneur bei Lykiadopoulos eine letzte Bemühung unternommen, seinen Status wiederzuerlangen. Als er damit gescheitert war, scheiterte auch alles andere, und der arme Tropf war gen Osten geflohen, um seine Schmach in der klassischen Manier seiner Vorväter zu verbergen.«
»Warum ist er nicht zur Fremdenlegion gegangen?«, sagte Mark spöttisch.
»Aus demselben Grund, aus dem Sie es nicht tun. Weil er zu faul war. Und weniger daran interessiert, seinen guten Namen wiederherzustellen, als einfach bloß frei von den Konsequenzen seines damaligen Tuns zu leben. Es war ihm gelungen, einer Tante jeden Monat grade genug Geld abzupressen, dass er ein klägliches Leben im Bordellviertel beim Place des Cannons fristen konnte, wo er zusammen mit einem unterbelichteten arabischen Jungen von abstoßendem Äußeren lebte, dem er leidenschaftlich zugetan war und der seine Zuneigung erwiderte. Tatsächlich, so bemerkte Lykiadopoulos mir gegenüber später einmal, gab es hier etwas Wichtiges über die menschliche Liebe zu lernen: Diese meint nicht eine bestimmte Person, sondern wird aus den Umständen oder einem Bedürfnis heraus auf das erstbeste erreichbare Objekt übertragen, das den Weg kreuzt. Wie bei der Geschichte mit Titania, verstehen Sie?«
Er blickte kurz zu Angela, um zu schauen, ob die Botschaft bei ihr angekommen war. Wenn dem so war, ließ sie sich davon nicht beirren. In aller Ruhe schenkte sie für alle frischen Tee aus.
»Es ergab sich«, fuhr Max fort, »dass Lykiadopoulos für einige Wochen in Beirut festgehalten wurde, weil dort eine heikle Angelegenheit mit ausländischen Währungen abzuwickeln war, womit ihn sein Syndikat betraut hatte. Eine der vergnüglicheren Folgen dieser Machenschaft war, dass Beirut anschließend in ägyptischen Pfund schwamm, zum Kurs von einem Pfund und Sixpence, aber das tut hier nichts zur Sache. Was Sie wissen sollten, ist, dass Lykiadopolous des Moulins teils aus Nettigkeit, teils aus Interesse noch zwei- oder dreimal in seiner Bruchbude aufgesucht und ihm jeweils kleine Gefälligkeiten erwiesen hat. Und als Lykiadopolous zum letzten Mal vorbeikam, um sich zu verabschieden, tat des Moulins, was er konnte, um sich dankbar zu zeigen. Um die drei Millionen, mit denen er bei ihm in der Schuld stand, zu begleichen, händigte er ihm das einzig Wertvolle aus, das er besaß: einen Brief. Einen Brief, der dem französischen Minister gehörte, in dessen Diensten er vor seiner Entlassung gestanden hatte, und den er spontan hatte mitgehen lassen, als er das Haus des Ministers zum letzten Mal verließ.«
»Wenn der Brief wertvoll war, wieso hat des Moulins ihn dann nicht selbst zu Geld gemacht?«
»Er war eigentlich als letzter Notnagel gedacht, aber als es so weit war, dass er ihn gebraucht hätte, hatte er die Hoffnung schon verloren. Er hatte weder die Kraft noch den Wunsch, das zu ändern, was er inzwischen als sein Schicksal ansah. Als er Lykiadopoulos seinen Wetteinsatz von drei Millionen zugerufen und einen wertlosen Scheck ausgeschrieben hatte, war das eigentlich eine Frage an Gott gewesen, ihm ein Zeichen zu geben, ob er weiter so leben sollte wie bisher oder ob er sich aufgeben und damit praktisch den Tod suchen sollte. Gott entschied sich für Letzteres, und des Moulins hatte die Entscheidung akzeptiert. Er würde sich mit seinem mageren Auskommen und dem schwachsinnigen Jungen in Beirut verkriechen, bis Gott sich seiner dann gänzlich entledigen würde. Er war nicht unglücklich, nur wie betäubt; und immerhin hatte er jemand noch weit Geringeren als sich selbst, um den er sich kümmern konnte. Was den Brief anging, so hatte dieser keine Bedeutung mehr für das, was in seinem Leben noch vor ihm lag; sollte Lykiadopoulos ihn zu Geld machen, wenn er konnte – was ihn selbst anging, er würde sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich auf ewig drunten im Dreck und Dunkel in die Arme seines geliebten Schwachkopfs legen.«
»Verstehe«, sagte Mark. »Und was stand in dem Brief?«
»Der Brief«, sagte Max in einem gelangweilten, nüchternen Tonfall, in dem er genauso gut Zahlen aus einem Rechnungsbuch hätte vorlesen können, »stammte von einem israelischen Geschäftsmann mit deutschen Wurzeln, der mittlerweile Yahel hieß. Er war dem Sohn des Ministers anvertraut worden – dem, den des Moulins später verführte –, als dieser 1956 die Ferien mit einer Schülergruppe in Israel verbrachte. Genau genommen darf man gut und gerne annehmen, dass die gesamte Schülerfahrt nach Israel einzig und allein arrangiert worden war, damit dem Minister in Frankreich eine geheime Botschaft zugespielt werden konnte.«
»Ziemlich umständlich, oder?«
»Glatt und wie am Schnürchen organisiert ist alles immer nur im Spionageroman. Im wahren Leben sind die Rädchen schartig und verrostet, weil sie schon so lange ihren Dienst tun müssen, und die Rillen haben durchweg die falsche Breite … Umständlich oder nicht – der Plan funktionierte. Sobald der Junge wieder zurück war, Mitte September ’56, übergab er den Brief seinem Vater, und was darin mitgeteilt wurde, war Folgendes: Erstens, die israelische Armee habe einen Plan für die Invasion in Ägypten ausgearbeitet, der innerhalb von vierundzwanzig Stunden ausgeführt werden könne. Zweitens, die Stimmung in Ben Gurions Kabinett sei eindeutig so, dass eine ›enge Abstimmung‹ mit Frankreich favorisiert werde, was gemeinsame Motive und ›kompatible Vorgehensweisen‹ angehe; sollten die Franzosen den geringsten Hinweis erkennen lassen, dass sie zu einem Austausch darüber bereit seien, würden die Israelis ihnen augenblicklich im Geiste ›totaler Kooperation‹ begegnen.«
»Kaum mehr als das, was ohnehin schon bekannt ist oder gemunkelt wird.«
»Ah! Yahels dritter Punkt war der folgende: Er sei über seine Geschäftspartner in London mit einem ranghohen Mitglied des britischen Kabinetts in Kontakt gekommen, das von bestimmten Kollegen mit der hochgeheimen Übermittlung ihrer – hochgeheimen – politischen Pläne betraut worden sei. Die Namen, das sollte ich dazusagen, werden klar genannt. Nach dem, was Yahel dann sagt, ist absolut offensichtlich, dass ein Teil des britischen Kabinetts nicht nur bereit und begierig darauf war, bei dem Spaß mitzumischen, sondern dass die ganze Idee der geheimen Dreierabsprache – Großbritannien, Frankreich, Israel – ursprünglich aus London stammte und das geistige Kind des eben genannten hochrangigen Kabinettmitglieds gewesen ist. Keine Rede von einem Hineinschlittern durch die Macht der äußeren Umstände, kein Zur-Kolonne-Stoßen in letzter Minute. Die Schuld für die gesamte Affäre liegt bei einem einzigen Mann, der willentlich und zu einem frühen Zeitpunkt das Vorgehen erdacht hat, bei ausgewählten Freunden dafür geworben und mit ausländischen Agenten konspiriert hat, um alle nötigen Schritte auf den Weg zu bringen. Erst nachdem und weil Israel grünes Licht aus London erhalten hatte, hielten die Israelis, mit Yahel als Sprachrohr, es für angebracht, sich an die Franzosen zu wenden.«
»Mit anderen Worten«, sagte Mark langsam, »die Krise ist von einer Handvoll Minister aus dem Kabinett arrangiert worden – ohne vermutlich die Wünsche des restlichen Kabinetts zu beachten.«
»Und ohne das Wissen des restlichen Kabinetts. Was erklärt, warum einige Ministerien, besonders diejenigen Abteilungen, die für die Streitkräfte zuständig sind, so dermaßen überrumpelt waren, als es losging. Niemand hatte die Kriegsherren informiert.«
»Sicher hätten doch aber … die schuldigen Minister als die perfekten Sündenböcke herhalten können, als klar wurde, dass die ganze Sache ein so desaströser Reinfall ist?«
»Nie im Leben! Hätte der Premierminister denn aufstehen und sagen können, dass ohne sein Wissen und ohne das seiner Berater eine kleine Gruppe Männer erfolgreich konspiriert hatte, mit dem Ziel, das Land in etwas hineinzuführen, das sich als der totale Krieg hätte erweisen können? Nein. Die ganze Sache musste wegerklärt werden, als wohlgemeinte Reaktion auf eine schwierige Situation, oder gerechtfertigt werden, als pflichtbewusste Unterstützung eines fehlgeleiteten Verbündeten, oder es musste eben eingestanden werden, dass es sich um ein vollkommenes Durcheinander gehandelt hatte – was immer Sie wollen, jedenfalls durfte das Ganze nicht als vorab gemeinschaftlich verabredeter Plan entlarvt werden. Und das bedeutete auch, über die schuldigen Minister kein Wort zu verlieren … von denen die meisten, da können Sie sicher sein, mittlerweile ausrangiert wurden. Aber mindestens drei von denen sind zu fähig, zu unentbehrlich, als dass man sich ihrer entledigen könnte, und die sind zurzeit ganz vorne mit dabei. Dieser Brief, Lewson, diskreditiert nicht nur einige führende Mitglieder unserer derzeitigen Regierung, er könnte sogar das Vertrauen der Bevölkerung allein in die Vorstellung, von den Konservativen regiert zu werden, auf Jahre hinaus beschädigen.«
»Wertvoll, wie Sie sagten.«
»Mehr als drei Millionen Francs wert. Erst recht in einem Wahljahr.«
»Und Lykiadopoulos?«
»Weiß nichts damit anzufangen. Liegt außerhalb seines Dunstkreises, sagte er. Er will keinen Ärger, sagt er: Er hat die vielen im Balkan angeborene Angst, dass er in dem Augenblick, in dem er sich der Politik auf hundert Meilen nähert, gleich niedergestochen oder in die Luft gejagt wird. Ein unmögliches Verhalten, sagt er, sei es dem Sohn des französischen Ministers gegenüber gewesen, diesen noch vor Beginn seiner Berufslaufbahn als Mittelsmann dazu gebracht zu haben, sich zu kompromittieren, wo er doch noch ein unschuldiger Junge war.«
»Ist ja offenbar leicht zu rühren, der Mann.«
»Wie alle Spieler. Das dürfen sie sich erlauben, bei diesem Lebenswandel. Was Lykiadopoulos aber eigentlich hindert, ist, dass er sich nicht geschickt genug anstellen würde. Er ist so daran gewöhnt, kurzfristige Probleme am Spieltisch zu lösen, dass er eine Sache nicht zu Ende denken kann, wenn es mal um etwas Längerfristiges geht. Er kann noch nicht mal klar zwischen den möglichen Märkten unterscheiden: den Käufern, die Geld für den Brief hinlegen würden, damit sie damit dann lauthals einen Skandal anzetteln können, und denen, die Geld bezahlen würden, vielleicht sogar deutlich mehr, um für Stillschweigen zu sorgen. Er versteht einfach nicht, dass mit einem Verkauf zu letzteren Bedingungen unter anderem keine Gefahr mehr bestünde, dass irgendwer dem armen Jungen auf den Leib rückt.«
»So denkt man als Grieche nicht. Die kommen aus einer Tradition, bei der immer wieder die persönliche Ehre auf dem Spiel steht, es Blutfehden gibt, so dass keine Angelegenheit jemals erledigt ist. Nehmen Sie den Fluch der Atriden …«
»Vergeltung üben, weil eine primitive Religion es verlangt«, sagte Max missbilligend. »Es gibt keinen Grund, warum dieser Brief für ihn irgendwelche Unannehmlichkeiten nach sich ziehen sollte. Er müsste lediglich den Verkauf aushandeln, für eine hohe Summe, und zusehen, dass er in sichere Hände kommt, die ihn in der Versenkung verschwinden lassen.«
»Gegen eine Schatzanweisung vielleicht?«
»Für solche Angelegenheiten gibt es spezielle Töpfe.«
»Warum lassen Sie Lykiadopoulos nicht einfach damit machen, was er will? Es ist sein Brief.«
Angela stellte das Teegeschirr auf ein Tablett.
»Da Lykiadopoulos keine Verwendung für den Brief hat«, sagte sie zögerlich, »kam es mir … uns … in den Sinn, dass er dir vielleicht ganz gelegen käme.«
»Ah, verstehe. Ich marschiere also einfach zu ihm hin und bitte ihn darum.«
»Hör auf Max!«, sagte sie, als wollte sie ein bockiges Kind dazu bringen, sich die Predigt seines Vaters anzuhören.
Max ächzte und hievte sich aus seinem Sessel, um ihr die Tür aufzuhalten. Angela ging mit dem Tablett hinaus.
»Ihr könnt eure kleine Unterredung beenden, während ich den Abwasch mache«, sagte sie. »Danach könnten wir zusammen eine kleine Runde drehen.«
Also wirklich, dachte Mark, wenn ich mir noch mehr von diesem Hausmütterchen-Getue anschauen muss, fange ich an zu schreien. Laut sagte er: »Also? Wie komme ich da ran?«
»Sie klingen nicht eben dankbar.«
»Doch, ich werde schon dankbar sein … wenn Sie irgendeinen Vorschlag haben, wie das machbar sein soll.«
»Ganz einfach«, sagte Max. »Ich gebe Ihnen ein Empfehlungsschreiben mit. Wie ich Ihnen schon sagte: Er ist ziemlich rührselig. Sie setzen also Ihre Vorzüge ein und finden heraus, wo der Brief ist, und dann stehlen Sie ihn.«
»Was natürlich ein Kinderspiel ist.«
»Sie können nicht erwarten, dass man Ihnen alles auf dem Tablett serviert.«
»Nehmen wir mal an, ich bin nicht sein Typ.«
»Jeder, der so jung ist wie Sie, ist sein Typ.«
»Und was, wenn es schon jemand anderen gibt?«
»Er ist niemand, der sich nicht auch einmal nebenraus was gönnt.«
»Also, wo finde ich ihn?«
»In Venedig. Hotel Danieli. Er soll draußen auf dem Lido in etwa zehn Tagen ein Spiel ohne Tischlimit abhalten. Sehen Sie zu, dass Sie mit Ihrer Tour durch sind, bevor das losgeht – wenn es so weit ist, wird er anderes im Kopf haben.«
»Erklären Sie mir eins«, sagte Mark. »Warum sind Sie so versessen darauf, dass ein guter alter Freund von Ihnen beraubt wird?«
»Worauf ich versessen bin, oder vielmehr Angie, ist, Sie unter fairen Bedingungen loszuwerden. Was meinen guten alten Freund angeht, so tut ihm der Brief nicht gut. Und nicht zuletzt, und gar nicht nur am Rande, wird es mich interessieren zu erfahren, was Sie mit dem Brief dann anstellen.«
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Die Korruptheit in den obersten Etagen«, erklärte Max geduldig, »ist ein Hobby von mir. Ich schlage kein Kapital aus meinem Wissen, weil ich im Reich der menschlichen Schwächen ja schon meine eigene kleine Nische gefunden habe, aber ich sammle gern Anschauungsmaterial. Ich sagte ja schon, dass Spieler leicht zu rühren sind. Sie haben zudem ein ungeheures Bedürfnis nach Bestätigung. Ich spiele zwar selbst nicht mehr, aber ich lebe vom Spielen, und auch ich habe dauernd das Gefühl, mich vergewissern zu müssen.«
»Vergewissern? Worüber denn, verdammt noch eins?«
»Ich will mir gerne immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass in der Welt kleingeistige und käufliche Menschen das Sagen haben, und zwar bis hinauf in die höchsten Kreise. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit – dass ich mich im gängigen Rahmen bewege, dass ich in einem wichtigen Bereich der menschlichen Norm entspreche. Sie lassen mich wissen, wie Sie diesen Brief veräußern werden, was die Leute sagen, was sie damit anfangen wollen, und ich versichere Ihnen, dass ich mich großzügig zeigen werde. Ich will bloß einen schnörkellosen Bericht der Tatsachen, mehr nicht. Und erlauben Sie sich nicht den Spaß, mir Lügen aufzutischen, Lewson. Denn früher oder später werde ich das herausfinden, und dann gnade Ihnen Gott.«