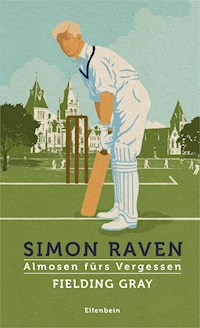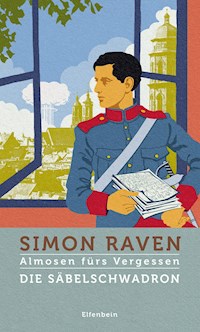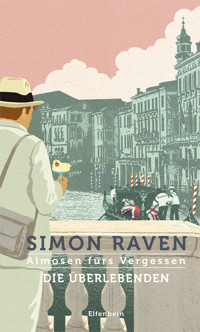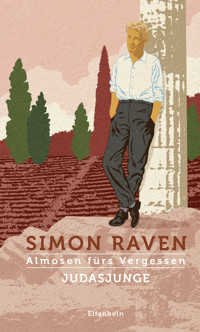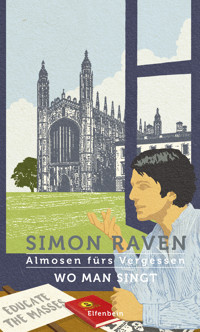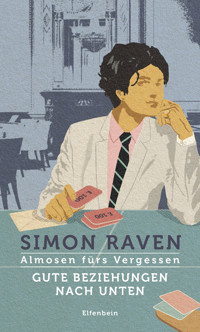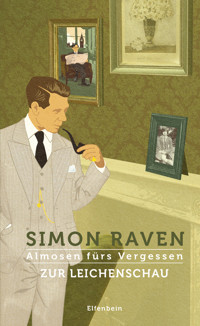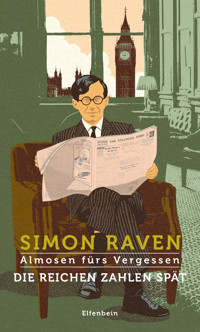Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Almosen fürs Vergessen
- Sprache: Deutsch
Korfu 1970, beim Dreh eines Monumentalfilms über die Irrfahrten des Odysseus: Jules Jacobson, Regisseur der namhaften amerikanischen Firma Clytemnestra Films, sitzt zwischen allen Stühlen. Dem Produzenten schwebt ein spektakulärer Kassenschlager vor, die Geldgeber fordern hingegen künstlerische Treue zum homerischen Original, die Stars liegen ihm mit Sonderwünschen in den Ohren, und ein sexsüchtiges Starlet mischt die sittsame griechische Kleinstadt, in der das Filmteam logiert, gründlich auf. Es reicht nicht, dass ein eilig eingeflogener Historiker aus Cambridge die Auswahl der Drehorte und das Drehbuch einer kritischen Prüfung unterzogen hat — die Verse Homers sträuben sich gegen die Verwendung im Film. Ein versierter Schriftsteller mit einem Faible für Literatur der Antike muss her und verwendbare Filmdialoge schaffen — Fielding Gray, der sich am Ort des Geschehens aber nicht nur in die paradiesisch bezahlte Textarbeit vertieft. Er taucht ein in die Welt selbstsüchtiger Darsteller, millionenschwerer Förderer und listenreicher Filmemacher, bis der Strudel aus Begehrlichkeiten, Intrigen, Ruhmeswillen und Gier auch ihn selbst erfasst. Im achten Band der Romanreihe "Almosen fürs Vergessen" nimmt Simon Raven sich für seine Panoramaschau der gehobenen britischen Nachkriegsgesellschaft wie gewohnt mit Witz und Biss die Kulturindustrie und ihre Protagonisten vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Raven
Wie Schatten kommt
Roman
Aus dem Englischen übersetzt
von Sabine Franke
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel
»Come Like Shadows« bei Anthony Blond, London.
Band 7 des Romanzyklus »Almosen fürs Vergessen«
Copyright © Simon Raven, 1998
First published as part of »Alms for Oblivion«:
Volume 2 by Vintage, an imprint of Vintage.
Vintage is part of the Penguin Random House
group of companies.
Einzelne im Roman befindliche Zitate wurden in der Übersetzung
von Dorothea Tieck (S. 5), Thassilo von Scheffer (S. 9, 41 und 44)
sowie Johann Heinrich Voß (S. 42–43 und 98) wiedergegeben.
Die Übersetzung dieses Bandes wurde
mit freundlicher Unterstützung der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur
Helmut und Hannelore Greve ermöglicht.
© 2023 Elfenbein Verlag, Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-047-2 (E-Book)
ISBN 978-3-96160-017-5 (Druckausgabe)
Hexen
Erscheint dem Aug und quält den Sinn,
Wie Schatten kommt und fahrt dahin!
Shakespeare, »Macbeth« (4. Akt, 1. Szene)
TEIL I
DAS PHÄAKENLAND
Große Bäume stehen darin in üppiger Blüte, Apfelbäume, Granaten und Birnen mit herrlichen Früchten, und auch süße Feigen und frische, grüne Oliven. Unverdorben bleiben die Früchte und finden kein Ende, weder Winter noch Sommer das ganze Jahr, und ein weicher Westwind lässt stets die einen erblühen, die anderen reifen. Birne reift auf Birne, es folgt der Apfel dem Apfel, auch die Traube der Traube, es folgt der Feige die Feige.
Homer, »Die Odyssee«, 7. Gesang
»Tausend Pfund die Woche«, sagte Tom Llewyllyn. »Bist du interessiert?«
»Möglicherweise«, sagte Fielding Gray.
»Sei nicht so blasiert!«
»Bin ich gar nicht. Bei solchen Aufträgen gibt es immer einen riesengroßen Haken. Von den riesengroßen Steuerforderungen ganz zu schweigen, wir leben schließlich im Jahr der Proleten 1970.«
»Da würden sie dir, so gut sie können, entgegenkommen. Sie würden einen großen Teil deines Geldes als Spesen deklarieren und es dir bar auszahlen, und wenn du sie nett fragst, lassen sie den Rest davon vielleicht über ein Konto in Zürich lau-fen.«
»Ich dachte, ihr Sozis hättet was gegen solche Dinge.«
»Bei Steuern«, sagte Tom, »geht’s um Gesetze und nicht um Moral. Es gibt legale Methoden, wie man so was abwickelt, und damit kennen die sich aus.«
»Haben sie dein Geld auch auf ein Konto in Zürich laufen lassen?«
»Nein, weil ich es ja hier brauche. Hier und jetzt. Patricia stellt sich, was ihr Geld angeht, immer ziemlich an … sagt, dass sie’s alles für Butzi sparen will … und besteht drauf, dass wir für alles meins nehmen müssen.«
»Dumme Kuh!«
»Nenn meine Frau nicht dumme Kuh«, sagte Tom gelassen.
»Indem sie dich dazu gebracht hat, dein Geld mit nach Hause zu bringen, hat sie dafür gesorgt, dass du die Hälfte davon an die Steuer verlierst.«
»Mehr als die Hälfte. Aber lass das mal unsere Sorge sein. Für dich würden sie sich schon irgendwas Passendes ausdenken … Zürich oder die Bermudas oder die Jungferninseln … vorausgesetzt, Fielding, dass du sie lieb bittest, wie gesagt.«
»Fielding konnte schon immer sehr lieb mit Leuten reden«, warf Tessie Buttock ein.
Fielding Gray und Tom Llewyllyn saßen zum Tee in ihrer alten Bleibe beisammen, dem Buttock’s Hotel, wo sie beide immer noch jedes Mal unterkamen, wenn sie sich in London aufhielten. Obwohl Tessie schon vor Jahren enorm viel Geld für den Standort in der Cromwell Road geboten worden war, hatte sie immer kategorisch abgelehnt. Ihr Pachtvertrag laufe noch über weitere zwanzig Jahre, sagte sie, da habe sie Glück, also konnten die verdammt noch mal mit dem Bauen ihres beschissenen neuen Hochhausturms aus Blech und Sperrholz noch so lange warten, bis sie in der Kiste lag. So hatte das Buttock’s sich also in die siebziger Jahre hinübergerettet, verstohlen und heimelig lag es da wie eh und je … und um einiges weniger schmuddelig, seit Tessies inkontinenter Terrier Albert Edward vor fünf Jahren heimgerufen worden war zu seinen Ah-nen.
»Ich weiß noch, wie Fielding immer so lieb mit dem armen Albert Edward geredet hat«, sagte Tessie jetzt, und eine Träne tropfte auf ihre Untertasse.
»Hab ich das wirklich?«, sagte Fielding, der sich nicht daran erinnerte und dem das auch herzlich egal war. »Das heißt aber noch lange nicht, dass ich bei Toms blöden Judenheinis nett daherreden will.«
»Wie kommst du darauf, dass es Juden sind?«, sagte Tom.
»Ich hab dir doch gesagt: Bei solchen Aufträgen gibt’s immer einen Haken, und meist heißt er Moishe oder Isaak. Diese Großkotze meine ich. Nicht solche wie Daniel oder Gregory.«
»Red keinen Quark, Schätzchen!«, sagte Tessie. »Du kannst doch nicht tausend pro Woche ablehnen, bloß weil der, der den Scheck unterschreibt, irgend so ’n jüdischer Schlawiner ist.«
»Ich hab ja nichts dagegen, dass sie die Schecks unterschreiben«, sagte Fielding. »Sondern gegen das, was sie dafür von mir haben wollen. Seichten Schund für die Massen, aber bitte mit einem Quäntchen Bedeutungsschwere. Scheiße mit ’nem Schleifchen drum. Und man darf es nicht mal sagen, wie es ist, und den Scheißdreck einen Scheißdreck nennen. Du musst vor kunstbeflissener Begeisterung sprühen und bei jedem Furz so tun, als hätte man’s mit einer hochinspirierten Einhauchung Gottes zu tun, bloß damit ihr armseliger beschränkter Geist ein bisschen gestreichelt wird und sie was von kreativer Arbeit daherquatschen können.«
»So schlimm, ja?«, sagte Tessie. »Ich muss sagen, wundern tut’s mich ja nicht. Ich weiß noch von damals aus der Bibel: Die hatten’s schon ganz schön mit dem Hokuspokus. Aber trotzdem«, sagte sie, »Toms Frage hast du noch nicht beantwortet: Woher willst du wissen, dass es Juden sind?«
»Tom redet vom Film«, sagte Fielding, »und das Filmgeschäft wimmelt nur so von denen.«
»Jetzt hört aber mal!«, sagte Tom. »Wollt ihr nun wissen, was ich über dieses ziemlich spektakuläre Angebot zu sagen habe, oder nicht? Wenn ja, dann hört auf, wie Himmler daherzureden, und hört mir für eine Minute zu.«
»Ganz genau. Fielding, mein Schätzelchen«, sagte Tessie und machte es sich in ihrem Sessel bequem, »du hältst jetzt schön die Schnute und lässt Tom alles erzählen, was es zu wissen gibt. All so was interessiert mich brennend: das Filmbiz, jüdische Filmbosse und so. Ich krieg da jede Woche so’n Film-Magazin, das heißt ›Heiße Schnipsel‹, aber es geht doch nichts darüber, was aus erster Hand zu hören.«
»Also gut«, sagte Fielding und wandte Tom sein eines Auge, das er noch hatte, zu. »Erzähl’s uns aus erster Hand. Ich hoffe, es kommt an ›Heiße Schnipsel‹ ran.«
»Anfang Juli«, begann Tom, »ist Pandarus auf mich zugekommen …«
»Na, das passt ja bestens.«
»… das ist eine Filmfirma in London«, sagte Tom leicht entnervt, »und eine Tochtergesellschaft von Clytemnestra Films in New York.«
»Wie in aller Welt kommen solche Leute denn ausgerechnet auf dich?«
»Wenn du einfach mal still wärst«, sagte Tom leicht errötend, »wirst du es gleich erfahren. Pandarus hat jedenfalls, unterstützt von Clytemnestra, eine Neuverfilmung der ›Odyssee‹ in Angriff genommen. Ein großer Teil der Finanzierung, wie man das dort nennt, wird von einer Stelle übernommen, die sich Oglander-Finckelstein-Trust nennt …«
»Du machst Witze!«
»… das ist eine amerikanische Stiftung, die von der Universität Montana verwaltet wird und massenhaft Geld für kulturelle und künstlerische Vorhaben verteilt – und die offenbar davon überzeugt werden konnte, dass diese Version der ›Odyssee‹ in diese Kategorie fällt.«
»Und tut sie das?«
»Sie wird ein kinematisches Äquivalent darstellen, das für sich genommen Gültigkeit beanspruchen kann«, sagte Tom vorsichtig, »wobei das Hauptaugenmerk eher auf der Handlung als auf den poetischen Qualitäten liegt. Beim Oglander-Finckelstein-Trust würde man es vermutlich bevorzugen, wenn es andersherum wäre … genau genommen wollen die, dass es andersherum ist … und da der Stiftungsrat bisher erst zwei Millionen Dollar der eigentlich zugesagten acht Millionen zugeschossen hat, muss der Produzent jetzt äußerst vorsichtig vorgehen. Er hat ein sehr ernsthaftes und poetisch ausgerichtetes Drehbuch in Auftrag gegeben, um das Plazet von Og-Finck zu erhalten, und um alle von seiner künstlerischen Integrität zu überzeugen, hat er außerdem verkündet, dass er einen hochkarätigen akademischen Berater hinzuziehen werde, und zwar keinen Geringeren als den Inhaber des ältesten Lehrstuhls für Griechische Sprache und Literatur an der Universität Oxford. Der Herr heißt, wie du vielleicht weißt, Hugh Lloyd-Jones. Aber durch eine groteske Fehlinterpretation des ›Who’s Who‹ wurde der Posten kurioserweise deinem alten Freund Somerset Lloyd-James angetragen …«
Und der hatte sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht, das Missverständnis aufzuklären, obwohl ihm sehr wohl bewusst gewesen sein musste, was da passiert war. Selbst zu beschäftigt, um den Auftrag ausführen zu können – er war gerade erst der Frontmann im Unterhaus für den Marquis of Canteloupe (den Wirtschaftsminister der neu angetretenen, von der Konservativen Partei gestellten Regierung) geworden – hatte Lloyd-James das Angebot von Pandarus/Clytemnestra höflich abgelehnt, im selben Zug aber »einen hochgelehrten und vielseitigen Fellow am Lancaster College der Universität Cambridge« empfohlen, »Mr. Tom Llewyllyn«.
»Er hat mir seinerzeit oft übel mitgespielt«, sagte Tom, »so dass ich annehme, er dachte, er schuldet mir eine gute Tat. Der alte Somerset kann durchaus ein feiner Kerl sein … wenn er dabei nichts zu verlieren hat.«
Wie dem auch sein mochte, Foxe J. Galahead, der Produzent, hatte sich durch den Kopf gehen lassen, ob Tom Llewyllyns Reputation schwer genug wog, und da er ihn mit dem berühmten Romanautor gleichen Namens (der aber Richard hieß) verwechselte, befunden, dass er hier genau das hatte, was er wollte (mit einem Romanautor, der zudem noch Professor war, mussten sich die hohen Geister bei Og-Finck nun wirklich beeindrucken lassen), und er war daraufhin mitten in den langen Ferien bei Tom im Lancaster College aufgetaucht, um Nägel mit Köpfen zu machen.
Tom jedoch hatte sich zunächst gesträubt, sich festnageln zu lassen. »Die Zeit, in der die ›Odyssee‹ spielt, ist nicht mein Gebiet«, hatte Tom gesagt. »Mein Forschungsbereich als Historiker umfasst die Neuere und Neueste Geschichte. Über die mykenische Zeit weiß ich rein gar nichts.«
»Da ist das Ganze wohl passiert, ja?«
»Ungefähr. Das Epos wurde um 650 v. Chr. verfasst oder genauer gesagt aus mündlichen Überlieferungen zusammengetragen. Vorgeblich wird darin von Geschehnissen berichtet, die sich fünfhundert Jahre zuvor zugetragen haben sollen, im sogenannten Heldenzeitalter, das man als eine Art Epilog zum mykenischen Zeitalter ansehen kann, welches wiederum ein Epilog zum Bronze…«
»… Stopp, stopp, mein Freund!«, sagte Foxe (»Nennen Sie mich ruhig Foxy!«) J. Galahead. »Ich find’, Sie wissen darüber mehr als genug!«
»Na, so viel weiß ja praktisch jeder.«
»Ihr hier in England seid dermaßen bescheiden, da haut’s mich von der Kirchenbank! Nix für ungut, Mr. Lewyllyn … Sie sind ja eigentlich, glaub ich, Waliser.«
»Engländer, was meine Gewohnheiten und den Wohnort angeht. Und auch meine Präferenzen.«
»Aber dieses Buch, das Sie über die walisischen Grubenarbeiter geschrieben haben …«
»Welches Buch über die walisischen Grubenarbeiter?«
»… heiliger Hodensack, Tom, wenn ich dieses Buch geschrieben hätte … ich weiß noch, das ist dann auch verfilmt worden … ›So grün war mein Tal‹ … wenn ich dieses fantastische, fantastische Buch geschrieben hätte, ich würd ja rumlaufen, als hätt ich nicht bloß einen Schwanz in der Hose! Aber das ist halt die englische Bescheidenheit … ich meine, die walisische Bescheidenheit … ich meine …«
Womit der Moment gekommen war, in dem sich die Tür zu Toms Collegeräumen öffnete und Patricia Llewyllyn mit der zehnjährigen Tochter Butzi hereinkam, gerade rechtzeitig, bevor Foxy Galahead hätte einfallen können, dass »So grün war mein Tal« bereits 1939 erschienen und bereits kurz darauf verfilmt worden war, und dass Tom, auch wenn er inzwischen die vierzig überschritten hatte, zur damaligen Zeit noch in seinen Krabbelhosen unterwegs gewesen sein musste. Nicht, dass das noch einen großen Unterschied gemacht hätte, denn Foxy war von Tom schon restlos begeistert und ungeheuer beeindruckt von dessen aus dem Stegreif gelieferten Erläuterungen zur Entstehungszeit der »Odyssee«, besonders vom Gebrauch des Wortes »vorgeblich«. Ohne Schlonz – der Kerl hier war sein Mann für Og-Finck!
Was also Foxy anbetraf, war Tom genau der Richtige für Foxy, und auch was Patricia anbetraf, war Tom genau der Richtige für Foxy, da bei dem Auftrag eine Menge Kohle drin war, und was Tom anbetraf … nun ja, er hatte schon immer mal nach Korfu gewollt, wo der Film gedreht wurde, und jetzt saß hier Foxy vor ihm und hielt ihm ein Flugticket erster Klasse genau dorthin unter die Nase.
»Und sind Patricia und Butzi denn auch mitgekommen, mein Lieber?«, fragte Tessie nun.
Nein, antwortete Tom. Pandarus wolle keine Ehefrauen und Kinder am Drehort haben und hätte ihn ihre Reisekosten selbst zahlen lassen, was Patricia mit ihrem zunehmenden Faible fürs Sparen nicht zulassen wollte. Sie und Butzi hätten überhaupt nichts dagegen, daheim in Grantchester zu bleiben, hatte sie ihm gesagt, und obwohl Butzi beinahe das ganze Haus zusammengeschrien (»Butzi will auch nach Kor-fuuu-hu-hu!«) und sich dann in einem malignen mauvefarbenen Schwall über ihre Levis erbrochen hatte, war beschlossen worden, dass Tom alleine fahren würde. So fand er sich also im unlängst vergangenen Juli für achthundert Pfund in der Woche als neu ernannter »Berater für akademische, historische und literarische Fragen« der Pandarus/Clytemnestra-Produktion von Homers »Odyssee« in einer verdammt großen Suite im Corfu Palace Hotel wieder.
»Korfu, Griechenland«, sagte Fielding. »Griechenland, Obristen. Obristen, Faschismus. Und da hattest du gar kein Problem damit?«
»Da hatte die ›Odyssee‹ ja nichts mit zu tun. Und Pandarus Films auch nicht.«
»Aber natürlich hat Pandarus Films da was mit zu tun! Dadurch, dass sie Geld in griechisches Territorium hat fließen lassen, hat die Firma einem oppressiven rechten Regime einen Gefallen getan und ihm in gewisser Weise sogar Anerkennung geschenkt.«
»Kann dir doch schnurzegal sein«, sagte Tessie.
»Ich wette, dass das nicht allen schnurzegal ist«, sagte Fielding, »den Gewerkschaften zum Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit stand im ›Guardian‹ ein genüsslicher Artikel darüber, dass die meisten Gewerkschaften aus der Film- und Fernsehbranche ihren Mitgliedern verboten hätten, an Produktionen irgendwo in Griechenland oder auf den dortigen Inseln mitzuwirken.«
»Das stimmt«, sagte Tom. »Die Gewerkschaftsführer wären sofort bereit gewesen, ihre eigenen Mitglieder im Dreck sitzen zu lassen, wenn man so der Junta eins ausgewischt hätte … von den einfachen Griechen ganz zu schweigen, die von so einer Filmproduktion ja auch profitieren. In diesem speziellen Fall spielte aber noch was Besonderes mit hinein. Ihr müsst wissen, dass Pandarus über die acht von Og-Finck zugesagten Millionen Dollar hinaus noch vier weitere brauchen wird, und Foxy konnte diese zusätzlichen Gelder nur auftreiben, indem er versprochen hat, dass der Dreh auf Korfu stattfindet.«
»Wie kommt das denn?«
»Das fehlende Geld haben letztlich zwei alte Casinofreunde von Foxy beigesteuert: Max de Freville …«
»Den kenne ich!«
»… und ein griechischer Freund von Max namens Lykiadopoulos. Die beiden besitzen im großen Stil touristische Einrichtungen auf Korfu und halten irgendwie auch Anteile am dortigen Casino.«
»Als ich Max zuletzt sah, war er eigentlich an Zypern interessiert.«
»So war es auch. Aber da standen die Aussichten schlecht, als die Unruhen dort wieder aufgeflammt sind, und so haben sie lieber beim allgemeinen Korfu-Boom mitgemischt, gleich schon ganz zu Beginn. Und der Boom hält bis heute an. Die beiden konnten ohne weiteres vier Millionen für Foxy hinlegen und haben es sogar gern getan … unter der einen Bedingung, dass der Film auf Korfu gedreht würde.«
»So dass, egal, von welcher Seite man es betrachtet, ihre eigenen Unternehmen in der Tourismus-Branche davon profitieren?«
»Genau. Aber das brauchte Foxy ja nicht weiter zu jucken, und das zusätzliche Geld brauchte er unbedingt, also hat er den Gewerkschaften klipp und klar gesagt: Entweder wird der Film auf Korfu gedreht, oder es wird keinen Film geben.«
Woraufhin die Gewerkschaftsführer kühl lächelnd nur kurz die Schultern gezuckt hatten – nicht jedoch die niederen Chargen, denen es bis zum Hals stand, immer ohne Arbeit zu sein und dabei zuschauen zu müssen, wie ihre Branche sich ihr eigenes Grab schaufelt. Sie wollten Filme machen, sagten sie. Ihre Gewerkschaftsbosse hätten bereits drei große Produktionen nacheinander mit übertriebenen Forderungen und infantilem Gerede in den Sand gesetzt, und wenn nun eine Zwölf-Millionen-Dollar-Produktion der »Odyssee« abgeblasen werden würde, weil irgendwo ein paar schmuddelige Studenten ein Problem mit der Regierung in Athen hätten, wäre das Fass endgültig voll. In kürzester Zeit war die Sache ziemlich hochgekocht, und die Gewerkschaftsbosse hatten daraufhin, als sie merkten, dass sie die Lage in diesem Fall gänzlich falsch eingeschätzt hatten, nach einer Ausflucht gesucht, mit der sie einen Rückzieher machen konnten, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Es war Foxy, oder vielmehr sein gewiefter Regisseur Jules Jacobson, der es für sie auf eine passende Formel gebracht hatte. Dieser Film, sagte man den Gewerkschaften, werde von großem kulturellem und erzieherischem Wert sein (wie ja schon das finanzielle Engagement von Og-Finck zeige), und es sei ein Film, der aus ganz wesentlichen künstlerischen Gründen auf Korfu gedreht werden müsse. Denn es sei Korfu (das homerische Scheria oder die Insel der Phäaken), wo sich ein Großteil der Geschichte tatsächlich zugetragen habe. So seien nicht nur die Landschaft und die Küstenlinie ideal, man werde darüber hinaus unsterbliche Szenen an den echten historischen Orten drehen können, so dass der Film nicht nur an Atmosphäre, sondern auch an Authentizität gewinne (et cetera, et cetera). Damit kamen sie durch: In den Zentralen der betroffenen Gewerkschaften wurde ein hochtrabendes Dokument aufgesetzt, mit dem verkündet wurde, dass für die Filmschaffenden des Films »Die Odyssee« eine besondere Ausnahmeregelung vom Griechenland-Embargo Anwendung finde, aufgrund ihrer einzigartigen Anstrengungen, mit kreativen Mitteln nationenübergreifend zur kulturellen Bildung beizutragen (et cetera, et cetera). Obwohl also eine ganze Reihe gerade sehr gefragter Bischöfe und auch unterbeschäftigter Universitätsgelehrter gar nicht mehr aufhören wollte, über »diesen Verrat am griechischen Volk« zu schimpfen und zu zetern, waren der Regisseur und seine zwei Filmcrews am 1. Juli ins Flugzeug gestiegen und nach Korfu geflogen, wo dann sieben Tage später der frisch rekrutierte Tom zu ihnen gestoßen war.
»Was die historischen Schauplätze angeht …«, sagte Fielding jetzt, »… das ist alles Humbug. Das Ganze ist lediglich eine Legende … wenn man es nicht gleich ganz ins Reich der Märchen verbannen will.«
»Ich konnte aber sehr gute Hinweise geografischer Art finden«, beharrte Tom, »die die Annahme stützen, dass Odysseus am Strand von Ermones an Land gespült und von dort aus an einen Ort gebracht wurde, der heute Paleokastritsa heißt.«
»Irgendwas musstest du für deine achthundert Pfund die Woche ja auch tun. Diese Theorie, was auch immer an ihr dran sein mag, hätte dein Regisseur aber auch für zehn Drachmen in jedem beliebigen Reiseführer finden können.«
»Kann schon sein«, sagte Tom. »Aber mit genau so was waren die Gewerkschaften eben glücklich. ›Topografisch-historische Faktentreue‹ haben wir das genannt. Und der Regisseur denkt, dass dieselbe Strategie sich auch bei der Universiät von Montana und dem Og-Finck-Trust bezahlt machen wird. Die ›topografisch-historische Faktentreue‹ könnte am Ende für Foxys Kreditwürdigkeit stehen … wenn er dann nach dem Rest des Geldes fragen muss.«
»Die werden sich nicht so leicht blenden lassen«, sagte Fielding und blickte mit seinem verbliebenen Auge wütend umher. »Amerikanische Wissenschaftler sind bei so was penibel genau.«
»Jetzt mal genug mit dem gelehrten Geschwafel«, raunzte Tessie mit einem Mal dazwischen. »Was ich wissen will, ist, was Tom dann alles passiert ist, als er dort angekommen war.«
»Als Erstes«, erzählte Tom, »war ich mit dem Regisseur, Jules Jacobson, zum Essen verabredet, damit er mir die ganzen Abläufe und das Drumherum erklären konnte.«
»Jacobson. Auch so ’n jüdischer Schlawiner?«
»Ein ganz besonderer, Tessie. Kommt aus dem East End und hatte es am Ende des Krieges bis zum Offizierspatent und dem Militärkreuz gebracht, und 1946 ist er ins Filmgeschäft eingestiegen, als Kameramann für die Erotikfilme seines Onkels. Seither hat er es weit gebracht, hat aber keine Station seines Weges vergessen …«
»Die erste Regel hier lautet«, hatte Jules Jacobson Tom im Restaurant des Corfu Palace Hotels gesagt, »dass ich die Anweisungen gebe. Ich habe die Regie. Foxy Galahead produziert den Film, was heißt, dass er das Geld auftreibt und Anspruch auf eine höfliche Behandlung hat. Mehr aber nicht. Wenn er Ihnen aufträgt, irgendwas zu tun, hören Sie ihm freundlich zu, dann gehen Sie einfach weiter und vergessen es.«
Jules Jacobson war ein hagerer, dunkelhaariger Mann mit schmalen, engstehenden grünen Augen. Er trug ein Seidenhemd, die Krawatte eines einst hochstehenden, inzwischen aber aufgelösten Füsilierregiments, kein Jackett und sehr enge Hosen. Der drückend heiße Juliabend schien ihm überhaupt nichts anzuhaben, während Tom der Schweiß in Strömen runterlief, so dass es ihm normalerweise mehr als peinlich gewesen wäre. Aber nicht so bei Jacobson: Denn Jacobson besaß die Art niveauvoller Zuvorkommenheit, die darauf verzichtet, das Unbehagen seines Gegenübers zur Kenntnis zu nehmen (und somit noch zu verstärken), wo doch ohnehin nichts daran zu ändern ist. Dazu besaß er eine ebenso feinsinnige Art von Autorität: Denn auch wenn das, was er sagte (obwohl prägnant ausgedrückt), eigentlich nichts Besonderes war, sorgte die Art seines Auftretens, mit von Selbstsicherheit getragener Gelassenheit, dafür, dass seine Worte Gesetz waren, so unabänderlich, als wären sie in Stein gemeißelt.
»Also denken Sie daran«, hatte Jacobson gesagt. »Hören Sie sich an, was Foxy sagt, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Lächeln sie dazu, wenn Sie die Energie dafür aufbringen können. Aber egal, was er will – tun Sie’s nicht. Es sei denn, Sie wissen, dass ich es auch will.«
»Das könnte unter Umständen schwierig werden. Schließlich ist er mein Auftraggeber.«
»Genau wie bei mir. Er bezahlt mich dafür, dass ich die Regie führe … und unter anderem auch Ihnen Anweisungen erteile. Sie werden noch sehen, dass in einer Filmfirma eine strenge Hierarchie herrscht. Es gibt eine strikt einzuhaltende Befehlskette, und jeder hat seine klar definierte Funktion. Zum Schein tun wir so, als wären wir alle gleichgestellt … wir sprechen uns, oben wie unten, mit Vornamen an … aber jeder, ohne Ausnahme, hat da draußen am Set seine ganz eigenen Aufgaben, seinen ganz speziellen Status und seine ganz eigenen Privilegien, und wehe, man hält sich nicht genau daran.«
Tom wischte sich über die Augenbrauen.
»Eine Befehlskette, sagten Sie?«
»Genau.«
»Nun, es müsste doch aber gewiss Mr. Galahead sein, der an der Spitze der Befehlskette steht?«
»Verwaltungstechnisch ja. Aber nicht, was die technischen oder die kreativen Abläufe angeht.« Jacobson benutzte diesen Begriff ganz ernsthaft, hatte Tom mit Bedauern registriert. »Die Inszenierung, die Schauspielführung, der Dreh, das Lichtkonzept, die Dialogabnahme … alles, was den Film an sich betrifft, ist meine Sache. So steht es auch in meinem Vertrag. Daraus folgt, dass Sie hier sind, um mich zu beraten, Antworten auf diejenigen Fragen zu finden, die ich stellen werde. Lassen Sie sich also nicht von Foxy auf irgendwelche sinnlosen Unternehmungen ansetzen. Er hat da so seine eigenen Ideen, was diesen Film angeht … und das sind ganz andere als meine.«
»Er zahlt Ihnen also Geld aus seiner Tasche dafür, dass Sie Ihren Film drehen können?«
»Nein, falsch. Das Geld ist ja nicht seines … er wirbt es nur ein. Und ich kann auch gewiss nicht den Film drehen, den ich gerne machen würde. Sie haben vom Oglander-Finckelstein-Trust gehört?«
»Mr. Galahead hat ihn erwähnt, als er mich in Cambridge aufgesucht hat.«
»Nennen Sie ihn ruhig Foxy. Wie ich schon sagte, wir halten hier die Illusion aufrecht, alle gleich wichtig zu sein. Das ist in unserem Geschäft traditionell so.«
»Foxy … Auch wenn ich ihn direkt anrede?«
»Ja, das machen alle so, selbst die Leute aus der Requisite. Alle außer mir und den beiden Hauptdarstellern. Wir dürfen ihn ›Foxy-Baby‹ nennen, wenn wir wollen … ein Privileg von uns.«
»So steht es auch in Ihrem Vertrag, vermute ich.«
Jacobson grinste.
»Sie zeigen bereits die richtige Einstellung«, sagte er. »Also zur Sache: Der Oglander-Finckelstein-Trust …«
Und er hatte zu erklären begonnen, wie die Dinge lagen, Sachverhalte, die Tom damals zum größten Teil noch nicht bekannt gewesen waren. Der Oglander-Finckelstein-Trust hatte, wie es aussah, zwei Millionen Dollar sofort zur Verfügung gestellt, mit dem Versprechen, dass sechs weitere Millionen folgen würden, unter der Bedingung, dass die Produktion »zufriedenstellende Fortschritte« machte. Da die ersten zwei Millionen dafür draufgegangen waren, den Film überhaupt erst »auf die Beine zu stellen« und die beiden Filmcrews nach Korfu zu transportieren, wurde die Produktion derzeit von den vier Millionen finanziert, die Max de Freville und Stratis Lykiadopoulos beigesteuert hatten. Jetzt, da alle Mitwirkenden fest am Drehort installiert waren, würde das Geld nicht mehr so rasant aus der Kasse fließen. Dennoch würden die derzeitigen Ressourcen bis Ende Oktober aufgebraucht sein, und es war äußerst wichtig, dass Og-Finck seinen nächsten Beitrag spätestens zum 1. November bereitstellte.
»Woraus ich schließe«, sagte Tom, »dass Sie nachweisen müssen, welche ›zufriedenstellenden Fortschritte‹ hier gemacht werden?«
»Was man dort unter ›zufriedenstellenden Fortschritten‹ versteht«, hatte Jules Jacobson präzisiert.
Und da lag nun der Haken: Fortschritte waren nur in Form eines ersten Teilrohschnitts nachweisbar, der aus dem Filmmaterial zusammengestellt werden musste, das in den folgenden drei Monaten erst noch gedreht wurde. Abgesehen davon war es nicht unwahrscheinlich, dass Vertreter von Og-Finck auf Korfu auftauchen würden, um das Team bei der Arbeit zu inspizieren, und in dem Fall war es wichtig, dass man den Eindruck vermittelte, alle seien emsig und voller Hingabe am Werk. Viel wichtiger aber noch, ja entscheidend für die gesamte Unternehmung war, dass den Syndizi des Trusts das gefiel, was »bereits im Kasten« war. Was sie sehen wollten, war das, was das vorliegende Drehbuch versprach: eine originalgetreue Version von Homers Meisterwerk, in die viele Originaldialoge aus der Feder des Dichters eingeflossen waren, ja selbst viele narrative und deskriptive Passagen aus seiner Feder, mit denen als poetischer Kommentar, von einer Erzählstimme eingesprochen, die visuellen Szenen unterlegt werden sollten.
»Und all das zusammen«, hatte Jules gesagt, »ist einfach zu viel des Guten. Die Konzeption ist viel zu literarisch angelegt. Das wird im Kino nicht funktionieren. Und doch werde ich für die so viel wie möglich davon umsetzen müssen – sonst haben wir bald keinen Zaster mehr.«
»Und was sagt Mr. Gala… was sagt Foxy dazu?«
»Er steht von Og-Finck aus gesehen auf genau dem entgegengesetzten Standpunkt. Er will mit dem Film, wenn er mal fertig ist, richtig Kohle machen, und das geht seiner Meinung nach nur, wenn wir möglichst viel Gefecht und Geficke drin haben und niemand länger redet, als man braucht, um ›Kacke!‹ zu sagen.« Jules klackerte wild mit den Zähnen und fuhr dann fort: »Ich glaube, er denkt, dass er Og-Finck so lange an der Nase herumführen kann, bis es zu spät für sie ist, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Caveat emptor. Aber wenn er ein Filmspektakel à la Errol Flynn haben will, hat er sich den falschen Regisseur ausgesucht. Ich werde hier einen Qualitätsfilm drehen, Tom, und hoffe bloß, dass Foxy-Baby nicht zu laut heult, wenn er das rausfindet.«
»Aber da sind Sie mit Ihrem Vertrag doch bestimmt auf der sicheren Seite. Sie haben ja eben gesagt, dass der Ihnen die Entscheidungsgewalt in allen künstlerischen Fragen zuspricht.«
»Das ist auch so, und meistens kann ich auch drehen, ohne dass Foxy dabei ist. Wenn er aber da ist, dann sitzt er mir den ganzen Tag im Nacken und will Blut, Sex und Orkane sehen – und glauben Sie mir, das ist alles andere als hilfreich.«
Jules hatte tatsächlich zwei Bündel an Forderungen zu bedienen, die unvereinbar und jedes für sich genommen vollkommen überzogen waren. Er hatte einen Produzenten, dem ein Kassenknüller der primitivsten Sorte vorschwebte, und Sponsoren, die Kunst in vollendetster Form sehen wollten.
»Der Punkt ist jedoch«, sagte Jules, »dass es noch nicht mal Kunst wäre. Diese homerischen Dialoge zum Beispiel. Wuchtige, fünf Minuten lange Reden, fantastische Texte, wenn man sie liest oder jemand sie rezitiert – aber einen Film killen Sie damit auf der Stelle. Und ich meine nicht nur, was Foxy daran stört: dass sie die Kinos leerfegen würden. Was ich meine, ist, dass diese Reden auf der Leinwand künstlerisch und dramaturgisch nicht funktionieren würden. Und das ist es, worum es mir geht, Tom: die Kinoleinwand.«
Was, hatte Tom sich erkundigt, gedachte Jules dann also zu tun? Nun, was Foxy anging, wollte Jules ihn möglichst lange bei Laune halten, indem er bei den bekannteren, bei Homer an sich schon spektakulären Szenen (die ohnehin vor Blut und Orkanen strotzten, nur der Sex kam etwas zu kurz) so richtig ins Volle ging und derweil die »kulturellen Szenen« vor Foxy verteidigte, indem er ihm versicherte, dass man die am Ende ja immer noch rausschneiden könne, sie aber auf kurze Sicht definitiv brauche, um sie Og-Finck zeigen zu können und sich so den nächsten Schwung Geld zu sichern. Auf die Weise würde bei Foxy der Eindruck entstehen, dass Jules sein treuer Verbündeter war, wenn es darum ging, Og-Finck hinters Licht zu führen …
»… und auf die Weise müsste ich ihn mir für die nächste Zeit erst einmal vom Leibe halten können. Und über mehr als ›für die nächste Zeit‹ darf man sich bei Menschen wie Foxy Galahead ohnehin nicht den Kopf zerbrechen.«
»Wir haben also Blut und Donnerhall, um Foxy bei Laune zu halten, und ›kulturelle Szenen‹ für den Oglander-Finckelstein-Trust. Aber wie sieht es denn mit diesen kulturellen Szenen aus, Jules? Werden die Og-Finck zufriedenstellen?«
»Das hoffe ich. Zum einen werden sie in ihrem authentischen Umfeld in Szene gesetzt … da kommen Sie ins Spiel … und außerdem kriegt man darin eine volle Ladung homerischer Dialoge und all das ab, damit die ganzen Eierköpfe auch ihre Freude haben. Ausdünnen kann ich das am Schneidetisch dann immer noch.«
»Wenn das Geld geflossen ist und es für Og-Finck zu spät ist, Schwierigkeiten zu machen?«
»Sie lernen schnell. Einen Cognac?«
»Gerne! Ich habe an diesem einen Abend definitiv mehr gelernt, als ich erwartet hätte. Aber verraten Sie mir eins, Jules: Warum lassen Sie sich von einem Fremden gleich so tief in die Karten schauen?«
»Ich denke, Sie sind genau meine Kragenweite – und außerdem werde ich Ihre Hilfe brauchen. Ich habe Ihre Bücher gelesen … ein paar zumindest … und ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen.«
Und so war es dann auch tatsächlich gewesen. Sie waren so gut miteinander ausgekommen, dass Tom bald über seinen Status als wissenschaftlicher Berater hinaus ein enger Vertrauter und Assistent geworden war. Offiziell bestand seine Aufgabe darin, Jules von seinem Wissen über das Altertum und seinem literarischen Urteil profitieren zu lassen. Er musste oft genau erklären, was diese oder jene Aussage oder längere Passage im homerischen Kontext zu bedeuten hatte. Doch nachdem er seine Ausführungen beendet hatte, bat James ihn auch immer häufiger, mit ihm gemeinsam zu überlegen, ob der eine oder andere der Schauspieler fähig war, etwas überzeugend darzustellen, und falls nicht, was man da unternehmen konnte. Dies wiederum führte zu langen Diskussionen über die Idiosynkrasien, Werdegänge und Krankengeschichten der gesamten Besetzung und darüber, wie Jules taktisch am besten vorging, um dieser gute schauspielerische Leistungen zu entlocken und gekränkte eitle Gemüter zu besänftigen.
»Die doofe Ziege«, würde Jules zum Beispiel über die Schauspielerin, die die Penelope verkörperte, sagen. »Sagt, sie hätte nicht genug große Spielszenen in der ersten Hälfte.«
»Braucht die Geschichte ja auch nicht. Homer liefert solche Szenen nicht.«
»Genau, Homer liefert solche Szenen nicht. Deshalb will sie, dass welche reingeschrieben werden.«
»Dann schreib sie ihr halt rein. Dreh sie … und verwirf sie dann.«
»Viel zu kostspielig … frisst Zeit und Geld.«
»Dann erkläre ihr das.«
»Sie wird sagen, dass für den Star des Films nichts zu kostspielig sein kann.«
»Sie ist aber nicht der Star.«
»Denkt sie aber. Und Gott steh uns bei, wenn sie das irgendwann nicht mehr denken sollte.«
»Sag ihr, dass ihre Rolle sich eher durch Qualität als durch Länge auszeichnet.«
»Sie würde das nicht verstehen, Tom. Sie hat die vierzig überschritten, ihr Name ist seit zwanzig Jahren jedem ein Begriff, und sie hat zu einer Zeit Karriere gemacht, in der man als Star immer im Mittelpunkt stand und die längste und tollste Rolle hatte.«
»So ist es ja auch – bei Odysseus. Sie kann doch nicht im Ernst denken, sie wäre so wichtig wie er.«
»Das nicht. Aber sie meint, sie wäre die einzige Frau bei dem Ganzen, die zählt.«
»Dann hat sie sie doch nicht alle! Da ist noch Kirke, Kalypso, Nausikaa …«
»Von denen hat sie wahrscheinlich gar nichts mitbekommen, Tom. Sie hat sicher nur die Szenen gelesen, in denen sie dabei ist, und das Einzige, was sie dazu sagen kann, ist, dass ihr die nicht reichen.«
»Nur die Szenen, in denen sie dabei ist?«
Du kennst diese Sorte Mensch nicht. Manche können kaum lesen – echte Schwachköpfe sind das. Aber Schwachköpfe, die eben das richtige Gesicht haben und die Gabe, andere nachzumachen, was sie an einem guten Tag dann durchaus auch als Schauspielerei ausgeben können. Verglichen mit vielen anderen ist unsere Penelope hier noch Gold wert. Wenigstens lernt sie ihren Text …«
»… und betrinkt sich nicht schon vor zehn am Morgen, wie Odysseus.«
»Über den reden wir ein andermal. Heute ist Penelope das Problem. Sie will mehr Szenen, kann aber keine bekommen, und sie wird hier alle anscheißen, wenn sie keine kriegt. Was soll man da bloß tun?«
»Ihr zuvorkommen und erst mal sie anscheißen«, sagte Tom. »Ihr sagen, dass über neue Szenen erst nachgedacht werden kann, wenn sie ihre jetzigen hinbekommt.«
»Aber die bekommt sie ja hin … so gut, wie es besser nicht geht. Das bringt nichts, an ihrem Selbstbewusstsein zu rütteln, indem man ihre an sich anständige Arbeit angreift.«
»Dann such ihr einen Liebhaber, damit sie Frieden gibt.«
»Sie steht auf Polizistinnen. Londoner Polizistinnen.«
»Vielleicht kannst du irgendwo eine bullige Lesbe auftun und ihr sagen, das wäre eine Londoner Polizistin, die Urlaub auf Korfu macht?«
»Die müssen aber ihre Uniform tragen.«
»Jesus im Himmel, Jules …!«
Das Problem ließ sich schließlich doch noch lösen, und zwar indem Penelopes Text in den bereits existierenden Szenen einfach auf die maximale homerische Länge aufgestockt wurde. Damit hatten sie der armen Frau so viel an Hausaufgaben aufgebürdet, dass ihr keine Zeit für weitere Beschwerden blieb. Und obwohl es, wie Jules anmerkte, zu noch mehr Arbeit am Schneidetisch führen würde, ließ sich dieser Gedanke zunächst noch in weite Ferne schieben.
Ähnliche Probleme, und davon gab es viele, wurden mit ähnlichen Mitteln gelöst. Für die größten und anhaltendsten Schwierigkeiten sorgte die Trunksucht von Odysseus, einem graumelierten und international beliebten Veteranen romantischer Seefahrtsfilme aus den Kriegsjahren, der erst dann zu voller Form auflief, wenn er eine Flasche Whisky zu zwei Dritteln geleert hatte, sobald er aber den Rest auch noch trank, schlichtweg zu gar nichts mehr zu gebrauchen war. Die Alkoholmenge, um die es dabei ging, blieb konstant dieselbe und wich nie auch nur um ein Quäntchen ab: Wenn der Filmstar ein Drittel der Flasche intus hatte, wurde, was er bot, langsam passabel, bei zwei Dritteln (haargenau) wurde er brillant, bei drei Dritteln … auf den Tropfen … war er ein hoffnungsloser Fall. Glücklicherweise ließ sich durch diese präzise Berechenbarkeit Jules’ Arbeit einigermaßen gut bewältigen: Es kam ein speziell präparierter Dekanter zum Einsatz, der als Uhr zu fungieren hatte, und der gesamte Drehtag richtete sich nicht nach den vergehenden Stunden, sondern danach, wie tief der Bourbon von Odysseus bereits stand. An Tagen, an denen der Stand zu schnell sank, und so war es an den meisten Tagen, musste Jules alles daransetzen, den Helden vor der Kamera zu halten und die Szene in den Kasten zu bekommen, bevor die finale und fatale Dosis seinen Rachen hinabrann und Odysseus in ein unerschütterliches Koma verfiel. Aber immerhin, sagte Jules zu Tom, konnte er mit einem schnellen Blick auf die Markierung an der Karaffe jederzeit feststellen, woran er bei Odysseus gerade war und welche Qualität schauspielerischer Leistung von ihm erwartet werden konnte, was eine große Erleichterung gegenüber der Arbeit mit den meisten anderen versoffenen Künstlern sei, die er so kannte.
Da also Jules und Tom gemeinsam eine Art Rezept fanden, wie alles von Odysseus’ Trinkexzessen bis hin zu den Heimwehattacken des Materialassistenten in den Griff zu bekommen war (Letzterem erlaubten sie, einmal in der Woche kostenlos mit seiner Mutter in Islington zu telefonieren), hatte der Film, wie Jules es ausdrückte, begonnen »zu werden«. Den ganzen Juli und August hindurch hatte Jules, während die zweite Filmcrew mit den Stuntaufnahmen für die Actionszenen beschäftigt war, seine Zeit zwischen den frühen Szenen im Palast des abwesenden Odysseus und den amourösen und klamaukigen Eskapaden auf Kirkes Insel aufgeteilt. Bei ersteren war es ihm gelungen, der fordernden Penelope mit viel therapeutisch eingesetzter, erschöpfender Arbeit beizukommen. Und aufgrund seiner zügigen Fertigstellung von letzteren hatte zum Glück diejenige Schauspielerin, die als Kirke besetzt war, früher als geplant nach England abreisen können, eine giftige kleine Hexe, die nur deshalb an die Rolle gekommen war, weil sie »Foxy einen geblasen« und mit den Allüren, die sie sich zur Feier dieser Errungenschaft zugelegt hatte, das gesamte Filmteam fast zum Wahnsinn getrieben hatte.
Nachdem sie Kirke loswaren und Foxy, warum auch immer, nur selten anwesend war, hatte Jules allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Alle (selbst Kirke) hatten exzellente Arbeit abgeliefert, die Stimmung in der Truppe war gut, sie lagen gut im Plan, die Kosten waren nicht ganz so exorbitant, wie sie hätten sein können. Aber einen bitteren Wermutstropfen gab es doch, eine drängende Sorge, die unaufhaltsam zunahm: die Qualität des Drehbuchs.
»Ach nö!«, rief, nein brüllte Tessie Buttock schon fast. »Noch mehr blödes Gerede über Bücher! Ich will wissen, was mit dieser Kirke ist … mit der, und wem sie alles einen bläst!«
»Mehr als das, was du schon gehört hast, weiß ich darüber auch nicht«, sagte Tom, »außerdem war Kirke da ja schon heimgereist.«
»Und hat sie dich auch mal drangenommen, bevor sie los ist?«
»Nein, Tessie. Ich bin schließlich verheiratet …«
»Ach, pfui! …«
»… und ob es dir gefällt oder nicht: Ich hatte viel zu viel zu tun mit diesem Drehbuch. Mag sein, dass in ›Heiße Schnipsel‹ was anderes steht, aber Filme werden immer noch aus Drehbüchern und nicht aus Schwanzlutscherei gemacht.«
Und das Drehbuch, mit dem sie auf Korfu arbeiteten, hatte Stunde um Stunde immer mehr Schwierigkeiten aufgeworfen. Es handelte sich, wie kaum anders zu erwarten, um dasjenige Drehbuch, das auch dem Oglander-Finckelstein-Trust vorlag und das von einem wohlinstruierten und korrumpierbaren Drehbuchautor eigens so eingerichtet worden war, dass es mit Sicherheit den Gefallen des Stiftungsrates finden würde, da es nur wenig Handlung, dafür aber viele poetische Passagen und Dialoge bot. Jules ging dennoch davon aus, dass er, wie er Tom erklärt hatte, im Laufe der Dreharbeiten nach und nach den Anteil von handlungsreichen Stellen ausdehnen und jedes Übermaß an Rede (mit oder ohne Zustimmung von Og-Finck) beim Schneiden herauskürzen konnte. Das unmittelbare Problem, das sich ihnen zunächst stellte, war wiederum ein anderes: nicht die Länge der Textpassagen, sondern ihre Sprache. Denn der Drehbuchautor hatte vollkommen versagt, als es darum ging, eine englische Version herzustellen, die sich für ihre Belange eignete. Für die wuchtigeren und blutigeren Szenen hatte er kurzerhand, verbatim, die der biblischen Sprache nachempfundenen Formulierungen aus der Übersetzung von Butcher und Lang verwendet, während er für alles, was sich im gesellschaftlichen und familiären Umfeld abspielte, unvermittelt und unbekümmert ob des stilistischen Kontrasts zu der eher volksnahen Version von Rieu übergewechselt war, nicht ohne gelegentlich und rein willkürlich das eine oder andere Versatzstück aus der Übersetzung von T. E. Lawrence einzustreuen.
Der Fairness halber musste man ihm zugestehen, dass sich das Ergebnis, so uneinheitlich es war, eigentlich recht gut las. Es war jedoch schauspielerisch nur schwer umsetzbar. Das ging schon damit los, dass keine der drei Übersetzungen flüssig von der Zunge ging, oder jedenfalls nicht von den Zungen, die von Pandarus besetzt worden waren. Und dazu kam, dass das Aufeinandertreffen verschiedener Stile (heroisch in der einen, volkstümelnd in der nächsten Szene) angesichts dessen, was Odysseus und Penelope künstlerisch zu bieten hatten, eine viel zu große Herausforderung darstellte. Obwohl beide über ein großes Spektrum durchaus überzeugender Gesichtsausdrücke verfügten, war keiner von ihnen in der Lage, mit den häufigen und radikalen Registerwechseln zurechtzukommen, da sie schließlich, wie Jules bemerkte, »verdammt noch mal nicht Gielgud und Evans« seien.
Aus diesen Gründen wurde durchgängig eine neue Textversion benötigt. Die Erzählstimme des Dichters, befand Jules, konnte an den Stellen, die er am Ende behalten würde, eventuell so bleiben, da sie in antikisierendem Englisch gehalten war – denn das würde dem Ganzen einen gewissen »Hintergrund« verleihen, und Jules hatte einen sehr guten Mann an der Hand (einen ehemaligen Priester), der das »Voiceover« des nur stimmlich in Erscheinung tretenden Homer in einem entsprechenden bardischen Ton liefern konnte. Doch was die Redepassagen der Figuren selbst anbetraf, sagte Jules, so mussten diese alle in einem einheitlichen Stil neu geschrieben werden, und zwar in einem modernen, der so universell einsetzbar war, dass er die Schauspieler mit ihren begrenzten elokutiven Fähigkeiten nicht überforderte, gleichzeitig aber die Möglichkeit bot, all die Passionen auszudrücken, mit denen der Dichter seine personae ausgestattet hatte. Die neue Version, hatte Jules begeistert erklärt, musste Langs würdevollen Ton ohne dessen Archaisierungen, Rieus Flüssigkeit ohne dessen Gewöhnlichkeit und Lawrences Feinsinn ohne dessen Affektiertheit haben. Dazu noch sollte sie den aristokratischen Geist der alten Sage ausstrahlen, ohne aber in irgendeiner Form egalitären Gemütern Anlass zum Naserümpfen zu geben.
»Eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe«, hatte Tom daraufhin bemerkt. »Wen hast du dafür ins Auge gefasst?«
»Uns. Uns beide zusammen. Wir haben ja schon ein ganzes Stück geschafft.«
»Wir haben hier und da ein bisschen daran herumgeflickt, wo es ging. Was du gerade beschrieben hast, ist aber eine komplette Neufassung.«
»Wir nehmen es uns einfach Stück für Stück vor, wie wir es gerade brauchen.«
»Das schaffen wir nicht, Jules. Da muss ein Experte ran.«
»Aber schau doch mal, Tom. Was wir brauchen, sind Dialoge, mit denen man die Geschichte begreift und die unsere depperten Schauspieler artikulieren können, ohne sich dabei an ihren falschen Zähnen zu verschlucken. Was diese Schauspieler angeht, sind wir die Experten.«
»Aber doch nicht fürs Übersetzen von Homer.«
»Es muss ja nicht haarklein stimmen. Wir schauen uns einfach an, was sie im Kern so sagen müssen, und suchen ihnen dann Formulierungen dafür, die so normal wie möglich klingen. Du hast schließlich einen Roman geschrieben …«
»Einen Roman, vor Jahren!«
»… also kannst du ja wohl ein paar Dialoge in die Tasten hauen, die natürlich klingen.«
»Aber wir haben es ja eben gerade nicht mit natürlich klingenden Dialogen zu tun, Jules. Hier spielen alle möglichen Konventionen eine Rolle. Diese Leute sind Götter und Könige und Helden und Geister, und die reden alle auf ganz besondere Weise.«
»Dann findest du halt eine Entsprechung für diese besondere Weise, nur eben in klarem, treffendem Englisch, so dass das Publikum im Odeon es versteht.«
»Im Odeon am Leicester Square, oder denkst du an Leyton Orient?«
»Beides. Simpel und direkt soll es sein, aber es muss schon auch irgendwie was haben. So, wie Robert Bolt schreibt.«
»Wofür Robert Bolt ja auch bezahlt wird.«
»Du willst mehr Geld?«
»Nein«, sagte Tom, der Sozialist. »Ich bekomme ja jetzt schon viel zu viel.«
»Dann verdien’s dir, indem du mir die Texte umschreibst.«
»Na ja, ich kann’s vielleicht versuchen.«
»Sehr schön«, hatte Jules daraufhin gesagt. »Fang mit der Stelle an, wo Telemach zu Nestor kommt.«
»Lieber Himmel, Jules, sei kein Unmensch! Da redet der alte Sack doch seitenlang …«
Aber Tom hatte sich hingesetzt und sich bemüht, sein Bestes zu geben, wobei die Mühe umso größer ausfiel, als Jules, der ihm normalerweise geholfen hätte, unerwartet von einer absurden Krisensituation vor Ort in Beschlag genommen wurde.
Grund dafür war das schamlose Betragen von zehn Filmsternchen, die mit auf Korfu weilten. Diese jungen Mädchen, die als Mägde oder Ähnliches besetzt waren, hatten es sich angewöhnt, die langen, warmen Abende hindurch unter den Arkaden vor der Corfu Bar zu sitzen und die Aufmerksamkeit eines jeden jungen männlichen Griechen auf sich zu ziehen, der das Krabbelhosenalter hinter sich gelassen hatte. Die Ordnungshüter waren eigentlich schon lange abgestumpft, was die unzüchtige Kleidung und das Gebaren von Touristen beiderlei Geschlechts anbetraf, die sich verhielten, als wären die Einheimischen um sie herum Freiwild, doch was die Sternchen nun trieben, überstieg alles je Dagewesene. Direkt vor der Bar, auf dem Cricketfeld auf der anderen Seite der Straße, spielten sich bei der Sondierung etwaig vorhandener Leidenschaften Szenen ab, die einem die Haare zu Berge stehen ließen, und bei zwei Gelegenheiten waren die Liaisons gar direkt auf der Cricket-Pitch vollzogen worden, unter johlendem Applaus von Schuljungen, die sich dicht gedrängt um das Feld geschart hatten. Da sie befürchteten, solche Aktivitäten könnten noch weiter in Mode kommen, hatten die korfiotischen Polizeibeamten Jules nun schließlich gebeten, die jungen Damen zu verwarnen. Dies hatte er getan, aber (ausnahmsweise einmal) kein Gehör gefunden: Ihr Privatleben, sagten die Mädchen, gehe ihn nichts an. Nicht, sagte Jules, wenn sie es in aller Öffentlichkeit austrügen. Selbst im freizügigen Korfu, sagte er ihnen, hätten die Griechen eine puritanische Ader, auf die man Rücksicht zu nehmen habe. Alles aber ohne Erfolg. Zwei Nächte darauf hatte die Polizei das jüngste und aufreizendste der Sternchen aufgegriffen, als es gerade wie eine wildgewordene irische Todesfee Schreie in höchster orgasmischer Agonie ausstieß, wozu ihr der Kellner eines angrenzenden Restaurants in einem offenen Wagen am Rand des Cricketfelds verholfen hatte. Zusammen mit ihrem Liebhaber war sie, noch immer spasmodisch zuckend, in Arrest genommen worden, unter dem »Ihr dreckigen Faschisten!«-Gebrüll ihrer Kolleginnen, die an den Tischen unter den Arkaden saßen und von einem älteren Kameramann gerade noch davon abgehalten worden waren, tatkräftig ins Geschehen einzugreifen.